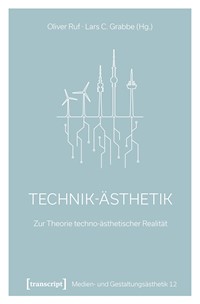
Technik-Ästhetik E-Book
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Medien- und Gestaltungsästhetik
- Sprache: Deutsch
Von Technik und Ästhetik zu sprechen, heißt, sich bereits begrifflich auf ein Feld einzulassen, das mindestens zwei divergente Perspektiven gemeinsam denkt. Dabei haben das Technische wie das Ästhetische die Bedeutung einer Interdependenz aufzuweisen: Das Technische konstituiert einerseits Funktionen, Formen und Gebrauchsaspekte – ästhetische Zustände evozieren andererseits zeichenhafte Realisierungen, phantasmatische Urteile und wahrnehmungsvermittelte Phänomene des Erscheinens. Die Beiträger*innen des Bandes zeigen, wie bei der Konfrontation von Technik und Ästhetik eine Art Verkopplung und intrinsische Dynamik qua techno-ästhetischer Evokation entstehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Diese Publikation wurde im Rahmen des Fördervorhabens 16TOA002 mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie mit Mitteln der Open Library Community Medienwissenschaft 2022 im Open Access bereitgestellt.
Die Open Library Community Medienwissenschaft 2022 ist ein Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozial- und Geisteswissenschaften:
Vollsponsoren: Humboldt-Universität zu Berlin | Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz | Technische Universität Berlin / Universitätsbibliothek | Universitätsbibliothek der Ruhr-Universität Bochum | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB Dresden) | Universitätsbibliothek Duisburg-Essen | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Universitätsbibliothek | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – KIT-Bibliothek | Universitätsbibliothek Kassel | Universitätsbibliothek in Landau | Universität zu Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitätsbibliothek Mannheim | Universitätsbibliothek Marburg | Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München | Fachhochschule Münster | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg | Universitätsbibliothek Siegen | Universitätsbibliothek Vechta | Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar | Jade Hochschule Wilhelmshaven/ Oldenburg/Elsfleth | Zürcher Hochschule der Künste | Zentralbibliothek ZürichSponsoring Light: Universität der Künste – Universitätsbibliothek | Freie Universität Berlin | Fachhochschule Bielefeld, Hochschulbibliothek | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | Fachhochschule Dortmund, Hochschulbibliothek | Technische Universität Dortmund / Universitätsbibliothek | Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg | Hochschule Hannover – Bibliothek | Landesbibliothek Oldenburg | Akademie der bildenden Künste Wien, Universitätsbibliothek | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HochschulbibliothekMikrosponsoring: Filmmuseum Düsseldorf | Bibliothek der Theologischen Hochschule Friedensau | Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater Hamburg | Hochschule Hamm-Lippstadt | Bibliothek der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | ZKM Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Bibliothek | Hochschule Fresenius | Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF – Universitätsbibliothek | Bibliothek der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS)
Mediale Produktionen und gestalterische Diskurse bilden ein vehement zu beforschendes ästhetisches Dispositiv: Medien nehmen nicht nur wahr, sondern werden selbst wahrgenommen und wahrnehmbar(er) – insbesondere durch die Grundkonstellationen ihrer oft technischen Artefakte und der diesen voran gehenden Entwürfe, mithin vor der Folie des dabei entstehenden Designs. Die Reihe MEDIEN- UND GESTALTUNGSÄSTHETIK versammelt dazu sowohl theoretische Arbeiten als auch historische Rekapitulationen und prognostizierende Essays.
Die Reihe wird herausgegeben von Oliver Ruf.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Lizenz (BY-SA). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell, sofern der neu entstandene Text unter derselben Lizenz wie das Original verbreitet wird.
(Lizenz-Text: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de)
Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
Erschienen 2022 im transcript Verlag, Bielefeld
© Oliver Ruf, Lars C. Grabbe (Hg.)
Umschlagkonzept: Natalie Herrmann, Theresa Annika Kiefer, Lena Sauerborn, Elisa Siedler, Meyrem Yücel
Designkonzeption & Umschlagabbildung: Andreas Sieß
Gestaltung & Satz: Andreas Sieß
Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
ISBN Print: 978-3-8376-5636-7
ISBN PDF: 978-3-8394-5636-1
ISBN EPUB: 978-3-7328-5636-7
Buchreihen-ISSN: 2569-1767
Buchreihen-eISSN: 2703-0849
DOI: https://doi.org/10.14361/9783839456361
Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
VorwortWas bedeutet eine Ästhetik der Technik?
Oliver Ruf / Andreas SießWas ist ein Labor?Zur Ästhetisierung experimenteller Umwelten
Daniel Martin FeigeGegen-TechnikenVom Ästhetisch-Werden des Technischen
Martin GessmannÄsthetik des VerschwindensDas Design der Technik im 21. Jahrhundert
Christoph Ernst / Jens SchröterStelle und ObjektZur Medienästhetik virtueller Realität im Kontext des Holodeck-Leitbildes
Olga MoskatovaZur Existenzweise des (Techno-)Ästhetischen in Gilbert Simondons Individuationsphilosophie
Andreas BroeckmannAspekte der Maschinenästhetik
Martina Venanzoni›Corpo-real‹ technologiesZu einer posthumanistischen Ästhetik von Information und Körper
Philipp ZitzlspergerTechnik als ästhetisches Problem im Funktionalismus
Tom PoljanšekNie ganz bei den SachenZur Phänomenologie der Immersion
Manuel van der VeenTechnik-Ästhetik einer Mixed RealityÜber das Verhältnis von Redundanz und Augmentation
Tobias HeldEigen- und SelbstbildÜberlegungen zur technischen Ästhetik in der Videotelefonie
Patrick Rupert-KruseExperience Through a MachineTechnik-Ästhetik hapto-taktiler Interfaces im Kontext immersiver Ensembles
Fabian Lorenz WinterZur ästhetischen Existenzweise technischer ObjekteBriefkopierbücher im Spannungsfeld von Archiv und Ästhetik
Manuela GantnerMorphologie des ›friedlichen Atoms‹Momente energetischer Spannung und Modellierung von Zeit als Gestaltungsprinzipien
Salvatore Pisani Mobilier urbainInfrastruktur-Ästhetik im Paris des 19. Jahrhunderts
Burkhard MeltzerWeiche KonturenTechnisch-ästhetische Aspekte des Dinglichen in der zeitgenössischen Kunst
Johannes BennkeVorbemerkungen zu einer Logik des DigitalenObfuskation in Codes, Kunst und Datenvisualisierung
Dominik MaederLive From The Flight DeckZur Technoästhetik des Cockpits in auto-ethnografischen Flugvideos
Oliver RufMedien-›Eingriffe‹Zur immanenten Ästhetik Künstlicher Intelligenz
Beiträger·innen
Vorwort
Was bedeutet eine Ästhetik der Technik?
»Wir erfahren darum niemals unsere Beziehung zum Wesen der Technik, solange wir nur das Technische vorstellen und betreiben.«
Martin Heidegger:Die Frage nach der Technik
Von Technik und Ästhetik zu sprechen, heißt, sich bereits begrifflich auf ein Feld einzulassen, das mindestens zwei divergente Perspektiven gemeinsam denkt und wenigstens aber verschobene Blickwinkel auf das zentrierte Phänomen auf je eigene Weise sowie mit je eigenen Ansprüchen diskutiert. Dabei haben das Technische wie das Ästhetische, so die Ausgangsthese des vorliegenden Bandes, die Bedeutung einer Interdependenz aufzuweisen. Das Technische wird Funktionen, Formen, ästhetische Urteile und Gebrauchsaspekte konstituieren können – als eine Art ästhetischer und multimodaler Wahrnehmungskatalysator –, der über exterozeptive sensorische Dimensionen, wie Haptik, Taktilität, Visualität, Audition, Olfaktorik und Gustatorik, ebenfalls auch interozeptive Sinne zu adressieren vermag. Ästhetische Zustände als zeichenhafte Realisierungen, als quasi-sakrale und phantasmatische Urteile oder wahrnehmungsvermittelte Phänomene des Erscheinens sind dadurch ebenso denkbar wie es möglich wird, dass besitzergreifende und pragmatische Bewegungen und Zeichenkonstellationen aufgerufen werden. Doch es kann, wie es bereits bei Roland Barthes heißt, der Eindruck eines »technischen und sehr menschlichen Vorgang[s] der Bearbeitung«1 zurückbleiben. Es entsteht gleichwohl eine Bewegung, die vom Anderen zum Einen leitet, eine Art Verkopplung und intrinsische Dynamik qua ästhetischer Evokation. Dadurch gewinnen Technik und Ästhetik eine weitere Rollenzuschreibung, die auf der einen Seite nach einer sich wandelnden Einstellung zum technischen Ding fragt und auf der anderen Seite sich, wie es Gilbert Simondon zeitgleich zu Barthes versucht, für die besondere Seins- und Existenzweise dieser Art von Ding interessiert:
Nicht ›Was ist die Technik?‹, sondern ›Wie ist die Technik?‹, d. h. in welchen performativen Gestalten und Handlungsakten verwirklicht und erhält sie sich? Wie kommt es zur Herausbildung von Werkzeugen, Instrumenten und Maschinen einerseits und Fabriken, Laboratorien, Netzwerken andererseits? Das beinhaltet auch die Frage nach dem Wo: In welchen Umgebungen und Zusammenhängen siedeln sich die technischen Dinge an, welche Landschaften werden für sie, aber ebenso von ihnen geschaffen? Dann folgt die Frage nach dem Wer, dem Menschen, der mit diesen Dingen umgeht – sei es auf konstruktive oder konsumtive Art, sei es individuell oder kollektiv, sei es unwissend oder informiert. [...] Abschließend [...] das Problems des Wann [...], die Frage nach den Seinsweisen, die der Technik vorausgehen und ihr gegenüberstehen sowie der ihr eigenen Zeitlichkeit.2
Technik und Ästhetik antworten, so ließe sich sagen, auf eine Indienstnahme von Objektivationen innerhalb kultureller Prozesse, als Ressourcen und Revitalisierungen dieser Fragen, etwa wenn es mit Bezug auf Bernhard Stiegler um die Prämisse geht, dass der Mensch stets technisch3 sei oder dass die Technik stets gegebenen und zu gebenden Zwecken als eine »Strukturierung von Zwecken«4 dient. Es sei auch an Ernst Cassirer gedacht, der das spezifisch Symbolische als menschliche Kategorie des animal symbolicum charakterisiert.5 Das Technische wird solcherart immer wieder neu in menschlicher Erfahrungspraxis fundiert und generiert selbst wiederum vielfältige kulturelle Formen, Ausprägungen und Praktiken, denen das Prädikat von etwas Ästhetischem allzu oft zu eigen ist.
Wenn Jacques Rancière vom (hier) Ästhetischen als Modus einer »Aufteilung des Sinnlichen« spricht, bei dem »ein Rahmen der Sichtbarkeit und Intelligibilität« die »Dinge oder Praktiken unter einer Bedeutung vereint«, dann entsteht eine »Gemeinschaft des Sinnlichen«, für den »Raum und Zeit auf bestimmte Weise eingeteilt und dadurch Praktiken, Formen der Sichtbarkeit und Verstehensmuster miteinander verknüpft werden.«6 Angesprochen ist damit eine spezifische Wesensbestimmung des Ästhetischen, nämlich stets im sinnlich-rezeptiven Kontext stattzufinden, das kontingente und material-ästhetische Bedingungen anspricht, die das Denkbare und Wahrnehmbare vom ungedacht und ungesehen Bleibenden unterscheiden. Als eine solche Bedingung erweist sich das Technische: Aus dieser Möglichkeit resultiert schließlich die Vorannahme, deren Tragfähigkeit es im Rahmen der folgenden Beiträge unter dem Schlagwort einer ›Technikästhetik‹ interdisziplinär zu überprüfen gilt: Ist diese (a) Ergebnis technischer und technologischer Aus- und Verhandlungen, einer (b) basalen Affizierung von Aus- und Eindrucksweisen, (c) eine Bipolarität, die als Strukturmerkmal das Erfahren, das Erfahrenwerden und das Erfahrene schlechthin nach der einen oder der anderen Seite entfaltet oder (d) eine konstitutive Interdependenz, eine Hervorbringung jeglicher Ästhetik auf den Prämissen einer progressiven Technizität? Ist hier vielleicht auch ein Unbehagen7 und/oder eine Widerständigkeit8 aufgerufen, von dem wiederum auch Rancière schreibt? Handelt es sich in der Konfrontation und im Zusammenspiel mit Technik um ästhetische Regime, womöglich auch um Designregime?9 »Das Prinzip des ästhetischen Regimes ist zunächst, dass die Schönheit gleichgültig gegenüber der Qualität des Sujets ist«, schreibt Rancière: »Was die neue Schönheit annulliert, ist das System, durch welches Körper Zeichen präsentierten, die Gedanken oder Gefühle übersetzten, Handlungen zusammenfassten usw.«10 Oder geht es im so genannten Zeitalter des Digital Turn vielleicht auch um ein Neudenken von Schönheit, deren Sinn sich erst in der Verkörperung durch das Mediale ergeben könnte, wobei sie dann weniger als Ziel, sondern vielmehr als produktive Performanz des Technischen zu beschreiben wäre?
Der mit dieser Publikation vorgeschlagene Begriff des Technikästhetischen soll mithin Anlass der diskursiven Verständigung und Überprüfung sein. Zu diskutieren sind dazu sowohl technikphilosophische wie kunstgeschichtliche, designtheoretische, phänomenologische wie semiotische Fragestellungen, aber auch medienkulturwissenschaftliche, wahrnehmungstheoretische sowie wissenschaftsforschende Annäherungen. Der hiermit vorgelegte Band möchte also den Fokus auf ganz unterschiedliche Negotationen richten, um von hier aus divergente Perspektiven zusammenzuführen und das anvisierte Gegenstandsfeld zu erhellen respektive in einen konstruktiven Antworthorizont zu stellen. Die Kartierung der versammelten Ausführungen betrifft denn auch ein solches Gespräch zwischen Disziplinen bzw. zwischen Theorie(n) und Anwendung(en). Der Band greift dazu unter dem Titel Technik-Ästhetik. Zur Theorie techno-ästhetischer Realität jene, bereits selbst historisch gewordene Tendenz des Interdisziplinären bzw. der Interdisziplinarität auf. Die Sammlung legt aber daher denn auch keine Grundlagen einer allgemeinen Ästhetik der Technik vor und entscheidet ebenfalls keine systematischen historisierbaren Fragen, versteht sich jedoch dennoch als Perspektive exemplarisch technikgeschichtlicher Anliegen, die Erscheinungen des Ästhetischen komplettieren. Diese Perspektive wird in einer Art Umschau erschlossen. In 19 Abhandlungen werden ausgewählte Theorien und Praktiken zur Erhellung ästhetischer respektive ästhetisch werdender respektive ästhetisierter Technik reflektiert, analysiert, diskutiert usw. Im Zentrum stehen jeweils das individuell heraus zu stellende Verhältnis von Technik und Ästhetik, von deren Gebrauch und Bildung, ihrem Einsatz, ihrer Nutzung, ihrer Produktion, ihres Zwecks etc. Technische Artefekate, Formen und Funktionsweisen, so der gemeinsame Fokus aller hier gesammelten Darstellungen, sind – ebenso wie ihre Fiktionen und Darstellungen – immer auch primär ästhetische Objekte und zugleich in ihren eigenen ›Energien‹ zu begreifen. Von Technik angeregte Theoriebildung ist Ästhetik. Dieses Anliegen will die Sammlung in den Rahmen einer vergleichenden Untersuchung rücken und damit auch zu stabilisieren versuchen. Technik-Ästhetik-Forschung ist dabei zudem immer auch Arbeit an Zugängen – auch in diesem Sinne ist die Botschaft des vorliegenden Bandes zu verstehen. Die Suche nach daran anschließenden Zugriffen, um zu finden, allerdings womöglich auch zu er-finden, was eine Technik-Ästhetik-Wissenschaft sein könnte, so die verbindende These, geht hierzu in der Suche nach Einfallswinkeln als technik-ästhetische Praxeologie (d.h. als Praxis-Wissenschaft) auf. Mit der Nahführung von einerseits Forschung und Theoriebildung und andererseits Anwendung und Praxis verbindet sich der Versuch, in der wiederkehrenden Frage nach der Technik und der Ästhetik Hinweise auf Leitlinien dieser ›Verbindung‹ festzustellen. »Also fragend bezeugen wir den Notstand, daß wir das Wesende der Technik vor lauter Technik noch nicht erfahren, daß wir das Wesende der Kunst vor lauter Ästhetik nicht mehr bewahren«,11 lautete 1953 mitunter ein Teil des Schlussworts von Martin Heideggers Aufsatz Die Frage nach der Technik, der bereits im Mottozitat dieses Vorworts referenziert ist. Dort heißt es weiter: »Je fragender wir jedoch das Wesen der Technik bedenken, um so geheimnisvoller wird das Wesen der Kunst.«12 Die nachfolgenden Überlegungen machen aus dem Schlusswort von 1953 eine vielstimmige Grußformel technik-ästhetisch grundierter Gegenwart.
Dieser Band kann nicht veröffentlicht werden, ohne allen, die am Gelingen dieses Projekts Anteil genommen haben, herzlich zu danken. Den Beiträger·innen für die Texte, der Programmabteilung sowie dem Projektmanagement des transcript-Verlags einmal mehr für die überaus konstruktive Zusammenarbeit auf dem Weg vom Manuskript zum Buch, Aleksandra Vujadinovic für die umsichtige wie sorgfältige Redaktion und Andreas Sieß für die souveräne Buchgestaltung.
Die vorliegende Publikation ist Teil des von der VolkswagenStiftung geförderten Projekts Rhine Ruhr Centre for Science Communication Research (RRC).
Bonn und Münster, im Sommer 2022
Oliver Ruf und Lars C. Grabbe
1 Roland Barthes: »Der neue Citroën«, in: Ders.: Mythen des Alltags, übers. v. Horst Brühmann. Berlin: Suhrkamp, 2010, S. 196–198, hier S. 196.
2 Henning Schmidgen: »Das Konzert der Maschinen. Simondons politisches Programm«, in: Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung 2 (2012), S. 117–134, hier S. 119f.
3 Vgl. Mark Hansen: »›Realtime Synthesis‹ and the Différance of the Body: Technocultural Studies in the Wake of Deconstruction«, auf: Culture Machine 5 (2003), https://culturemachine.net/deconstruction-is-in-cultural-studies/realtime-synthesis-and-the-differance-of-the-body/, zul. abgeruf. am 18.07.2022.
4 Jean-Luc Nancy: »Von der Struktion«, in: Erich Hörl (Hg.): Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt. Berlin: Suhrkamp 2011, S. 54–72, hier S. 56.
5 Vgl. Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis. Text und Anmerkungen bearbeitet v. Julia Clemens. Hamburg: Meine 2010.
6 Jacques Rancière: Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien. Berlin: b-books, 2006, S. 25f., 71.
7 Vgl. ders.: Das Unbehagen in der Ästhetik. Wien: Passagen, 2008.
8 Vgl. ders.: Ist Kunst widerständig? Berlin: merve, 2008.
9 Vgl. Oliver Ruf: »Designregime. Zur Theorie einer ästhetischen Idee«. In: Ders. u. Stefan Neuhaus (Hg.): Design-Ästhetik. Theorie und soziale Praxis. Bielefeld: transcript 2020, S. 17–36.
10 Rancière: Ist Kunst widerständig?, S. 51.
11 Martin Heidegger: »Die Frage nach der Technik«. In: Ders.: Gesamtausgabe. I. Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976. Bd. 7: Vorträge und Aufsätze. Hrsg. v. Friedrich-Wilhelm Herrmann, Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann 2000, S. 7–36, hier S. 36.
12 Ebd.
Daniel Martin Feige
Gegen-Techniken
Vom Ästhetisch-Werden des Technischen
In unserem üblichen Sprachgebrauch sind Redeweisen wie diejenige von ›künstlerischen Techniken‹ in robuster Weise etabliert. Der Schluss liegt deshalb nahe, einen engen Zusammenhang zwischen der Technik und dem Ästhetischen zu sehen. Eine naheliegende Variante dieses Gedankens besagt, dass es sich bei Ästhetik in Form der Kunst und der Technik um interdependente Phänomene handelt; wir könnten dementsprechend ästhetische Phänomene nicht ohne Rekurs auf technische Phänomene erläutern und vice versa, ohne dass sich wohlgemerkt das eine auf das andere reduzieren ließe oder beide in einer höheren Art der Einheit ihre Identität einbüßen würden. Ein paradigmatischer Fall, in dem ein solcher Gedanke sicherlich überzeugend ist, ist das Verhältnis von Sprache und Denken:1 Wir können nicht verstehen, was denken ist, insofern wir nicht verstehen, was es heißt, eine Sprache zu sprechen und umgekehrt. Das heißt aber nicht, dass das, was es heißt, zu denken, auf das reduzierbar wäre, was es heißt, eine Sprache zu sprechen – und auch nicht, dass das, was es heißt, eine Sprache zu sprechen auf das reduzierbar wäre, was es heißt, zu denken. Wenn wir ein entsprechendes begriffliches Manöver für die Frage des Verhältnisses von Ästhetik und Technik in Anschlag bringen würden, würde das etwa Folgendes meinen: Was das Ästhetische ist, lässt sich nicht ohne seinen Bezug auf das Technische erläutern – und was das Technische ist, nicht ohne seinen Bezug auf das Ästhetische.
Die folgenden Überlegungen werden gegen einen solchen Gedanken argumentieren – und weitergehend gegen den Gedanken, dass ›das Technische‹ und ›das Ästhetische‹ (beides verstanden als Reflexionsbegriffe) im Rahmen ein und derselben Logik zu explizieren sind. Mehr noch: Ich werde für folgenden Gedanken argumentieren: Die Logik des Ästhetischen ist eine gegenüber der Logik des Technischen andersartige und sogar entgegengesetzte Logik





























