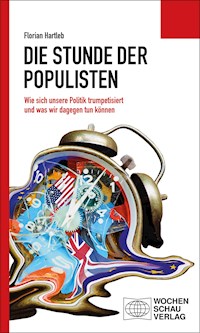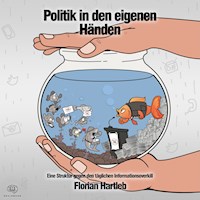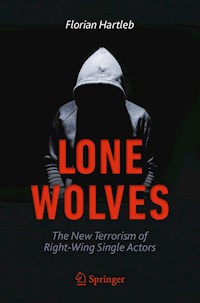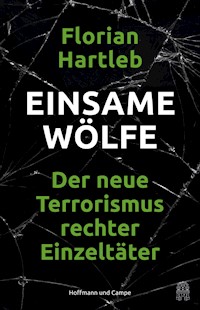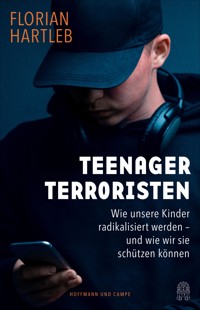
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob beim Anschlag auf das israelische Generalkonsulat von München oder beim vereitelten Angriff auf Konzerte von Taylor Swift in Wien – immer öfter sind die Terroristen im Teenageralter. Ein Phänomen, das unsere Sicherheit und die Grundfeste unserer Gesellschaft massiv erschüttert. Florian Hartleb, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Extremismus beschäftigt, zeigt in seinem Buch, wie die Jugendlichen verführt und radikalisiert werden, mit welcher Anziehungskraft Ideologien und Verschwörungstheorien wirken und welche Rolle dabei Social-Media- und Gamingplattformen spielen. Ein aufrüttelnder Einblick in die Szene - und zugleich eine Handreichung, wie wir Jugendliche vor dieser gefährlichen Entwicklung schützen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Florian Hartleb
Teenager-Terroristen
Wie unsere Kinder radikalisiert werden - und wie wir sie schützen können
Für meine beiden Söhne Villem (8 Jahre) und Gustav (3 Jahre) sowie meine Partnerin Teele
Die Rache der Übersehenen – eine Einführung
Das Labyrinth
Man stelle sich einen sechzehnjährigen Jungen vor, der jeden Tag durch eine Schule geht, in der er zwar körperlich anwesend ist, aber geistig durch das Raster fällt. Zu Hause herrscht Sprachlosigkeit, online findet er plötzlich Resonanz – jemand spricht ihn an, hört zu, nennt ihn »Bruder«. Was ihm sein Umfeld nicht geben konnte – Orientierung, Wert, Bedeutung –, bekommt er in radikalisierten Foren in greller, überzeichneter Form zurück. Der Weg vom Gefühl der Unsichtbarkeit zum Gefühl der Mission ist erschreckend kurz. Aus einem einsamen Jugendlichen wird ein potenzieller Täter, nicht weil er »böse« ist, sondern weil ihm niemand rechtzeitig die Hand gereicht hat, bevor andere es taten – mit Parolen, Feindbildern und falscher Geborgenheit.
Und dann explodiert etwas – vielleicht eine Bombe, vielleicht nur ein Leben, das entgleist. Zurück bleiben fassungslose Eltern, entsetzte Lehrer, ratlose Nachbarn, die sagen: »Man hätte es nie gedacht.« Doch die Zeichen waren da – nicht laut, nicht grell, sondern leise: Rückzug, Verhärtung, ein verlorener Blick, ein plötzlicher Sinn fürs Absolute. In der Radikalisierung eines Teenagers spiegelt sich auch das Versagen der Welt, die ihn nicht gehalten hat. Der Moment der Gewalt ist nicht der Anfang, sondern das bittere Ende einer Geschichte, die viel früher begonnen hat – mit einem Kind, das dazugehören wollte und schließlich dort aufgenommen wurde, wo es niemand erwartet hätte: im Schatten einer zerstörerischen Ideologie.[1] Teenager-Terrorismus ist kein Akt der Bosheit, er ist die Rache des Übersehenen. Ein Kind, das zu lange im Schatten stand, beginnt selbst, Schatten zu werfen.
Die Radikalisierung junger Menschen ist wie der Weg durch ein Labyrinth – kein geradliniger Pfad, sondern ein System aus Irrwegen, Sackgassen und geheimen Durchgängen, und oft nur einem Ausgang.[2]
Der Eingang ist meist unscheinbar, für Außenstehende kaum sichtbar. Der Jugendliche betritt das Labyrinth nicht mit einem Entschluss zur Gewalt, sondern mit einer Suche: nach Zugehörigkeit, Bedeutung, Gerechtigkeit, Identität. Es beginnt alles mit dem Gefühl, nicht dazuzugehören, unsichtbar zu sein, von Leere, Einsamkeit, Unverstandenheit. Soziale Exklusion, Diskriminierung, familiäre Instabilität oder schulisches Scheitern weisen den Weg.
In den digitalen Gängen des Labyrinths begegnet er neuen Stimmen – Foren, Videos, Chatgruppen. Dort wird er plötzlich gesehen, gehört, benannt. Die Stimmen geben ihm einfache Antworten, klare Schuldige und ein Gefühl von Macht. Die Orientierung ist noch diffus, aber das Versprechen: verlockend.
Je tiefer er vordringt, desto enger werden die Gänge. Zweifel werden als Schwäche markiert, Andersdenkende als Feinde. Die eigene Identität wird radikalisiert, vereinfacht, verdichtet. Es gibt kaum mehr ein Zurück – nur noch den Weg nach vorn, in die Dunkelheit.
Am Ende des Labyrinths steht kein Licht, sondern der vermeintliche Ausweg – ein Akt der Gewalt, eine symbolische Tat gegen die Gesellschaft, die ihn nie aufgenommen hat. Der Terrorakt ist die Entladung eines existenziellen Staus, eine zerstörerische Antwort auf eine Welt, die ihn nie gefragt hat, wie es ihm geht.
Nicht alle bleiben im Labyrinth gefangen. Es gibt geheime Durchgänge zurück: Begegnung, Vertrauen, alternative Zugehörigkeiten. Der Ausstieg ist schwer, aber möglich, wenn jemand die Hand reicht, Orientierung gibt und einen Kompass durch das Dickicht bietet.
In einer Zeit, in der Radikalisierung nicht mehr in dunklen Kellern, sondern in hellen Kinderzimmern beginnt, entlarvt dieses Buch ein verdrängtes Phänomen: den Terror aus der Mitte der Jugend. Ihre Welt ist eine, die gleichzeitig von grenzenlosen Möglichkeiten und der quälenden Angst vor dem Scheitern geprägt ist. Was sie auszeichnet, ist die Fähigkeit, alles zu hinterfragen, das Bestehende zu zerlegen und sich durch eine Flut aus Informationen und Eindrücken zu bewegen – ohne immer zu wissen, welcher Weg der richtige ist. Ihre Herausforderung besteht nicht nur in der Anpassung an die gesellschaftlichen Normen, sondern darin, ihre eigene Stimme zu finden, die sich zwischen der Flut der Erwartungen von außen und dem Drang nach Selbstverwirklichung behaupten muss. Inmitten dieser Suche ist der Teenager nicht nur von Neugier und Idealismus getrieben, sondern auch von der tiefen Sehnsucht, zu verstehen, wo er in dieser Welt seinen Platz hat – und womöglich auch, wie er die Welt verändern kann. Es ist diese Mischung aus grenzenlosem Potenzial und der ungestümen Kraft, die einen Teenager zu dem macht, der, wie kein anderer, die Welt auf den Kopf stellen kann.
Teenager-Terrorismus gedeiht dort, wo junge Menschen sich dauerhaft als Außenseiter erleben – entwurzelt, übersehen, ohne Stimme. Soziale Exklusion ist kein abstrakter Zustand, sondern ein stilles Gift:[3] Sie wirkt schleichend, indem sie Teilhabe verweigert, Anerkennung entzieht und Zukunftszuversicht dämpft. Wer über Jahre hinweg spürt, dass er nicht dazugehört, dass seine Geschichte in den Erzählungen der Gesellschaft keinen Platz hat, ist empfänglich für andere Narrative – jene, die klare Feindbilder zeichnen, Zugehörigkeit versprechen und den Schmerz der Ausgrenzung in Wut verwandeln.
Radikale Ideologien geben jenen Jugendlichen ein Zuhause, die sich von der offenen Gesellschaft verraten fühlen. Sie sind Türöffner für ein gefährliches Gefühl: Bedeutung. Plötzlich zählt man, wird gesehen, bekommt einen Auftrag – nicht selten mit mörderischer Konsequenz. Wie ein Navigationssystem, das den Jugendlichen auf einen gefährlichen, verschlungenen Weg führt, wählt er die Ideologie, ohne die dunklen, gefährlichen Abgründe zu erkennen, in die sie ihn ziehen wird. Eine Gesellschaft, die dem Terror entgegentreten will, muss deshalb mehr tun, als zu schützen und zu bestrafen – sie muss zuhören, einladen und Räume schaffen, in denen kein junger Mensch sich fragen muss, ob sein Leben einen Platz in ihr hat.
Dass ein Buch über Teenager-Terrorismus aktuell notwendiger denn je ist, zeigt ein Fallbeispiel: Die Bundesanwaltschaft hat im Mai 2025 fünf rechtsextreme Deutsche festnehmen lassen. Vier von ihnen wirft sie die Mitgliedschaft in der Vereinigung »Letzte Verteidigungswelle« vor, die die Bundesanwaltschaft des Rechtsterrorismus bezichtigt. Einer der Festgenommenen soll die Vereinigung unterstützt haben. Alle fünf sind zwischen vierzehn und achtzehn Jahre alt, »wobei sie alle als Jugendliche mit Verantwortungsreife handelten«, heißt es weiter in der Erklärung des Generalbundesanwalts. Die Polizei begann zudem mit Durchsuchungen in dreizehn Objekten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Thüringen.
Die »Letzte Verteidigungswelle« soll spätestens seit Mitte April 2024 existieren und sich »als letzte Instanz zur Verteidigung der ›Deutschen Nation‹« verstehen, wie es von der Bundesanwaltschaft heißt. Ihr werden mehrere konkrete Terrortaten zur Last gelegt. So sollen zwei der Festgenommenen am 23. Oktober 2024 ein Feuer in einem Kulturhaus in Altdöbern in Südbrandenburg gelegt haben, wobei ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500000#x2005;Euro entstanden sei. Nur durch Zufall seien keine Menschen verletzt worden. Am 5. Januar 2025 sollen zwei weitere Personen im thüringischen Schmölln das Fenster einer Asylbewerberunterkunft eingeschlagen und versucht haben, das Gebäude zu entflammen. Dies sei allerdings gescheitert. Die Täter hätten u.a. die Schriftzüge »Ausländer raus« und »NS-Gebiet« an das Gebäude geschmiert, außerdem Hakenkreuze und Sigrunen. Vorausgegangen sind dieser Entdeckung Undercover-Recherchen eines Teams des Magazins Der Stern und von RTL.[4]
Der führende Terrorismusforscher Peter R. Neumann hielt im September 2024 fest, ungefähr zwei Drittel der Terrorverdächtigen, die in den letzten zehn Monaten verhaftet wurden, seien Teenager unter neunzehn Jahren gewesen.[5] Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Österreich warnte unlängst davor, dass sich an Schulhöfen bereits Zehnjährige radikalisieren.[6] Die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, Europol, zeigte sich in ihrem Bericht von 2024 besorgt über die gezielte Ansprache von jungen Menschen durch Terroristen.[7] Im Global Terrorism Index 2025 ist die Radikalisierung Jugendlicher ebenfalls ein Kernpunkt.[8]
Und ein Buch über Teenager-Terrorismus ist heute relevanter denn je, weil sich die Mechanismen der Radikalisierung fundamental verändert haben und traditionelle Sicherheitsstrategien oft nicht ausreichen, um diese neue Bedrohung zu verstehen und zu bekämpfen. Während früher terroristische Netzwerke klaren Hierarchien folgten, erleben wir heute eine digitale, dezentralisierte und individualisierte Form des Extremismus, die besonders Jugendliche anspricht. Soziale Medien, Gaming-Communitys, Foren und verschlüsselte Chatgruppen bieten extremistischen Ideologien ein neues Rekrutierungsfeld, in dem Hass und Gewalt allmählich normalisiert werden und Jugendliche oft unbemerkt in Radikalisierungsprozesse geraten.
Der Teenager ist von der schieren Menge an Informationen überwältigt, die ihm Tag für Tag entgegenströmt – oft widersprüchlich, oft entmutigend. Doch dann trifft er auf eine vermeintlich klare Antwort, eine radikale Ideologie, die ihm verspricht, was er am meisten sucht: Zugehörigkeit, Sinn und die Illusion von Kontrolle. Für viele Jugendliche, die in einer Welt der ständigen Veränderung und Unsicherheit nach einem klaren Ziel suchen, ist der Weg in den Terrorismus eine tragische, aber greifbare Möglichkeit. Doch dieser Weg ist kein unvermeidliches Schicksal, sondern ein gefährlicher Strudel, der jedes Gefühl von Menschlichkeit, Empathie und Frieden auslöscht.
Dieses Buch nimmt den Leser, die Leserin mit in die dunklen Ecken der digitalen Radikalisierung, in Chatgruppen, in denen Hass gepredigt wird, in Foren, die Terrorakte wie Videospiele inszenieren, und in die Psyche von Jugendlichen, die sich an einem Punkt befinden, an dem Gewalt als einziger Ausweg erscheint.
Doch dies ist kein Buch über Hoffnungslosigkeit – sondern eine präzise Analyse der Ursachen und Auswirkungen eines beunruhigenden Trends. Und ein Weckruf. Das Buch legt nicht nur die Mechanismen offen, die junge Menschen in die Fänge extremistischer Bewegungen treiben, und enthüllt die emotionalen, sozialen und psychologischen Strukturen, die sie für Manipulation anfällig machen, sondern es richtet auch einen dringenden Appell an uns alle: Es fordert dazu auf, die Augen nicht zu verschließen, sondern aktiv Lösungen zu finden. Denn es liegt in unserer Hand, die nächste Generation vor der Verführung durch Hass und Gewalt zu bewahren. Terrorismus ist nicht nur eine Frage von Ideologie und Gewalt – er ist auch eine Frage der Prävention, der Bildung und der gesellschaftlichen Verantwortung. Je mehr Menschen verstehen, wie Radikalisierung funktioniert, desto besser können wir junge Menschen davor bewahren, den falschen Weg einzuschlagen.
Die Emotionalität des Themas und die Relevanz der Lösungsfindung lassen sich unter drei Stichworten zusammenfassen:
Jugendliche befinden sich in einer Phase der Selbstfindung und der emotionalen Zerrissenheit. Wir können uns in ihre Unsicherheiten hineinversetzen, ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Identität verstehen. Es berührt uns zutiefst, zu sehen, wie diese verwundbare Phase ausgenutzt wird. Die persönliche Verbindung zu den Ängsten und Hoffnungen der Jugendlichen macht das Thema so aufwühlend und bedeutungsvoll.
Der Teenager-Terrorismus betrifft unsere nächste Generation, die unsere Zukunft prägen wird. Wenn diese Generation von Hass und Gewalt verführt wird, verlieren wir nicht nur Einzelne, sondern die gesellschaftliche Stabilität und die Werte, die eine friedliche und gerechte Welt ausmachen. Es ist eine existenzielle Sorge, dass wir die Jugend, die die Gesellschaft von morgen führen soll, an extremistische Ideologien verlieren könnten.
Es ist noch nicht zu spät, aber die Zeit drängt. Jeder Schritt, den wir nicht in Richtung Prävention und Aufklärung unternehmen, könnte das Leben eines Jugendlichen und die Sicherheit der Gesellschaft gefährden. Es geht nicht nur um das Verständnis eines Problems, sondern um das Handeln, um radikalisierte Jugendliche zu retten, bevor sie irreversibel auf den falschen Weg geraten.
Die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist daher unbequem, aber unvermeidlich. Und deshalb ist dieses Buch über Teenager-Terrorismus auch nicht nur für Experten oder Sicherheitsbehörden relevant. Es ist für alle gedacht – Eltern, Lehrer und die Gesellschaft als Ganzes –, die verhindern wollen, dass die nächste Generation von Tätern heranwächst. Denn jeder Jugendliche, der aus der Radikalisierung herausgehalten werden kann, bedeutet nicht nur ein gerettetes Leben, sondern auch ein Stück mehr Sicherheit für uns alle.
Und dieses Buch richtet sich direkt an die Jugendlichen selbst, indem es aufzeigt, wie extremistische Gruppen oder Influencer ihre Unsicherheiten ausnutzen, um ihre Ideen zu verbreiten, wie diese Gruppen ihnen das Gefühl geben, Teil von etwas Wichtigem und Überlegenen zu sein, und ihnen zugleich Freiheit und Erfolg versprechen. Es soll dabei helfen, die Manipulation hinter diesen Ideen zu erkennen und sich davor zu schützen. Es fordert Jugendliche auf, die eigene Identität zu finden, ohne sich von gefährlichen Ideologien beeinflussen zu lassen, und gibt ihnen Werkzeuge an die Hand, selbstkritisch zu denken und sich eine eigene Meinung zu bilden.
Terrorismus und Teenager-Terrorismus – eine Definition
Was genau ist Terrorismus? Die Frage klingt einfach – ist aber alles andere als eindeutig zu beantworten. Es gibt Dutzende wissenschaftliche Definitionen, politische Festlegungen, juristische Rahmen. Die UNO hat sich bis heute nicht auf eine einheitliche Definition einigen können. Einige Terrorismusforscher differenzieren zwischen den Begriffen »Terrorismus« und »Terror«.[9] Dabei wird eine gewaltsame Methode als Terror bezeichnet, wenn sie von einem Staat ausgeübt wird, was als Staatsterrorismus bezeichnet wird. (Diese Unterscheidung ist jedoch nicht in allen Definitionen enthalten.) Terrorismus wird als gewaltsame Methode verstanden, die häufig gegen Zivilisten und zivile Einrichtungen gerichtet ist. Ein Freiheitskämpfer oder Widerstandskämpfer setzt zwar ebenfalls physische Gewalt ein, richtet sich jedoch hauptsächlich gegen militärische Ziele und verfolgt direkt die politischen oder militärischen Leitlinien seiner Organisation. Im Gegensatz dazu setzt der Terrorist vorrangig auf die psychologischen Auswirkungen der Gewalt. Er nutzt Gewalt als kommunikatives Mittel, um indirekt seine Ziele zu erreichen, wobei seine Kommunikation auf das Opfer gerichtet ist – dies kann ein Staat mit seinen Institutionen sein, aber es kann sich auch um Zivilisten handeln.
Walter Laqueur definierte Terrorismus bereits 1981 als »die Anwendung oder die Androhung der Anwendung von Gewalt, einer Kampfmethode oder einer Strategie, um bestimmte Ziele zu erreichen. […] Der Terrorismus zielt darauf ab, beim Opfer einen Zustand der Angst hervorzurufen, der rücksichtslos ist und nicht den humanitären Regeln entspricht […]. Public relations ist ein wesentlicher Faktor in der terroristischen Strategie.«[10] Laut Bruce Hoffman hat Terrorismus »unweigerlich politische Ziele und Motive, er ist gewalttätig – oder, was ebenso wichtig ist, er droht mit Gewalt […].«[11] Peter Waldmann sieht im Terrorismus die »planmäßige Vorbereitung gezielter Anschläge unter den schwierigen Bedingungen des Untergrunds und die Kalkulation des Schockeffekts«.[12] Im virtuellen Zeitalter erscheint diese Bestimmung obsolet, da es mittlerweile zahlreiche Lone Actors gibt, also Einzeltäter in der Tatausführung.
Allen Definitionen gemeinsam ist: Terrorismus ist mehr als Gewalt. Er ist eine bewusste Strategie – eine Form der Kommunikation mit mörderischen Mitteln. Der Täter will nicht nur Schaden anrichten, sondern eine Botschaft senden: an die Öffentlichkeit, an die Politik, an die Gesellschaft. Er will Angst säen, Vertrauen zerstören, Handlungsspielräume verschieben. Deshalb richtet sich Terrorismus häufig nicht gegen bewaffnete Gegner, sondern gegen Unbeteiligte. Je unvorhersehbarer, je brutaler und je symbolischer die Tat, desto größer ihre Wirkung. Und genau das macht Terrorismus zu einer Herausforderung für jede liberale Demokratie: Er funktioniert, weil wir uns betroffen fühlen.
Doch was passiert, wenn nicht erwachsene Fanatiker, sondern Teenager zu Terroristen werden? Dreizehn-, Fünfzehn- oder Siebzehnjährige, die sich online radikalisieren, Anschläge planen oder sich in ideologischen Echokammern verlieren – oft unerkannt von Eltern, Schule oder Gesellschaft? Diese Täter tragen Kapuzenpullis statt Uniformen, tippen in Foren, statt Bomben zu bauen, und sind doch genauso gefährlich. Denn sie handeln nicht aus klarer politischer Überzeugung, sondern aus einer Mischung aus Suche, Wut, Angst und Anerkennungsdrang. Radikalisierung im Jugendalter ist kein Einzelfall mehr, sondern ein wachsendes Phänomen. Sie geschieht leise, digital, unauffällig – bis es zu spät ist.
Teenager-Terrorismus
Obwohl Radikalisierung seit Jahrzehnten erforscht wird, gibt es eine besorgniserregende Forschungslücke, wenn es um jugendliche Täter geht. Viele Studien konzentrieren sich auf erwachsene Extremisten oder auf militärische Terrororganisationen[13], doch die Dynamiken, die speziell Teenager in diesen Sog ziehen, sind weit weniger gut verstanden. Wie unterscheiden sich die psychologischen und sozialen Faktoren bei Jugendlichen von denen Erwachsener? Welche Rolle spielen moderne digitale Plattformen in der Radikalisierung Heranwachsender? Und warum sind viele Präventionsprogramme nur begrenzt erfolgreich? Dieses Buch setzt genau hier an – um Licht in einen Bereich zu bringen, der trotz wachsender Bedrohung noch immer viel zu wenig erforscht ist.
Der Begriff »Teenager-Terrorismus« selbst ist umstritten, weil er tiefgreifende ethische, rechtliche und gesellschaftliche Fragen aufwirft. Letztlich geht es darum, reale Risiken von moralischer Panik zu trennen und langfristige, nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Ohne eine wissenschaftliche Debatte bleibt der Teenager-Terrorismus entweder ein blinder Fleck oder ein Instrument politischer Instrumentalisierung – beides wäre fatal für die Sicherheit und die Zukunft junger Menschen.
Eines ist dabei klar: Die Gefahr wächst. Radikale Ideologien, digitale Manipulation und soziale Isolation erschaffen eine neue Generation extremistischer Jugendlicher, die nicht in klassischen Terrornetzwerken beginnt, sondern oft in Gaming-Foren, Telegram-Chats oder YouTube-Algorithmen. Wer verstehen will, warum Kinder und Jugendliche zu Attentätern werden, muss über einfache Sicherheitsmaßnahmen hinausdenken. Es braucht eine tiefgehende Analyse, die psychologische, soziale, ideologische und technologische Faktoren kombiniert – denn Extremismus ist kein spontanes Phänomen, sondern das Ergebnis eines schleichenden Prozesses. Teenager-Terrorismus ist nicht einfach das Resultat individueller Fehlentscheidungen, sondern spiegelt strukturelle Defizite der Gesellschaft wider: die Bildungskrise, mediale Überflutung, den Verlust von kritischem Denken und eine zunehmende Emotionalisierung des Diskurses. Teenager-Terrorismus ist damit ein Frühwarnsystem für gesellschaftliche Probleme: Wo Jugendliche radikal werden, gibt es oft tieferliegende soziale Krisen. Und während die Gesellschaft noch nach Erklärungen sucht, wächst in den Schatten bereits die nächste Generation heran.
Die Muster des Teenager-Terrorismus verändern sich dabei stetig. Während frühere Radikalisierungswege oft über persönliche Kontakte oder religiöse Gruppen führten, sind heute anonyme Online-Communitys der wichtigste Rekrutierungsraum. Extremistische Inhalte verbreiten sich durch virale Trends, die gezielt auf die digitale Jugendkultur zugeschnitten sind. Auch die Taten selbst haben sich verändert: Statt auf große, koordinierte Anschläge setzen viele jugendliche Täter auf Einzeltäterstrategien, inspiriert durch Amokläufe und ideologische »Manifeste«.[14] Der moderne Teenager-Terrorismus ist dezentraler, schwerer zu überwachen und oft unvorhersehbar – eine Entwicklung, die Sicherheitsbehörden weltweit vor neue Herausforderungen stellt.
Doch Teenager-Terrorismus bleibt auch deshalb ein weitgehend unerforschter und verhüllter Bereich, da er in vielen Gesellschaften mit einem Tabu belegt ist. Die Vorstellung, dass junge Menschen, die in einer Phase der Entwicklung und Orientierung stecken, zu solch gewaltsamen, ideologisch motivierten Handlungen fähig sind, stellt eine erschütternde Realität dar, die viele nicht begreifen wollen. In der Gesellschaft existiert eine tiefe Verdrängung der Tatsache, dass Jugendliche in extremistische Ideologien abrutschen können – nicht zuletzt aus der Angst heraus, dass der Jugendschutz und das Bild der unschuldigen Jugend durch diese dunklen Realitäten infrage gestellt werden. Es herrscht ein tief verwurzeltes Bedürfnis, diese Welt vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen, aus Sorge, die ohnehin schon verletzlichen Jugendlichen könnten durch die bloße Diskussion noch weiter stigmatisiert werden. Doch in dieser dramatischen Leere aus Verleugnung und Ignoranz wird nicht nur der Dialog über die Ursachen und Lösungen behindert, sondern die Gesellschaft nimmt auch die Gefahr in Kauf, dass die Mechanismen, die Teenager zu radikalisierten Taten treiben, unbemerkt weiterwachsen.
Das Thema des Teenager-Terrorismus wird außerdem oft vernachlässigt, weil es in der öffentlichen Wahrnehmung als »fern« oder als Problem, das »andere« betrifft, wahrgenommen wird – eine verzerrte Sichtweise, die die tatsächliche Bedrohung unterschätzt. In vielen Gesellschaften wird Radikalisierung als ein Problem für Erwachsene oder bestimmte Randgruppen angesehen, das in sozialen Brennpunkten oder auf Überwachungslisten gedeiht, während die potenzielle Anfälligkeit von Jugendlichen zu selten anerkannt wird. Wir denken, Terror käme von außen. Wir glauben, Feinde würden Grenzen überschreiten, Waffen tragen, Fahnen schwenken. Doch die Realität ist viel erschreckender: Die neuen Krieger tragen keine Uniform – sie tragen Schulrucksäcke. Sie stammen nicht unbedingt aus Krisengebieten, sondern aus ganz normalen Nachbarschaften. Sie wachsen in westlichen Demokratien auf, gehen zur Schule, haben Freunde – und können dennoch in den Extremismus abrutschen.
Denn es sind gerade die jungen Menschen in einer Phase der Selbstfindung und Identitätsbildung, die besonders anfällig für radikale Ideologien sind, die ihnen einfache Antworten auf ihre komplexen Fragen bieten. Doch die komplexen psychologischen, sozialen und digitalen Mechanismen, die zu diesem Phänomen führen, sind für viele nicht greifbar oder werden als zu schwierig oder unangenehm angesehen, um sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Teenager-Terrorismus ist ein Riss mitten durch unsere Gesellschaft – weil er dort entsteht, wo Jugendliche sich übersehen, missverstanden, entwurzelt fühlen. Wer sich radikalisiert, tut das nicht im luftleeren Raum. Er lernt in Klassenzimmern, surft in denselben Netzwerken, lebt oft in Reichweite unserer Blicke – und doch jenseits unserer Aufmerksamkeit. Wenn aus Kindern Täter werden, ist das nicht nur ihr Versagen. Es ist auch unseres. Denn wo Erwachsene nicht zuhören, tun es andere. Und nicht jeder, der zuhört, meint es gut.
Das Thema wird also auch oft verdrängt, weil es unangenehme Fragen aufwirft, die die gesellschaftlichen Strukturen betreffen: Warum sind Jugendliche so leicht manipulierbar? Welche Rolle spielen die digitale Welt und die Art, wie Extremisten soziale Medien nutzen, um junge Menschen zu erreichen? Und vor allem, warum sind wir als Gesellschaft nicht besser darin, Jugendliche in ihrer Entwicklung zu begleiten und vor diesen Gefahren zu schützen? Der Fokus auf Teenager-Terrorismus erfordert eine Auseinandersetzung mit Fragen der sozialen Integration, der Erziehung und der politischen Verantwortung – Themen, die oft komplex und politisch heikel sind. Anstatt das Problem aktiv anzugehen, wird es oftmals als zu groß, zu abstrakt oder zu »unbequem« angesehen, um es auf die Agenda zu setzen.
Teenager-Terrorismus ist ein disruptiver Prozess, weil er gesellschaftliche Normen, Sicherheitsstrukturen und Radikalisierungsmechanismen in einer neuen, unberechenbaren Weise verändert. Er führt zu Misstrauen und Polarisierung in der Gesellschaft. Er schürt Ängste, befeuert Vorurteile und kann den sozialen Zusammenhalt und den gesellschaftlichen Frieden destabilisieren. Anders als klassische Terrororganisationen, die auf strikten Hierarchien und langfristigen Strategien beruhen, ist der moderne Teenager-Terrorismus dezentralisiert, digital vernetzt und emotional getrieben. Und er hat eine globale Dimension: Ein Jugendlicher in Deutschland kann sich gleichzeitig von Attentaten in Neuseeland oder Syrien inspiriert fühlen. Diese neue Form von Extremismus untergräbt bestehende Sicherheitskonzepte und stellt Gesellschaften vor neue Herausforderungen.
Bisher gibt es wenig spezialisierte Forschung über Teenager-Terrorismus – das Buch könnte eine wissenschaftliche Lücke schließen. Durch die Kombination aus aktuellen Studien, psychologischen Analysen, der Schilderung von technologischen Entwicklungen und Präventionsstrategien kann das Buch eine einzigartige Perspektive bieten. Es ist nicht nur eine Warnung, sondern auch ein Leitfaden, um Extremismus unter Jugendlichen besser zu verstehen. Denn wer versteht, wie Radikalisierung funktioniert, kann sie auch verhindern.
Die Opferperspektive
Wenn über Teenager-Terrorismus gesprochen oder in den Medien berichtet wird, taucht ein beunruhigendes Phänomen auf: Die Opferperspektive wird ausgeblendet. Obwohl sie eine entscheidende Rolle spielt, wenn es um die gesellschaftliche und mediale Aufarbeitung von Terroranschlägen geht,[15] wird die Opferperspektive im Zusammenhang mit Teenager-Terrorismus häufig in den Hintergrund gedrängt. Stattdessen liegt der Fokus oft auf den Tätern, ihrer Radikalisierung, ihren Beweggründen und den Fehlern der Sicherheitsbehörden. Dies hat mehrere Gründe, die sowohl mit der Berichterstattung als auch mit psychologischen und gesellschaftlichen Mechanismen zusammenhängen.
Erstens herrscht die Faszination für den Täter und seine Radikalisierung vor. Wenn ein Jugendlicher zum Terroristen wird, wirft das viele Fragen auf: Warum hat er das getan? Was hat ihn radikalisiert? Welche Warnsignale gab es? Medien, Wissenschaftler und Sicherheitsbehörden konzentrieren sich stark auf diese Fragen, weil sie verstehen wollen, wie sich ein scheinbar »normaler« Jugendlicher in einen Mörder verwandelt. Dabei geraten die Opfer oft in den Hintergrund, da sie nicht in dieses Narrativ der Täteranalyse passen. Besonders in Fällen, in denen der Täter in Online-Foren aktiv war oder ein »Manifest« hinterlassen hat, beschäftigen sich Journalisten und Experten eher mit seinen Motiven, anstatt die Stimmen der Opfer in den Vordergrund zu rücken.
Zweitens herrscht die Tendenz vor, jugendliche Terroristen als »Opfer« von Umständen wie sozialer Isolation, psychischen Problemen oder gesellschaftlicher Vernachlässigung darzustellen. Besonders wenn es sich um junge Täter handelt, werden häufig Fragen nach ihrer schwierigen Kindheit, Mobbing-Erfahrungen oder fehlender Perspektive gestellt. Dadurch entsteht eine gefährliche Verschiebung der Perspektive: Der Täter wird zum »tragischen Produkt« der Gesellschaft stilisiert, während die Opfer unsichtbar bleiben. Wenn es auch wichtig ist, die Ursachen von Radikalisierung zu analysieren, darf dies nicht auf Kosten der eigentlichen Opfer geschehen. Besonders einsame, sozial isolierte oder gemobbte Jugendliche können in extremistischen Gruppen Anerkennung finden. Diese Gemeinschaften geben ihnen das Gefühl, endlich gesehen und verstanden zu werden – doch oft geschieht dies auf Kosten der Verachtung und Abwertung anderer.
Drittens lautet die Medienlogik: Sensationslust statt Empathie. Medien neigen dazu, Geschichten zu erzählen, die Schock, Drama und Aufmerksamkeit erregen.[16] Ein »normaler« Jugendlicher, der zum Terroristen wird, verkauft sich besser als die tragischen Geschichten der Opfer. Täter werden mit Fotos, Hintergrundanalysen und persönlichen Details dargestellt, während Opfer oft nur als »Zahl« oder als kurze Erwähnung im Bericht erscheinen. In vielen Fällen wird ihr Leid erst dann thematisiert, wenn Angehörige oder Überlebende selbst aktiv ihre Stimme erheben. Doch oft ist der Schaden dann bereits angerichtet: Der Täter hat die Schlagzeilen dominiert, während das eigentliche menschliche Leid in den Hintergrund gerückt ist.
Die mediale Fokussierung auf den Täter verstärkt dann zusätzlich noch die digitale Glorifizierung, denn in Online-Communitys, besonders in rechtsextremen und nihilistischen Netzwerken, werden jugendliche Terroristen oft als Helden oder Märtyrer stilisiert. Diesem Mechanismus will dieses Buch keinesfalls Vorschub leisten. Die Trauer um die Opfer, deren Leben willkürlich und abrupt ausgelöscht wurde, war eine Motivation, es zu schreiben.[17]
Historische Herleitung und geopolitische Einordnung
Terrorismus war nie statisch, nie eine Konstante – er hat sich immer angepasst, weiterentwickelt, neu erfunden. In der antiken griechischen Welt gab es Fälle von jungen Attentätern, die aus politischer Überzeugung handelten. Das berühmteste Beispiel ist der Mord an Hipparchos, einem athenischen Tyrannen, im Jahr 514 v. Chr. durch Harmodios und Aristogeiton. Auch wenn diese Männer keine »Teenager« im modernen Sinne waren, handelte es sich um junge Erwachsene, die aus ideologischer und persönlicher Motivation Gewalt ausübten.
Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, einen Blick auf die Geschichte des Terrors zu werfen. Der Begriff »Terror« stammt aus der Französischen Revolution bzw. der ihr nachfolgenden Schreckensherrschaft (»la grande terreur«) von 1793 bis 1794, symbolisiert durch das Instrument zur Vollstreckung der Todesstrafe, die Guillotine. Er bezog sich auf durchorganisierte und -orchestrierte staatliche Gewalt.[18] Bis heute schwingt das Bild mit, dass der Terror von einer gruppenförmigen Elite innerhalb einer Gesellschaft ausgeht, zumal sich viele Terrorbewegungen vom Glauben, dass ein radikaler Bruch in der Gesellschaft möglich sei, angezogen fühlten.
Totalitäre Regime haben Jugendliche schon immer systematisch als »Werkzeuge« für Gewalt, Terror und Unterdrückung missbraucht.[19] Durch Indoktrination, militärische Erziehung und sozialen Druck werden junge Menschen zu loyalen Anhängern geformt, die bereit sind, im Namen des Regimes zu töten, zu denunzieren oder sich an staatlich legitimierter Gewalt zu beteiligen. Besonders perfide ist, dass viele Jugendliche in diesen Strukturen bereits im Kindesalter durch Propaganda und Gruppenzwang radikalisiert werden, sodass sie ihre eigene Rolle als Täter oft gar nicht mehr hinterfragen.
In George Orwells Roman 1984 gibt es die »Spione« – eine Jugendorganisation, in der Kinder ihre eigenen Eltern ausspionieren und ans Regime verraten. Orwell zeigt hier, wie leicht junge Menschen durch Propaganda und Gruppenzwang manipulierbar sind, wenn sie in einem System aufwachsen, das ihnen Feindbilder liefert und Loyalität zur »Partei« über alles stellt.[20] Ähnliche Dynamiken lassen sich im realen Phänomen des Teenager-Terrorismus beobachten. Jugendliche, die in extremistische Gruppen abrutschen, sind oft auf der Suche nach Orientierung, Zugehörigkeit oder Bedeutung – Bedürfnisse, die solche Gruppen gezielt ausnutzen. Wie bei Orwells »Spionen« wird ihnen ein klares Feindbild vermittelt, gepaart mit dem Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Die Ideologie ersetzt persönliche Werte, der Gruppendruck verdrängt eigenes Urteilsvermögen. Die Mechanismen reichen von ideologischer Indoktrination über militärische Zwangsrekrutierung bis hin zu psychologischer Manipulation – sei es durch die Verheißung von Ruhm, durch Angst oder durch die Illusion von Macht und Bedeutung. So wird das Denken gelenkt, die Wut instrumentalisiert – und die Jugend zu einer Waffe gemacht, nicht selten gegen sich selbst.
Viele totalitäre Staaten setzen auf Jugendorganisationen, um junge Menschen systematisch an die Staatsideologie zu binden und sie für Gewalt oder militärische Zwecke verfügbar zu machen. In der Geschichte gibt es zahlreiche Beispiele, von der Hitlerjugend in der NS-Zeit bis zu den Kommunistischen Roten Garden in China während der Kulturrevolution, in denen Millionen Jugendliche zu fanatischen Vollstreckern der kommunistischen Säuberungen gemacht wurden. Diese Programme hatten oft das Ziel, eine neue Generation heranzuziehen, die kompromisslos an das Regime glaubte und bereit war, für dessen Ideale zu kämpfen – selbst wenn es Gewalt oder Terrorismus bedeutete.
Ein grausames Beispiel für die systematische Instrumentalisierung von Jugendlichen durch ein totalitäres Regime ist Kambodscha unter der Herrschaft der Roten Khmer (1975–1979).[21] Pol Pot und die Führung der Roten Khmer rekrutierten junge, ungebildete Bauernkinder, denen sie ein radikales Klassenbewusstsein einimpften und sie dazu brachten, jeden zu verfolgen, der als »Feind der Revolution« galt – darunter Lehrer, Intellektuelle und selbst ihre eigenen Familienmitglieder. Sie wurden in Umerziehungslagern indoktriniert und emotional abgestumpft und entwickelten sich zu Kämpfern, Gefängniswärtern, Folterern und brutalen Vollstreckern, die in Einrichtungen wie dem berüchtigten Foltergefängnis Tuol Sleng (S21) arbeiteten und dort Tausende von Menschen grausam ermordeten. Ihre Loyalität galt einzig der Ideologie der Roten Khmer – eines Regimes, das in nur vier Jahren schätzungsweise zwei Millionen Menschen durch Hinrichtungen, Zwangsarbeit und Hungersnöte sterben ließ. Der Missbrauch von Jugendlichen als fanatische Täter war ein strategischer Bestandteil der Machtsicherung des Regimes, denn sie waren formbar, brutal und hatten keine Erinnerung an ein anderes System als die blutige Herrschaft der Roten Khmer.