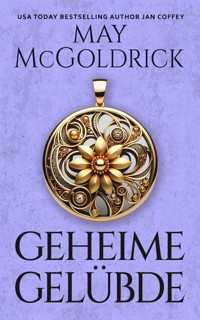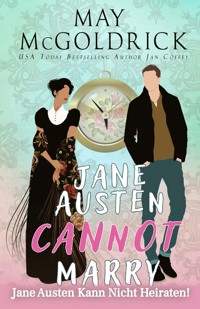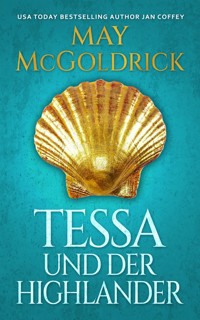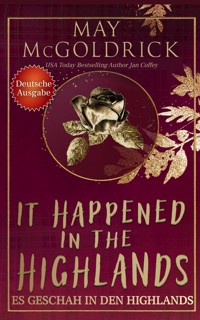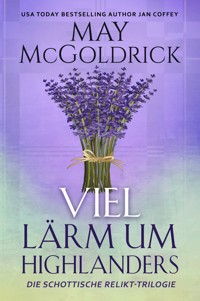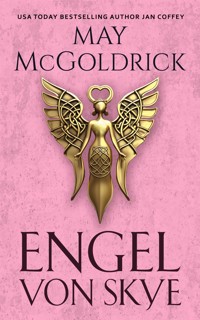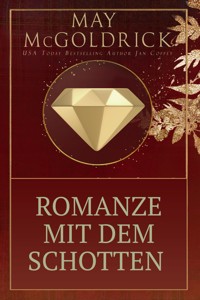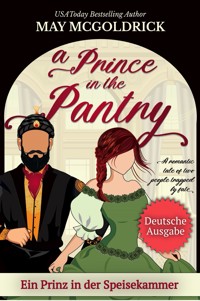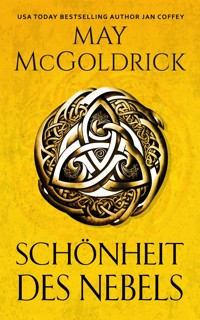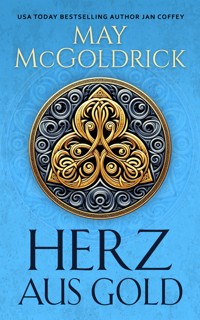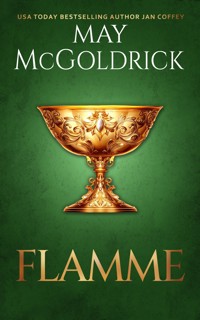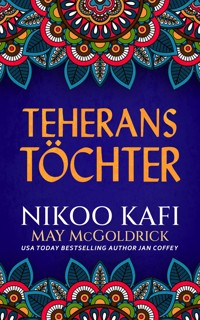
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen. Zwei Revolutionen. Ein Leben im Exil und in Sehnsucht. 1978 ist die siebzehnjährige Omid gezwungen, am Vorabend der islamischen Revolution aus dem Iran zu fliehen und eine Mutter zurückzulassen, die durch ihren Widerstand gegen das Regime zu einer gezeichneten Frau geworden ist. Als sie in Amerika ankommt, glaubt Omid, dass ihr Aufenthalt nur vorübergehend sein wird. Doch als ihre Mutter zur Flüchtigen erklärt wird, zerbricht ihr Traum von einer Rückkehr und sie muss sich ein Leben im Exil aufbauen – ein Leben, das geprägt ist von Verlust, Widerstandsfähigkeit und dem Nachhall einer Vergangenheit, der sie nicht entkommen kann. Drei Jahrzehnte später ist Omid eine Mutter, die ihre Töchter in Connecticut großzieht und versucht, die Erinnerungen an das Land, das sie einst Heimat nannte, zu verdrängen. Doch als ihre älteste Tochter Sayeh in Teheran inmitten einer neuen Protestwelle verhaftet wird, kollidieren Omids Vergangenheit und Gegenwart. Als Sayeh im Untergrund verschwindet, wird Omid in die gleiche Angst und den gleichen Trotz gestoßen, die einst ihre eigene Jugend prägten. "Teherans Töchter" erzählt die Geschichte zweier Generationen von Frauen, die durch Revolution und Exil miteinander verbunden sind, und ist eine kraftvolle Erzählung über Widerstand, Identität und die unverbrüchlichen Bande zwischen Müttern und Töchtern. Echos des Widerstands Der Preis der Freiheit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TEHERANS TÖCHTER
Tehran’s Daughters
NIKOO KAFI
withMAY MCGOLDRICK
withJAN COFFEY
Book Duo Creative
Urheberrecht
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben. Sollte Ihnen der Roman gefallen, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn in einer Online-Rezension weiterempfehlen.
Teherans Töchter (Tehran’s Daughters) © 2009. Nikoo Kafi und James A. McGoldrick.
Deutsche Übersetzung ©2024 von Nikoo und James McGoldrick
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen elektronischen oder mechanischen Mitteln, einschließlich Informationsspeicher- und –abrufsystemen, ohne schriftliche Genehmigung des Autors vervielfältigt werden, mit Ausnahme der Verwendung kurzer Zitate in einer Buchbesprechung.
KEINE KI-TRAINING: Ohne die ausschließlichen Rechte des Autors [und des Verlags] gemäß dem Urheberrecht in irgendeiner Weise einzuschränken, ist jede Verwendung dieser Veröffentlichung zum „Trainieren“ generativer künstlicher Intelligenz (KI)-Technologien zur Generierung von Texten ausdrücklich untersagt. Der Autor behält sich alle Rechte vor, die Nutzung dieses Werks für das Training generativer KI und die Entwicklung von Sprachmodellen für maschinelles Lernen zu lizenzieren.
Ursprünglich veröffentlicht als Omids Schatten.
Inhalt
Buch 1
Hafiz
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Buch 2
Hafiz
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Anmerkung der Autorin
Über den Autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
Buch 1
Wir sind nicht hierhergekommen, um Gefangene zu machen,
sondern um uns immer tiefer hinzugeben
der Freiheit und der Freude.
Wir sind nicht in diese exquisite Welt gekommen,
um uns selbst als Geiseln der Liebe zu halten.
Lauf, mein Lieber,
vor allem lauf weg von allem,
was deine kostbaren, sich entfaltenden Flügel
nicht stärken könnte.
Lauf wie der Teufel, mein Lieber,
von jedem, der beabsichtigt,
ein scharfes Messer
in die heilige, zarte Vision
deines schönen Herzens zu stechen.
Denn wir sind nicht hierhergekommen, um Gefangene zu machen
oder um unsere wundersamen Geister einzusperren,
sondern um immer und immer tiefer zu erfahren
unseren göttlichen Mut, unsere Freiheit und unser Licht!
- Hafiz
KapitelEins
Teheran, Iran
Dezember 1978
Ich war siebzehn, und ich brach das Gesetz. Wissentlich.
Die Einfachverglasung in den hohen Fenstern des alten Highschool-Gebäudes schepperte vom schrillen Klang der Glocke. Das metallische Läuten schallte durch die leeren Flure und störte die Andacht in den überfüllten Klassenzimmern, indem es die Dutzenden von Mädchen, die sich in jedem Raum drängten, in Aufregung versetzte.
Ich knallte meine Bücher zu und stopfte sie schnell in meine Tasche. Das Stimmengewirr übertönte die Rufe unserer Naturwissenschaftslehrerin, die versuchte, letzte Anweisungen für unsere Laborberichte zu geben. Ich schnappte mir meine Tasche und meine Jacke und suchte nach meinen drei Freundinnen. Sie standen bereits an der Tür.
„Omid“, hielt mich unsere Lehrerin zurück.
Ich sah, wie sie einen Artikel aus einer Fachzeitschrift in der Hand hielt, den sie mir zu kopieren versprochen hatte.
„Farda. Merci“, rief ich zurück. Morgen ist früh genug. Ich konnte mich nicht ablenken lassen. Nicht jetzt.
Selbst als ich mich zum Gehen wandte, protestierten meine Gelenke gegen die Bewegung. Mein Körper zitterte. Ich führte es auf die Aufregung zurück. Wir waren dabei, das Gesetz zu brechen. Die Konsequenzen, wenn wir erwischt würden, könnten katastrophal sein. Aber das spielte keine Rolle. Wir kämpften für das Allgemeinwohl.
Meine Freundinnen warteten auf mich und ich rannte an ihnen vorbei, als erste in den Flur des zweiten Stocks hinaus. Just als ich das tat, blieb die Glocke abrupt stehen. Noch bevor ihr Echo verklingen konnte, füllten sich die leeren Flure mit Mädchen, die aus ihren Klassenzimmern strömten. Wir vier tauschten ein Nicken aus, bevor wir uns zerstreuten.
Jede von uns hatte einen Stapel Flugblätter dabei. Wir hatten unseren Ablauf geprobt. Wir wussten, wie viele andere Schüler uns helfen und an welchem Ort in der Schule sie uns treffen würden. Wir hatten das weitläufige Areal der Marjan High School und das Gelände unter all denen aufgeteilt, die bereit … und mutig genug … waren für die Freiheit zu arbeiten.
Die Schüler drängten sich in der Halle. Die meisten der Mädchen aus unserer Klasse hatten bereits die Flugblätter, die wir verteilten. Die anderen mussten nicht lange animiert werden, um einige zu nehmen.
Das zweiseitige Flugblatt war vollgepackt mit Informationen. Termine der Demonstrationen. Zeit und Ort für die Anreise. Hinweise darauf, wer wir waren, wofür wir eintraten und was während des Marsches gesungen werden sollte. Es enthielt Angaben zum Kriegsrecht, das seit September über die Stadt Teheran verhängt worden war. Die Rückseite war mit Informationen der vom Schah-Regime begangenen Gräueltaten versehen. Die Verbrechen, die die verhasste SAVAK – die von der CIA ausgebildete Geheimpolizei des Schahs – in ihren versteckten Gefängnissen verübte. Wir sprachen darüber, warum es für uns, die Gymnasiasten, so wichtig war, uns den anderen anzuschließen und unsere Stimme zu erheben.
Eine Klassenzimmertür zu meiner Linken öffnete sich, aber bevor jemand heraustreten konnte, zog die Lehrerin sie wieder zu. Sie brüllte Anweisungen in das Getümmel hinein.
Der morgige Marsch würde um 7:00 Uhr beginnen, bevor der morgendliche Pendlerverkehr einsetzt. Letzte Woche hatten 40.000 Studenten eine Kundgebung abgehalten. Diese Woche schlossen wir uns ihnen an, was mit Sicherheit zu einer viel größeren Beteiligung führen würde. Wir würden die Stadt lahmlegen.
Mit Verspätung öffnete sich eine weitere Klassenzimmertür und die Schüler strömten heraus. Die ersten fünf Mädchen nahmen mir ohne jede Aufforderung Flugblätter aus der Hand. In diesem Flügel im zweiten Stock, in dem ich stand, waren die Zwölftklässler untergebracht. Die marineblau gekleideten Mädchen strömten in den Flur wie Käfer, die ein Nest unter einem umgestürzten Felsen verlassen. Der Lärm im überfüllten Korridor war jetzt lauter als die Glocke gewesen war. Ich klemmte meine Tasche zwischen meine Füße und kämpfte gegen den Ansturm der Menschen an.
Ich war ein selbst ernanntes Mitglied der Rebellengruppe Fedayeen-e-Khalq und damit der Anführer der Schule. Meine drei Freundinnen und ich hatten vier Monate zuvor, zu Beginn unseres Abschlussjahres, eine Ortsgruppe an der Highschool gegründet. Jede von uns hatte ihre eigenen Gründe und Motive, sich zu engagieren. Aber wir hatten alle ein gemeinsames Ziel vor Augen.
Ich verteilte drei weitere Flugblätter.
„Farda sobh.“ Morgen früh, sagte ich jedem Mädchen. „Geloyeg madresseh.“ Vor der Schule.
Meine Freunde und ich wollten Redefreiheit, Meinungsfreiheit, die Freiheit, Führer zu wählen, denen die Interessen des iranischen Volkes am Herzen liegen. Wir wollten der blutigen Diktatur, die unser Land beherrschte, ein Ende setzen.
Wir wollten Veränderung.
Meine beste Freundin Roya hatte leider den persönlichsten Grund, sich für Veränderungen einzusetzen. Ihr Bruder war ein politischer Gefangener. Er war die letzten sechs Jahre im Evin-Gefängnis im Nordwesten Teherans eingesperrt gewesen. Wir hatten schon so viele Geschichten über diesen Ort gehört. Horrorgeschichten. Selbst wenn jemand das Glück hatte, aus dem Evin-Gefängnis herauszukommen, war er nicht mehr derselbe.
Auch unsere Freundin Neda hatte Grund, den Schah zu hassen. Sie war die Cousine eines berühmten linken Dichters, der eines Tages vor über einem Jahrzehnt aus seinem Haus verschwunden war … und nie wieder gesehen wurde. Es wurde geflüstert, dass SAVAK für sein Verschwinden verantwortlich war. Keiner zweifelte daran. Neda hatte sogar denselben Nachnamen wie der Dichter, und es war immer noch ein Name, der für Protest stand. Neda sah es als ihre Berufung, als ihre erbliche Bestimmung an, sich an diesem Kampf zu beteiligen.
Und Maryam war beteiligt, weil wir anderen es auch waren. Sie wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren und genoss die Vorzüge, die zum inneren Kreis der wenigen Privilegierten gehörten. Sie kannte niemanden, der wegen seiner intellektuellen Ansichten gelitten hatte oder inhaftiert worden war. Dennoch schloss sie sich unserem Kampf an und genoss deshalb den Respekt von uns allen.
Ich war in all das verwickelt, weil ich mit offenen Augen aufgewachsen war. Meine Mutter ließ nicht zu, dass ich ein behütetes Leben führte. Ich wurde ermutigt, den Diskussionen zuzuhören, die Azar mit den anderen Intellektuellen und Aktivisten führte, die sie nach Hause brachte. Streitereien über den Schah, das Land, Gott. Sie hatte zu allem eine starke Meinung. In ihren Armen sah ich mir die geschmuggelten Filme an, die im Iran nicht legal gezeigt werden durften. Ich hörte die Geschichten der Geflüchteten und der Enteigneten.
Und so wurde ich zur Abtrünnigen. Ich habe mich nie angepasst. Ich stellte das Leben und die Regeln in Frage, von denen ich glaubte, dass sie von den Verantwortlichen willkürlich aufgestellt wurden, von Männern, die nichts anderes im Sinn hatten, als sich zu bereichern und ihre eigenen Interessen zu schützen. In der Schule habe ich häufig die Autorität infrage gestellt und bin deswegen in Schwierigkeiten geraten. Aber ich habe mir meine Momente ausgesucht. Ich war nicht ständig feindselig und auch nicht mit jedem. Meine Mutter hat immer gesagt, das sei mein Glück gewesen.
Mit dem Pahlavi-Regime nicht einverstanden zu sein, war für mich so natürlich wie die Luft, die ich atmete, und das Wasser, das ich trank. Ich war mit meiner Mutter durch das Land gereist, in den Süden nach Abadan und in den Norden nach Mashhad. Ich hatte hungernde Kinder gesehen, die in den unzähligen verfallenen Steindörfern mittendrin um Essen bettelten. Ich war durch die schmutzigen Straßen im Süden von Teheran gelaufen, durch die ärmsten Viertel der Stadt. Der Geruch von Haschisch und Müll hing in der Luft und zerlumpte Kinder saßen mit alten Männern im Schatten verfallener Gebäude auf staubigen Straßen. Dies waren Orte, an denen die Menschen nicht einmal mehr von fließendem Wasser oder einer anständigen Schule träumten.
Und ich war auch in den Straßencafés in Shermoon, im Norden von Teheran, gewesen, wo Wohlstand in der Luft hing und nach Chanel, Givenchy und Gauloises duftete. Hier wurden Reichtum und Komfort durch die glitzernden Geschäfte und die schönen Menschen, die sie frequentierten, definiert. Und in den von Bäumen gesäumten Straßen und Vierteln im Norden Teherans standen die Häuser der Reichen hinter hohen Mauern, erbaut aus Stein und Mörtel und dem Blut der Massen.
Meine Wut über die Ungerechtigkeiten um mich herum war im vergangenen Sommer nach einer Entdeckung meiner Freundin Roya hochgekocht. Meine Mutter, Azar Parham, Geschichtsprofessorin an der Universität Teheran, war vor acht Jahren ein Gründungsmitglied der Fedayeen-e-Khalq an der Universität gewesen. Diese Entdeckung rückte mein ganzes Leben in den Mittelpunkt. In diesem einen Moment lösten sich Dutzende von Fragen, auf die ich nie eine Antwort finden konnte, in Luft auf.
Ich verstand mein Leben, ihr Leben und den Respekt, den ihre Studenten und die anderen Dozenten ihr entgegenbrachten. Im Handumdrehen wusste ich, warum sie mich so sein ließ, wie ich war – rechthaberisch und eigensinnig. Jetzt verstand ich auch, warum Azar ihre Kurse außerhalb der Universität abhielt und warum alle ihre Studenten sie weiterhin besuchten. Die Art und Weise, wie sie sie behandelten, hatte etwas Bewunderndes an sich, ganz anders als das, was ich für meine Lehrer empfand.
Ich hatte immer gewusst, dass sie klug, ja sogar brillant war. Sie war eine der ersten Frauen, die von der Universität Teheran einen Doktortitel erhalten hatten. Und mit dieser Bezeichnung ging eine gewisse Autorität einher. Aber die Aufmerksamkeit, die sie auf sich zog, war auf einer anderen Ebene angesiedelt, und ich konnte sie bis jetzt nicht verstehen.
Ich verstand jetzt auch besser den Grund für die Entfremdung, die zwischen meiner Mutter und meinen Großeltern bestand. Sie war eine alleinerziehende Mutter und eine Freidenkerin. Sie waren Muslime, so gläubig, dass sie eine Hadsch-Pilgerreise nach Mekka gemacht hatten. Sie starrten einander über einen gähnenden Abgrund hinweg an.
Ich wusste, dass wir Familie hatten; Azar war die jüngste von drei Schwestern. Alle anderen in unserer Familie lebten in Isfahan, und doch waren wir nie dort. Wir wurden nie zu Hochzeiten eingeladen. Wir gingen nicht zu Beerdigungen. Norooz, das persische Neujahrsfest, wurde nur von uns beiden gefeiert. Meine Mutter tauschte Nachrichten über die Familie aus, indem sie gelegentlich mit ihren Schwestern telefonierte.
Azar war der Meinung, dass die islamischen Kleriker zu ihren Lebzeiten immer reaktionärer geworden waren. Sie benutzten den Islam nicht so, wie er gedacht war, sondern in einer Weise, die an das Mittelalter erinnerte, als Mittel zur Kontrolle der Gläubigen. Sie war von traditionellen islamischen Eltern erzogen worden und hatte dennoch immer ihre eigene Meinung vertreten.
Als sie in den 1950er Jahren aufwuchs, kannte sie das empfindliche Gleichgewicht, das Reza Schah, der Vater des jetzigen Königs, zwischen den Kräften der Verwestlichung und den islamischen Traditionen, die dem iranischen Volk nach den arabischen Invasionen vor etwa vierzehnhundert Jahren aufgezwungen worden waren, hergestellt hatte. Azar akzeptierte dieses Gleichgewicht, da sie wusste, dass jeder Einzelne den Lebensstil wählen konnte, der ihm passte. Was sie jetzt wollte, war Demokratie, um die Korruption zu ersetzen, die die Monarchie zu durchdringen schien wie das verrottete Gebälk eines alten Hauses. Sie wollte eine Revolution für das iranische Volk.
Als ich diese Dinge erfuhr, stieg meine Meinung über sie sprunghaft an. Sie wusste nicht, dass ich es wusste. Sie hatte keine Ahnung, dass ich seit jenem Sommertag viele der Artikel, die sie geschrieben hatte, recherchiert und gefunden hatte. Ich hatte Abschriften der zahlreichen öffentlichen Reden gefunden, die sie gehalten hatte. In unserem eigenen Haus waren Akten über Akten verborgen. Sie war eine Lehrerin. Kisten voller Papiere und mit Büchern gefüllte Regale waren Teil ihrer Existenz … Teil unserer Existenz. Ich stöberte in ihrer Arbeit und suchte nach den verborgenen Schätzen des Wissens. Ich fand die Revolution zwischen den Zeilen. Ich entdeckte die Wurzeln ihrer Überzeugungen und wusste irgendwie, dass ich ein lebendiger Zweig war. Das Lesen ihrer Worte half mir, meine eigenen zu formulieren.
Und es war komisch, dass Azar bei all dem, mit all ihrer Intelligenz keine Ahnung hatte, warum ich nach Jahren der Rebellion und des ständigen Streits nun mit großen Augen zu ihr aufblickte und sie bewunderte.
Sie wusste auch nicht, dass ich, anstatt den täglichen Konkoor-Kurs nach der Schule zu besuchen, um mich auf die nationale Universitätsprüfung vorzubereiten, Anti-Schah-Flugblätter verteilte, Versammlungen abhielt und am Entwurf für unsere nächste Publikation arbeitete. Ich war eine Organisatorin, eine Führungspersönlichkeit in meinen eigenen Kreisen, hungrig danach, Veränderungen herbeizuführen … so wie sie daran arbeitete, Veränderungen herbeizuführen.
„Farda sobh.“ Morgen früh. Viele Mädchen nahmen das angebotene Papier an. Aber einige drückten sich mit der Schulter an die gegenüberliegende Wand, um mir auszuweichen. Sie nahmen keinen Blickkontakt auf.
Sie waren das Niedrigste vom Niedrigen. Die meisten von ihnen waren Schüler, die von ihren Vätern oder Brüdern zur Schule begleitet wurden. Heuchler. Sie trugen den Hadschab, wenn sie mit diesen Männern unterwegs waren, aber sobald sie die Schule betraten, rannten sie zur Toilette, legten ihre Kopfbedeckung ab und schminkten sich so dick wie möglich. Einige von ihnen nahmen sogar mittags das Kopftuch ab und verbrachten den Nachmittag mit ihren Freunden. Ich sah, wie sie bei Schulschluss in die Menge der Schüler zurückschlüpften, die Gesichter sauber geputzt und die Haare ordentlich bedeckt. Sie taten so, als wären sie so fügsam und pflichtbewusst und anständig vor den Männern ihrer Familien.
Es verging jedoch keine Woche, in der nicht die Nachricht von der „Fehlgeburt“ einer von ihnen auf der Toilette durch das Gebäude schallte.
Ich hatte gehört, wie diese Mädchen sagten, dass unsere Gedanken wie gormeh sabzi rochen, der scharfe grüne Eintopf, der in jedem persischen Haushalt serviert wird. Sie meinten damit, dass wir unsere Gedanken und Handlungen nicht verbergen konnten. Es spielte keine Rolle, was wir sagten oder taten. Für sie waren wir gefährlich, weil wir so dachten. Wir waren offen kritisch gegenüber der Autorität. Schlimmer noch, sie hielten uns für Kommunisten. Die Veränderungen, die wir anstrebten, so dachten sie, würden ihnen alles wegnehmen, was sie schätzten. Geld, Jungs und ihren muslimischen Glauben. Zumindest den Islam, wie sie ihn gerne praktizierten.
Ich verzieh ihnen ihre Ignoranz. Ich glaubte, dass sie wie Schafe zu unserer Denkweise getrieben werden würden, sobald wir unsere Schlacht gewonnen hätten. Sie waren keine Anführer, sondern Mitläufer. Und ich begrüßte die Herausforderung, diesen Frauen eines Tages den Wert des unabhängigen Denkens beizubringen. Die Kraft der Freiheit. Ich sehnte den Tag herbei, an dem dieselben Menschen ihre Gleichstellung mit den Männern in der Gesellschaft erkennen und schätzen würden.
Ein weiteres Flugblatt. „Geloye madresseh“. Vor der Schule.
Mit Freude stellte ich fest, dass die Zahl der Schüler, die die Flugblätter mitnahmen, im letzten Monat erheblich zugenommen hatte. Der Wandel lag in der Luft, er war ansteckend. Die Angst, erwischt zu werden, wurde von dem Adrenalin überwältigt, das durch unsere Körper strömte. Wir wurden alle von den elektrischen Strömen des Wandels mitgerissen.
Ich holte einen weiteren Stapel Flugblätter aus meinem Rucksack, als Maryam mir von der nächsten Gangkreuzung aus zuwinkte, dass ihr das Material ausgegangen sei. Unsere Naturwissenschaftslehrerin verließ die Klasse und schloss die Tür hinter sich ab.
„Khanoom Habadi“, rief ich und winkte mit einem Flugblatt in ihre Richtung. Sie verdrehte die Augen, schüttelte den Kopf und berührte ihren schwellenden Bauch. Wir alle wussten, dass ihr erstes Kind noch vor dem persischen Neujahr im März erwartet wurde. Sie war eine der Guten, was uns betraf. Obwohl sie sich unserem Kampf nicht anschloss, verurteilte sie ihn auch nicht. Und wir verstanden, dass sie viel verletzlicher war als jeder von uns.
Bei mir persönlich hatte sie einen Stein im Brett. Aufgrund ihrer ständigen Ermutigung hatte ich die Anzahl der naturwissenschaftlichen Kurse, die ich belegt hatte, verdoppelt. Sie wollte, dass ich eine Karriere als Ingenieur anstrebte – etwas, worüber ich immer mehr nachdachte.
Es waren nur noch wenige Schüler auf dem Flur. Ich sah Maryam mit leeren Händen auf mich zugehen. Hinter ihr tauchte Neda aus dem Treppenhaus auf. Die Panik in ihrem Gesicht ließ uns beide erstarren.
„Sie sind hier“, rief sie.
Diese Aussage beendete meine friedlichen Tagträume über Babys und Technik. Die Papiere glitten durch meine Finger und breiteten sich zu meinen Füßen aus. Sofort ging ich in die Hocke, um sie einzusammeln. Sie und Maryam erreichten mich im Handumdrehen. Gemeinsam sammelten wir die losen Zettel ein, während Neda uns aufklärte.
„Ein Armeelaster steht am hinteren Tor der Schule, ein weiterer vor dem Haupteingang. Ein Dutzend Soldaten hat sich auf der Straße verteilt. Sie sind bewaffnet und haben an den Toren Kontrollpunkte eingerichtet. Jeder wird befragt, bevor er die Schule verlässt.“ Sie senkt ihre Stimme. „SAVAK-Agenten sind auch hier.“
Die Erwähnung der Geheimpolizei des Schahs auf dem Campus bedeutete eine Katastrophe. Ich merkte, dass meine Hände zitterten, als ich mit den Papieren in meinen Armen aufstand. Ich stopfte die Flugblätter in meinen Rucksack, zusammen mit ein paar hundert anderen, die schon darin waren.
„Was sollen wir tun?“, fragte Maryam. Ihr Gesicht war aschfahl.
Ich führte die anderen zu dem Fenster mit Blick auf das Eingangstor. Die Schüler standen Schlange und versuchten, hinauszukommen. Die Soldaten öffneten einige Schultaschen und ich konnte sehen, wie die gerade von uns verteilten Flugblätter auf dem Schulhof lagen, wo die Mädchen sie hingeworfen hatten. Die Busse warteten und auf der Straße dahinter kam der Verkehr zum Stillstand. Ich blickte in die Gesichter zweier mit Gewehren bewaffneter Soldaten, die beim ersten Bus standen. Sie konnten nicht mehr als ein Jahr älter sein als wir.
Die Informationen, die ich auf die Rückseite der Flugblätter getippt hatte, waren plötzlich Realität. Jeden Tag wurden Studenten verhaftet. Sie verschwanden einfach. Es gab keinen Richter und keine Geschworenen, keinen Prozess für die Verhafteten. Keine Gesetze schützten die Angeklagten. Die Familien erhielten keine Nachricht. Die Verhafteten wurden in das Evin-Gefängnis gebracht, wo Frauen und Männer gefoltert wurden, damit sie gestanden oder die Namen anderer Personen nannten, damit sie verhaftet werden konnten.
Kalte Stacheln der Angst durchbohrten meine Wirbelsäule. Ich spürte Maryams Hände, die meinen Arm umklammerten. Wir zitterten alle.
„Ihr Mädchen“, sagte Khanoom Habadi scharf hinter uns. „Kommt mit mir.“
Die Lehrerin für Naturwissenschaften schaute hinter uns aus dem Fenster. Bis zu diesem Moment hatte ich nicht bemerkt, dass die junge Lehrkraft zurückgekehrt war. Mit ängstlichen Blicken folgten wir ihr zurück zum Klassenzimmer, wo sie die Tür aufschloss und uns alle hineinließ.
Das große Klassenzimmer diente gleichzeitig als Chemie- und Physiklabor. Sie führte uns zu einem überdimensionalen Waschbecken an der Seite des Raumes und forderte uns auf, alle Flugblätter, die wir noch hatten, hineinzulegen. Wir taten, wie uns gesagt wurde. Sie half mir, meinen Rucksack zu durchsuchen, um sicherzugehen, dass keine mehr darin waren. Auch die, die in den Schulbüchern steckten, wurden herausgezogen und zu den anderen gelegt.
Als wir alle in das Waschbecken befördert hatten, entzündete sie ein Streichholz an den Papieren.
Ich schaute entsetzt auf den Rauch, aber Khanoom Habadi schaltete ungerührt die Ventilatoren für die Abluftöffnungen über der nahen Reihe von Brennern ein.
„Öffne die Fenster halb“, befahl sie.
Ich beeilte mich, zu tun, was mir gesagt wurde. Der beißende Geruch des Rauches brannte mir in der Nase, aber die kalte Luft, die hereinströmte, brachte mich mit einem Schlag zurück in die Realität der Gefahr, in der wir uns befanden. Mit dem Versuch dieser Frau, uns zu helfen, wurden uns die möglichen Folgen unseres Handelns noch deutlicher vor Augen geführt. Unser Leichtsinn gefährdete sowohl sie als auch ihr Baby. Ich schaute über meine Schulter. Da war immer noch Rauch im Raum, aber die junge Lehrerin wirkte ruhig, als sie in den Papierbündeln herumstocherte und dann Neda anwies, die Abluftventilatoren auf die höchste Stufe zu stellen.
„Ihr seid länger geblieben und habt mit mir ein Chemieexperiment zu Ende gebracht“, sagte Frau Habadi zu uns allen.
Ich sah mich um und bemerkte, dass Roya nicht bei uns war. Sie hatte unten Flugblätter verteilt.
„Roya“, flüsterte ich ihren Namen laut.
Sie durfte nicht erwischt werden. Letzten Freitag waren wir bei ihr zu Hause zum Mittagessen gewesen. Ihre Mutter war jünger als meine, aber die Last der Trauer um ihren inhaftierten Sohn hatte sie so gebrechlich gemacht, dass sie doppelt so alt aussah wie Azar. Ihre Familie hatte schon so viel gelitten. Mit Royas Nachnamen und der Vorgeschichte ihres Bruders würde das ausreichen, um sie für schuldig zu erklären.
Ich rannte zur Tür. Die Naturwissenschaftslehrerin rief mir nach. Erst an der Tür drehte ich mich zu ihnen um. Meine beiden Freundinnen standen bei ihr, die Augen weit aufgerissen und starr auf mich gerichtet.
„Ich bin gleich wieder da“, log ich.
KapitelZwei
Die Flure waren leer, und das Treppenhaus hatte das Echo eines Mausoleums, als ich zwei Stufen auf einmal nehmend hinunterrannte. Unten angekommen, drängte ich mich durch die Tür, die zu dem Flur führte, von dem ich wusste, dass Roya dort sein sollte. Die schwere Tür prallte mit einem lauten Knall gegen ihre Feder und schwang zu mir zurück.
Dieser Korridor führte zum Haupteingang der Schule. Zusätzlich zu den doppelten Reihen von Glastüren, die den Weg draußen freigaben, führten drei separate Flure, zwei Treppenhäuser und eine Reihe von Verwaltungsbüros in die geräumige Eingangshalle.
Zwei Personen standen an der Tür zum Hauptbüro. Frau Elahi, die Schulleiterin, sprach mit einem Mann mittleren Alters, der einen dunkelgrauen Anzug mit Krawatte trug. Er hatte nichts Auffälliges an sich, außer einer Hasenscharte und einem Blick, der sich auf mich richtete, sobald ich die Eingangshalle betrat. Als es an der Tür klopfte, blickte auch Frau Elahi in meine Richtung. Der Mann starrte mich weiter an. Ich verlangsamte meine Schritte und versuchte, ruhig zu wirken, als ob nichts geschehen wäre. Mein Herz pochte jedoch in meiner Brust, und ich spürte, wie sich die Angst wie Eiswasser in meinem Körper ausbreitete.
Zwei Lehrer standen an den Glastüren, die aus dem Gebäude führten. Ich konnte einige der Militäruniformen und die Menge der Schüler erkennen, die sich immer noch auf die Tore zubewegte.
Vielleicht hat sich Roya unter die anderen Schüler gemischt und versucht zu entkommen. Ich hoffte so sehr, dass sie genau das getan hatte. Mit einem Nicken zu Frau Elahi ging ich auf die beiden Lehrer zu. Beide kannten mich, und einer von ihnen war im Jahr zuvor mein Mathelehrer gewesen.
„Was ist denn los?“, fragte ich sie leise, als ich zu ihnen trat. „Warum ist die Polizei hier?“
„Nicht die Polizei“, sagte einer von ihnen leise und deutete auf den grauen Anzug mit Frau Elahi. „SAVAK.“
Mein Herz sank. Es stimmte. Ich wusste genug über SAVAK, um ihre Anwesenheit mit dem endgültigen Untergang von allem gleichzusetzen, was wir zu tun versuchten. SAVAK wusste alles, früher oder später.
„Was wollen sie?“ schaffte ich es zu fragen.
„Ich glaube, sie haben bereits … äh, die Person, hinter der sie her sind“, flüsterte der andere Lehrer. „Deshalb lassen sie die Schüler jetzt endlich gehen.“
„Roya …“, flüsterte ich bestürzt. Die beiden sahen mich an.
Sie hatten Roya abgeholt. Ich tat es nicht bewusst, aber ich ertappte mich dabei, wie ich mich in Richtung des Hauptbüros bewegte. Wie ein Roboter bewegte ich mechanisch einen Fuß und dann den anderen. Meine Gedanken rasten, während ich versuchte, mir Szenarien auszudenken, die meine Mutter nicht in diese Sache hineinziehen würden. Sie würde natürlich auch in Gefahr sein. Aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Die Agenten würden unser Haus durchsuchen. Wenn ich in der Lage war, die Beweise für ihren Aktivismus zu finden, würden sie es auch sein.
Aber dann war da noch Roya. Meine beste Freundin seit der ersten Klasse. Sie konnte die Verantwortung für unser Handeln nicht allein tragen. Sie war eine Mitläuferin, die ich geführt hatte. Ich hatte den Anstoß gegeben, der die Flammen ihrer Rebellion angefacht hatte. Ich war der Wind gewesen, der das Feuer verbreitet hatte. Ich konnte sie diesen Weg nicht allein gehen lassen. Ich würde mich selbst aufgeben und ihnen sagen, dass sie mir nur einen Gefallen getan hatte.
Mein Körper bewegte sich aus eigenem Antrieb auf den SAVAK-Agenten und die Schulleiterin zu.
Frau Elahis Blick war auf den Mann gerichtet, aber ich wusste, dass sie mich beobachtete, als ich näher kam. Der SAVAK-Agent stand jetzt mit dem Rücken zu mir und schaute in das Büro, während er mit der Direktorin sprach.
Während meiner Zeit an dieser Highschool hatte ich manchmal Angst vor dieser Frau gehabt. Sie brauchte keine eiserne Faust, um für Disziplin zu sorgen. Ihr missbilligender Blick reichte aus, um jedem der Mädchen, das ihre Schule besuchten, Angst einzuflößen. Ich sah, wie ihr Gesicht blass wurde, als ich mich näherte. Sie war diejenige, die ängstlich aussah.
„Ihr habt die falsche Person“, sagte ich, als ich sie erreichte.
Er wirbelte herum und sah mir direkt in die Augen. Als er das tat, spürte ich, wie mir das Blut in den Adern gefror. Sein dunkler Blick enthielt Albträume, Ängste, die alles übertrafen, was ich mir je hätte vorstellen oder auf einem unserer Flugblätter hätte notieren können. Es war der Blick der Toten. Ich spürte, wie mein Kinn zu zittern begann. Meine Zunge schwoll unter meinem Gaumen an, und ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch Luft in meine Lungen bekommen würde.
„Was hast du gesagt?“, fragte er. Seine Stimme war tief und hart, und das schwache Lispeln tat nichts, um die Wirkung abzuschwächen.
Ich öffnete meinen Mund, um zu wiederholen, was ich gesagt hatte. Ich schuldete Roya meine Loyalität, egal was passierte, aber es kam kein Ton heraus.
„Oh, nein“, sagte Frau Elahi schroff. „Ich habe die richtige Person. Aber jetzt habe ich auch ihre Komplizin.“
Ich hatte meine Direktorin noch nie so wütend gesehen. Sie zitterte vor Wut, und der Agent wandte seinen Blick wieder zu ihr.
„Es tut mir leid, Mr. Fattah“, sagte sie, ohne den Blick von mir zu nehmen. „Diese junge Frau hat mit mir gesprochen und nicht mit Ihnen.“
Tränen stiegen mir in die Augen. Ich schüttelte den Kopf und sah sie an. Sie wusste, wie sehr Royas Familie gelitten hatte. Ich konnte das nicht zulassen.
„Ich … ich bin …“
„Sie werden in meinem Büro auf mich warten“, befahl sie.
Ich schüttelte den Kopf. Meine Füße waren auf dem Boden zementiert. Ich würde nie wieder den Mut aufbringen können, so etwas zu tun. Ich musste sie retten, solange ich noch konnte, bevor man sie mir wegnahm.
„Was hat sie getan?“, fragte der Agent. Er starrte mir ins Gesicht.
Ich konnte sehen, wie Frau Elahi kurz in Panik geriet, doch dann fasste sie sich und eine eisige Maske trat an ihre Stelle.
Sie hatte Angst, und ich musste ihr die Last abnehmen. Da war etwas, das ich getan hatte. Ich musste die Konsequenzen tragen. Ich griff in die Vordertasche meines Rocks und fand einen der gefalteten Zettel. Ich nahm ihn heraus und streckte meine Hand aus. Blitzschnell griff die Direktorin zu und schloss meine Hand in ihre eigene Faust.
„Sie hat geschummelt, ich schäme mich, das zu sagen. Dieses Mädchen, eine unserer besten Schülerinnen, hat mit einer Freundin bei einem Mathetest geschummelt.“
Frau Elahi zerrte mich zur Bürotür.
„Entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da.“
Ich war mindestens einen halben Kopf größer als die Direktorin, aber der Griff um meine Hand war schmerzhaft und ließ mir keine andere Wahl, als zu tun, was sie wollte. Ich warf einen Blick auf die beiden Lehrer, die immer noch in der Nähe der Tür standen und uns mit großen Augen anstarrten. Ich sagte mir, dass ich noch Zeit hatte, zu streiten. Ich hatte nicht vor, meine Freundin zu verraten.
Die beiden Rezeptionistinnen starrten über ihre Schreibtische hinweg, als wir durch die Tür stürmten. Keiner von beiden sagte etwas, als die Direktorin mich einen kurzen Korridor entlang zu ihrem Büro schob.
„Holen Sie ihre Mutter ans Telefon“, sagte Mrs. Elahi knapp über ihre Schulter, bevor sie mich durch die Tür schob.
Die Wände des Büros der Direktorin waren mit dunklem Holz getäfelt. Die Jalousien an den Fenstern waren zugezogen. Sie schob mich zu einem kleinen Sofa an der gegenüberliegenden Wand, aber ich setzte mich nicht. Ich war jedoch froh, mich aus ihrem Griff zu befreien. Ich drehte mich um, bereit zum Kampf, als sie die Tür mit so viel Kraft zuschlug, dass die Bilder an den Wänden klapperten.
Das einzige Mal, dass eine Schülerin hierher gebracht wurde, war, wenn sie kurz vor dem Rauswurf stand. In Anbetracht dessen, was ich noch zu tun bereit war, war ein Schulverweis wohl kaum eine Strafe. Die Direktorin wandte sich an mich, und ich wusste, dass ich nur ein kleines Zeitfenster hatte, um mich zu erklären.
„Ich kann nicht zulassen, dass sie Roya mitnehmen“, sagte ich hastig. „Ich war es. So war es schon immer. Ich bin derjenige, der die Flugblätter schreibt. Ich schreibe das Material. Eher sterbe ich, khanoom, als dass ich zulasse, dass ihre Familie noch eines ihrer Kinder verliert. Bitte, ich weiß, was ich tue.“
„Hören Sie auf mit der Hysterie“, sagte sie heftig. Sie schüttelte den Kopf und warf einen nervösen Blick auf die geschlossene Tür. „Ich will kein weiteres Wort von diesem Unsinn hören. Ich weiß nicht, wo Roya ist, aber sie sind weder deinetwegen noch ihretwegen, noch wegen irgendeines Schülers hierhergekommen.“
„Was?“ Die Erkenntnis über das, was sie sagte, setzte sich nur langsam durch. „Sie … die Lehrer … sie sagten, er sei SAVAK … dass er bereits jemanden verhaftet hätte.“
„Ja“, sagte sie leise. „Aber keinen Schüler.“
„Aber …“ In meinem Kopf drehte sich alles.
„Kein Wort mehr“, schnauzte sie. „Du setzt dich hin und bleibst da, bis deine Mutter kommt.“
Sie ging zur Tür, blieb aber stehen, drehte sich zu mir um und hob drohend den Finger.
„Und du wirst dich nie wieder so dumm anstellen, wie du es da draußen getan hast. Das ist kein Spiel. Hast du mich verstanden?“
KapitelDrei
Die Minuten dehnten sich zu Stunden. In der überbevölkerten und ausufernden Stadt Teheran war niemand nur einen Telefonanruf entfernt. Seit meinem ersten Jahr an der Highschool war ich entweder mit dem Schulbus oder, in seltenen Fällen, mit dem Taxi nach Hause gefahren. Ich konnte mich nicht erinnern, wann meine Mutter das letzte Mal zur Schule gekommen war, um mich abzuholen.
Kurz nachdem Frau Elahi mich in ihrem Büro zurückgelassen hatte, brachte eine der Sekretärinnen meinen Mantel und meine Schultasche herein, die Neda oder Maryam aus dem Labor mitgebracht haben mussten. Als ich die Frau fragte, ob meine Freunde schon nach Hause gegangen seien und ob sie Roya gesehen habe, sagte sie nichts. Sie war offensichtlich angewiesen worden, nicht mit mir zu sprechen.
Als ich wieder allein war, ging ich zu einem der Fenster und spähte über den Rand der Jalousien. Das Büro des Schulleiters blickte auf einen großen Innenhof, der durch ein hohes Tor mit zwei Metalltüren von der Straße getrennt war. Auf der Straße jenseits der Mauern herrschte reger Verkehr. Ich konnte keine Schüler sehen, aber einer der Soldaten stand auf der Straße und sprach mit jemandem, der nicht in meinem Blickfeld lag. Die Worte von Frau Elahi kamen mir wieder in den Sinn. Sie waren nicht hierhergekommen, um einen Schüler zu verhaften. Das bedeutete, dass einer der Lehrer verdächtigt worden war. Mir gingen verschiedene Möglichkeiten durch den Kopf, wer ihr Opfer gewesen sein könnte.
Im Iran waren die Menschen unglücklich. Es spielte keine Rolle, welcher sozioökonomischen Gruppe man angehörte. Die Beschönigung der Wahrheit durch die Medien funktionierte nicht mehr. Die wiederholten Studentenproteste und die ständigen Zusammenstöße mit dem Militär hatten den Schah letzten Monat gezwungen, im Fernsehen zu sagen, dass er die Stimme unserer Unzufriedenheit gehört habe. Er versprach, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und Wiedergutmachung zu leisten. Unmittelbar nach der Sendung war es jedoch zu zahlreichen Verhaftungen gekommen. Nichts hatte sich geändert. Wieder einmal hatte der Schah gelogen.
Ich setzte mich wieder aufs Sofa und kramte in meiner Tasche nach Stift und Papier. Ich war ein guter Schüler, aber an Lernen war im Moment nicht zu denken. Ich begann, den Text für das nächste Flugblatt aufzuschreiben. Ich schrieb Ideen für eine Demonstration auf, die wir organisieren könnten, um gegen die Verhaftung unseres Lehrers zu protestieren. Die Verwaltung würde sicherlich angewiesen werden, nichts zu sagen, aber bis morgen würden die Schüler herausfinden, wer fehlte. Nichts würde das Interesse der Schüler, die bisher gleichgültig gewesen waren, so sehr wecken wie die Verhaftung eines ihnen so nahestehenden Menschen.
Es war meine Aufgabe, dieses Interesse zu schüren und das Beste daraus zu machen. Es waren Zeiten des Aufbruchs, des emotionalen und politischen Aufbruchs. Die Mädchen an unserer Highschool waren zwischen zwölf und neunzehn oder zwanzig Jahre alt. Die Umwälzungen im Lande drängten die Menschen in bestimmte politische Lager. Zu den wichtigsten ideologischen Gruppierungen gehörten die nationalistisch Gesinnten und die Anhänger des Kommunismus. Beide Gruppen waren gegen den Schah, und das machte viele Studenten zu potenziellen Demonstranten auf der Straße, wenn nicht diese Woche, dann nächste oder übernächste Woche.
Im vergangenen Jahr waren im ganzen Iran Taschenbücher von Hand zu Hand gereicht worden, die die Geschichten derjenigen erzählten, die den Kampf des Volkes in Russland begonnen hatten. Sie waren leicht und schnell zu lesen. Wir hatten Dutzende von ihnen. Jetzt war es an der Zeit, sie an weitere Schüler des Gymnasiums weiterzugeben.
Ich verlor die Zeit aus den Augen, aber ich hatte schon mindestens ein Dutzend Seiten mit Ideen aufgeschrieben, als meine Mutter und die Direktorin in der Tür erschienen.
Ich blickte in das Gesicht meiner Mutter und versuchte, ihre Stimmung herauszulesen.
„Komm, Omid. Wir müssen vor sechs Uhr noch etwas erledigen.“
Groß, schlank, immer professionell gekleidet, war Azar eine auffällige Frau. Sie hatte einen Streifen vorzeitig ergrauten Haares, der in ihrem streng zurückgekämmten Haar aufleuchtete. In diesem Moment fiel mir nur auf, dass sie blass aussah. Nicht wütend, nur sehr blass und müde.
Meine Mutter war eine leidenschaftliche Frau. Sie wusste, was sie im Leben wollte, und es fiel ihr nicht schwer, es auszudrücken. Ich war da nicht viel anders. Es gab viele Fälle, in denen unsere Nachbarn trotz geschlossener Türen und Fenster wahrscheinlich jedes Wort unserer Schreiduelle gehört hatten. Ich stopfte die Zettel in meine Tasche und schloss den Reißverschluss. Ich nahm an, dass Frau Elahi und meine Mutter bereits alles durchgesprochen hatten, was zu besprechen war, denn wir taten jetzt nichts dergleichen. Das war eine Erleichterung; ich war auch müde. Ausgelaugt. Und ich war ungeduldig, nach Hause zu kommen und meine Freunde anzurufen. Wir hatten heute Abend noch eine Menge Arbeit vor uns.
Die Sekretärinnen waren für heute weg. Die Lichter über den Schreibtischen waren erloschen, und vom Flur aus konnte ich das Summen des Staubsaugers eines Hausmeisters hören.
„Rufst du mich an, sobald die Vorbereitungen getroffen sind und du weißt, wohin ich die Unterlagen schicken soll?“, fragte Frau Elahi meine Mutter, als wir uns auf den Weg durch das Büro machten.
Ich wollte fragen, welche Vorkehrungen getroffen wurden und wessen Aufzeichnungen, aber dann ließ die Direktorin die nächste Bemerkung fallen.
„Morgen findet keine Schule statt.“ Sie sprach zu mir. „Sag das deinen Freunden, die du heute Abend siehst.“
„Sie wird sich mit keinem ihrer Freunde treffen“, sagte Azar knapp, gab mir keine Gelegenheit zu einer Antwort und schob mich durch die Bürotür in die Eingangshalle.
Ich war beunruhigt, als ich zwei bewaffnete Soldaten in der Eingangshalle sah. Der oberste Hausmeister des Gebäudes stand in ihrer Nähe. Als wir in die hereinbrechende Dämmerung hinausgingen, begleitete er uns zum verschlossenen Eingangstor und ließ uns hinaus.
Ich beschloss, keine voreiligen Erklärungen über das Geschehene abzugeben. Ich wusste, dass Azar es nicht auf sich beruhen lassen würde. Sie ließ nie etwas auf sich beruhen. Ich wusste, dass wir nicht nur eine, sondern viele Diskussionen über die Ereignisse des Tages haben würden, aber ich würde sie darauf ansprechen lassen.
„Hast du ein Taxi genommen?“, fragte ich.
„Nein, ich bin gefahren“, sagte sie. „Wie ich schon sagte, wir müssen Dinge erledigen.“
Wir gingen die Straße entlang und ich war überrascht, dass ihr Ton noch immer nicht wütend war. Ich beschloss, das Gespräch zwanglos zu halten. „Wohin gehen wir?“
Die Stimme meiner Mutter hatte einen kalten Biss, der zu der späten Nachmittagsluft passte. „Das erfährst du schon noch.“
Ich blieb stehen, zog meine Jacke an und zog die Büchertasche höher auf meine Schulter. Sie wurde nicht langsamer, und ich musste rennen, um sie einzuholen. Während wir liefen, dachte ich darüber nach, dass die Schule morgen geschlossen sein würde. Ich fragte mich, ob Frau Elahi diese Entscheidung getroffen hatte oder ob der SAVAK-Agent dies angeordnet hatte. Aber warum hingen diese Soldaten immer noch in der Nähe der Schule herum, als wir gingen? Vielleicht eine Durchsuchung. Die Schließung des Gymnasiums könnte einige Mädchen ermutigen, sich dem Marsch anzuschließen. Und wie sollte ich alle erreichen, wenn wir die Demonstration absagen würden? Die Studenten der Universität haben trotz des Streiks ihre Demonstrationen fortgesetzt. Das würden wir auch tun. Ich konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und Roya anzurufen. Wir mussten uns einen Plan einfallen lassen.
„Ich kann auch ein Taxi oder den Bus nach Hause nehmen“, bot ich hoffnungsvoll an. „Dann kannst du dir Zeit lassen, was auch immer du zu tun hast.“
„Nein, du kommst mit mir.“
Der Ton meiner Mutter blieb kühl, und als wir das Auto erreichten, fielen die ersten Regentropfen vom Himmel. Sie hatte unerlaubt geparkt, zu nah an der Kreuzung. Doch in einer Stadt, die bereits mit fünfmal so vielen Autos vollgestopft war, wie sie vernünftigerweise aufnehmen konnte, bedeuteten Verkehrsregeln nicht viel.
„Wie viele Stopps machen wir?“, fragte ich und stieg ein. Ich konnte nicht aufhören, an Roya zu denken. Wichtiger als die Pläne für morgen war mir, ihre Stimme zu hören, mich zu vergewissern, dass sie sicher zu Hause angekommen war. Ich wollte jedes Detail darüber wissen, wie gefährlich ihre Situation war und wie sie es geschafft hatte, zu entkommen.
„Zwei Haltepunkte“, antwortete Azar. Sie bog in den Verkehr ein. Der Fahrer des Wagens, dem sie die Vorfahrt schnitt, drückte aus Protest auf die Hupe.
„Was sind die Stopps?“
„Ich sagte doch, dass du es erfährst, wenn wir dort sind.“
Ich dachte schon daran, dass ich ein öffentliches Telefon finden könnte, sobald meine Mutter an der ersten Haltestelle war. „Ich warte im Auto.“
„Du kommst mit mir rein.“
„Warum?“, fragte ich, denn ich wusste, dass alle unsere Streitereien damit begannen, dass ich nach dem Warum fragte. Normalerweise wäre der nächste Schritt gewesen, dass sie gesagt hätte, sie sei die Erziehungsberechtigte und ich müsse tun, was man mir sage. Danach konnten wir richtig loslegen, aber dieses Mal ging sie nicht darauf ein. Ihre Lippen verengten sich zu einer dünnen Linie, und sie antwortete nicht. Stattdessen griff sie nach unten und schaltete das Radio ein, eine Taktik, die ich selbst anwandte, wenn ich ein Gespräch vermeiden wollte.
Die beschwingte, schwüle Stimme von Googoosh erfüllte sofort die Stille und ich dachte an sie. Googoosh hatte alles. Schönheit. Ruhm. Geld. Die Säle und Stadien füllten sich, wenn sie sang. Sie ging, wohin sie wollte, tat, was ihr gefiel. Sie stand über den Problemen all der Menschen, für die sie sang.
Wir fuhren, ohne zu sprechen. Ich überlegte, ob ich sie jetzt nicht bedrängen sollte; ich hatte heute Abend noch etwas zu erledigen, und unser Gespräch würde weder einfach noch kurz sein. Ich war mir ohnehinnicht ganz sicher, was die Direktorin meiner Mutter erzählt hatte.
Eine Sache, die ich aber unbedingt tun wollte, war, ihr mitzuteilen, was ich bei der Durchsicht ihrer Akten über sie erfahren hatte. Ich wollte, dass Azar wusste, wer sie war und wofür sie stand. Ich war stolz auf sie, und plötzlich wollte ich, dass sie das wusste.
Nicht reden wollen. Ich wollte reden. Ich wollte nicht. Meine eigenen widersprüchlichen Impulse brachten mich um. Schließlich griff ich hinüber und schaltete das Radio aus.
„Bringen wir es hinter uns. Können wir darüber reden, was vorgefallen ist?“
„Nein.“
„Ich habe nichts getan, was du nicht auch getan hast.“ Sie sagte nichts, also machte ich weiter. „Es tut mir leid … aber ich bin nur einer von einer Million anderer junger Menschen in diesem Land, die unzufrieden sind mit dem, was vor sich geht. Ich habe das getan, was alle anderen auch tun. Was alle anderen auch tun sollten. Ich habe meine Meinung geäußert. Das ist doch nicht so schlimm, oder?“
Keine Antwort. Ich warf einen Blick in ihre Richtung. Wir befanden uns auf der Roosevelt Street, und es herrschte reger Verkehr, aber ihre Knöchel waren weiß, als sie das Lenkrad mit einem Todesgriff festhielt.
„Das hast du mir beigebracht. Zu sprechen. Zu denken. Aktiv zu sein. Ich bin der Mensch, zu dem du mich gemacht hast.“
„Ich weiß.“
Ihre Stimme war kaum ein Flüstern, aber ich spürte den Ton der Selbstanklage in ihr.
„Warum bist du dann wütend?“
„Weil das hier anders ist.“
„Ich kann nicht erkennen, wie.“
„Du spielst … du spielst mit deinem Leben.“
Ihre Stimme wurde brüchig. Ich starrte auf ihr Profil und sah, wie ihr die Tränen über die Wange liefen.
„Warum weinst du?“
Sie wischte sich eine Träne weg, und die Finger kehrten zum Lenkrad zurück. Ich konnte so viel besser mit ihr umgehen, wenn sie mich anschrie. Es kam nicht allzu oft vor, dass sie sich von ihren Gefühlen überwältigen ließ. Zumindest nicht in meiner Gegenwart. Sie war die Verkörperung der Stärke. Sie war die Löwin aus den alten Kindergeschichten.
„Azar joon“, sagte ich sanft und berührte ihren Arm. Meine liebe Azar. Das war ein Kosename, mit dem ich sie seit meiner Kindheit bezeichnet hatte. Sie war für mich so sehr eine Freundin wie eine Mutter; wir waren nur zwanzig Jahre auseinander. Die Worte milderten immer ihre Stimmung, brachten sie zum Lächeln. Aber heute Abend nicht. „Rede mit mir. Schrei mich an. Sei wütend. Ich hasse es, dich weinen zu sehen.“
Sie sah mich an und blickte dann wieder auf die Straße, aber ich sah eine Traurigkeit in diesem Blick, die ich noch nie in ihren Augen gesehen hatte. Ich lenkte meinen Blick aus dem Fenster.
Azar bog links in eine Straße ein und ich schaute nach vorn. Ich kannte diese Gegend. Diese Blocks waren der Anfang des amerikanischen Botschaftsviertels. Ich blickte auf den Stacheldraht an einer Backsteinmauer und spürte, wie sich ein mulmiges Gefühl in meinem Magen ausbreitete.
An der nächsten von Bäumen gesäumten Straße bog sie rechts ab und suchte nach einem Parkplatz.
Mein Mund wurde plötzlich trocken. Der Teil von mir, der immer vergessen wollte, dass mich zwei Menschen gezeugt hatten, kam wieder zum Vorschein.
„Wer wohnt hier in der Nähe?“ Meine Stimme zitterte.
Sie fuhr rückwärts in eine Parklücke. „Du hast einen Termin in der amerikanischen Botschaft.“
„Warum?“
Sie stellte den Motor ab. Ihre Hände blieben auf dem Lenkrad. Sie schaute weiter geradeaus.
Ich schüttelte den Kopf. „Nein. Ich gehe da nicht rein. Du kannst mich nicht zwingen.“
Sie drehte sich um und sah mich an. „Ich schicke dich weg, Omid.“
„Nein. Das kannst du nicht. Wir haben darüber gesprochen, erinnerst du dich?“ Ich protestierte. „Du kannst mich nur nach Amerika schicken, wenn ich an keiner der Universitäten hier angenommen werde. Ich habe die Konkoor-Prüfung noch nicht abgelegt, aber ich gehöre zu den Besten meiner Klasse. Ich werde es schaffen. Ich weiß, dass ich es schaffe. Du hast gesagt, du würdest bis nach meinem Abschluss warten, um Entscheidungen zu treffen.“
„Ich warte nicht bis zur Abschlussfeier. Ich schicke dich jetzt weg.“ Die Gelassenheit in ihrer Stimme machte mir Angst. Sie versuchte nicht, mich zu überzeugen. Sie sagte mir, was sie zu tun gedachte.
„Das kannst du nicht“, rief ich. „Ich bin mitten im Schuljahr. Du kannst mich nicht einfach so entwurzeln. Das ist nicht fair mir gegenüber. Du hast versprochen, mich die Schule beenden zu lassen.“
„Omid –--“
„Ich dachte, du liebst mich. Ich dachte, du wolltest, dass ich – dein einziges Kind – bei dir lebe. Was habe ich getan? Bitte … Azar joon.“ Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. „Tu mir das nicht an. Wirf mich nicht weg. Bitte!“
Sie streckte die Hand aus und griff nach meinem Kinn. Ihre Finger waren eiskalt. Ihr Blick begegnete meinem durch einen Tränenschleier hindurch. „Ich werfe dich nicht weg. Hörst du mich? Ich schicke dich weg, weil ich dich liebe. Weil ich möchte, dass meine Tochter lebt. Hör mir zu. Ich will, dass du lebst.“
„Es geht um die Flugblätter, die ich herumgereicht habe, nicht wahr?“, fragte ich. Ich war nicht mehr in der Lage, meine Gefühle zu kontrollieren. „Wir können über sie reden. So wie wir auch über alles andere reden. Ich werde vorsichtiger sein. Ich werde mich nicht mehr in eine solche Situation begeben. Es war dumm von mir, dass ich mich dem SAVAK-Agenten ausliefern wollte. Das weiß ich jetzt. Ich verspreche, dass ich nie wieder so irrational handeln werde.“
Ihre Finger lösten sich von meinem Kinn, und sie ergriff meine Hände. „Omid, du bist siebzehn. Nächsten Sommer wirst du achtzehn sein. Ich kann dich nicht mehr beschützen. Ich –--“
„Ich brauche keinen Schutz.“
„Doch, den brauchst du. Weißt du, ich weiß, was du in der Schule gemacht hast. Und ich weiß, dass du meine Akten durchgesehen hast. Ich hätte dich aufhalten sollen, als ich es herausfand, aber ich habe es nicht getan. Ich nehme an, es war Eitelkeit … Ich weiß, es war Dummheit. In gewisser Weise hat es mich stolz gemacht, zu denken, wie viel wir beide gemeinsam haben.“
„Aber es ist wahr. Wir sind gleich. Deshalb gehöre ich hierher … wo du bist. Ich sollte bei dir sein. Du bist der einzige Elternteil, den ich habe.“
Noch während ich es sagte, wusste ich, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Sie schüttelte den Kopf.
„Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Er ist einverstanden. Du wirst bei ihm und seiner Frau bleiben, bis du die Highschool abgeschlossen hast.“
„Nein.“ Ich zog meine Hände weg und drückte mich gegen die Tür hinter mir. „Ich kenne sie nicht.“
„Doch, du wirst gehen“, sagte sie fest. „Und du wirst sie kennenlernen … und deine beiden Halbbrüder.“
„Bitte …“ Ein Schluchzen entrang sich meiner Kehle. Ich blickte nach draußen in den immer stärker werdenden Regen. Habib Mottahedeh war kein Vater, für mich war er nur ein Name. Noch weniger wusste ich über seine Frau und seine Kinder. Er und meine Mutter hatten geheiratet, als sie beide im ersten Studienjahr an der Universität Teheran waren, und sie waren nur zwei Jahre lang verheiratet gewesen. Als ich geboren wurde, ließen sie sich scheiden und er wechselte an eine Universität in Amerika. Er ging und kam nie wieder zurück. Azar blieb. Sie blieb, beendete ihr Studium und behielt mich bei sich.
Habib und seine neue Frau schickten mir zweimal im Jahr Geschenke – zu meinem Geburtstag und zu Norooz. Sie war Amerikanerin, und seltsamerweise war sie es, die ein paar Mal im Jahr anrief und nach mir fragte. Obwohl ich in der Schule entsprechenden Unterricht hatte, sprach ich kein Englisch, also war meine Mutter diejenige, die übersetzte und das meiste sagte. Zu Weihnachten bekam ich von ihnen auch eine Karte mit einem Bild ihrer Familie. Der Anblick dieser Karte löste bei mir keinerlei Gefühle aus. Ich war nicht eifersüchtig, und ich vermisste ihn nicht. Er war ein gut aussehender Mann mit südländischen Zügen. Sie hatte irisches Blut und rötliches Haar und die Zwillingsjungen hatten das Aussehen ihrer Mutter. Was mich betraf, so hätte das Familienfoto ein Ausschnitt aus einem amerikanischen Magazin sein können.
Ich wusste nichts über sie. Azar hätte mich genauso gut in eine Kommune in China schicken können.
„Azar joon …“ fing ich wieder an.
Sie schüttelte den Kopf und hatte sichtlich Mühe, ihre Gefühle zu kontrollieren. Das gab mir Hoffnung. Sie wollte mich nicht wirklich wegschicken.
„Madar …“, flehte ich.
Azar unterbrach mich mit einer Handbewegung. „Vor einem Jahr … vor sechs Monaten … selbst im Herbst gab es noch Hoffnung. Aber jetzt wird es immer schlimmer werden.“
„Nein, es wird besser werden. Der Schah kann sich nicht mehr lange halten. Wir sind dabei, ihn zu schlagen. Die Menschen sind auf der Straße. Unsere Stimmen werden gehört.“
Ich hielt inne und merkte, dass es töricht war, ihr einen Vortrag über die Situation zu halten; sie wusste so viel mehr als ich. Plötzlich waren meine politischen Überzeugungen und Hoffnungen trostlos und sinnlos im Vergleich zu dem, was mir am wichtigsten war. Ich kämpfte darum, in dem einzigen Zuhause zu bleiben, das ich kannte, mit dem einzigen Elternteil, den ich kannte. Ihr entschlossener Blick verriet mir jedoch, dass sie sich nicht so leicht beirren lassen würde.
„Ich werde mich ändern. Ich werde mit all dem hier aufhören. Ich werde mich nicht mehr einmischen. Ich werde nach der Schule nach Hause kommen. Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Ich bitte dich. Ich gebe dir mein Wort. Ich werde nie –--“
„Omid.“ Sie nahm mein Gesicht in ihre Hände und zwang mich, ihr in die Augen zu sehen. „Ich weiß Dinge, die du nicht weißt. Ich bitte dich, dies für mich zu tun… für meine Sicherheit und für deine. Ich bitte dich, zu Habib und seiner Familie zu gehen und dort bis zum Ende des Schuljahres zu bleiben. Wenn die Dinge dort nicht funktionieren … wenn du zurückkommen willst, dann … kannst du das. Du kannst hierher zurückkommen und auf die Universität gehen.“
„Wenn du mich nicht bei dir haben willst, schick mich nach Isfahan zu deinen Eltern.“
„Nein. Du und ich werden nur sicher sein, wenn du außer Landes bist“, sagte sie in einem zerbrechlichen Ton. „Die Vorbereitungen sind getroffen worden. Du wirst gehen, Omid.“
Die Diskussion war beendet. An den Rest des Nachmittags kann ich mich kaum noch erinnern. Das Innere der US-Botschaft bestand aus einem Warteraum und einem Schalter mit einer Frau, die meiner Mutter mein Visum aushändigte. Auf dem Heimweg holten wir meine Flugtickets in einem Reisebüro ab.
Später in der Nacht dachte ich, dass es Hunderte von Dingen gab, die ich hätte tun können. Ich hätte aus dem Auto springen und bei Royas Familie bleiben können. Ich hätte mehr kämpfen und streiten können. Ich hätte noch viel schwieriger sein können. Aber da war etwas im Ton meiner Mutter, ein Ton des Flehens, den ich noch nie gehört hatte. Das war es, was mich zum Aufhören brachte. Sie war verzweifelt. Ich musste ihr helfen.
KapitelVier
Ich kehrte nicht zur Marjan High School zurück, und mein Flug ging drei Tage später vom Flughafen Mehrabad. Ich konnte meine Freunde anrufen, um mich von ihnen zu verabschieden, aber meine Mutter verbot mir, jemanden zu sehen. Ich verließ den Iran mit dem Versprechen, dass ich im nächsten Sommer zurück sein würde. Ich ließ alles zurück, was ich kannte, und alles, was mir lieb und teuer war.
Ich weigerte mich, mehr als einen kleinen Koffer mitzunehmen. Die Dinge, die einen besonderen Platz in meinem Herzen hatten, wollte ich unbedingt zurücklassen. Mein Tagebuch, meine Farsi-Übersetzungen von Victor Hugos Les Misérables-Benavayan und Tolstois Krieg und Frieden-Gangh va Solh-mein Divan von Hafiz, mein abgenutztes Lederexemplar des Golestan von Sa’di und das Dutzend anderer Bücher, die ich so oft gelesen hatte und immer wieder zur Hand nahm. Die Jeansröcke, in denen ich praktisch lebte, habe ich nicht eingepackt. Meine Lieblingsturnschuhe und die Wildlederjacke, die ich im letzten Sommer in Mashhad gekauft hatte, ließ ich zurück. Die neue Unterwäsche, die Azar für mich besorgt hatte, schob ich in die unterste Schublade der Kommode. Ich packte nur alte Kleidung und Dinge ein, die mir nicht gefielen. Ich nehme an, das war meine Art, gegen die Entscheidung zu protestieren, die mir aufgezwungen wurde.
Im Geiste der Rebellion nahm ich eine Sammlung mit, die entscheidend dazu beigetragen hatte, den Nährboden für meine Überzeugungen zu schaffen: den Gedichtband von Khosrow Golesorkhi, dem Dichter, Journalisten und Revolutionär, dessen aufmüpfiges Auftreten gegenüber der Schah-Regierung – und seine anschließende Hinrichtung durch ein Erschießungskommando – seinen Namen in vielen von uns verankert hat. Khosrow Golesorkhi war von der Regierung beschuldigt worden, ein Mitglied der Fedayeen-e-Khalq zu sein … wie meine Mutter.
Es war noch dunkel, als wir am Morgen meines Fluges unser Haus verließen. Meine Mutter fuhr. Das Kriegsrecht war noch eine halbe Stunde in Kraft, aber es wurden Sonderausweise für diejenigen ausgestellt, die zum Flughafen mussten oder medizinische Notfälle hatten.
„Er ist ein guter Mann“, sagte Azar auf Farsi zu mir, als wir fuhren.
Wenn ich nicht so wütend wäre, hätte ich gelacht. Sie hatte siebzehn Jahre gewartet, bevor sie versuchte, mich wie meinen Vater zu machen. Sie war zu spät dran, wollte ich ihr sagen. Aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, gemein zu ihr zu sein. Ich wusste, dass sie in den letzten drei Tagen mindestens so sehr gelitten hatte wie ich. Jedes Mal, wenn ich aus meinem Zimmer kam, sei es mittags oder um Mitternacht, war sie wach und lief durch die Wohnung. Ihre Augen waren vom Schlafmangel geschwollen … oder vielleicht vom Weinen. Trotz alledem blieb sie standhaft in ihrer Entscheidung. Sie war nicht ins Wanken geraten, und das würde sie auch nicht tun.
Sie sprach weiter über meinen Vater, aber ich ignorierte sie.
Ich blickte auf die leeren Bürgersteige, auf die Militärfahrzeuge, die hier und da an den Kreuzungen parkten, auf die Soldaten auf den Straßen. Niemand hielt uns an, um unseren Pass zu kontrollieren. Es war, als wüssten sie bereits, dass sie einen Unruhestifter loswerden würden. Gut, dass wir sie los sind.
Roya erzählte mir am Telefon, dass sie in den letzten Tagen zu keiner einzigen Demonstration gegangen war. Sie durfte nicht aus dem Haus, außer um zur Schule zu gehen. Selbst da wurde sie hin und zurück eskortiert. Sie hatte den Verdacht, dass meine Mutter mit ihrer Mutter gesprochen hatte; ihre Familie behielt sie sehr genau im Auge. Neda und Maryam waren auch nicht zu irgendwelchen Kundgebungen gegangen. Azar muss auch mit ihren Familien telefoniert haben.
Roya und ich waren das Rückgrat der Organisation unserer Schule. Das war ein Rückschlag, aber ich wusste, dass mein Weggang nichts ändern würde. Das, wofür wir kämpften, war größer als jeder Einzelne.