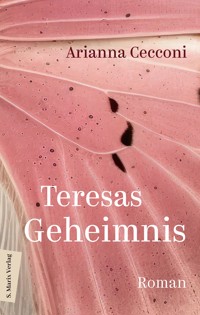
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr ganzes Leben lang hütet Teresa ein Geheimnis. Als sie spürt, wie ihr Gedächtnis immer löchriger wird, beschließt sie, zu verstummen. Sie legt sich ins Bett und steht nicht wieder auf. Ihre Töchter Flora und Irene, ihre Cousine Rusì, die peruanische Pflegerin Pilar und Nina, ihre Enkelin, die diese Geschichte erzählt, wollen aber nicht auf ihre Gegenwart verzichten. Sie transportieren Teresas Bett mitten ins Wohnzimmer. Zehn Jahre liegt sie reglos dort. Die Frauen kreisen um sie wie Planeten, jede auf ihrer eigenen Bahn, doch alle miteinander verbunden. Jede ein Teil von Teresas Geheimnis. Als der Arzt sagt, dass Teresa sterben wird, kommen sie um ihr Bett zusammen. In vier Tagen und Nächten, die sie bei ihr wachen, enthüllt Teresa vier Orakel. Sie helfen den Frauen ihrer Familie, die Knoten zu lösen, die ihre Leben begrenzen. Arianna Cecconi öffnet die Augen für die kleinen Momente und Verflechtungen, die das Leben ausmachen. Ein realistisches und fantastisches Buch, das uns erschüttert, vor Lachen und Rührung, und in die Tiefen unserer Geheimnisse eintaucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arianna Cecconi
TERESAS GEHEIMNIS
Arianna Cecconi
TERESAS GEHEIMNIS
Aus dem Italienischen von Klaudia Ruschkowski
Arianna Cecconi
ist Anthropologin und lebt zwischen Marseille und Italien. Sie forscht an der École des Hautes Études im Bereich der Sozialwissenschaften und lehrt Religionsanthropologie an der Università Milano Bicocca. Ihre Forschungsschwerpunkte sind politische Gewalt, magisch-religiöse Praktiken, Träume und Schlaf. Teresas Geheimnis ist ihr erster Roman.
Klaudia Ruschkowski
1959 in Dortmund geboren, ist Autorin, Dramaturgin, Herausgeberin und literarische Übersetzerin aus dem Englischen und Italienischen. Sie konzipiert Literatur-, Kunst- und Kulturprojekte. Sie lebt in Italien und Deutschland. 2021 erschien im S. Marix Verlag ihr Roman Rot, sagte er.
Inhalt
Halt inne und hör zu
Eselsbauch
Ängste wegwaschen
Ein T auf dem Herzen
Ein Bleistift
Sieben Nüsse
Zwölf Zehen
Auf deinen Spuren
Carmen und die Liebe
Der Beckenknochen von Marx
In die Haut
Auf Gold sitzen
Teresas kleiner Finger
Nächtliche Verbindungen
Bultos
Die Frequenzen meiner Stimme
Das Leben der Fotos
Rote Jacke
Wenn die Zikaden es sagen
Geschichtsstückchen
Teresas Testament
Nachwort
Halt inne und hör zu
Die Weisheit des Orakels der Cumäischen Sibylle erwuchs aus der Liebe und der Hast, den Wünschen und der Unfähigkeit, über sie hinauszuschauen.
Als die Sibylle noch eine Frau war, verliebte sich Apollon unsterblich in sie, und sie ließ sich seine Liebe gefallen im Austausch für ein Leben, das so lang sein sollte wie die Zahl der Sandkörner, die sie in Händen hielt. Doch aus Hast vergaß sie, zusammen mit der Unsterblichkeit auch um ewige Jugend zu bitten, und so wurde sie uralt, runzlig und winzig klein. Ihr Körper verschrumpelte wie der einer Zikade, bis er in ein Gefäß passte, aus dem man nur ihre Stimme flüstern hörte, Prophezeiungen, die stets mit den Worten schlossen: »Ich will sterben«.
Ich weiß nicht, ob die Cumäische Sibylle Kassandra beneidete – auch sie eine Sibylle, auch sie berührt von Apollons Liebe und, da sie diese Liebe nicht erwiderte, dazu verdammt, mit ihren Worten, die der Wahrheit zu nah waren, auf Unglauben zu stoßen.
Ich weiß nicht, wann Apollons Augen auf meine Großmutter Teresa fielen.
Dies ist eine Geschichte über unsichtbare Dinge, über Prophezeiungen und häusliche Orakel, über Freiheit und Zufall, über die Schwierigkeit, sich zu entscheiden, auszuwählen, zu lieben, zu wachsen und zu sterben. Es ist eine Familiengeschichte, eine Geschichte des Schweigens, der Zeichen und der Kunst, sie zu deuten.
Vor dem Lesen sind einige kleinere Maßnahmen erforderlich, eine Art Tribut an das Unergründliche und eine Geste des Respekts gegenüber der Intimität der Dinge, die noch nicht sichtbar sind, es aber in Kürze sein werden, der Dinge, die hier ihre Geschichte und ihre Geheimnisse offenbaren. Eine Übung in Besonnenheit, um nicht ein ähnliches Schicksal zu erleiden wie die Cumäische Sibylle.
Zuallererst ist es geboten, sich vor ein Fenster zu setzen und die Schuhe auszuziehen. Den Boden unter den Füßen zu spüren und die Augen zu schließen. Und dann zu versuchen, eine Frage zu beantworten: Wie entscheidest du dich für das, wofür du dich entscheidest?
Ich weiß nicht, ob ich euch all dies erzähle, um Zeit zu gewinnen oder wegen des Unfalls, zu dem es gerade in der Küche kam. Ich war dabei, ein Stück Käse abzuschneiden, die Rinde war hart, und die Klinge stieß mitten in meine Handfläche. Ich dachte an Teresa, das glaube ich zumindest. Jetzt muss ich sehr viel langsamer schreiben, und es tut weh, wenn ich mit der Linken die Tasten des H,a,l,t,i,n,n,e,u,n,d,h,ö,r,z,u drücke. Die unsichtbaren Dinge und die Geheimnisse verzeihen weder Zerstreutheit noch Hast.
Man kann ihnen nicht zuhören, während man mit etwas anderem beschäftigt ist.
Teresa hatte nie an die geglaubt, die so tun, als könnten sie in den Rillen des Fleisches ein festgeschriebenes Schicksal lesen. Wie jemand, der sein ganzes Leben lang durch unbekannte Länder reist, sich dort verirrt und um Orientierungshilfen bittet, nur um schließlich festzustellen, dass die Landkarte in seiner Hand verzeichnet ist. Sie hatte ihre Hände immer zum Arbeiten benutzt, zum Waschen, zum Essen, zum Liebkosen, und glaubte nicht, dort je von anderem lesen zu können. Wenn aber das Schicksal nicht existierte, verlangte es meine Großmutter nach einer Erklärung, was denn dann Freiheit war.
Wir können unser Leben frei bestimmen, sagen manche, aber Teresa war früh bewusst geworden, dass sie ein Gesicht und einen Körper besaß, die waren, wie sie waren, und die sie sich nicht ausgesucht hatte. So wie sie sich nicht die Familie ausgesucht hatte, in der sie zur Welt gekommen war – der Vater Bauer, hart wie die Wand, die er in sich errichtet hatte, und eine Mutter, die zu früh gestorben war, als dass sie sich an sie erinnern konnte.
Sie war auf dem Benvenuta-Hof großgeworden, unter sechs kräftigen Geschwistern, umgeben von einem Nebel, der zwischen September und März die Konturen der Dinge verbarg. Sie hatte Antonio geheiratet und den Kopf gesenkt, und ihre beiden Töchter, meine Mutter Irene und meine Tante Flora, waren zur Welt gekommen, ohne dass sie sie erwartet hätte.
Für einige ist die Palette der Möglichkeiten schwindelerregend groß, für andere nicht größer als ein Steinchen, man kann es unter das Kopfkissen legen und darauf schlafen, denn morgen wird es genauso sein wie heute.
Nein, in Teresas Leben schien nicht einmal die Freiheit zu existieren. Jedoch wussten weder sie noch irgendein anderer unserer Familie, ob es Freiheit oder nicht doch Schicksal war, das sie mit dieser Art von Glück erfüllte: Unvermittelt wie ein Lichtschwall stob es in ihrem Blick auf, ein Brodeln, das ihr Lachen durchflutete.
Teresa hütete ein Geheimnis, das sie immer mit sich trug.
Es gibt Familienschätze, die von Hand zu Hand wandern, die Lichtschimmer und Hoffnungen bewahren; es gibt Familienleichen, die versteckt im Keller liegen; es gibt Familiengerüche, die ersten, an die man sich erinnert, und die letzten, die man vergisst; und dann gibt es die Familiengeheimnisse.
Manchmal wissen alle von ihnen. Manchmal ist es nur einer, der sie in seinem Mund bewahrt. Teresa hatte ihr Geheimnis viele Jahre lang fest zwischen den Zähnen gehütet, selbst, als die herausgefallen und durch ein Gebiss aus Gold und Emaille ersetzt worden waren. Sie wollte nicht riskieren, es entwischen zu lassen. Als sie dann spürte, wie ihr das Alter die Zunge löste, hatte sie beschlossen, zu verstummen.
Das Gedächtnis meiner Großmutter wurde löchrig wie ein Sieb. Etwas in ihrem Kopf machte sich einen Spaß daraus, die Gesichter auf den Familienfotos verschwinden zu lassen. Anfangs suchte sie nach ihnen. Sie tauchten auf, dann waren sie wieder fort. Der erste, der verschwand, war Großvater Antonio, und dann wir, eine nach der anderen. Teresa grub irgendwo Namen aus: Nina, Flora, Irene, Rusì, Pilar. Aber die Namen hatten kein Gesicht.
Auch die Gegenstände im Haus verloren nach und nach ihre Geschichte und erhielten neue Plätze: das Telefonbuch unter dem Kissen, die Wollknäuel zwischen dem Besteck, eine kaputte Bürste in der Backröhre, die Schuhe im Kühlschrank.
Wir füllten Krumen der Realität in die Taschen ihrer Kleider oder steckten sie in ihre Geldbörse: Adresse und Telefonnummer, ihren Ausweis. Einmal erhielten wir einen Anruf von der Kassiererin im Supermarkt, Teresa habe drei Honiggläser in der Hand und wisse weder, wie sie sie bezahlen, noch wohin sie sie bringen sollte.
Während Großmutters Erinnerung zerbröselte, brachen sich die wütenden Worte Bahn, Beleidigungen, die nicht zu einer Großmutter mit blauen Augen passten. Schimpfworte, die urplötzlich aus ihr herausbrachen – »Hure«, »Hornochse« – und beim Mittagessen rund um den Tisch der Casa del Fico schauten wir uns an, unterdrückten mitunter ein Lachen oder richteten den Blick starr auf den Teller. Dachte sie das wirklich? In wen verwandelte sich Teresa? Sie schien von einer fuchsteufelswilden, zornigen Gottheit besessen.
Dann folgten die Wörter ohne Sinn – Singsang und Kinderreime, die sie aus irgendeiner Abstellkammer ihres Gedächtnisses hervorgeholt hatte. Wörter, die kindliche Erinnerungen wieder aufleben ließen, in denen die Gegenwart die Gestalt der Vergangenheit annahm, die Alten wieder jung wurden, die eigenen Kinder zu Fischen. Die Welt war wieder von Kindheitsfreunden bevölkert und von den bizarren Bewohnern des Benvenuta-Hofs. Die Toten wurden wieder lebendig.
Schließlich trocknete auch der Fluss der Kinderreime aus. Großmutters Sprache verkümmerte zur Hieroglyphe, und ihre Erscheinung passte sich der Metrik des neuen Schweigens an. Sie glich einer antiken Statue, in Stein gehauen. Perfekte Wangenknochen, ein dreieckiges Kinn, die blauen Augen aus Eis.
Mit einem Schlag war sie vollends verstummt, eines Nachmittags, als wir in der Küche saßen und Bohnen pulten. »Wer bist du?«, hatte sie mich gefragt.
»Oma, Nonna, ich bin Nina, deine Enkelin.«
Sie hatte die Augen geschlossen, um tief in sich nach der Bedeutung des Wortes Enkelin zu suchen. Aber sie konnte sie nicht finden.
»Ein Käffchen fürs Äffchen nach dem Schläfchen.« An ihre Kehrreime erinnerte sie sich eher als an mein Gesicht.
Dann wurden ihre Augen feucht, genau wie meine. Sie schaute aus dem Fenster und tat so, als wäre nichts.
Am Abend legte sie sich ins Bett, ein für alle Mal, und ihr Körper hörte auf, sich zu bewegen. Sie stand nicht mehr auf, sie sprach nicht mehr: Reglos und stumm fixierte sie das, was die anderen Leere nennen, sie dagegen zu deuten gelernt hatte.
Wir brachten ihr Bett mitten in den Wohnraum, unseren Salotto, wo immer eine von uns da war, um einen Blick nach ihr zu werfen, den Bettbezug glattzustreichen, ihr das Haar zu kämmen und den Dutt festzustecken. Der Raum war hell und hoch, mit einem Fenster zum Garten. Wir hatten es geschafft, das Bett zwischen die beiden blauen Sessel, die Anrichte, das Fernsehschränkchen und den großen, ovalen Tisch zu quetschen.
Wir hatten uns so schnell an ihre Gegenwart gewöhnt, dass wir uns den Raum gar nicht mehr ohne dieses Bett vorstellen konnten. Nicht das Bett aus Olivenholz, in dem sie mit Großvater Antonio geschlafen hatte – das war oben geblieben. Der Arzt hatte ein spezielles Bett empfohlen; es ließ sich auf Knopfdruck heben und senken.
Pilar war die erste, die etwas an den Metallstäben hinter Teresas Kopf befestigte. Eine Muschel, eine große Muschel, weiß und braun mit rosa Streifen. Sie kam aus Puerto Maldonado im Tropenwald des Amazonas von Peru. »Sie bringt buena suerte«, hatte Pilar mir erklärt. »Ein Glücksbringer für die Jäger, ehe sie losziehen.«
Ein paar Tage später knüpfte Rusì einen Baumwollfaden mit einer kleinen Statue von Padre Pio neben die Muschel aus dem Amazonas. Die Muschel und Padre Pio baumelten jetzt gemeinsam dort, und hin und wieder ging der Kater auf sie los und hinterließ Kratzspuren auf dem Hals des Heiligen.
Ein, zwei Wochen darauf gesellte sich ein Fläschchen mit einer grünlichen Flüssigkeit hinzu. Bereits am nächsten Tag wurde das Fläschchen von der Heiligen Lucia bewacht, und so ging es fort, bis sich Großmutters Bett in einen Weihnachtsbaum außerhalb der Saison verwandelt hatte, in ein Heiligtum für sämtliche Gottheiten. Kleine Baumrindenreste, rote und schwarze Samenkörner, ein Bild von Sankt Martin, ein Kindersöckchen, das Foto der Stigmata, Ampullen mit Wasser von heiligen Orten, am Fußende der gekreuzigte Christus neben einem kleinen Stofflama. Eines Morgens war sogar ein weißes Ei aufgetaucht: der Kokon einer Seidenraupe, wie die, die sie in Großmutters Jugend auf dem Benvenuta-Hof gezüchtet hatten. Es kam nie heraus, wer ihn gespendet hatte.
Nach und nach hörten wir auf zu kämpfen, verzichteten auf die Phosphorkuren und die Rituale, die uns einmal Freude bereitet hatten: Großmutters Erinnerungen hochzuholen, ihr laut vorzulesen, geduldig das Haar zu kämmen. Die Rettung von Großmutters Gedächtnis verlor immer mehr den Reiz des Abenteuers, und außerdem hatten wir uns an die neuen Verhältnisse gewöhnt.
Jetzt kam es vor, dass wir auf Teresas Bett einen Stapel Handtücher, ein Buch, die große Keramikschüssel mit dem Blumenmuster deponierten. Die Dinge lagerten dort den ganzen Tag über, ohne dass es uns auffiel. Das Bett war zu einem Möbelstück wie jedes andere geworden, und unter dem Laken versteckte der Kater Remigio seine Trophäen: eine Eidechse ohne Schwanz, einen gelben Schmetterling, ein paar Hühnerfedern. Eines Nachmittags war ich nach oben gegangen, um zu telefonieren, und hatte die Zeitung auf Großmutters Füßen vergessen. Als ich zurückkam, war sie ganz von der Repubblica bedeckt, über ihrem Gesicht ein großes Foto vom Tor des AC Mailand, letzter Spieltag.
Man gewöhnt sich an alles. An die Stille, die Unordnung, die Liebe oder die Einsamkeit. Wir hatten uns an eine Großmutter ohne Gedächtnis gewöhnt, die noch da und nicht mehr da war. Wir saßen um den Tisch, unterhielten uns, vergaßen ganz, dass sie in unserem Rücken lag und zuhörte.
Zehn Jahre lang, mit geschlossenen Augen. Wenn sie sie einmal öffnete, schaute sie zur Decke. Meine Großmutter sah Geister.
Wenn ich heute an dich denke, Teresa, und ich denke oft an dich, sehe ich dich zuallererst bei Nacht.
Alt, bleich im Gesicht, das Haar weiß wie die Perlenkette, die du immer um den Hals trugst, im Bett, mitten im Salotto. Halb lebendig und halb tot, halb Großmutter, halb selbst schon ein Geist, sahst du die Geister durch die Luft spazieren, die Wände hinaufklettern, sich im Kronleuchter verheddern. Mit jedem Windhauch verschob sich vor dir die Grenze zwischen Leben und Tod. Aber du sagtest kein Wort, du verrietst nichts, und wir haben nichts bemerkt. Mit deinen Augen aus Eis hast du das Vergehen der Zeit und unserer Leben beobachtet, die sich ändern wollten und sich nie geändert haben. Die Casa del Fico war unsere Spieluhr, wir drehten uns um uns selbst, ohne Unterlass, aber immer auf der Stelle.
Bevor du zu einem Orakel wurdest, hatte niemand den Frauen meiner Familie beigebracht, wie man sich entscheidet. Daher war jede von uns ihrer eigenen Methode gefolgt:
Rusì, deine Cousine, hielt sich an die Gebote des Christentums.
Irene, deine Ältere, hörte auf ihre Träume.
Flora, die Jüngere, suchte in Büchern, auch wenn sie sich dabei von einer silbrigen Schlange leiten ließ.
Pilar, die bei uns war, um dich zu pflegen, ließ den Dingen ihren eigenen Lauf, da das Leben so lief in dem Land, aus dem sie stammte: Peru.
Ich, deine Enkelin Nina, verzichtete auf Entscheidungen und überließ alles dem Zufall.
Wir tragen die Vergangenheit mit uns wie Wale, die in ihrem Bauchfett die Knochen aus der Epoche bewahren, als sie noch Beine besaßen. Während sie schwimmen, die riesigen Wale, schauen ihnen die Fische zu, ohne zu ahnen, dass es eine Zeit gab, in der die großen Tiere neben ihnen Luft atmeten und über die Erde zogen. Vielleicht erinnern sich nicht einmal die Wale selbst daran, aber in ihrem Inneren wissen sie es. Ihr Körper weiß es, und er hütet dieses Geheimnis in seinem Bauch, eingebettet in das Fett des neuen Lebens.
Auch Teresa trug ihr Geheimnis in sich. Und wenn die Wale nie schlafen und ihr ganzes Leben lang unentwegt schwimmen, so hatte sie sich, umgekehrt, für die Lethargie entschieden. Sie hatte sich ins Bett gelegt und war nicht mehr aufgestanden.
Die Lethargie nährt sich, wie man weiß, vom Fett. Dem Übermaß an eigenem Fleisch verdankt es sich, dass man Monate, Jahreszeiten, ja, ganze Jahre hindurch schlafen kann. Auch Großmutter nährte sich, wie die Tiere, von sich selbst. Alles reduziert sich auf das Wesentliche, Herz, schlag’ langsam, um mich nicht zu wecken.
Im Allgemeinen erleben die Menschen kleine Lethargien, die eine Nacht lang dauern – oder eine Reise lang. Um zum Orakel zu werden, war Teresa in einen Schlaf gefallen, der zehn lange Jahre währte.
Als das ganze Fett verzehrt und sie zu Haut und Knochen geworden war, konnten ihre Weisheit und ihr Geheimnis ins Freie gelangen.
Eselsbauch
Schließlich kam der Tag, den wir alle gefürchtet hatten.
Um zwei Uhr nachmittags griff Pilar zum Telefon. Rusì kauerte im Wohnzimmer neben Teresas Bett, sie zitterte.
Meine Nummer, die meiner Mutter und meiner Tante Flora standen bleistiftgeschrieben auf einem an die Wand geklebten Zettel. Pilar begann mit meiner Mutter, der Tochter, die am weitesten entfernt war. Es klingelte drei Mal.
Irene tastete nach dem Telefon.
»Mamasita Irene, der Arzt war da. Er sagt, Teresa wird sterben.« Pilar sagte das alles in einem Atemzug, ihre Stimme schien von der anderen Seite des Ozeans zu kommen.
Vor Irene baumelte das Schwarzweißfoto einer Vorstadtstraße, zwei Jungen, die an einer Motorhaube lehnen und eine Zigarette rauchen. Sie hatte es gerade aus dem Entwickler gefischt.
»Ich bin sofort da. Nicht Nina anrufen, das mache ich selbst.«
Ich habe geahnt, dass es heute passiert, dachte sie und erinnerte sich an einen Ausschnitt aus dem Traum der letzten Nacht. Sie war durch den Salotto in der Casa del Fico gegangen, und Teresas Bett stand nicht mehr dort.
Sie zog das andere Foto, das noch immer in der Wanne schwamm, aus der Flüssigkeit. Dieselben Jungen, diesmal von hinten. Sie gingen auf ein großes Gebäude zu, eine verlassene Fabrik. Irene musste an das letzte Foto denken, das sie von ihrer Mutter gemacht hatte, eines der wenigen: Im Familienalbum klaffte immer eine Lücke, Teresa fehlte. Nur damals, an einem Sommertag, als die Großmutter auf der Tenne eingenickt war, hatte Irene den Moment genutzt, um eine Aufnahme von ihr zu machen. »Für deinen Grabstein«, hatte sie lachend gesagt. An jenem Tag lag Teresas Tod in weiter Ferne.
Irene verließ die Dunkelkammer. Das Studio, in dem sie arbeitete, war ausgestorben. Mittagspause. Während ihre Augen sich wieder an das Licht gewöhnten, suchte sie nach Worten, um es mir zu sagen.
Die Balinesen besitzen nur ein einziges Wort für Enkelin und Großmutter, kumpi, in ihm wohnen beide. Wenn die Großmutter stirbt, lebt die Enkelin weiter, aber ihr fehlt ein Teil.
So ging es auch in der Casa del Fico. Es war Teresa, der ich mich anvertrauen konnte, so als würden ihr Ohr und mein Mund perfekt zusammenpassen.
Meine Mutter war manchmal eifersüchtig, wir beide hatten Mühe, miteinander zu sprechen. In den letzten Monaten waren wir oft aneinandergeraten, nicht einmal die räumliche Entfernung kühlte uns ab. Auch am Vortag hatten wir uns wegen einer Kleinigkeit gestritten. Es heißt, wir wären voller Wasser, und bei zunehmendem Mond überflutet es uns. In fünf Tagen ist Vollmond, sagte ich mir, gewiss war ich deshalb so nervös. Also ließ ich es klingeln, als ich ihre Nummer sah. Aber sie rief ein zweites und drittes Mal an.
»Ja?«
»Nina … wo bist du?«
»Ich trinke Kaffee, warum?«
»Pilar hat angerufen. Sie sagt, es wäre gut, sofort zu kommen.«
»Warum?«
»Großmutter ging es heute Morgen nicht so gut.«
»Was ist passiert?«
Schweigen. Ich wollte es nicht hören. »Ich glaube, es wäre richtig, zu ihr zu fahren und bei ihr zu sein.«
Ich legte auf, ohne weiter zu fragen. Der Körper wurde schlapp, eine Hitzewelle zog durch den Kopf. Ich war allein in irgendeiner Bar, keiner kannte mich, keiner wusste, wer Teresa war. Meine Großmutter lag im Sterben, und ich saß hier unter lauter Unbekannten. Ich steckte das Telefon in die Tasche. Warum bin ich am letzten Wochenende nicht zu ihr gefahren? Ich war bis zum letzten Moment unentschlossen. Fahre ich oder fahre ich nicht? Am Ende bin ich zu Hause geblieben, in der Stadt. Wenn meine Großmutter da gestorben wäre, ich hätte es mir nie verziehen.
Wo anfangen? Den Kaffee bezahlen.
Dann ging alles seinen Gang. Schmerz macht einen zuweilen praktisch und schnell.
Ich sprang in den Bus zum Bahnhof: Ich musste mich beeilen. Mit meinen fünfunddreißig Jahren hatte ich bis jetzt noch nie einen Toten gesehen. Als Gabrieles Onkel starb, hatte ich gewartet, bis der Sarg geschlossen war, ehe ich die Leichenhalle betrat. Das Eigenartige beim Anblick von Toten ist, dass dir bewusst wird, dass sie wirklich tot sind, hatte Gabriele gesagt, es stimmt nicht, dass sie zu schlafen scheinen. Aber woran merkt man das? An den Falten um die Augen, hatte er hinzugefügt, und mich dort leicht mit den Lippen berührt.
Ich habe nur meinen Hund Buricchio sterben sehen, er war über die Straße gelaufen, und der Bus hatte ihn überfahren. Aber ich wollte seinen leblosen Körper nicht anschauen, ich bin weinend weggelaufen. Großmutter hat ihn geholt und im Garten begraben. Da liegt er noch immer, in der Casa del Fico, wo ich zur Welt kam.
Das Haus ist eines der letzten im Ort, kurz vor den Feldern, mit einer glatten, pampelmusenfarbenen Fassade.
Antonio und die Großmutter sind im Mai 1968 vom Benvenuta-Hof in die Casa del Fico gezogen. Auf den Straßen von Paris rief man: »Die Fantasie an die Macht«, und Antonio hatte begriffen, dass es Zeit war, zu sterben. Im selben Jahr holte er sich eine Lungenentzündung.
Der Umzug war sowieso nicht seine Entscheidung gewesen, sondern Teresas, die im Ort wohnen wollte, um ihren Töchtern ein Leben als Bäuerinnen zu ersparen. Antonio hatte das nicht so gesehen: Er wollte auf dem Hof bleiben, wo Irene und Flora sich um die Tiere und das Land gekümmert und eine gute »Seidenraupenehe« geführt hätten.
Dem hatte die Großmutter nie etwas erwidert, nur einfach Tag für Tag einen Graben darumgezogen. Monatelang tat sie so, als würde der Umzug unmittelbar bevorstehen, verrückte die Möbel, stellte die Dinge woanders hin, hängte die Kleider von hier nach dort. Kleine Verschiebungen. Antonio kam abends vom Feld und fand den Kleiderhaken für seine Mütze nicht mehr an der Wand, wo er gewesen war. »He, du, wo ist der Haken geblieben?« Teresa tat so, als wäre nichts; einen Kleiderhaken hatte es dort nie gegeben. Der große Topf, in dem die Raupen kochten, stand plötzlich auf der Tenne, gefüllt mit Erde. Teresa hatte rote Blumen eingepflanzt. Die Hosen lagen nicht mehr in derselben Schublade wie immer, sondern in der darunter. Antonio erkannte den Benvenuta-Hof nicht wieder, das Bauernhaus verschob sich wie von selbst. Verwirrt, beunruhigt, stand er nachts auf und drehte seine Runden, um sich zu vergewissern, dass alles noch da war.
Bis er eines Tages, als sie um den Esstisch saßen, vor Teresa, Rusì, Flora und Irene verkündete: »Dieses Jahr ziehen wir um.« Die Schwestern waren damals sechzehn und zwanzig Jahre alt.
Teresa hatte die Worte ihres Mannes registriert, ohne ihn anzuschauen. In ihrem Inneren brannte sie jedoch vor Aufregung, vor Ungeduld, sie hätte am liebsten Walzer getanzt, es allen verkündet. Stattdessen erhob sie sich ruhig, um abzuräumen: »Wann soll das sein?« Flora und Irene hatten dabei ihr kleines Lächeln bemerkt, das einer Löwin, die es nicht nötig hat, mit ihrem Sieg zu prahlen.
Für die Casa del Fico hatte Teresa sich schon seit langem entschieden. Jedes Mal, wenn sie mit dem Rad in den Ort fuhr, machte sie vor dem Haus Halt und betrachtete es. Es war seit einigen Jahren unbewohnt und wartete, wie ihr schien, nur darauf, dass sie die Fensterläden öffnete, um Luft in die großen Räume zu lassen. Hinter dem Haus gab es eine Scheune und einen Garten. Er hatte sich im Laufe der Zeit in einen kleinen Wald verwandelt. Teresa war es gelungen, sich zwischen Hecke und Brombeergestrüpp hineinzuschmuggeln. Während sie durch das hohe Gras ging, sah sie vor sich bereits die Stauden, an denen sich Tomaten wiegten, die sonnenbeschienenen Zucchini und ihre Hühner, im Stall unter der Veranda. Mitten im Garten stand ein großer Feigenbaum. An seinen Zweigen hingen Dutzende reifer Früchte, die niemand mehr erntete, und sie steckte sich eine samt Schale in den Mund, erfüllt vom Geschmack eines neuen Lebens. Sie betrachtete den Feigenbaum, er war alt und gesund, legte eine Hand an seinen Stamm, und mit lauter Stimme, ohne Zeugen, taufte sie das Haus »La Casa del Fico«, das Feigenbaumhaus.
Unten die große Küche mit dem Ofen und der Salotto, in dem sie jetzt schlief. Für wie lange noch? Oben sechs Zimmer – sechs, wie wir, drei auf der einen, drei auf der anderen Seite. Dazwischen ein Abstellraum. Die Türen ließen sich nicht abschließen, es gab keine Schlösser, aber das machte nichts: Die Geräusche blieben in den dicken Mauern. Teresas Zimmer war das größte und lag auf der Gartenseite: Von ihrem Fenster aus sah sie den alten Feigenbaum mit seinen Wurzeln, die sich über der Erde wellten. An seinem Stamm stand ein Stuhl, und früher, als sie noch redete, saß Teresa im Sommer dort und genoss die frische Luft. Im Winter kauerte sie neben dem Küchenofen, da Rusì die Heizkörper aus Furcht vor den Rechnungen immer herunterdrehte. Ihr war warm, so oft, wie sie in ihren fellgefütterten Hausschuhen die Treppe hoch und runter schlurfte. Jeden Morgen und jeden Abend fegte sie durchs Haus, wischte Staub und beklagte sich über all die Partikel, die im Morgengrauen und bei Sonnenuntergang aufwirbeln. Auch Pilar verbrachte ihre Tage mit einem Auf und Ab, um Remigio nachzulaufen, der ihr den Nähfaden gestohlen hatte, oder Küchenvorräte zu holen, die oben in der kühlen Kammer lagerten. Ihre Flip-Flops trommelten über den Boden, es schien, als würde sie springen, so behände wie damals im Andengebirge. Auf der Treppe zwischen dem Erdgeschoss und den oberen Räumen herrschte ein reger Verkehr: Lambruscoflaschen, Mehltüten, Konservendosen begegneten dort den frischen Wäschestücken, die duftend in Schränke und Schubladen zurückkehrten. Das Haus ruhte nie aus.
Irene wartete, bis ihre beiden Partner, mit denen sie das Fotostudio betrieb, vom Mittagessen zurück waren, erklärte ihnen die Situation und schloss ihre Bürotür. Eine Stunde später fuhr sie durch den dichten Nebel der Poebene, den sie nur zu gut kannte. Sie war dort aufgewachsen, wie vor ihr Teresa. Sie mochte es, mit dem Auto durch die schwere, graue Luft zu fahren. Als Kind war sie in den Nebel hineingelaufen, hatte alle Stimmen von ferne gehört: Furcht gepaart mit einer sinnlichen Freude, sich zu verstecken. Sie mochte es, zu verschwinden. Mit sieben hatte sie einmal im dichten Nebel vor der Treppe des Benvenuta-Hofs das Gefühl gehabt, als könne wirklich alles verschwinden und nie wieder zum Vorschein kommen. Bis dahin hatte sie gesehen, wie der Tod Pferde ereilte, Kälber, Kaninchen, aber in jenem Moment spürte sie, dass er sich neben ihr versteckt haben könnte, und sie wusste nicht, wo. Angst überfiel sie, und in ihrem Kinderkörper breitete sich eine neue Art von Traurigkeit aus. Sie war zu ihrer Mutter gelaufen. »Mamma, was fühlt man, wenn man stirbt?«. Teresa, am Herd, auf dem sie die Polenta rührte, hatte den Löffel beiseitegelegt und sie fest in die Arme genommen. »Ich weiß nicht, mein Schatz. Man stirbt, und fertig.« Sie hatte bemerkt, wie Teresas Augen traurig wurden, als wüsste sie es nur zu gut. Nicht, was man fühlt, wenn selbst stirbt, aber was man empfindet, wenn jemand stirbt, den man liebt.
Auch jetzt war meine Mutter Irene auf dem Weg zu ihrer Mutter, doch diesmal würde die sie nicht in den Arm nehmen können, um die Angst und den Nebel zu verscheuchen. Irene fuhr langsam, mit erleuchteten Scheinwerfern, obwohl es erst drei Uhr nachmittags war.
Als sie in den Salotto der Casa del Fico trat, saßen Pilar und Rusì nebeneinander auf dem Sofa. Rusì weinte, sie schien noch winziger und älter als sonst, auch wenn keine von uns sie je jung gesehen hatte. So wie keine von uns sie je nackt gesehen hatte, oder mit einem Mann, der nicht Jesus war. Ihm hatte sie ihre Liebe versprochen, ganz allein, zu Hause, ohne ins Kloster zu gehen und Nonne zu werden.
Pilar erhob sich vom Sofa und ging Irene entgegen, um sie in die Arme zu schließen.
»Ahi, Mamasita.«
Zusammen mit meiner Mutter war der Eselsbauch in den Raum eingetreten. Panza de burro, so nennt man in Peru den Nebel, der den ganzen Winter über Lima liegt: Ein Esel, zwischen Erde und Himmel, der seinen grauen Bauch auf die Köpfe der Menschen stützt.
Irene näherte sich Teresas Bett und strich sanft über ihre Hand. Mamma.
Teresa lebte, sie atmete schwach, ganz schwach, aber sie atmete.
Pilar erzählte, dass die Großmutter morgens kreidebleich gewesen war, ihr Atem ein Hauch. Der Arzt hatte gesagt, es sei eine Frage von Stunden. Deshalb hatte sie angerufen. Jetzt lag auf Teresas Gesicht wieder ein wenig Farbe, aber der Arzt war sich sicher: »Bereitet euch darauf vor, es kann von einem Augenblick auf den anderen geschehen.«
»Ich wusste, dass es heute geschieht. Ich habe es heute Nacht geträumt«, sagte Irene und schaute Pilar an.
»Es ist ja nichts Schlimmes passiert.« Rusì stand mit einem Ruck vom Sofa auf. »Siehst du’s nicht, es geht ihr schon besser.« Sie war erhitzt, rot im Gesicht, wegen der Tränen. Sie putzte sich die etwas krumme Nase, dann wandte sie sich an die Großmutter: »Meine Teresina, mach dir keine Sorgen. Ich bin hier.«
In den vergangenen Jahren hatte Irene vierzehn Mal von Teresas Tod geträumt, Träume, die immer zu langen Auseinandersetzungen mit Rusì geführt hatten. Rusì ertrug nicht, wenn meine Mutter Vorahnungen in die Welt setzte, die dann nicht einmal Wirklichkeit wurden. Für wen hält sie sich? Sie setzte sich wieder aufs Sofa, umklammerte den Rosenkranz und schloss die Augen.
Der neue Tod, der hier heranzog, brachte im Schlepptau die Erinnerung an all die Tode mit sich, die ihm vorausgegangen waren. Erneut sah Rusì die Füße ihrer Mutter, die toten Füße ihrer Mutter. Drinnen im Haus hatten die Verwandten drei Tage über ihren Leichnam gewacht, während Rom draußen vom Krieg erschüttert wurde. Aber Rusì war zu klein, sie durfte nicht an der Totenwache teilnehmen. Die Leute gingen im Raum, in dem die tote Mutter lag, ein und aus, und durch den Türspalt sah sie nur die Füße, in den braunen Strümpfen. Dies war das letzte Bild, das Rusì von ihr geblieben war. Sie erinnerte sich nicht einmal an ihr Gesicht, nur an diese toten Füße in den Wollstrümpfen.
Teresas Füße, nackt, von einem weißen Laken bedeckt, lebten noch, aber für wie lange? Rusì fühlte sich wie das kleine Mädchen von damals, das durch den Türspalt spähte. »Jesus, ich bitte dich, lass mir meine Teresa nicht sterben.«
Ich traf um vier Uhr nachmittags bei der Großmutter ein. Ich hatte den Zug genommen und dann den Bus, der in der Nähe der Casa del Fico hielt, und während der ganzen Fahrt über Teresas Tod geweint. Ich war schon fast im Ort, als ich Pilars Anruf erhielt: Großmutter lebte noch. Aber man kann nicht auf Kommando aufhören zu weinen.
Schon an der Schwelle zum Salotto fiel mir auf, dass ihr Gesicht nicht so viel anders war als beim letzten Mal. Sie hatte auf mich gewartet.
Nonna. Da bin ich.
Meine Mutter stand vor der Küchentür, in ihren roten Schuhen. Das runde Gesicht, die Fältchen um den Mund, die blauen Augen unschlüssig, so betrachtete sie mich neben dem Bett. Wenn ich sehr traurig war, hielt sie einen Sicherheitsabstand: Sie wusste nicht, was sie tun sollte, und das, glaube ich, machte ihr Angst. Manchmal überkam sie aber auch die Lust, mich wie einen Baum zu schütteln, damit die Traurigkeit von mir abfiel. »Komm schon, Nina, das Leben ist herrlich«, sagte sie laut, aber ob sie es selbst glaubte?
Mamma, nimm mich einfach in den Arm, sag nichts. Lass mich traurig sein, aber sei bei mir. Irene wusste nicht, wie sie das machen sollte.
»Was ist ein Schuldgefühl?«, hatte Pilar eines Tages gefragt, weil es so etwas in den peruanischen Bergen nicht gab.
»Schuldgefühl ist, wenn du dich für die Traurigkeit eines anderen verantwortlich fühlst. Wenn du spürst, dass ein Mensch, den du liebst, unglücklich ist, und dass er es ist, ist deine Schuld«, hatte Irene geantwortet. Ein Doppelknoten, der zwei Menschen gebunden hält.
»Also bist auch du traurig?«
»Ja, in gewissem Sinn.«
Aber meine Mutter empfand nicht nur Traurigkeit. Seit meiner Geburt fühlte sie sich schuldig, weil sie mir keinen Vater geschenkt hatte.
Ich bin die einzige in der Familie mit braunen Augen, Locken und dunkler Haut, wie Pilar. Ich sehe meiner Mutter Irene nicht ähnlich; die Farben habe ich von meinem Vater. Als ich klein war, habe ich geweint, weil ich blaue Augen haben wollte wie meine Großmutter, meine Mutter, und wenn ich in der Schule mich und meine Familie malen sollte, malte ich mich immer mit riesigen, himmelblauen Augen im Gesicht. Auf dem Bild, neben mir, waren nur Frauen. Großmutter hatte den größten Kopf, meine Mutter malte ich mit langen Füßen, aus den Augen von Tante Flora kullerten runde Tränen, Tante Rusì war so klein, dass sie wie ein Mädchen wirkte.
Einmal fragte mich meine Lehrerin, warum ich den Mann mit dem Bart und den Locken an den Rand des Blattes gequetscht hatte, ausgeschlossen aus dem Kreis meiner Familie. »Familie heißt die und ist weiblich«, antwortete ich.
»Weil du keinen Vater hast«, sagte meine Banknachbarin. In der Pause auf dem Schulhof zog ich sie so lange an den Zöpfen, bis sie weinte. Am liebsten hätte ich ihr all die feinen blonden Haare ausgerissen.
Und außerdem stimmte es nicht, ich hatte einen Vater, nur dass ich ihn nie kennengelernt habe.
Was sollte Irene tun? Machtlosigkeit erzeugt Wut, und in meiner Mutter verwandelte sich das Schuldgefühl in Gereiztheit. Sie konnte meinen Schmerz nur ertragen, wenn er nicht zu lange dauerte; nahm er überhand und überkam er auch sie, dann rebellierte sie gegen meine Traurigkeit, die auch die ihre war. Ein Magnet, der abstößt.
Als sie mich neben Teresa weinen sah, hätte sie am liebsten gesagt: »Komm, Nina. Du weißt doch, dass die Großmutter seit einer ganzen Weile sterben will. So hilfst du ihr nicht.« Es gelang ihr, still zu bleiben, aber wo war die Trauer meiner Mutter um ihre Mutter? Sie empfand keinen Schmerz, eher eine vage Erleichterung. Musste sie sich auch deshalb schuldig fühlen? War die winzige Frau, die dort im Bett lag, die seit Jahren nicht mehr sprach und sich nicht mehr rührte, noch ihre Mutter?
Außerdem schleppte schon meine Tante Flora den Schmerz aller anderen mit sich herum.
Seit Jahren wohnten meine Mutter und ich nun schon nicht mehr in der Casa del Fico. Flora hingegen hatte etliche Male versucht, wegzugehen, es war ihr aber nie gelungen. Kaum kam der Tag des Aufbruchs näher, wurde sie von schrecklichen Kopfschmerzen überfallen, die Wochen anhielten. Sie hatten während ihres Studiums an der Universität begonnen und waren mit ihr zusammen älter geworden. Wenn sie sie nahen fühlte, legte sie sich ins Bett – so wie Teresa dann später –, mit heruntergelassenen Rollläden und einem nassen Lappen auf der Stirn. Sie blieb solange liegen, bis es vorbei war.
Irene ertrug es nicht, dass ihre Schwester auf nichts reagierte, dass ihr anscheinend nicht bewusst war, wie sie den anderen wegen nichts Sorgen machte.
Während einer der Migräneattacken war Irene einmal aufgebracht in Floras Zimmer gestürmt, um die Fensterläden aufzureißen.
»Jetzt reicht’s, jetzt stehst du auf und kommst runter, es ist schon fünf Uhr nachmittags.«
Flora, den Kopf unter dem Kissen, hatte sich nicht gerührt, nur ihre schönen, glatten, grazilen Beine leicht an den Laken gerieben. Irene bemerkte, dass Flora das kleine Bild, ein Geschenk von einer Reise nach Guatemala, von der Wand genommen hatte: eine große Sonne, im Relief, in Aluminium geprägt, die über einem Maisfeld leuchtet, wo Frauen im Kreis tanzen. Sogar das Licht der falschen Sonne war ihr zu viel.
»Irene, bitte, mach das Fenster zu. Mir tun die Augen weh.«
Floras Stimme klang so zerbrechlich, dass Irene sich geschämt hatte. Wortlos hatte sie die Läden geschlossen und war gegangen.
Als Flora nach Hause kam, war es fast sechs. Bei ihrem Eintreten tanzten die weißen Leinengardinen vor den Fenstern. Das war schon lange nicht mehr geschehen, und es fiel mir auf. Wenn es Flora gut ging und sie einen Raum betrat, erzeugte sie einen unsichtbaren Wind, der die Dinge und die Menschen umherwirbelte. Sie ließ die Räume vibrieren. Sie war hübsch, aber unwiderstehlich wurde sie vor allem durch diesen Schwung, den sie in der Luft hervorrief. Ihr Haar schien aus vulkanischem Staub zu sein, anthrazitfarben, mit langen, grauen Strähnen; fast als hätte sie bereits in einer anderen geologischen Ära gelebt und von dort, als Erinnerung im Haar versteckt, winzige Feuersteinchen mitgebracht. Vielleicht war es das Knistern ihres Haars, das die Luft aufrührte, vielleicht waren es ihre Hände oder ihre Hüften, die unmerklich wogten. In ihrem Blick lag etwas Kindliches. Ein Mädchen, versteckt im Körper einer Frau.
Flora war überrascht, uns alle im Salotto anzutreffen. Pilar hatte sie angerufen, natürlich, aber ihr Telefon, auf ihrem Bett im oberen Stock, hatte ungehört vibriert. So war es oft. Flora verließ das Haus, und niemand wusste, wohin sie ging.
Als sie noch mit der Welt sprach, hatte Teresa sie häufig nach ihrem Ziel gefragt, wenn sie sie an der Tür überraschte.
»Wohin gehst du, Flora?«
»Ich mache nur einen Rundgang.«
»Einen Rundgang wohin?«
»Wenn du einen Rundgang machst, weißt du nie, wohin.«
»Ich wüsste es nur gern.«
»Ich auch … aber manchmal mache ich einen Rundgang und Schluss.«
»Kann ich dich nicht einmal begleiten?«
»Nein, Mamma, Rundgänge macht man allein.«
Teresas Augen glänzten. Sie wusste, dass sie sie nicht aufhalten konnte, und dass ihre Tochter ein paar Stunden später verstört zurückkehren würde, als wäre sie losgegangen, um etwas oder jemanden zu suchen, der entweder nicht da gewesen war oder nicht auf sie gewartet hatte. Oder sie kam heim, ihre Miene ein wenig zerknirscht, ihr Kleid ein wenig zerknittert, und brach grundlos in Lachen aus. Ich stellte mir dann vor, wie sie mit irgendeinem Liebhaber, der ihr den Hals küsste, ohne Spuren zu hinterlassen, durch das Gras rollte.
Auch die Pflanzen, Barometer ihres Wirbelns, spürten es: Sie atmeten ihre Luft und ließen neue Blätter oder eine kleine orangefarbene Blüte sprießen, das Alpenveilchen neben dem Fernseher senkte den Kopf, dem Kaktus auf der Anrichte wuchsen zwei neue Stacheln. Flora zog keine Linie, man konnte ihr nie folgen. Sie war ein Punkt, der auftauchte und verschwand.
»Tante Flora, bist du verlobt?«, hatte ich sie einmal gefragt, als wir zu zweit in der Küche saßen. Sie hatte mich ernst angeschaut. »Wenn ich mich eines Tages verlobe, bist du die erste, die es erfährt, das verspreche ich dir.« Aber dieser Tag kam nie, so wie sie nie den Mut gefunden hatte, das Haus zu verlassen und woanders zu leben.
Flora legte ihren Mantel neben Rusì auf das Sofa. »Nina, ich wusste gar nicht, dass du heute kommst.« Sie umarmte mich, ihre Hände waren kalt, und mein Herz schlug zu heftig, um etwas erwidern zu können.
Pilar trat auf sie zu. Sie wusste, dass Flora starken Emotionen nicht gewachsen war.
»Mamasita Flora, der Arzt hat gesagt, Teresa ist heute sehr schwach, besser, wir alle sind bei ihr. Wir müssen zusammen sein. Teresa könnte … sterben.« Das letzte Wort hastig, leise. Pilar verschluckte es, um es untergehen zu lassen, aber Flora hatte es nur zu gut gehört. Schlagartig wurde sie bleich. Ich schlang meine Arme von hinten um sie und half ihr, sich auf dem Sofa auszustrecken.





























