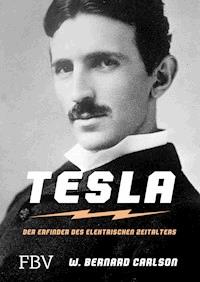
22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: FBV Geschichte
- Sprache: Deutsch
Nikola Teslas Forschungen revolutionierten das Verständnis von Elektrizität. Seine Erfindungen setzten völlig neue Maßstäbe für die weltweite Energieversorgung und ermöglichten erst das moderne Leben, wie wir es heute kennen. Nicht umsonst trägt das weltweit beste Elektroauto, von Silicon-Valley-Star Elon Musk, den Namen Tesla. Doch nicht nur für seine 112 angemeldeten Patente ist Nikola Tesla bekannt, auch sein extravaganter Lebensstil und sein Hang zur exzessiven Selbstdarstellung machten ihn berühmt. W. Bernard Carlson blickt mit seiner mehrfach ausgezeichneten Biografie tief in die Psyche des Genies: Eindrucksvoll zeigt er, wie nah Genie und Exzentrik beieinanderliegen und was das Ausnahmetalent antrieb. Zusätzlich fließen Hunderte Originalquellen ein, die zeigen, wie es Tesla möglich war, Innovationen wie am Fließband zu produzieren, und welche Business-Strategien auch heute noch gültig sind. Einer der größten Erfinder der Moderne in einem ganz neuen Licht. Gewinner des Sally Hacker Prize der Society for the History of Technology Gewinner des IEEE William and Joyce Middleton Electrical Engineering History Award Amazon.com-Bestseller »Bestes Wissenschaftsbuch« Top-10-Bestseller bei Booklist Online Einer der »Choice's Outstanding Academic Titles« »Best Popular Physical Science Books« von The Guardian Auf der Longlist des Royal Society Winton Prize
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 877
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
W. BERNARD CARLSON
TESLA
W. BERNARD CARLSON
TESLA
DER ERFINDER DES ELEKTRISCHEN ZEITALTERS
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
6. Auflage 2024
© 2017 by FinanzBuch Verlag,
ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Die englische Originalausgabe erschien 2013 bei Princeton University Press unter dem Titel Tesla: Inventor of the Electrical Age.
© der Originalausgabe 2013 by Princeton University Press. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Elisabeth und Thomas Gilbert
Redaktion: Dr. Carina Heer
Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Sven Hirsch
Korrektorat: Desirée Šimeg
Umschlaggestaltung: Laura Osswald
Umschlagabbildung: Getty Images/Buy enlarge
Satz: ZeroSoft, Timisoara
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-95972-007-6
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86248-991-6
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86248-992-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter
www.m-vg.de
INHALT
Abbildungsverzeichnis
EINLEITUNG:
Dinner bei Delmonico’s
KAPITEL 1:
Eine ideale Kindheit (1856–1878)
KAPITEL 2:
Der Traum vom perfekten Motor (1878–1882)
KAPITEL 3:
Learning by Doing oder erste praktische Erfahrungen (1882–1886)
KAPITEL 4:
Der Wechsel strom findet seinen Meister (1886–1888)
KAPITEL 5:
Der Verkauf des Motors (1888–1889)
KAPITEL 6:
Die Suche nach einem neuen Ideal (1889–1891)
KAPITEL 7:
Ein wahrhafter Magier (1891)
KAPITEL 8:
Die Show kommt nach Europa (1891–1892)
KAPITEL 9:
Der Wechsel strom setzt sich in den USA durch (1892–1893)
KAPITEL 10:
Drahtlose Beleuchtung und der Oszillator (1893–1894)
KAPITEL 11:
Werbung ist alles (1894–1895)
KAPITEL 12:
Auf der Suche nach Alternativen (1895–1898)
KAPITEL 13:
Stehende Wellen (1899–1900)
KAPITEL 14:
Ein Traum wird wahr in Warden clyffe (1900–1901)
KAPITEL 15:
Der dunkle Turm (1901–1905)
KAPITEL 16:
Lebenslang ein Visionär (1905–1943)
Epilog
Angaben zu Quellen und Literatur
Archivarische Sammlungen
Abkürzungen und Quellen
Danksagungen
Über den Autor
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 0.1: Zeigt den Erfinder im glänzenden Schein von Myriaden elektrischer Lichtblitze, nachdem er sich selbst hohen Spannungen ausgesetzt hatte
Abb. 1.1: Teslas Vater Milutin (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 1.2: Teslas Geburtshaus in Smiljan, Provinz Lika (© Kenneth M. Swezey Papers, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution)
Abb. 2.1: Faradays Grundsatz elektromagnetischer Induktion
Abb. 2.2: Diagramm, das die Rechte-Hand-Regel veranschaulicht
Abb. 2.3: Der Magnet von Hippolyte Pixii mit dem ersten Kommutator von 1832
Abb. 2.4: Vereinfachte Ansicht eines elektrischen Generators
Abb. 2.5: Vereinfachte Ansicht eines Kommutators in einem elektrischen Generator
Abb. 2.6: Gramme-Dynamo für Vorführungen im Klassenzimmer
Abb. 2.7: Aragos drehende Scheibe und Babbages sowie Herschels Variation
Abb. 2.8: Wirbelströme in einer sich drehenden Scheibe in einem magnetischen Feld
Abb. 2.9: Bailys elektrischer Motor von 1879
Abb. 3.1: Die ersten von Zipernowsky, Bláthy und Déri in den Jahren 1884 und 1885 entwickelten Transformatoren (© Wikimedia Commons/Zátonyi Sándor)
Abb. 3.2: Tesla in Paris, 1883 (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 3.3: Diagramm aus einem späteren Tesla-Patent
Abb. 3.4: Darstellung des Wechselstrommotors, den Tesla 1882 in Straßburg baute
Abb. 3.5: Eine Gruppe Männer steht vor den Edison-Maschinenwerken auf der Goerck Street in New York (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 3.6: Tesla im Jahre 1885 (© Kenneth M. Swezey Papers, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution)
Abb. 4.1: Teslas thermoelektrischer Motor von 1886
Abb. 4.2: Teslas pyromagnetischer Generator von 1886–1887
Abb. 4.3: Teslas Wechselstrommotor von 1887
Abb. 4.4: Teslas Aufbau für das Ei des Kolumbus, etwa 1887
Abb. 4.5: Teslas grundlegende Anordnung für seine Versuche mit Wechselstrommotoren im Herbst 1887
Abb. 4.6: Tesla-Motor, gebaut 1887–1888 (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 5.1: Ferraris’ Wechselstrommotor, etwa 1885
Abb. 6.1: Skizze des Apparats, den Hertz nutzte, um elektromagnetische Wellen zu untersuchen
Abb. 6.2: Skizze einer Teslaspule
Abb. 7.1: Der Stromkreis, den Tesla für seinen Vortrag von 1891 am Columbia College benutzte
Abb. 7.2: Tesla präsentiert im Mai 1891 seine drahtlosen Lampen vor dem American Institute of Electrical Engineers
Abb. 7.3: Diese Skizze zeigt, wie Tesla seinen Sender und Empfänger erdete
Abb. 8.1: Der Apparat, den Tesla für seinen Londoner Vortrag von 1892 nutzte, um den Namen von Sir William Thomson aufleuchten zu lassen
Abb. 8.2: Motor mit nur einem Draht, den Tesla 1892 bei seinem Vortrag in London vorführte
Abb. 8.3: »Paris – Herr Tesla hält einen Vortrag vor der Gesellschaft der französischen Physiker und der Internationalen Vereinigung der Elektrotechniker«
Abb. 10.1: Empfänger, den Tesla Mitte der 1890er Jahre benutzte, um elektromagnetische Wellen aufzuspüren (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 10.2: Teslas Oszillator, oder die Kombination von Dampfmaschine und Generator
Abb. 10.3: Stromkreis, den Tesla benutzte, um drahtlose Energie an seine Lampen in seinem Labor in der South Fifth Avenue zu liefern, circa 1894
Abb. 10.4: Die Empfängerspule für Teslas Resonanztransformator, wie er sie circa 1894 in seinem Labor in der South Fifth Avenue benutzte (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 10.5: »Drei phosphoreszierende Birnen, auf ihre Aktinität getestet und mit Eigenlicht fotografiert.«
Abb. 11.1: Tesla um 1894/95 (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 11.2: Robert Underwood Johnson und Tesla im Labor in der South Fifth Avenue (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 11.3: Katharine Johnson (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 11.4: »Die erste jemals mit phosphoreszierendem Licht aufgenommene Fotografie«
Abb. 11.5: Mark Twain in Teslas Labor, 1894
Abb. 11.6: Teslas Vision der drahtlosen Stromübertragung im Vergleich zu den Plänen seiner Zeitgenossen in den 1890er Jahren
Abb. 11.7: »Teslaspule zur Gewinnung und Entladung der Erdelektrizität« (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 12.1: Teslas Labor in der East Houston Street (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 12.2: »Tesla in seinem Labor – Porträt, entstanden bei zwei Sekunden Belichtung durch eine einzelne Vakuumröhre ohne Elektroden, mit einem Volumen von etwa 1,5 Litern und der Leuchtkraft von 250 Kerzenstärken« (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 12.3: Von Tesla 1896 angefertigtes Schattenbild eines menschlichen Fußes in einem Schuh (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 12.4: Skizze eines Querschnitts durch Teslas erstes funkgesteuertes Boot von 1898
Abb. 12.5: Skizze von Teslas funkgesteuertem Boot und Sender
Abb. 12.6: Zeitungsillustration, die Teslas funkgesteuertes Boot so zeigt, wie er es auf der Pariser Weltausstellung vorführen wollte
Abb. 12.7: Undatierte Bleistiftskizze von Tesla in einem Café (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 12.8: Richmond P. Hobson (© Kenneth M. Swezey Papers, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution)
Abb. 12.9: NT, »Electrical Transformer«, US-Patent 593.138 (eingereicht am 20.03.1897, erteilt am 02.11.1897)
Abb. 12.10: Vorführung, die 1898 in Teslas Labor in der Houston Street stattfand, um zu zeigen, dass sich Hochfrequenzströme bei niedrigem Druck durch Gas leiten lassen (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 12.11: Tesla, »System of Transmission of Electrical Energy«, US-Patent 645.675 (eingereicht am 02.09.1897, erteilt am 20.03.1900)
Abb. 12.12: »Die von Tesla geplanten Ballonstationen zur drahtlosen Übertragung von Elektrizität«
Abb. 12.13: »Teslas System zur Übertragung von elektrischem Strom auf natürlichem Wege (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 13.1: Colorado Springs Anfang des 20. Jahrhunderts
Abb. 13.2: Blick auf die Versuchsstation von der Pikes Peak zugewandten Seite (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 13.3: Das Innere der Versuchsstation (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 13.4: Die Abbildung zeigt, wie Jupiters Mond Io den Ring aus geladenen Teilchen durchläuft
Abb. 13.5: Darstellung eines typischen Schaltkreises, wie Tesla ihn in Colorado Springs nutzte
Abb. 13.6: Darstellung von Teslas abgestimmtem Stromkreis in Colorado Springs
Abb. 13.7: Der Verstärkungssender mit mehreren Sekundärspulen (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 13.8: »Versuch zur Veranschaulichung des induktiven Effekts eines elektrischen Resonanztransformators mit großer Leistung« (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 13.9: »Versuch zur Veranschaulichung der Übertragung von elektrischer Energie ohne Kabel« (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 13.10: Unbekannter Assistent [möglicherweise Lowenstein?] am Hauptnetzschalter in der Versuchsstation (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 13.11: »Entladung der Zusatzspule, ausgehend von vielen am Messingring [auf der Spule] befestigten Drähten« (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 13.12: Tesla sitzt im Verstärkungssender, während die Entladung von der
Sekundärspule zu einer anderen Spule übergeht (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 14.1: Stanford Whites Entwurf für Teslas Labor (© Christopher J. Bach)
Abb. 14.2: Der Maschinenraum in Wardenclyffe (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 14.3: Der Raum für Motor und Dynamo in Wardenclyffe (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 14.4: Der Elektronikraum in Wardenclyffe, gefüllt mit diversen Geräten (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 14.5: Das Labor und der Turm von Wardenclyffe (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 14.6: Diese Patentskizze für den Wardenclyffe-Turm zeigt eine Version des oberen Kontakts sowie den Schaltkreis, den Tesla zu benutzen plante
Abb. 14.7: Der Turm von Wardenclyffe mit einer Halbkugel als oberer Kontakt (© Kenneth M. Swezey Papers, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution)
Abb. 15.1: »Teslas drahtloser Sendeturm, 62 Meter hoch, in Wardenclyffe, N. Y., von dem die Stadt New York mit Elektrizität versorgt wird, und mit dessen Hilfe Camper, Segler und Sommerurlauber ohne Zeitverlust mit Freunden zu Hause kommunizieren können werden«
Abb. 15.2: Ein De-Forest-Wireless-Automobil im New Yorker Finanzviertel im Jahre 1903
Abb. 15.3: Tesla im Jahre 1904 (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 15.4: Titelseite von Teslas Broschüre, Februar 1904
Abb. 15.5: Teslas Vision der Erde, wie sie mit inkompressiblem Fluid gefüllt wird
Abb. 16.1: Tesla-Turbine
Abb. 16.2: Teslas Turbinenversuchsanlage in der Edison Waterside Station, New York, im Jahre 1912
Abb. 16.3: Tesla in seinem Büro im Woolworth Building, ca. 1916 (© Deutsches Museum, München, Archiv, CD_62746)
Abb. 16.4: Tesla während eines Interviews anlässlich seines Geburtstags im Jahre 1935
Abb. 16.5: Teslas Plan für einen Hochspannungsgenerator, der als Teilchenstrahlenwaffe benutzt werden sollte (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Abb. 16.6: Diese Skizze zeigt den Projektor, den Tesla nutzen wollte, um einen Strahl mit stark geladenen Quecksilberpartikeln von seiner Strahlenwaffe abzufeuern (© Nikola Tesla Museum, Belgrad)
Für Jane, die mir von Anfang an Glauben geschenkt hat.Für Tom Hughes, dem ich für immer zu Dank verpflichtet sein werde.
Es ist etwas in mir, das Einbildung sein könnte, wie es so oft bei jungen überglücklichen Menschen der Fall ist, aber sollte ich das Glück haben, einige meiner Ideale zu erreichen, dann wäre es im Interesse der ganzen Menschheit.
Nikola Tesla, 1892
EINLEITUNG:
DINNER BEI DELMONICO’S
Es war ein heißer Sommerabend im New York des Jahres 1894, und der Reporter hatte beschlossen, dass es an der Zeit war, den Magier zu treffen.
Der Reporter, Arthur Brisbane, war ein aufstrebender Zeitungsjournalist von Joseph Pulitzers New York World. Er hatte über den rätselhaften Fall von Jack the Ripper in London berichtet, über den Stahlarbeiterstreik in Homestead, Pittsburgh, und über die erste Hinrichtung auf einem elektrischen Stuhl in Sing Sing. Brisbane hatte ein Gespür fürs Detail und konnte Geschichten erzählen, die Hunderttausende Leser faszinierten. Später würde er leitender Redakteur von William Randolph Hearsts New York Journal werden, den Spanisch-Amerikanischen Krieg unterstützen und den Boulevardjournalismus neu definieren.1
Brisbane schrieb vor allem Artikel für die neue Sonntagsausgabe der World und hatte bereits Premierminister und Päpste, Preisboxer und Schauspielerinnen porträtiert. Nun war er auf einen Erfinder aufmerksam geworden, über den er schreiben wollte: Nikola Tesla. Dessen Name war in aller Munde: »Jeder Wissenschaftler und selbst jeder Trottel kennt seine Arbeit […] in der New Yorker Society ist er bekannt wie ein bunter Hund.« Seine Erfindungen dienten nicht nur der Elektrizitätsgewinnung in dem neuen Kraftwerk, das gerade an den Niagarafällen entstand; Tesla hatte sogar seinen eigenen Körper 250 000-Volt-Schlägen ausgesetzt, um die Sicherheit von Wechselstrom zu beweisen. Bei solchen Vorführungen avancierte Tesla zu einer fürwahr »strahlenden Gestalt, bei der Flammen des Lichts aus jeder Pore drangen, von den Fingerspitzen bis zu sämtlichen Haarspitzen auf seinem Kopf« (Abb. 0.1). Aus einem Dutzend zuverlässiger Quellen hatte Brisbane erfahren, dass »es nicht den geringsten Zweifel gab, dass dies ein sehr berühmter Mann war«. »Unseren herausragendsten Elektriker« nannten ihn die Leute. »Bedeutender noch als Edison.«2 Brisbane war neugierig geworden. Wer war dieser Mann? Was trieb ihn an? Konnte man aus diesem Tesla eine gute Story für Tausende von Lesern herrausholen?
Abb. 0.1 »Zeigt den Erfinder im glänzenden Schein von Myriaden elektrischer Lichtblitze, nachdem er sich selbst hohen Spannungen ausgesetzt hatte.«
Quelle: Arthur Brisbane: »Our Foremost Electrician«, New York World, 22.07.1894, in TC 9: 44–48, S. 46.
Der Reporter hatte gehört, dass der Magier regelmäßig im angesagtesten Restaurant Manhattans essen ging, dem Delmonico’s am Madison Square. Die Küchenchefs des Delmonico’s hatten sich mit Gerichten wie Lobster Newberg, Chicken à la King und Baked Alaska einen Namen gemacht. Aber mehr noch als für sein Essen war das Delmonico’s bekannt als Dreh- und Angelpunkt der besseren New Yorker Kreise, war der Ort zum Sehen und Gesehenwerden. Hier dinierte die alte Aristokratie, die von Ward McAllister benannten berühmtesten 400 Persönlichkeiten, Seite an Seite mit dem neuen Geldadel der Wall Street und der aufsteigenden Mittelklasse. Hier fanden ebenso Bälle und Tanzabende statt wie Pokerrunden und Herrenabende, Damen verabredeten sich zum Lunch, Theaterbesucher nach den Vorstellungen zum späten Abendessen. Ohne das Delmonico’s, bemerkte der New York Herald, »würde die ganze soziale Maschinerie der Unterhaltungswelt […] zum Stillstand kommen«.3 Dieser Magier, dachte Brisbane, war offensichtlich ebenso ambitioniert wie stilbewusst. Was trieb ihn an?
Brisbane traf Tesla an jenem späten Sommerabend im Delmonico’s an, als dieser sich mit Charles Delmonico unterhielt, dessen Schweizer Großonkel das Restaurant 1831 eröffnet hatten. Tesla, der zuvor in Prag, Budapest und Paris gelebt hatte, fiel es leicht, mit einem Mann wie Charles Delmonico zu plaudern. Wahrscheinlich hatte Tesla einen langen Tag in seinem Labor in der Innenstadt verbracht und war nun zum Abendessen hier vorbeigekommen, bevor er in sein Hotel heimkehren würde, dem Gerlach, das gleich um die Ecke lag.
Der Reporter betrachtete das äußere Erscheinungsbild des Magiers sorgfältig:
»Nikola Tesla ist nahezu der größte und dünnste und mit Sicherheit der ernsthafteste Mann, der regelmäßig ins Delmonico’s geht.
Er hat sehr tief liegende Augen. Sie sind ziemlich hell. Ich fragte ihn, wie es komme, dass er als Slawe so helle Augen habe. Er erzählte, dass seine Augen früher einmal viel dunkler gewesen seien, aber durch das viele Denken seien sie um einige Nuancen heller geworden. […]
Er ist sehr dünn, über ein Meter achtzig groß und wiegt gerade mal 60 Kilo. Er hat sehr große Hände. Viele begabte Menschen haben das – Lincoln zum Beispiel. Seine Daumen sind bemerkenswert groß, selbst für so große Hände. Sie sind außergewöhnlich groß. Das ist ein gutes Zeichen. Der Daumen ist der intellektuelle Teil der Hand. […]
Nikola Tesla hat einen Kopf, der sich oben wie ein Fächer ausbreitet. Sein Kopf ist wie ein Keil geformt. Sein Kinn ragt wie ein Eispickel nach vorne. Sein Mund ist zu schmal. Sein Kinn ist zwar nicht schwach, aber auch nicht stark genug ausgeprägt.«
Während er Teslas äußere Erscheinung studierte, versuchte Brisbane sich auch ein Bild von seinem Charakter zu machen:
»Sein Gesicht kann man nicht studieren und beurteilen wie das von anderen Menschen, denn er ist kein normaler Arbeiter. Sein Leben spielt sich oben in seinem Kopf ab, dort, wo Ideen Gestalt annehmen und er reichlich Platz hat. Sein Haar ist schwarz wie Tinte und gelockt. Er geht gebückt – wie die meisten Menschen, wenn sie nicht gerade das Blut eines Pfaus in sich tragen. Er lebt ganz in seiner eigenen Welt. Sein größtes Interesse gilt seiner Arbeit. Er verströmt diese Mischung aus Eigenliebe und Selbstbewusstsein, die gewöhnlich mit dem Erfolg einhergeht. Und er unterscheidet sich von den meisten Menschen, über die geschrieben und geredet wird, insofern als er etwas zu erzählen hat.«
Wie andere Reporter hatte Brisbane sich das nötige Hintergrundwissen verschafft – dass Tesla 1856 in einer serbischen Familie in Smiljan geboren wurde, einem kleinen Bergdorf in der militärischen Grenzregion des österreichisch-ungarischen Reichs (im heutigen Kroatien), dass er schon als Junge die ersten Erfindungen gemacht hatte und dass er ein technisches Studium im österreichischen Graz absolviert hatte. Erpicht darauf, voranzukommen, war Tesla nach Amerika immigriert und 1884 mittellos in New York angekommen.
Teslas kometenhafter Aufstieg seit 1884 lieferte eine großartige Zeitungsgeschichte. Nachdem er kurz für Edison gearbeitet hatte, nahm Tesla sein Schicksal in die eigenen Hände, richtete sich ein Labor ein und erfand einen neuen Wechselstrommotor, der auf einem sich drehenden Magnetfeld basierte. Obwohl Tesla versucht hatte, Brisbane das Prinzip zu erklären, das hinter dem rotierenden Magnetfeld stand, kam der Autor zu dem Schluss, dass dies »eine Sache sei, die man beschreiben, aber nicht verstehen kann«. Dafür betonte Brisbane, dass die Unternehmer des Wasserkraftwerkprojekts an den Niagarafällen Edisons Gleichstromsystem abgelehnt und sich stattdessen für Teslas Vorschlag entschieden hatten, elektrische Energie durch mehrphasigen Wechselstrom zu gewinnen und zu übertragen. Teslas Arbeiten in der Elektrizitätstechnik waren weithin anerkannt, doch Brisbane hätte auch noch hinzufügen können, dass Tesla Vorträge vor profilierten wissenschaftlichen Verbänden gehalten hatte und von Columbia und Yale mit Ehrendoktortiteln ausgezeichnet worden war. In gerade mal zehn Jahren hatte es der Mann, der vor Brisbane saß, vom Habenichts zu Amerikas bedeutendstem Erfinder gebracht. Das war doch mal eine perfekte Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte.
Aber was bringt die Zukunft, fragte Brisbane, zumal der Magier erst 38 Jahre alt war. Ah, »die Elektrizität der Zukunft« – das war ein Thema, über das Tesla sich leidenschaftlich gern ausließ:
»Wenn Herr Tesla über die Herausforderungen der Elektrizität redet, die er zu lösen sucht, wird er zu einer wahrlich faszinierenden Person. Nicht ein einziges Wort von dem, was er sagt, kann man verstehen. Er unterteilt die Sekunden in Millionstel Bruchteile und will aus dem Nichts genügend Strom gewinnen, um alle Arbeiten in den Vereinigten Staaten erledigen zu lassen. Er glaubt, dass die Elektrizität alle Arbeitsprobleme bewältigen wird. […] Herrn Teslas Theorien zufolge ist es sicher, dass schwere Arbeit in der Zukunft darin bestehen wird, auf elektrische Knöpfe zu drücken. In ein paar Jahrhunderten werden Kriminelle […] dazu verurteilt, täglich 15 elektronische Knöpfe zu drücken. Ihre Landsleute, die bis dahin längst von Arbeit entwöhnt sind, werden auf diese Schufterei voll Mitleid und Entsetzen herabblicken.«
Brisbane hörte Tesla mit gespannter Aufmerksamkeit zu, wie er beschrieb, dass er gerade elektrisches Licht perfektioniere, indem er hochfrequenten Wechselstrom benutzte, um Edisons Glühbirnen zu ersetzen. »Verglichen mit Teslas Idee«, dachte Brisbane, »ist das gegenwärtige System für Glühlampen so primitiv wie ein Ochsenkarren mit zwei schlichten Holzrädern gegenüber einer modernen Eisenbahn.« Mit noch mehr Begeisterung sprach der Magier jedoch von seiner Idee der drahtlosen Übertragung von Energie und Nachrichten: »Sie mögen glauben, ich sei ein Träumer oder sehr verstiegen«, sagte er, »wenn ich Ihnen erzähle, worin meine wahre Hoffnung liegt. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich mit absoluter Zuversicht dem Tag entgegenblicke, an dem man Nachrichten vollkommen drahtlos durch die Erde schickt. Ich hege weiterhin große Hoffnungen, auf gleiche Weise elektrische Kräfte verlustfrei zu übertragen. Was die Übertragung von Nachrichten durch die Erde betrifft, bin ich von deren Erfolg restlos überzeugt.«
Stundenlang unterhielt sich der Reporter mit dem Magier, denn »alles, was er erzählte, war interessant, sowohl die elektrischen Details wie alles andere«. Tesla sprach über seine serbische Herkunft und seine Liebe zur Dichtkunst. Er erzählte Brisbane, dass er harte Arbeit schätze, aber dass Ehe und Liebe sich nicht mit seinem Erfolg vereinbaren ließen. Er glaubte nicht an Gedankenübertragung oder »psychische Elektrizität«, war jedoch fasziniert von den Möglichkeiten des menschlichen Geistes. »Ich unterhielt mich mit Herrn Tesla aus Smiljan«, schrieb Brisbane, »bis zum Morgengrauen, als die Putzfrauen bereits den Marmorboden im Delmonico’s zu schrubben begannen.« Sie trennten sich als Freunde. Brisbane schrieb eine Titelgeschichte, die Tesla zum Begriff für jedermann machte, und avancierte später zu einem der mächtigsten leitenden Zeitungsredakteure Amerikas.
Was passierte also mit dem Magier? Auch wenn er es zu dieser Zeit nicht wissen konnte, hatte Tesla im Sommer des Jahres 1894 seinen Zenit erreicht. Im Laufe der vorangegangenen zehn Jahre hatte er sich eines kometenhaften Aufstiegs erfreut und war von seinen Kollegen unter den Ingenieuren und Wissenschaftlern in hohem Maße bewundert worden. So verkündete der in London erscheinende Electrical Engineer: »Kein anderer Mensch unserer Zeit hat mit einem einzigen Schritt eine derart universelle wissenschaftliche Reputation erreicht wie dieser Elektrizitätsingenieur.«4 Welche Brillanz, welches Versprechen – was passierte dann?
In der darauffolgenden Dekade, von 1894 bis 1904, setzte Tesla seine Erfindungen fort, entwickelte einen hochfrequenten Hochspannungstransformator (heutzutage als Teslaspule bekannt), neue elektrische Lampen, eine Mischung aus Dampfmaschine und elektrischem Generator und eine Reihe anderer Geräte. Tesla war einer der Ersten, der mit den 1885/86 von Heinrich Hertz nachgewiesenen unsichtbaren elektromagnetischen Wellen experimentierte und versuchte, sie für neue Technologien zu nutzen, unter anderem für ein aufsehenerregendes ferngesteuertes Boot. Teslas großer Traum blieb jedoch, Energie und Nachrichten durch die Erde zu übertragen, womit sich die existierenden Netzwerke für Strom, Telefon und Telegrafie als überflüssig erweisen würden. Um diesen Traum zu verwirklichen, richtete er in Colorado Springs und in Wardenclyffe auf Long Island Versuchsanstalten ein, denn er war sich sicher, dass sein System technisch realisierbar war und Millionen von Dollar fließen lassen würde. Obwohl Tesla bereits 1899 die kühne Aussage getroffen hatte, dass er Nachrichten über den Atlantik schicken würde, kam Guglielmo Marconi ihm 1901 zuvor, und so ging Marconi als Erfinder des Funks in die Geschichtsbücher ein. Zwischen 1903 und 1905 konnte Tesla keine Geldgeber mehr für seine Erfindungen gewinnen, er hatte Probleme mit seinen Instrumenten und erlitt schließlich einen Nervenzusammenbruch. Auch wenn er bis 1943 lebte, lagen Teslas beste Tage bereits 1904 hinter ihm. So schrieb Laurence A. Hawkins 1903:
»Wäre vor zehn Jahren die Öffentlichkeit in diesem Land gefragt worden, den vielversprechendsten Mann auf dem Gebiet der Elektrizität zu benennen, hätte die Antwort ganz ohne Zweifel ›Nikola Tesla‹ gelautet. Heute ruft sein Name im besten Fall das Bedauern hervor, dass so ein großes Versprechen unerfüllt geblieben ist.«5
Wenn man über Tesla schreibt, muss man unterscheiden zwischen unfairer Kritik und übertriebenem Enthusiasmus. Einerseits können wir uns Hawkins’ Leitartikel anschließen und Tesla aburteilen, weil er seine Erfindungen nach 1894 nicht mehr vollendete, besonders seinen Plan für drahtlose Energieübertragung. Sicherlich musste jemand, der so entschieden an diese Möglichkeit glaubte und den Status quo des Big Business und der technologischen Systeme herausforderte, entweder verrückt sein oder falsch liegen. Ja, Tesla hatte mit dem Wechselstrom den richtigen Weg eingeschlagen, aber mit dem Funk hatte er sich verrannt, weswegen Marconi ihn hatte ausstechen können. Für mich führt diese Betrachtungsweise zu einem irreführenden Zwiespalt: Wenn Erfinder ihre Sache gut machen, werden sie als Genies gepriesen, wenn sie scheitern, gelten sie als verrückt.
Andererseits ist es einfach, Tesla als eine Persönlichkeit zu feiern, die in puncto technologischer Kunstfertigkeit direkt hinter Leonardo da Vinci kommt. Tesla hat ergebene Fans, die glauben, dass er Elektrizität und Elektronik im Alleingang erfunden hat.6 So konstatierte ein Fan auf seiner Webseite:
»Tesla erfand so ziemlich alles. Wenn du an deinem Computer arbeitest, denk an Tesla. Seine Teslaspule liefert die Hochspannung für die Bildröhre, die du benutzt. Der Strom für deinen Computer stammt von einem von Tesla entworfenen Wechselstromgenerator, wird durch einen Tesla-Transformator geleitet und erreicht dein Haus als dreiphasiger Tesla-Strom.«7
Ich stimme von ganzem Herzen zu, dass wir verstehen müssen, wie Tesla diese wegweisenden Apparaturen erfunden hat, und dass wir seine Rolle in der elektrischen Revolution, die die Gesellschaft zwischen 1880 und 1920 neu gestaltet hat, würdigen sollten.8 Aber bei diesem Vorhaben sollten wir vorsichtig sein, Tesla nicht in einen »Superman« mit fantastischen intellektuellen Kräften zu verwandeln.9
Ältere Biografien über Tesla haben die Tendenz, ihn über Gebühr zu feiern.10 In diesem Buch möchte ich einen Mittelweg einschlagen. Ich will Tesla nicht nur feiern, sondern auch kritisch betrachten. Seinem spektakulären Aufstieg (1884–1894) folgte ein gleichermaßen dramatischer Abstieg (1895–1905). Die Aufgabe eines Tesla-Biografen ist es, dessen Leben Stück für Stück zusammenzufügen, sodass sowohl sein Aufstieg als auch sein Abstieg Sinn ergeben. Tatsächlich sollten die Umstände, durch die ein Individuum zu Erfolg gekommen ist, auch Erklärungen für das Scheitern dieser Person liefern. Ein Maßstab für eine gute historische Auslegung heißt Symmetrie – sodass sowohl der Erfolg als auch das Versagen in den Fokus des Betrachters rücken.
Während sich vorangegangene Biografien zudem weitestgehend auf Teslas Persönlichkeit konzentriert haben, versucht dieses Buch, den Menschen und seine schöpferische Arbeit ausgewogen zu würdigen. Im Laufe des Buchs werde ich versuchen, drei grundsätzliche Fragen zu beantworten: Wie ist Tesla zu seinen Erfindungen gekommen? Wie funktionierten seine Erfindungen? Und was passierte, als er seine Erfindungen vorstellte? Um diese Fragen zu beantworten, werde ich auf Teslas Korrespondenz ebenso zurückgreifen wie auf Geschäftsberichte, Nachlässe, Publikationen und andere Dinge, die die Zeit überdauert haben. Einige Leser werden enttäuscht sein, dass ihre Lieblingsanekdote über Tesla hier nicht auftaucht, und möglicherweise werden hier mehr technische Details besprochen, als ihnen lieb ist. Als Historiker muss ich jedoch Teslas Geschichte erzählen, soweit sie dokumentiert ist, ohne Rücksicht auf jene Vorstellungen und Träume, die wir möglicherweise auf Helden wie Tesla projizieren. In vielerlei Hinsicht hatte Brisbane Recht, als er sagte, das Ziel seiner Geschichte sei, »diesen großartigen neuen Elektriker von Grund auf zu entdecken, damit Amerikaner sich für Teslas Persönlichkeit interessieren und so seine zukünftigen Leistungen mit Bedacht und Sorgfalt studieren können«.
KONZEPTE UND THEMEN
Um die Geschichte von Teslas dramatischem Aufstieg und Fall zu erzählen, benötigen wir einen Rahmen, der es uns erlaubt, die Puzzleteile dieser Geschichte zusammenzufügen. Gerade weil Tesla ein Erfinder war, müssen wir uns in besonderer Weise Gedanken zu Erfindungen als solche machen. Aus meiner Sicht ist es allzu leicht, Erfindungen mit Unwägbarkeiten wie Genie, Wunder und Glück in Verbindung zu bringen – im Gegensatz dazu betrachte ich eine Erfindung als einen Prozess, den wir analysieren und verstehen können.11
Erfindungen entstehen aus Aktivitäten, mit denen Individuen neue Geräte und Prozesse erschaffen, die menschlichen Bedürfnissen und Wünschen dienen sollen. Damit das überhaupt möglich ist, muss ein Erfinder oftmals Phänomene der Natur untersuchen. In einigen Fällen braucht ein Erfinder nur die Natur ganz genau zu beobachten, um herauszufinden, was funktionieren wird. In anderen Fällen muss er neue Einsichten durch Experimente gewinnen. Weil die Natur nicht ohne Weiteres ihre Geheimnisse preisgibt, könnte man sagen, dass ein Erfinder mit der Natur »verhandelt«.12
Gleichzeitig definiert sich eine Erfindung nicht einfach darüber, wie etwas gemacht wird; ein Erfinder muss seine Erfindung auch mit der Gesellschaft in Verbindung bringen. In einigen Situationen sind die Bedürfnisse klar definiert, und die Gesellschaft wartet nahezu auf eine neue Erfindung. Als die Eisenbahnen Mitte des 19. Jahrhunderts stärkere Schienen und die Armee stärkere Kanonenrohre brauchten, war die Nachfrage nach der von Henry Bessemers 1856 eingeführten neuen Methode der Stahlerzeugung groß. In anderen Situationen gibt es keine bereits existierende Notwendigkeit, und ein Erfinder muss die Gesellschaft vom Nutzen einer Erfindung überzeugen. Als Alexander Graham Bell 1876 das Telefon erfand, erklärten sich nur wenige Menschen bereit, eines zu kaufen. Tatsächlich benötigte die Bell Telephone Company Jahrzehnte, um die Amerikaner davon zu überzeugen, dass jeder Haushalt ein Telefon brauchte. Bell und die ihm nachfolgenden Unternehmen mussten nicht nur das Telefon erfinden, sondern auch eine Marketingstrategie, die die Interessen der Benutzer aufgriff. In diesem Sinne »verhandeln« Erfinder mit der Gesellschaft.13
Was Erfindungen interessant macht, ist, dass Erfinder auf dem Grat zwischen Natur und Gesellschaft wandeln. Einerseits müssen sie gewillt sein, sich mit der Natur zu beschäftigen, um herauszufinden, was wie funktioniert, andererseits müssen sich Erfinder auch mit der Gesellschaft auseinandersetzen und ihre Erfindungen gegen Geld, Ruhm oder Hilfsmittel eintauschen. Um erfolgreich zu sein, müssen Erfinder auf beiden Seiten kreativ sein – und insofern sowohl mit der Natur als auch mit der Gesellschaft verhandeln können.
Indem sie sich zwischen Natur und Gesellschaft bewegen, entwickeln Erfinder ihre eigene Weltanschauung und kreative Methode, in denen sich ihre Persönlichkeit, Bildung, Erfahrung und ihr Umfeld widerspiegeln. Erfinder finden ihre eigenen Wege, die Natur zu erforschen, aus ihren Entdeckungen funktionierende Geräte zu entwickeln und schließlich andere Menschen davon zu überzeugen, dass das von ihnen Geschaffene sinn- und wertvoll ist. Im Laufe von Teslas Geschichte wird man sehen, dass seine Herangehensweise von seinem religiösen Hintergrund, seinen Freunden und Förderern sowie seinen Depressionen beeinflusst wurde. Wie Thomas Hughes bemerkte, entwickeln Erfinder – wie Künstler – einen einzigartigen Stil.14
Teslas Stil als Erfinder definierte sich aus dem Spannungsfeld zwischen Ideal und Illusion. Ich habe dieses Spannungsfeld dem Höhlengleichnis entlehnt, das Platon in Der Staat beschreibt.15 Platon hatte dieses Gleichnis aufgestellt, um den Unterschied zwischen Unwissenheit und Erkenntnis zu illustrieren, zwischen der Wahrnehmung von Welt und Wirklichkeit bei normalen Menschen und bei Philosophen. Um deutlich zu machen, dass normale Menschen ein beschränktes Verständnis von Wirklichkeit haben, stellte er sich eine Gruppe von Menschen vor, die, gefangen in einer Höhle, an Stühle gefesselt waren und deren Köpfe so befestigt wurden, dass sie sich nicht herumdrehen und sehen konnten, wie das Licht (oder die Wahrheit) in die Höhle eindrang. Auf diese Art und Weise gefangen, verbrachten sie ihr Leben damit, über die sich bewegenden Schatten zu sprechen, die an die Wand projiziert wurden und die von Menschen und Gegenständen stammten, die sich vor einem hinter der Gruppe gelegenen Feuer bewegten. Für Platon hieß das, dass normale Menschen nur mit Illusionen umzugehen wissen. Im Gegensatz dazu glaubte Platon, dass ein Philosoph wie ein Gefangener sei, der, von den Fesseln befreit, verstehe, dass die Schatten an der Wand nur wenig mit der Realität zu tun hatten, denn er könne auf diese Weise die wahre Realität erkennen – erkennen, dass die Schatten durch das Feuer und die sich bewegenden Objekte entstanden. Platons Philosophen konnten direkt aufs Feuer und sogar in die Sonne außerhalb der Höhle blicken, um die Wahrheit zu verstehen. Nur Philosophen, schloss Platon, konnten universelle Wahrheiten begreifen: Ideale.
Wie wir sehen werden, war Tesla wie einer von Platons Philosophen, jemand, der sich entschlossen hatte, Ideale zu suchen und zu verstehen. So erzählte Tesla einem Biografen, dass er von einem Spruch von Sir Isaac Newton inspiriert worden sei: »Ich halte einfach den Gedanken so lange vor meinem geistigen Auge fest, bis mir alles klar ist.«16 Während er sich die Natur für seine Erfindungen zunutze machte, investierte Tesla viel Zeit und Energie in dem Bemühen, das grundlegende Prinzip einer Erfindung zu erkennen, und arbeitete daran, dieses Ideal auf ein funktionierendes Gerät zu übertragen. Bei seinem Wechselstrommotor war dieses Ideal das magnetische Drehfeld; in ähnlicher Weise war das Ideal der elektromagnetischen Resonanz die Basis für seine Geräte zur drahtlosen Übertragung von elektrischer Energie.
Bei einigen Gelegenheiten äußerte sich Tesla ausführlich über seine idealistische Herangehensweise an Erfindungen; so beschrieb er es seinen Kollegen der Elektrotechnik, als er 1917 mit der Edison-Medaille ausgezeichnet wurde, wie folgt:
»Ich habe unbewusst etwas entwickelt, was ich als eine neue Methode betrachte, schöpferische Ideen und Konzepte zu verwirklichen, und die ganz im Gegensatz zu der rein experimentellen Methode steht, die in Edison zweifellos ihren größten und erfolgreichsten Vertreter hat. In dem Moment, in dem man ein Gerät entwirft, um eine noch nicht ausgereifte Idee in die Praxis umzusetzen, wird man zwangsläufig von den Details und Fehlern der Apparatur in Beschlag genommen. Während man dann mit Verbesserungen und neuen Entwürfen beschäftigt ist, lässt die Konzentration nach und man verliert den Blick für das große grundlegende Prinzip. Man erzielt Resultate, aber opfert dafür die Qualität.
Meine Methode ist anders. Ich habe es nicht eilig, was die konstruktive Arbeit angeht. Wenn ich eine Idee habe, beginne ich unmittelbar, diese in meinem Geist auszubauen. Ich ändere die Struktur, ich mache Verbesserungen, ich experimentiere und stelle mir vor, wie das Gerät läuft. Für mich ist es absolut dasselbe, ob ich meine Turbine in Gedanken betreibe oder sie wirklich in meinem Labor teste. Das macht keinen Unterschied, die Ergebnisse sind die gleichen. Wie man sieht, kann ich auf diese Weise eine Erfindung schnell entwickeln und perfektionieren, ohne einen Finger rühren zu müssen. Wenn ich so weit bin, dass ich an dem Gerät jede mir erdenkliche Verbesserung vorgenommen habe, dass ich nirgendwo mehr einen Fehler sehe, konstruiere ich schließlich das Erzeugnis meiner Gedanken. Jedes Mal funktioniert mein Gerät so, wie ich es konzipiert habe, und mein Experiment verläuft genau nach meinem Plan. [Hervorhebungen hinzugefügt]«17
Ich vermute, dass Tesla zu dieser idealistischen Herangehensweise teilweise durch seine religiöse Herkunft gelangt ist. Wie Kapitel 1 zeigen wird, waren Teslas Vater und Onkel allesamt Priester der serbisch-orthodoxen Kirche, und Tesla hatte etwas von jenem tiefen Glauben verinnerlicht, dass durch den Sohn Gottes, der das Wort, der Logos ist, allem in der Schöpfung ein grundlegendes Prinzip innewohnt.18 In diesem Sinne war Tesla dem großen britischen Wissenschaftler Michael Faraday ähnlich, dessen Forschungen in den Bereichen Elektrizität und Chemie sehr stark von seinen religiösen Überzeugungen beeinflusst waren. Faraday gehörte der Kirche der Sandemanianer an, einer 1730 gegründeten christlichen Sekte, die Faraday stark an die Einheit von Gott und Natur glauben ließ.19
Indem Tesla seine Erfindungen mit einem gewissen Idealismus in Angriff nahm, wies er eine – wie der Ökonom Joseph Schumpeter es nannte – subjektive Rationalität auf, im Gegensatz zu einer objektiven (siehe Kapitel 2). Für Schumpeter entwickeln Ingenieure und Manager schrittweise Erneuerungen, indem sie bestehende Bedürfnisse einzuschätzen suchen, wohingegen Unternehmer und Erfinder radikale und revolutionäre Erfindungen einführen, die auf Ideen beruhen, die aus dem Inneren kommen.20 Mit objektiver Rationalität formt ein Individuum Ideen als Reaktion auf die Außenwelt (den Markt), wohingegen ein Individuum mit subjektiver Rationalität die Außenwelt neu gestaltet, damit sich diese seinen inneren Ideen anpasst. Sowohl bei dem magnetischen Drehfeld als auch bei der elektromagnetischen Resonanz erkennen wir, dass die Ideale von innen kamen und Tesla sich bemühte, die soziale Welt neu zu gestalten, um seine Erfindungen zu verwirklichen.
Teslas Stil als idealistischer Erfinder ähnelte dem anderer Erfinder und unterschied sich zugleich. Man kann Tesla mit Alexander Graham Bell vergleichen, der sich selbst einen »theoretischen Erfinder« nannte, weil er es vorzog, Ideen in seinem Geiste zu überarbeiten und zu formen. Im Unterschied dazu verfolgte Thomas Edison einen fast gegensätzlichen Stil und zog es vor, seine Ideen mit physikalischen Hilfsmitteln zu entwickeln, sei es mit Zeichnungen oder dem Bearbeiten der Geräte auf der Werkbank.21
Wenn er das Ideal hinter einer Erfindung erkannt hatte, war Tesla bereit, sie als Artikel oder Patent schriftlich auszuarbeiten, und es bereitete ihm große Freude, sie in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Tesla nahm jedoch nur widerwillig die Mühen auf sich, die notwendig waren, um seine Erfindungen in profitable Produkte umzuwandeln. Außerdem war er oft frustriert, dass einfache Menschen die Ideale, die seinen Erfindungen zugrunde lagen, nicht begriffen, sodass er auf Illusionen zurückgriff, um sie von dem Wert seiner Schöpfungen zu überzeugen. Tesla glaubte schließlich selbst daran, dass er für eine Erfindung neben dem Erkennen des Ideals auch die richtige Illusion erschaffen musste – von aufregenden und revolutionären Veränderungen, die seine Erfindungen für die Gesellschaft mit sich bringen würden. Durch Vorführungen, technische Vorträge und Zeitungsinterviews versuchte Tesla, die Vorstellungskraft der Öffentlichkeit ebenso zu wecken wie die der Unternehmer, die seine Erfindungen erwerben und weiterentwickeln sollten. Tesla nutzte Illusionen, um mit der Gesellschaft in Verhandlung zu treten – mit Illusionen sicherte er sich die nötigen Mittel, um seine Ideale in reale Maschinen zu verwandeln.
Obwohl ich hier den Begriff »Illusion« benutze, muss ich betonen, dass Tesla nicht versucht hat, seine potenziellen Unterstützer zu täuschen, indem er log oder ihnen unrichtige Informationen gab. Das Wechselspiel zwischen Erfinder und Förderer ist eher mit dem zu vergleichen, was sich zwischen Schauspieler und Publikum abspielt: Der Schauspieler mag bestimmte Sachen sagen und bestimmte Gesten machen, aber es ist das Publikum, welches das Gesagte und die Gesten interpretiert und daraus einen Eindruck gewinnt. In diesem Handeln vermischen die einzelnen Zuschauer im Publikum das, was der Darsteller bietet, mit dem, was sie aus dem kulturellen Kontext kennen.22 In seinen öffentlichen Vorträgen bot Tesla seinem Publikum genau die richtige Art von Information – eine Mischung aus Magie, wissenschaftlichen Fakten und gesellschaftlichen Kommentaren –, sodass dieses zu dem Schluss kommen musste, dass Teslas Erfindungen die Welt verändern würden. Tesla verstand es, die Menschen zu ermutigen, in seinen Erfindungen ganze Welten neuer Möglichkeiten zu sehen. Ich möchte sogar behaupten, dass alle Erfinder und Unternehmer mit ihren Schöpfungen Illusionen erzeugen müssen – dass wir im Vorhinein nie wissen können, welche Auswirkung eine Erfindung haben wird, und dass also eine Diskussion über eine neue Technologie oft auf Illusionen zurückgreift. Wie der Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke treffend bemerkte: »Jede hinreichend entwickelte Technologie wird einem wie Magie vorkommen.«23
Erfinder haben demzufolge Erfolg, indem sie sich die Natur für ein neues Gerät zunutze machen und dieses Gerät mit den Hoffnungen und Wünschen der Menschen verknüpfen. Viele Erfinder und Unternehmer sind bestrebt, für unerforschte Technologien und neuartige Unternehmenskonzepte die richtige Illusion zu kreieren, aber Tesla konnte außerordentlich gut Erfindungen und kulturelle Begehrlichkeiten verbinden.24 Unglücklicherweise konzentrierte sich Tesla in der zweiten Dekade seiner Karriere (1894–1904) – als er auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft war – mehr darauf, Illusionen zu schaffen, als seine Ideale in funktionierende Maschinen zu verwandeln. Teslas Geschichte war, wie wir sehen werden, ein Kampf zwischen Ideal und Illusion.
KAPITEL 1:
EINE IDEALE KINDHEIT (1856–1878)
Unsere ersten Versuche, etwas zu erreichen, sind rein instinktiv; es sind die ersten Schritte einer lebendigen und ungeschliffenen Fantasie. Wenn wir älter werden, setzt die Vernunft sich durch, wir werden zunehmend systematisch und gehen geplanter vor. Aber jene ersten Impulse sind die wichtigsten Momente, auch wenn sie nicht zu direkten Ergebnissen führen, und sie können sogar unser Schicksal beeinflussen.
NIKOLA TESLA, My Inventions (1919)
Erfinder müssen in einem außergewöhnlichen Spannungsfeld leben. Einerseits müssen sie in engem Kontakt mit ihren innersten Gefühlen, Einsichten und Impulsen stehen – dem, was Tesla die »ersten Schritte einer lebendigen und ungeschliffenen Fantasie« nennt –, da diese oft die Quellen neuer Ideen und Erfindungen sind. Andererseits können Erfinder nur dann eine Idee in eine praktische Erfindung umsetzen, wenn sie diese an die größere weltliche Ebene von Markt und Nachfrage anpassen, und das geschieht, indem sie systematisch und planvoll denken. Erfinder müssen das Subjektive (das, was sie instinktiv wissen) mit dem Objektiven (das, was sie über die Welt lernen) verknüpfen.1 Wie hat es Tesla als Kind vermocht, diese Fantasie zu kultivieren und sie nicht vom Verstand verdrängen lassen?
Es ist uns möglich, diese grundlegende Frage über sein kreatives Spannungsfeld zu untersuchen, weil Tesla seine emotionale und intellektuelle Entwicklung in einer 1919 veröffentlichten Autobiografie beschrieben hat.2 Doch bevor wir uns seinem Innenleben widmen, sollten wir uns zunächst damit beschäftigen, wo Tesla geboren wurde und wer seine Eltern waren.
EINE FAMILIE IN DER HABSBURGER MONARCHIE
Nikola Tesla wurde 1856 in Smiljan in der Provinz Lika im heutigen Kroatien geboren. Damals bildete ein Teil Kroatiens die Militärgrenze des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs. Die Gegend trug den Namen Vojna Krajina. Teslas Vater Milutin und seine Mutter Djuka waren jedoch Serben – Serbien liegt weiter südlich, in der Balkanregion, und gehörte damals zum Osmanischen Reich. Wie kam es dazu, dass Teslas Familie Mitte des 19. Jahrhunderts in diesem Gebiet lebte? Wie erging es ihnen als Mitglieder einer Minderheit in dieser polyglotten Monarchie?
Der Journalist Tim Judah hat bereits festgestellt, dass »die Serben schon immer ein Volk in Bewegung« waren.3 Als Nachkommen der Slaven, die aus dem heutigen Deutschland und Polen nach Süden ausgewandert waren, haben die Serben sich immer schon in Wellen über den Balkan bewegt, manchmal auf der Suche nach besserem Ackerland, manchmal als Reaktion auf Gewalt und Invasionen. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht im 15. und 16. Jahrhundert marschierten die osmanischen Herrscher gen Norden, überquerten den Großteil der Balkanhalbinsel und vertrieben zahlreiche christliche Völker. Die Osmanen vertrieben die Serben aus ihrem Heimatland (dem heutigen Serbien und Teilen des Kosovo), weswegen viele Serben in das Gebiet des heutigen Kroatien emigrierten.4 Die österreichischen Behörden, denen daran gelegen war, ihre Grenzen gegen die Osmanen zu sichern, bestärkten die Serben darin, sich in dieser Gegend niederzulassen und der Armee beizutreten, denn die Serben waren eingeschworene Feinde der osmanischen Türken. Im Gegensatz zu anderen Gebieten des Habsburger Reichs konnte die Region Vojna Krajina dem festen Griff der Armee nichts entgegensetzen: So war etwa jeder zwölfte männliche Untertan gezwungen, dem Militär beizutreten. Für die Habsburger Monarchie entwickelte sich die Vojna Krajina schon bald zum Einzugsgebiet für Soldaten, die nicht nur gebraucht wurden, um die Balkangrenze zu sichern, sondern die auch in anderen Kriegsregionen militärisch eingesetzt wurden.5
Teslas Vorfahren wanderten in den 1690er Jahren vom Westen Serbiens nach Lika aus. Die Serben mühten sich, in dieser kargen, kaum besiedelten Berggegend Landwirtschaft zu betreiben. Tesla zufolge war die Erde so steinig, dass die Serben von Lika zu sagen pflegten: »Als Gott die Steine über der Erde verteilte, trug er sie in einem Sack, und als er über unsere Gegend schritt, riss der Sack auf.«6
Im Serbischen hat der Name Tesla zwei Bedeutungen. Üblicherweise bezeichnet man damit eine Dechsel, eine kleine Axt, deren Blatt quer zum Griff angebracht ist. Der Name wird aber auch benutzt, um Menschen zu beschreiben, die vorstehende Zähne haben, was ein typisches Merkmal in der Familie Tesla war.
Teslas Großvater, der ebenfalls Nikola hieß, wurde 1789 in Lika geboren. In seiner Kindheit wurde dieses Gebiet von den Österreichern an Napoleon abgetreten und als Illyrische Provinzen dem französischen Kaiserreich einverleibt.7 Wie andere Serben aus Lika schlug auch Großvater Nikola eine militärische Karriere ein; während der Napoleonischen Kriege diente er in der französischen Armee, stieg zum Feldwebel auf und heiratete Ana Kalinić, die Tochter eines Obersts.
Nach der Niederlage Napoleons im Jahre 1815 fielen die Illyrischen Provinzen zurück an die Habsburger. Um sich vor den Türken zu schützen und die örtliche, aus Kroaten und Serben bestehende Bevölkerung unter Kontrolle zu halten, klassifizierten die Habsburger die Provinz nach wie vor als militärische Grenzregion. Obwohl das österreichische Kaiserreich offiziell römisch-katholisch war, erlaubten die Österreicher den Serben in Kroatien ihre eigenen, orthodoxen Kirchen.
Nach den Napoleonischen Kriegen kehrte Großvater Nikola Tesla nach Lika zurück; er beendete seinen Dienst in der französischen Armee und diente nun bei den Österreichern. Nikola und Ana hatten zwei Söhne, Milutin (1819–1879) und Josif, sowie drei Töchter: Stanka, Janja und eine weitere, deren Name nicht bekannt ist. Die beiden Söhne besuchten zunächst eine deutschsprachige Schule und danach eine österreichische Militärakademie (wahrscheinlich die Theresianische Militärakademie in der Wiener Neustadt). Josif, ein talentierter Mathematiker, der später diverse Standardwerke zur Mathematik schreiben würde, blühte in diesem Umfeld regelrecht auf und wurde Lehrer an einer Militärakademie in Österreich.8
Im Gegensatz zu seinem Vater und seinem Bruder gefiel Milutin das militärische Leben gar nicht. Nachdem er an der Schule einen Tadel erhalten hatte, weil er seine Messingknöpfe nicht ordentlich poliert hatte, verließ er die Schule und beschloss, stattdessen Priester in der serbisch-orthodoxen Kirche zu werden. Milutin schrieb sich in PlaŠki ins Orthodoxe Priesterseminar ein und machte 1845 als bester Student seines Jahrgangs den Abschluss.
1847 heiratete Milutin die 25-jährige Djuka (Georgina) Mandić (1822–1892), die Tochter des Priesters Nikola Mandić aus Gračac. Während die Familie Tesla traditionellerweise eine militärische Laufbahn verfolgte, waren die meisten Männer des Mandić-Clans Angehörige des Klerus: Nicht nur Djukas Vater war ein Priester, auch ihr Großvater und ihre Brüder standen im Dienst der Kirche. Einige von Djukas Brüdern waren sehr erfolgreich, so wurde ihr Bruder Nikolai Erzbischof von Sarajevo und Metropolit der serbisch-orthodoxen Kirche in Bosnien.
Kurz nachdem er Djuka geheiratet hatte, wurde Milutin eine kleine, aus 40 Haushalten bestehende Gemeinde in Senj zugewiesen, an der Adriaküste Kroatiens. Dort, in einer kleinen, steinigen Kirche, hoch auf eine steile Klippe gebaut, errichteten sie ihr Heim und Djuka gebar zunächst drei Kinder: Dane (1848–1863), Angelina (geb. 1850) und Milka (geb. 1852).
Abb. 1.1 Teslas Vater Milutin.
Quelle: NTM.
In Senj erwartete man von Milutin, die Gemeinde aufzubauen und gleichzeitig »Fremden und Katholiken gegenüber« die Serben zu repräsentieren. Milutin war groß und blass, mit hohen Wangenknochen und einem spärlich wachsenden Bart, wodurch er stets sehr ernst aussah (Abb. 1.1). Seine Gemeinde erlebte ihn als äußerst energischen Prediger – für seine Predigt »Über die Arbeit« wurde ihm sogar von seinem Bischof die Rote Schärpe verliehen. Milutin war ein idealistischer junger Priester, der durchaus bereit war, die österreichischen Mächte zu hinterfragen. Im Jahre 1848 bat er den örtlichen Militärkommandanten, den serbischen Soldaten zu erlauben, dass sie sonntags den orthodoxen Gottesdienst besuchten, doch die Österreicher weigerten sich und verlangten, dass die Serben weiterhin der katholischen Messfeier beiwohnten.9
Möglicherweise hatten die Erlebnisse seines Vaters in Napoleons Armee Milutin beeinflusst, denn seine Weltsicht war eine Kombination aus progressiven und nationalistischen Ideen. In den Regionen, die Napoleon erobert hatte, hatten die Franzosen den alten Ideen von Feudalismus und absolutistischer Herrschaft ein Ende bereitet und stattdessen Wert auf Wissenschaft und Rationalität gelegt. Durch die Neugründungen von Oberschulen (Gymnasien) hatten sie die schulische Ausbildung gefördert, zudem hatten sie es ethnischen Gruppen erlaubt, über Autonomie nachzudenken.10 Natürlich hätte keiner dieser Schritte den Österreichern oder den Osmanen gut gefallen.
Wie etliche gut gebildete Serben Mitte des 19. Jahrhunderts war auch Milutin der Meinung, dass sich die Lebensbedingungen für die Serben nur verbessern würden, wenn es ihnen erlaubt würde, ihre Traditionen zu pflegen und eine eigene Nation zu gründen, unabhängig sowohl von den Österreichern als auch von den Osmanen. 1852 schrieb Milutin in einem Brief:
»Bei Gott! Nichts ist mir so heilig wie meine Kirche und die Gesetze und Sitten meiner Vorväter, und nichts ist so kostbar wie die Freiheit, das Wohlergehen und Fortkommen meines Volkes und meiner Brüder, und für diese beiden – die Kirche und das Volk – werde ich stets bereit sein, mein Leben zu geben, wo auch immer ich mich befinde.«11
Doch trotz seines großen Diensteifers erwies sich Senj als sehr schwierige Aufgabe für Milutin. Sein Gehalt reichte kaum, um die Familie zu versorgen, und die feuchte Luft wirkte sich negativ auf seine Gesundheit aus. Also bat Milutin um eine Versetzung, und im Jahre 1852 wurde er nach Smiljan in Lika versetzt, zur Kirche der Heiligen Apostel Petrus und Paulus.
Übersetzt bedeutet Smiljan »der Ort des süßen Basilikums«, und tatsächlich sagte dieses Dorf der Familie Tesla viel mehr zu. Die Gemeinde von Petrus und Paulus umfasste etwa 70 bis 80 Haushalte (also knapp 1000 Seelen), die weiße Kirche stand am Fuße des Berges Bogdanić, neben ihr verlief das Flüsschen Vaganac. Die Kirche war pittoresk, aber recht einsam gelegen – der nächste Nachbar lebte gut drei Kilometer entfernt. Neben der Kirche standen der Familie ein schönes Haus und ein Flecken fruchtbaren Ackerbodens zur Verfügung (Abb. 1.2).12 Damit Milutin die Familien in seiner Gemeinde besuchen konnte, schenkte ein türkischer Pascha aus Bosnien ihm einen prächtigen Araberhengst als Dank dafür, dass er einige Muslime in der Gegend unterstützt hatte.13
Abb. 1.2 Teslas Geburtshaus in Smiljan, Provinz Lika, aufgenommen in den 1930er Jahren. Quelle: KSP, Smithsonian Institute.
In Smiljan hatte Djuka alle Möglichkeiten, ihrer Familie ein angenehmes Zuhause zu schaffen. Tesla erinnerte sich:
»Meine Mutter war unermüdlich. Sie schuftete regelmäßig von 4 Uhr in der Früh bis 11 Uhr abends. Von 4 Uhr bis zum Frühstück, also 6 Uhr, während die anderen noch schliefen, hatte ich die Augen schon auf und beobachtete mit großer Freude meine Mutter, wie sie sich eiligst, manchmal fast im Laufschritt, den vielen ihr selbst auferlegten Pflichten widmete. Sie wies die Diener an, sich um unsere vielen Tiere zu kümmern, molk die Kühe, erledigte alle möglichen anderen Arbeiten ohne Hilfe, deckte den Tisch und bereitete das Frühstückfür den gesamten Haushalt zu. Die Familie stand erst auf, wenn das Frühstück fertig war. Nach dem Frühstück folgte jeder dem inspirierenden Vorbild meiner Mutter. Alle arbeiteten fleißig, gingen in ihrer Arbeit auf und erreichten so ein hohes Maß an Zufriedenheit.«14
In dem Maße, wie Djuka den Haushalt unter ihre Fittiche nahm, verbesserte sich auch Milutins gesundheitlicher Zustand, und er widmete sich wieder mit voller Energie seinen Predigten. Milutin begann, eine eigene Bibliothek mit Werken über Religion, Mathematik, Naturwissenschaften und Literatur in diversen Sprachen zusammenzustellen. Er konnte problemlos Gedichte rezitieren und prahlte damit, dass er die Klassiker der Literatur, sollten sie jemals verloren gehen, aus dem Gedächtnis nacherzählen könne. Milutins wertvollster Besitz war eine Ausgabe des Sluzhebnik, eine serbischsprachige Liturgie, die 1519 in Venedig gedruckt worden war. Tesla erbte dieses Buch von seinem Vater und nahm es mit nach Amerika.15
Milutin begann auch, für diverse serbische Zeitungen und Zeitschriften zu schreiben, darunter die serbische Dnevnik von Novi Sad, die in Zagreb publizierte Srbobran und ein serbo-dalmatisches Journal aus Zadar. Milutin fürchtete, dass die Serben sich aufgrund mangelnder schulischer Ausbildung sowohl gesellschaftlich als auch politisch nicht würden weiterentwickeln können, und setzte sich daher für die Gründung einer Schule ein, in der sie in ihrer eigenen Sprache unterrichtet werden sollten.16 Man kann Milutin daher als einen Reformator bezeichnen, der sich bemühte, das Alltagsleben des serbischen Volkes zu verbessern.
KIND DES LICHTS
Unter diesen glücklichen Umständen wurde Tesla um Mitternacht in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 1856 (nach dem alten Kalender) in Smiljan geboren.17 Einer Familienlegende zufolge tobte an jenem Abend ein so fürchterliches Gewitter, dass die völlig verschreckte Hebamme des Dorfes gesagt haben soll: »Er wird ein Kind des Sturms.« Die Mutter soll daraufhin geantwortet haben: »Nein, ein Kind des Lichts.« Tesla wurde gleich am Tag seiner Geburt zu Hause getauft, was darauf schließen lässt, dass er als Neugeborenes relativ schwach war und die Familie sich Sorgen machte. Wie es das österreichische Gesetz vorsah, wurde das Kleinkind beim Ersten Regiment von Lika registriert, in der Neunten Kompanie von Medak, deren Hauptquartier sich in Raduč befand. Somit wurde erwartet, dass er ab dem 15. Lebensjahr dort seinen Dienst antreten würde.18
Als kleiner Junge liebte Tesla es, mit seinen älteren Geschwistern und seiner jüngeren Schwester Marica (geb. 1859) zu spielen. Sie tobten auf dem Kirchplatz oder beschäftigten sich draußen auf dem Bauernhof mit den Tauben, Hühnern, Ziegen und Schafen der Familie.19 Aber am liebsten verbrachte Tesla seine Zeit mit Macak, einem schwarzen Kater. Macak folgte dem jungen Nikola überallhin, und sie verbrachten manche fröhliche Stunde damit, im Gras herumzutollen.
Tatsächlich war es der Kater Macak, der Tesla an einem trockenen Winterabend auf die Elektrizität aufmerksam machte. »Als ich Macaks Rücken streichelte«, erinnerte er sich, »sah ich ein Wunder, das mich sprachlos machte. Macaks Rücken sah aus wie eine Fläche aus Licht und meine Hände schufen Funkenschauer, die so laut knisterten, dass man es im ganzen Haus hören konnte.« Neugierig geworden, fragte der Junge seinen Vater, was die Funken verursacht habe. Milutin war zunächst verwirrt, antwortete dann aber: »Nun, das ist nichts anderes als Elektrizität, genau dasselbe siehst du bei einem Gewitter durch die Bäume.« Die Antwort des Vaters, der die Funken mit einem Blitz gleichsetzte, faszinierte den Jungen. Tesla streichelte Macak weiter und fragte sich: »Ist die Natur nichts anderes als eine gigantische Katze? Und wenn dem so ist, wer streichelt ihr dann den Rücken?« Er schlussfolgerte: »Das kann nur Gott sein.«
Dieser ersten Beobachtung folgte ein weiteres bemerkenswertes Ereignis. Als es im Zimmer dunkler wurde und die Kerzen angezündet wurden, stand Macak auf und machte ein paar Schritte. »Er schüttelte seine Pfoten, als wäre der Boden nass«, erinnerte Tesla sich 1939:
»Ich beobachtete ihn aufmerksam. Hatte ich da etwas gesehen oder war es bloß Einbildung? Ich strengte meine Augen an und konnte ganz deutlich erkennen, dass sein Körper von einer Art Heiligenschein umgeben war!
Ich kann gar nicht genug betonen, welchen Effekt diese wundersame Nacht auf meine kindliche Fantasie hatte. Tag um Tag beschäftigte ich mich mit der Frage: ›Was ist Elektrizität?‹ Doch ich fand keine Antwort. Seit jener Zeit sind 80 Jahre vergangen und noch immer beschäftigt mich diese Frage und noch immer habe ich keine zufriedenstellende Antwort.«20
Der Legende nach hat James Watt sich als kleiner Junge dafür interessiert, wie Dampf den Deckel eines Kessels anheben lassen konnte. Ebenso war es Macak, der Kater, der Tesla als alles auslösende Inspiration diente und ihn dazu brachte, sich ein Leben lang mit der Elektrizität zu befassen.
EINE BLÜHENDE FANTASIE
Als kleiner Junge begann Tesla, nach dem Vorbild seiner Mutter Djuka, hier und da Dinge zu reparieren und weiterzuentwickeln. Während die anderen Bauern einfachstes Werkzeug benutzten, das seit Jahrhunderten unverändert geblieben war, entwickelte Djuka Verbesserungen, die es ihr erlaubten, ihren Haushalt effizienter zu führen. Ihr Sohn erinnerte sich liebevoll:
»Meine Mutter war eine erstklassige Erfinderin – ich denke, sie hätte Großes erreicht, wenn sie nicht so weit ab von der modernen Welt und ihren vielfältigen Möglichkeiten gelebt hätte. Sie erfand und konstruierte alle erdenklichen Werkzeuge und Geräte und webte die feinsten Muster aus Garn, das sie selbst gesponnen hatte […] Sie arbeitete unermüdlich, vom Morgengrauen bis spät in die Nacht, und die meisten Kleidungsstücke und Objekte im Haus waren Dinge, die sie mit ihren eigenen Händen gefertigt hatte. Selbst im hohen Alter von über 60 waren ihre Finger noch so geschickt, dass sie drei Knoten in eine Wimper knoten konnte.«21
Tesla folgte dem Beispiel seiner Mutter und schuf schon als Kind Dinge. Eine seiner ersten Erfindungen fußte auf der Bemühung, wie Tesla es sagte, »dem Menschen die Energien der Natur zunutze zu machen«. Mit dem Ziel, eine Flugmaschine zu bauen, entwickelte Tesla eine Spindel mit vier Rotoren an einem Ende und einer Scheibe am anderen. Intuitiv hatte er den Gedanken, dass die sich drehenden Rotoren eventuell genug Auftrieb generieren würden, um das ganze Gerät in die Lüfte schweben zu lassen, etwa so wie ein moderner Helikopter. Um das Gerät anzutreiben, plante Tesla, Junikäfer an den Rotoren zu befestigen. Da kam ein Junge des Weges, der Sohn eines ehemaligen Offiziers der österreichischen Armee. Zu Teslas großem Ekel nahm der Junge die Käfer und aß sie auf. Tesla brach sein Experiment ab und beschloss, nie wieder in seinem Leben ein Insekt anzurühren.22
Dieser nicht zu Ende geführten Flugmaschine folgten noch zahlreiche weitere einfallsreiche Projekte. Wie etliche andere neugierige Jungen nahm auch Tesla mechanische Uhren auseinander, nur um danach festzustellen, wie mühselig es war, sie wieder zusammenzusetzen. Er schnitzte sich sein eigenes Holzschwert und stellte sich vor, er sei ein großer serbischer Krieger. »Damals stand ich voll im Bann der serbischen Nationaldichtung und bewunderte all die Heldentaten«, erinnerte sich Tesla. »Ich verbrachte Stunden damit, die imaginären Feinde niederzumähen – in Wirklichkeit waren es Maispflanzen, und wegen der verdorbenen Ernte gab es eine gehörige Ohrfeige von meiner Mutter.«23
Obwohl Tesla nach außen hin den Eindruck eines typischen, glücklichen Jungen machte, geriet in seinem Innersten seine blühende Fantasie zuweilen außer Rand und Band. In seiner Autobiografie beschrieb er es so:
»Bis ich acht Jahre alt war, […] kamen meine Gefühle in Wellen und Wogen, ohne Unterlass bewegten sie sich zwischen den extremsten Polen hin und her. Meine Begierden waren so kräftig, dass sie alles andere überwanden und sich ständig vervielfachten, wie die Köpfe der Hydra. Der Gedanke an Schmerzen, im Leben und im Tod, bedrückte mich, und ich hatte religiös bedingte Ängste. Ich war überwältigt von abergläubischen Überzeugungen und lebte in der ständigen Angst vor dem Bösen, vor Geistern und Trollen und lauter unheiligen Mächten der Finsternis.«
Die Tatsache, dass es Tesla schwerfiel, zwischen Einbildung und Realität zu unterscheiden, machte dies umso alarmierender:
»Als Junge litt ich unter einem besonderen Gebrechen. Ich hatte Visionen, oft begleitet von gleißend hellen Lichtblitzen, die es mir erschwerten, reale Objekte zu sehen, und meine Gedanken und Taten beeinträchtigten. Es waren immer Bilder von Dingen oder Szenen, die ich wirklich schon einmal gesehen hatte, es war nie ausgedacht oder erfunden. Wenn jemand ein Wort sprach, konnte ich plötzlich ganz klar und deutlich die visuelle Abbildung des gesprochenen Wortes vor mir sehen, sodass es mir manchmal schwerfiel, zu entscheiden, ob dieses Objekt wirklich greifbar vor mir war oder nicht. Das war für mich sehr unangenehm, und ich hatte Angst. […] Diese Visionen scheinen außergewöhnlich gewesen zu sein, obwohl ich vielleicht eine gewisse Prädisposition hatte, weil ich weiß, dass mein Bruder ähnliche Probleme hatte. […] Es waren eindeutig keine Halluzinationen, wie kranke oder verängstigte Menschen sie entwickeln, denn in jeglicher anderen Hinsicht war ich normal und ganz ausgeglichen. Um ein Beispiel für meine Not zu geben: Man stelle sich vor, ich hätte einem Begräbnis oder einem ähnlichen emotional anrührenden Akt beigewohnt. Dann würde sich zwangsläufig in der Stille der Nacht ein lebendiges Bild der ganzen Szene vor meinem Auge auftun und sich einfach nicht verscheuchen lassen, was ich auch dagegen versuchte, manchmal würde dieses Bild sogar vor mir stehen bleiben, selbst wenn ich mit meinen Händen durch das Fantasiegebilde fuhr.«24
Da er unfähig war, diese Bilder zu kontrollieren, fühlte Tesla sich schwach und hilflos.
EIN TODESFALL IN DER FAMILIE
Zu diesen seelischen Schwierigkeiten kam noch erschwerend hinzu, dass Tesla im Schatten seines älteren Bruders Dane aufwuchs, den seine Eltern für außergewöhnlich begabt hielten. Man erwartete von Dane als ältestem Sohn, dass er in die Fußstapfen seines Vaters und seiner Onkel treten und Geistlicher werden würde. Doch im Jahre 1863 starb Dane bei einem Reitunfall, verursacht durch den feurigen Araberhengst seines Vaters, und Nikola, damals sieben Jahre alt, war Augenzeuge dieser Tragödie.25
Milutin war so erschüttert über den Tod seines Lieblingssohns, dass er beschloss, die Heimat in Smiljan aufzugeben und in die nächstgrößere Stadt zu ziehen, nach Gospić, dem ländlichen Zentrum von Lika-Senj, das zugleich als administratives Zentrum der österreichischen Militärgrenze diente.26 Hier predigte Milutin für die nächsten 16 Jahre unter der zwiebelförmigen Kuppel der Kirche des Märtyrers St. Georg. Zwar widmete Milutin sich weiter seinen pastoralen Pflichten und unterrichtete in den Schulen vor Ort Religion, doch er verfasste weniger Artikel und interessierte sich weniger für die Sache seiner Landsleute. Er fing an, sich auffällig zu verhalten, »sprach mit sich selbst, ja führte sehr angeregte Gespräche, zuweilen sogar hitzige Diskussionen mit sich selbst« und änderte dabei seine Stimme, sodass es klang, als ob mehrere Personen an dem Gespräch beteiligt seien. Milutin konnte den Tod von Dane niemals verwinden, und schon bevor er ein wirklich alter Mann war, nannten die Leute ihn »den alten Mann Milovan«.27
Für Tesla erwiesen sich sowohl der Tod des Bruders als auch der Umzug nach Gospić als zutiefst verstörende Erfahrungen. Er liebte sein Zuhause auf dem Lande, und er vermisste die Tiere auf dem Bauernhof. Er hatte soeben erst sein erstes Schuljahr in Smiljan absolviert, und das geschäftige Treiben in der etwas größeren Stadt überforderte ihn. »In unserem neuen Haus war ich bloß ein Gefangener«, schrieb er. »Durch die Fensterläden beobachtete ich die fremden Menschen. Ich war so schüchtern, dass ich lieber einem brüllenden Löwen gegenüber gestanden hätte als einem dieser Stadtmenschen, die da draußen flanierten.«28 Tesla war mit seinem Heimatdorf so tief verbunden, dass er, als er in den USA seine ersten Patente anmeldete, angab, er sei aus Smiljan in Lika, nicht aus Gospić.
Der plötzliche Tod seines Bruders brachte auch zwangsläufig Veränderungen in der Beziehung zwischen Tesla und seinen Eltern mit sich, vor allem in der zu seinem Vater. Milutin und Djuka betrauerten den Verlust Danes, auf den sie alle ihre Hoffnungen gesetzt hatten, so sehr, dass sie unfähig waren, die Qualitäten ihres anderen Sohns zu erkennen. »Wann immer ich etwas tat, das des Lobes würdig gewesen wäre, erinnerte es meine Eltern nur noch mehr an ihren Verlust«, beschrieb Tesla es. »Also wuchs ich mit sehr wenig Selbstvertrauen auf.« (Die Familie von Alexander Graham Bell wurde 1870 durch den plötzlichen Tod von Melville James und Ted, seines älteren und jüngeren Bruders, erschüttert, doch in diesem Fall hielt die Familie zusammen und konzentrierte alle Erwartungen auf den verbliebenen Sohn.)29 Wie so viele Kinder versuchte auch Tesla, die Liebe seiner Eltern für sich zu gewinnen, indem er nach Perfektion strebte. Milutin, der hoffte, sein Zweitgeborener würde ein Priester werden, paukte mit ihm »alle möglichen Übungen – zum Beispiel, die Gedanken anderer erraten, die sprachlichen Fehler einer Formulierung oder eines Ausdrucks erkennen, lange Sätze auswendig lernen und wiederholen oder Kopfrechnung. Das Ziel dieser täglichen Übungen war, Gedächtnis und Verstand zu trainieren und vor allem ein kritisches Bewusstsein aufzubauen. Diese Übungen waren ohne Zweifel sehr nützlich«.30 Doch wie Tesla sie in seinen Erinnerungen beschreibt, spürt man, dass er die Übungen aus einer Art Pflichtgefühl seinem Vater gegenüber machte.





























