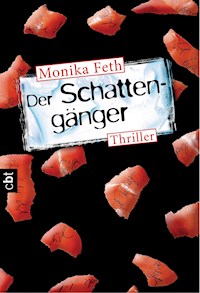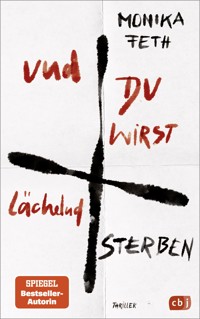Inhaltsverzeichnis
Motto
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Copyright
Motto
- bitte eine Seite freischlagen
Prolog
Sie hörte das feine, spitze Geräusch schon, noch bevor es ihre Ohren richtig erreicht hatte, und ihr wurde vor Entsetzen kalt.
Metall traf auf Metall.
Während sie gehetzt nach einem Versteck Ausschau hielt, presste sie die Hände vor den Mund, um sich bloß mit keinem Laut zu verraten. Als wäre das überhaupt noch von Bedeutung.
Wieder wurde ein Schlüssel in ein Schloss gesteckt, näher diesmal und überaus deutlich.
Wie laut ihr Atem in der Stille war! Sie lief ziellos im Zimmer umher, und ihre Angst wuchs mit jedem Schritt. Kein Versteck! Nirgends! Der Schrank, das Bett, die Vorhänge, mehr Möglichkeiten gab es nicht. Vor Anstrengung fing sie an zu keuchen.
Lieber Gott …
Sie warf sich auf den Boden, kroch unter das Bett und robbte gleich wieder darunter hervor. Zog verzweifelt die Schranktüren auf und machte sie wieder zu. Tränen ließen die Umrisse der Gegenstände vor ihren Augen verschwimmen.
Sie saß in der Falle.
Jetzt konnte sie die Schritte hören. Viele. Und sie waren unterwegs zu ihr.
Langsam wich sie zum Fenster zurück, öffnete es mit bebenden Händen und warf einen Blick in die Tiefe. Ein Schweißtropfen rann an ihrer Wirbelsäule hinunter.
Vor ihrer Tür machten die Schritte Halt.
Mit allerletzter Kraft schwang sie sich auf die Fensterbank, ohne die Klinke aus den Augen zu lassen. Lieber Gott, dachte sie. Gib mir den Mut zu springen …
Dann hörte sie den Schlüssel im Schloss.
1
Schmuddelbuch, Montag, 10. November
Gestern wurde aus dem Fühlinger See die Leiche eines zweiundzwanzigjährigen Mannes geborgen. Die Polizei geht von einem Fremdverschulden aus, machte aber, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, keine weiteren Angaben. Dies wäre seit Mai bereits das vierte Gewaltverbrechen mit Todesfolge in Köln. Einen Zusammenhang der Todesfälle schließt die Polizei nach dem derzeitigen Kenntnisstand jedoch aus. (Kölner Anzeiger)
»Warum nicht, Greg?«
»Dafür gibt es tausend Gründe, Schätzchen.«
»Nenn mir drei!«
»Also gut. Erstens: Ich will nicht. Zweitens: Ich will nicht. Drittens: Ich will nicht. Und jetzt lass mich arbeiten.«
»Das ist nicht fair, Greg!«
Gregory Chaucer stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch und vergrub die Finger im Haar. Dann hob er den Kopf und bedachte Romy mit einem milden Blick. »Seit wann, Mädchen, ist das Leben fair?«
»Ich weiß, dass ich recht habe, Greg.«
»Das ist ja das Schlimme. Du hast meistens recht.«
»Also gibst du mir grünes Licht?«
»Nein!« Gregory Chaucer beugte sich vor und griff nach dem Telefon. »Sonst noch was?«
Er konnte das gut, jemanden, der ihm auf die Nerven fiel, mit beleidigender Beiläufigkeit abservieren, und Romy hatte das schon oft am eigenen Leib zu spüren bekommen. Er guckte einen dann stur über den Rand seiner Lesebrille hinweg an, wobei sich seine Stirn in angestrengte Falten legte, was seinem Gesicht einen gleichermaßen erstaunten wie abwartenden Ausdruck verlieh. Diesmal, hatte Romy sich vorgenommen, würde sie sich davon nicht beeindrucken lassen.
»Und wenn ich dir verspreche, vorsichtig zu sein?«
»Das versprichst du mir doch dauernd.«
»Bitte, Greg. Du weißt, dass du dich auf meine Nase verlassen kannst.« Sie rührte sich nicht von der Stelle. »Vier Tote in einem halben Jahr, Greg. Du willst mir doch nicht erzählen, dass nichts dahintersteckt?«
»Ich will dir gar nichts erzählen, Romy. Ich will meine Ruhe haben, nichts weiter. Renitente Volontärinnen sind das Letzte, was ich im Augenblick brauche.«
»Renitent? Das kränkt mich jetzt aber wirklich, Greg.«
Gregory Chaucer stöhnte auf.
»Setz dich, Romy.«
Er hatte den Satz noch nicht ausgesprochen, als Romy schon auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch saß und ihn mit großen Augen anschaute.
»Also. Noch einmal. Was hast du vor?«
»Bloß ein bisschen herumstochern, Greg. Vier Tote! Das könnte die Geschichte meines Lebens werden.«
»Die Geschichte deines Lebens …« Gregory Chaucer konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Wie alt bist du? Fünfzig?«
Romy beschloss, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. »Gerade achtzehn geworden. Aber du hast mir immer gesagt, dass man zugreifen muss, wenn man eine Geschichte vor sich hat.«
»Wenn.«
»Das ist eine Geschichte, Greg. Ich hab das im Gefühl.«
Gregory Chaucer hatte Romy schon oft gepredigt, ein Journalist ohne den richtigen Riecher sei keinen Pfifferling wert. Genau da versuchte Romy ihn zu packen.
»Es geht um Mord, Romy, das ist ein verdammt heißes Eisen …«
»… das man schmieden muss, solange es heiß ist …«
»Du hast keine Erfahrung. Nimm wenigstens einen Kollegen mit.«
»Es ist meine Geschichte, Greg. Ich will die nicht teilen.«
Gregory Chaucer, deutsch-irischer Abstammung, seit dreißig Jahren im Zeitungsgeschäft und seit zehn Jahren Verleger und Chefredakteur des links-alternativen KölnJournals, hatte vier Tugenden auf sein Banner geschrieben: den richtigen Riecher, Neugier, Biss und eine ordentliche Portion Egoismus. Er selbst hatte sich mit mutigen, kompromisslosen Artikeln an die Spitze geschrieben und verlangte normalerweise auch von anderen, dass sie Zivilcourage und Ehrgeiz zeigten.
»Tut mir leid, Romy. Ich kann dir nicht …«
Sie stand auf und sah traurig auf ihn hinunter. »Okay, Greg.«
»Du wirst es ohne meine Erlaubnis tun«, sagte er.
»Was?«
»Du weißt genau, was ich meine.«
»Du lässt mir ja keine Wahl, Greg.«
Er seufzte. »Hau schon ab! Und pass auf dich auf!«
Das brauchte er ihr nicht zweimal zu sagen. Sie warf ihm eine Kusshand zu und war schon aus seinem Büro verschwunden.
Das Alibi war rappelvoll. Romy erkannte das eine oder andere Gesicht, aber sie hatte heute keine Lust, sich zu irgendjemandem an den Tisch zu setzen. Ganz hinten, bei der Garderobe, war noch ein Zweiertisch frei. Romy nahm ihn, obwohl sie es hasste, wenn die Ärmel fremder Mäntel und Jacken ihren Nacken streiften, sobald sie sich bewegte. Zudem war dies die absolut finsterste Ecke in diesem ohnehin sehr düsteren Café.
Aber sie würde halbwegs ungestört nachdenken können. Das gelang ihr in der Redaktion nur selten. Da war ein ständiges Kommen und Gehen, ein Klingeln von Telefonen und ein Summen von Stimmen. Da gab es keine ruhige Nische.
Irgendwann hatte Romy das Alibi für sich entdeckt, ein Bistro, das von einem schwulen Paar geleitet wurde, Giulio und Glen, die beide behaupteten, ihren ursprünglichen Taufnamen zu tragen und nicht auf Wohlklang geschielt zu haben. Doch das behaupteten sie von ihrer Haarfarbe auch, obwohl jeder sehen konnte, dass Siegfried und Roy dafür Pate gestanden hatten.
Man konnte im Alibi stundenlang vor einem einzigen Cappuccino sitzen, ohne zum Verzehr genötigt zu werden. Der Boden war schwarz lackiert, an den blutrot gestrichenen Wänden hingen verrückte Bilder, die zum Verkauf angeboten wurden, nackte, verdrehte, signalfarbene Leiber, in deren Haaren Vögel nisteten, aus deren Wimpern Blätter sprossen und zwischen deren Zehen Käfer und Hummeln hausten.
An einer Wand standen Bücherregale, vollgestopft mit zerlesenen, teilweise arg zerfledderten Kriminalromanen, die dem Alibi seinen Namen gegeben hatten. Es war erlaubt, sogar erwünscht, sich daraus zu bedienen. Man konnte ein Buch mit nach Hause nehmen, um es zu Ende zu lesen, und später zurückbringen, durfte es jedoch auch behalten, solange man es durch ein anderes ersetzte.
Die langbeinigen Mädchen, die hier bedienten, blieben nie lange. Kaum hatte man sich an die eine gewöhnt, wurde sie auch schon von einer anderen abgelöst. Es waren Paradiesvögel, die sich für eine Weile niederließen, um dann in wärmere Gefilde weiterzufliegen.
Romy bestellte sich einen Cappuccino und ein Mineralwasser und packte ihren Laptop aus.
Gleich am ersten Tag bei der Zeitung hatte sie damit angefangen, regelmäßig ihre Gedanken und Beobachtungen zu notieren. Sie verfasste Texte zu allen möglichen Themen, manchmal ausgefeilt und so gut wie druckreif, manchmal unfertig oder auch nur in Form bloßer Gedankensplitter. Sie sammelte Zitate, Zeitungsausschnitte, Fotografien und Einkaufsquittungen, ohne zu wissen, wann und wofür und ob überhaupt sich das alles jemals verwenden lassen würde.
Meistens schrieb sie an ihrem Laptop. War sie ohne ihn unterwegs, was selten vorkam, benutzte sie eines der Notizbücher, die sie wie unter Zwang ständig kaufte und von denen sie das aktuelle immer mit sich herumschleppte. Bei Gesprächen verwendete sie gern das Diktiergerät, das sie sich vor kurzem zugelegt hatte. Zur Not taten es aber auch Zettel, die sie später in das Notizbuch einklebte, genau wie die Zeitungsausschnitte, Fotografien und Quittungen.
Sie nannte diese Form des Tagebuchs, das ja streng genommen gar keines war, ihr Schmuddelbuch.
Jedes Mal, wenn sich die Tür öffnete, strömte kalte Luft herein. Das Wetter hatte sich verändert. Die Temperatur war über Nacht um zehn Grad gefallen. Leichter Schneeregen ging aus dem braungrauen Himmel nieder. Die Häuser waren in Grau getaucht. Selbst das Licht der Autos wirkte schmutzig. Romy wickelte sich den Schal fester um den Hals und zog die Stulpen, die sie in den Wintermonaten meistens trug, ein Stück weiter über die Finger. Dann fing sie an zu schreiben.
Fühlinger See. Leiche: männlich, zweiundzwanzig Jahre alt.
Tatort aufsuchen. Informationen über das Opfer beschaffen. Umfeld kennenlernen.
Vierter Mord.
Wer waren die früheren Opfer?
»Hi, Süße!«
Der Typ, der zu dieser Stimme gehörte, war Romy von ganzem Herzen zuwider, aber er arbeitete als Lokalredakteur beim Kölner Anzeiger, kannte Gott und die Welt und war einer von den Leuten, mit denen man es sich besser nicht verscherzte. Sein Kopf war eine Quelle nützlicher Informationen, und obwohl Romy sich dafür verabscheute, nutzte sie die Schwäche, die er anscheinend für sie hegte, gnadenlos aus.
»Hi, Ingo.« Das Süße wollte sie ihm heute durchgehen lassen, und dass er sich unaufgefordert zu ihr an den Tisch setzte, ebenfalls. Der Artikel über den Toten im Fühlinger See stammte aus seiner Feder oder vielmehr aus seinem Computer. Der Himmel hatte ihn im rechten Moment ins Alibi geschickt.
Er bestellte sich ein Käse-Schinken-Baguette und einen doppelten Espresso, sah der Bedienung lüstern hinterher, lehnte sich dann zurück und musterte Romy mit einem langen, forschenden Blick.
»Wollten wir nicht demnächst mal miteinander ausgehen?«, fragte er.
»Wollten wir das?«
Er versuchte es immer wieder. Und Romy wies ihn jedes Mal zurück.
»Erkenne ich da etwa einen ungewohnten Ausdruck von Milde in deinen Augen?«
»Muss an der schummrigen Beleuchtung liegen.« Romy rang sich zu einem Lächeln durch. »Du hast doch nicht vergessen, dass ich vergeben bin?«
Ingo schlug die Beine übereinander. Sein Gesicht, das vorher beinahe offen gewesen war, hatte sich wieder verschlossen und trug jetzt eine Maske von Arroganz und Überheblichkeit. Vielleicht war es aber auch gar keine Maske. Vielleicht war das sein wahres Gesicht. Romy hatte es noch nicht herausgefunden.
»Was willst du?«, fragte er.
»Ich?« Romy hob die Hände, ein Bild reiner Unschuld. »Wir plaudern doch bloß.«
»Ungewohnte Freundlichkeit ist alarmierend, Liebchen, vor allem bei dir.«
»Okay.« Romy wandte sich wieder ihrem Laptop zu. »Wir müssen ja nicht reden. Ich hab sowieso zu tun.«
Er beugte sich vor, um einen Blick auf das zu werfen, was Romy bereits getippt hatte, eine Todsünde unter Journalisten. Und wenn man noch so wenig im Leben respektierte - man schaute einem Kollegen bei der Arbeit nicht ungefragt über die Schulter, das war ein ungeschriebenes Gesetz. Und es galt selbst für junge Volontärinnen.
Romy schaltete den Laptop aus und klappte ihn zu. Sie überlegte sich gerade, wie sie Ingo möglichst geschickt auf den Toten aus dem See ansprechen könnte, als die Kellnerin das Baguette und den Espresso brachte.
Ingo begrapschte das Mädchen förmlich mit seinen Blicken, doch sein Interesse tropfte an ihr ab. Verärgert wandte er sich seinem Teller zu und fing an zu essen. Die Kruste des Baguettes, das warm serviert wurde, krachte unter seinen Zähnen. Krümel spritzten über den Tisch. Remoulade lief ihm in die Mundwinkel.
»Ich habe deinen Artikel gelesen«, begann Romy. »Den über den Mann aus dem See.«
Ingo nickte, ließ sich aber beim Essen nicht stören.
»Die Polizei mauert ja ganz schön«, fuhr Romy fort.
Ingo wiegte den Kopf. Das blonde, strähnige Haar fiel ihm in die Augen. Er strich es mit fettglänzenden Fingern hinter die Ohren. Romy wusste, dass er Anfang dreißig war. Sie wäre von selbst nie darauf gekommen. Ingo Pangold gehörte zu diesen alterslosen Menschen, die mit zwanzig kaum anders aussehen als mit fünfzig.
»Wenn die nichts sagen wollen, dann halten die dicht«, tastete Romy sich weiter vor. »Da nützen einem auch die besten Kontakte nichts.«
Seine grauen Augen wurden schmal. Einen Moment lang hörte er auf zu kauen. Dann schluckte er den Bissen herunter und spülte mit Espresso nach. Er feixte. »Guter Versuch. Wär fast drauf reingefallen.«
Mist!, dachte Romy. »Komm schon«, sagte sie schmeichelnd. »Ein bisschen was kannst du mir doch erzählen.«
Wieder verengten sich seine Augen. »Wieso interessiert dich der Fall?«
»Aus keinem bestimmten Grund«, wich Romy aus. »Der Typ war jung. Das lässt einen doch nicht kalt.«
»Scheiß drauf! Hinter was bist du her?«
Romy wusste, dass sie sein Vertrauen gewinnen musste. Sie winkte die Kellnerin herbei und bestellte sich ebenfalls ein Baguette. Gemeinsame Vorlieben hatten etwas Verbindendes, das war als Einstieg sicher nicht verkehrt. »Also gut«, sagte sie. »Ich recherchiere für einen Artikel über Wasserleichen.«
Er prustete Espresso über den Tisch.
»Über Wasserleichen?«
Romy tat beleidigt. Sie wischte sich die glitzernden Tröpfchen vom Pulli.
»Wo, bitte, ist denn da die Story?«
Die Story. In ihrem Beruf ging es immer nur darum. Das Leben eines guten Reporters war eine einzige Jagd danach. Nicht nach irgendeiner, sondern nach der Story.
»Wusstest du, dass achtzig Prozent aller Wasserleichen nicht älter geworden sind als fünfundzwanzig?«, improvisierte Romy. »Verstehst du? Junge Leute, Freitod, Mord, Unglücksfälle. Und alle haben mit Wasser zu tun. Das ist meine Story.«
Er würde herausfinden, dass sie ihn angelogen hatte, aber das würde hoffentlich noch eine Weile dauern. Jedenfalls nahm er ihr die Geschichte ab. Er entspannte sich, verlor sein Misstrauen und wischte sich mit seiner Serviette den Mund.
»Also gut«, sagte er mürrisch und säuberte sich schnalzend mit der Zunge die Zähne. »Ein bisschen was hab ich natürlich rausgefunden.«
Romy versuchte, nicht allzu interessiert auszusehen, als Ingo anfing, aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Calypso trat aus dem Haus und zog schaudernd die Schultern zusammen. Gegen knackige, trockene Kälte hatte er nichts einzuwenden, aber Kälte und Nässe zusammen waren ihm ein Graus. Er warf einen Blick auf den dunklen Himmel, zog sich die Kapuze über den Kopf, ließ die Hände in den Ärmeln seiner Jacke verschwinden und trabte los. Schon nach ein paar Schritten waren seine Socken nass und seine Zehen fingen an, sich in Eiszapfen zu verwandeln. Er hätte Stiefel anziehen sollen, wusste aber nicht, ob er überhaupt noch welche besaß.
In der Kölner Bucht wurde es so gut wie nie richtig Winter. Die meisten Menschen, die hier lebten, hatten sich daran gewöhnt und waren deshalb auf Schneefälle nicht vorbereitet. Selbst harmloser Schneeregen konnte den Verkehr in der Stadt und auf den Autobahnen zum Erliegen bringen, weil viele nahezu panisch darauf reagierten.
Um mit den Kindern rodeln zu gehen, musste man normalerweise mit ihnen in die Eifel fahren oder rüber ins Bergische. In Köln verrotteten Tausende von Schlitten unbenutzt in den Kellern. Wahrscheinlich würde auch dieser Winter in Matsche und Smog verkümmern.
Seit das Rauchen in Restaurants und Cafés verboten war, standen selbst jetzt im November noch die Tische und Stühle draußen. Die Besitzer hatten Heizstrahler aufgestellt und boten warme Decken an, die bei Nässe jedoch weggeräumt wurden. Einige Hartgesottene saßen dennoch draußen, in eine der Decken eingemummelt, eine Zigarette oder einen Zigarillo zwischen den blau gefrorenen Fingern.
Calypso warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Kurz vor elf. Er hatte noch fast den ganzen Tag vor sich. Einen gestohlenen Tag, der eigentlich nicht ihm gehörte, sondern der Bank. So, wie die meisten seiner Tage der Bank gehörten. Wie er selbst der Bank gehörte, mit Haut und Haar.
So war das nämlich. Sie krallten sich ihre Mitarbeiter, klopften sie mürbe und stutzten sie zurecht, bis sie in ihr Schema passten. Übrig blieben Krawattenträger in knitterfreien Anzügen, mit sauber gefeilten Nägeln, gepflegtem Haar und einem unaufdringlichen Aftershave, die statt eines Ritterschwerts silberne Kugelschreiber schwangen und Zahlenkolonnen in Kästchen schrieben.
Zum Kotzen.
Die Banklehre war der letzte Versuch seiner Eltern, aus Calypso einen anständigen Menschen zu machen. »Da lernst du was fürs Leben«, hatte sein Vater ihm gesagt. »Was Reelles.« Calypso wusste, was sein Vater von ihm erwartete. Dass er endlich »zu Potte« kam, das »Schluderleben« aufgab, die »Rosinen im Kopf« vergaß und sich immer die eine Wahrheit vor Augen hielt: »Lehrjahre sind keine Herrenjahre.«
Seine Mutter mochte verstehen, dass Calypso auf der Suche war, dass er Verschiedenes ausprobieren musste, um zu erkennen, welcher Weg ihn zum Ziel führte und an welches Ziel er überhaupt gelangen wollte. Doch sie wagte es nicht, sich ihrem Mann zu widersetzen, denn wenn ihm die Argumente ausgingen, brüllte er sein Gegenüber nieder, und gegen beides war sie machtlos.
Heute gönnte Calypso sich einen freien Tag. Als der Wecker geklingelt hatte, war er noch einmal weggedöst, und als er die Augen zum zweiten Mal aufgemacht hatte, war ihm klar geworden, dass er es nur noch mit Hängen und Würgen schaffen würde, pünktlich zu sein. Doch dazu hatte seine Energie einfach nicht ausgereicht. Er hatte beschlossen, blauzumachen und sich noch einmal umgedreht.
Er hasste die Banklehre.
Warum hatte er dann so ein schlechtes Gewissen?
Seine Schritte wurden länger. Er merkte, dass er plötzlich ein bestimmtes Ziel ansteuerte, das Alibi. Um diese Zeit war Romy meistens dort. Vielleicht konnten sie ein bisschen zusammensitzen und reden. Er hatte auf einmal solche Sehnsucht nach ihr, dass er am liebsten losgerannt wäre.
Calypso stapfte mit gesenktem Kopf voran. Der Schneeregen war mehr Schnee als Regen, und er mochte es nicht, wenn die kleinen Flocken prickelnd auf seiner Haut zerschmolzen oder sich auf seine Wimpern setzten. Außerdem fühlte er sich auf einmal wie auf dem Präsentierteller. Alle Leute schienen ihn anzustarren. Als wüssten sie, dass er im Grunde gar nicht hier sein dürfte.
Quatsch, dachte er. Reine Einbildung.
Die Bank lag in Junkersdorf. Es war äußerst unwahrscheinlich, dass er hier, im Belgischen Viertel, einem seiner Arbeitskollegen vor die Füße lief.
Calypso liebte die Gegend, in der er wohnte. Köln war bei weitem nicht die schönste aller Städte, aber es gab Ecken mit Flair, und das Belgische Viertel, das wegen seiner belgischen Straßennamen so hieß, gehörte mit Sicherheit dazu. Er war durch Zufall hier gelandet, als er ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft gesucht hatte.
So war er an Tonja und Helen geraten.
Und so war er Romy begegnet, die im selben Haus wohnte, hoch oben unter dem Dach.
Es hatte eine Reihe von Mitbewerbern gegeben, aber er hatte sich von der ersten Sekunde an prächtig mit Tonja und Helen verstanden und sie sich mit ihm. Noch während der Besichtigung waren sie sich einig geworden.
Vier Wochen später war er eingezogen. Zeitgleich hatte er mit seiner Banklehre begonnen.
Mit zwanzig Jahren war er keineswegs der älteste Auszubildende. Doch alle in der Berufsschule kamen ihm jünger vor, manche wie halbe Kinder. Sie schnipsten Papierkügelchen durch die Gegend, spielten den Lehrern alberne Streiche, schickten mit geheimnisvoller Miene Zettelchen auf die Reise.
Sein unstetes Leben hatte Calypso Erfahrungen sammeln lassen, von denen diese Kindsköpfe keine Ahnung hatten. Ein knappes Jahr als ungelernter Arbeiter im Eisenwerk in Brühl. Viel Knete, weil er sich freiwillig für jeden Schichtdienst hatte einteilen lassen. Knete, die ihm allerdings zwischen den Fingern zerronnen war.
Ein weiteres Jahr unterwegs. England, Schottland, Italien.
Und nie auch nur einen Cent von seinen Eltern.
Die wollten wissen, in was sie investierten. Das Medizinstudium des Bruders beispielsweise war etwas, für das es sich lohnte, sich »krummzulegen«. Auch die jüngere Schwester stand vor einer vielversprechenden Laufbahn. Sie würde nach dem Abitur BWL studieren und später in der Firma des Vaters als Betriebsprüferin arbeiten.
»Die Welt steht dir offen.« Das war das Credo der Eltern. Und sie schienen nicht mal zu merken, wie mikroskopisch klein diese Welt war, in der sie sich bewegten.
Lauter vorgefertigte Pfade. Calypso konnte sich nicht vorstellen, sein Leben so vorauszuplanen. Er schaffte es ja nicht mal, sich das Leben überhaupt vorzustellen.
Als er kurz vor dem Abi die Schule hinwarf, um endlich wieder Luft zu kriegen, brach für seine Eltern die Welt zusammen, die sie ihm angeboten hatten.
Das erste Mädchen, in das er sich unterwegs verliebte, nannte ihn Calypso. Er schlüpfte in den neuen Namen wie in ein Kleidungsstück, das eigens für ihn geschneidert worden war, und zum ersten Mal fühlte er sich wohl in seiner Haut.
Wieso war er schließlich doch in dieser verdammten Bank gestrandet?
Aus Unachtsamkeit.
Weil er begriffen hatte, dass er immer noch nicht lebte, was er leben wollte. Und weil das, was ihm vorschwebte, so unklar war wie die Umrisse der Dinge hinter einem dampfbeschlagenen Saunafenster.
Genau an diesem Punkt hatte sein Vater zugeschlagen und seine Beziehungen spielen lassen.
Inzwischen ahnte Calypso, wohin er wollte. Aber er war ängstlich geworden. Wie oft konnte man aussteigen, ohne jedes Mal einen Teil von sich selbst zu verlieren?
Der Schneeregen hatte nachgelassen und Calypso streifte die Kapuze ab. Jeans und Sweatshirt, darin erkannte er sich. Die Anzüge und die gebürsteten Lederschuhe waren seine tägliche Verkleidung. Er atmete auf, wenn er sich abends endlich umziehen konnte.
Da war das Alibi. Er stieß die Tür auf. Es war knallvoll, jeder Tisch besetzt. Stimmenlärm schlug ihm entgegen. Es duftete nach Kaffee und Pizzabaguette. Ganz hinten an der Garderobe entdeckte er Romy. Sie saß an ihrem Laptop und schrieb.
Als sie aufsah, begegneten sich ihre Blicke über den weiten Raum hinweg. Romy begann vor Freude zu strahlen.
Ich liebe dich, dachte Calypso. Ich liebeliebeliebe dich.
Sie stand auf und schmiegte sich in seine Arme. Es störte sie nicht, dass seine Jacke nass war und ein bisschen nach Hund roch und ein bisschen nach dem Rauch aus den Schornsteinen draußen. Dann bog sie den Kopf zurück und schaute ihn an. »Solltest du nicht in der Bank sein?«
Er nickte und zog die Jacke aus. Setzte sich zu ihr an den Tisch. Lenkte sie mit einer Frage ab.
»Was schreibst du da?«
Ihre Augen leuchteten vor Begeisterung, doch sie vergaß nicht, sich misstrauisch umzusehen und vorsichtshalber die Stimme zu senken, als sie antwortete.
»Greg hat mir grünes Licht gegeben.«
»Für diesen Mord am See?«
Romy nickte. »Da steckt was drin, das spür ich.«
Calypso hatte noch nichts gegessen. Er bestellte sich ein Omelette und eine Cola.
Romys Faszination für dieses Thema knisterte zwischen i hnen.
»Ich bin gerade dabei, mir zu überlegen, wie ich vorgehen, wo ich anfangen soll. Meine ersten Informationen habe ich schon ergattert.«
Calypso fand ihr Tempo beeindruckend. Und ihre Fähigkeit, direkt auf das Ziel loszusteuern. Er beneidete sie um die Kompromisslosigkeit, mit der sie ihren Traum verfolgt hatte - für Zeitungen zu schreiben.
»Von Ingo«, fuhr sie fort. »Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, ein zweites Frühstück mit Mister Größenwahn einzunehmen.«
Zweifelhaft und Größenwahn waren genau die richtigen Worte. Calypso hatte sich ein paar Mal mit diesem Ingo Pangold unterhalten und danach das dringende Bedürfnis gehabt, sich die Hände abzuschrubben.
Ingo war ein Ein-Mann-Unternehmen, erfolgsorientiert und konsequent. Er gab niemandem Auskunft, von dem er sich nicht einen Vorteil versprach, und legte jedem Steine in den Weg, den er als Konkurrenz empfand.
Seine Arbeiten waren perfekt recherchiert, aber kalt und ohne Herzblut geschrieben, und vor ein paar Monaten hatte eine renommierte Professorin für Geschichte, deren Privatleben er an die Öffentlichkeit gezerrt hatte, nach einem seiner Artikel einen Selbstmordversuch unternommen. Ingo Pangold hatte von ihrer heimlichen Lebensgefährtin erfahren und beide als Lesbierinnen geoutet.
Romy hatte sich furchtbar darüber aufgeregt. Und nicht nur sie. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war Ingo Pangold zum meistgehassten Mann der Szene geworden.
»Ein zweites Frühstück?«
Auch diese Seite an Romy war Calypso vertraut. Für eine wichtige Information nahm sie alles in Kauf, sogar ein Frühstück mit einem Kotzbrocken wie Pangold.
»Und das ist dir nicht gleich wieder hochgekommen?«
»Ich hab seinen Namen!«
Calypso schaute sie verständnislos an.
»Den des Ermordeten aus dem See.«
»Hättest du den nicht auch über die Bullen rauskriegen können?«
»Sag mal, Cal, in welcher Welt lebst du eigentlich? Ich bin eine popelige kleine Volontärin. Ich habe null Verbindungen. Glaubst du, die reißen sich darum, mir höflich Auskunft zu erteilen? Die Ermittlungen sind im vollen Gange. Da sind die stummer als Fische.«
»Ingo gegenüber nicht?«
»Der ist ein alter Hase und hat sich im Lauf der Jahre ein Netzwerk von Kontakten aufgebaut. Irgendeine undichte Stelle gibt es immer. Eine Hand wäscht die andere, so läuft das doch.«
Die Welt, die Romy da beschrieb, war tatsächlich nicht die Welt, in der Calypso lebte. In seiner Welt waren die Hierarchien klar umrissen. Man stieg nicht auf, weil man kreativ war oder originell, sondern weil man mit Zahlen und Fakten umgehen konnte. Natürlich spielten auch Fleiß und Beharrlichkeit eine Rolle, aber man landete nicht irgendeinen Coup, wie das in den Medien möglich war, und wurde dann dafür belohnt.
»Willst du nicht wissen, wie er heißt?«
Romys Augen funkelten.
»Wer?«
»Der Tote natürlich.«
Calypso war es eigentlich ziemlich schnuppe, wie er hieß, doch damit würde er bei Romy nicht durchkommen. Also nickte er.
»Thomas Dorau.«
Sie strahlte ihn an.
War das alles? Ein Name? Und darüber freute sie sich so?
»Das ist aber noch nicht alles«, beantwortete sie seine Gedanken. »Er hatte eine Tätowierung am Handgelenk.«
Jetzt war ihr Blick triumphierend.
»Am Handgelenk? Komische Stelle für ein Tattoo.«
»Es kommt noch besser: Er hat sich nicht etwa einen Drachen in die Haut ritzen lassen, einen Adler, eine nackte Frau oder ein Herz mit dem Namen seiner Freundin darin.«
»Sondern?«
»Ein aufgeschlagenes Buch.«
»Da sag noch mal einer, die Leute würden nicht mehr l esen.«
»Ein aufgeschlagenes Buch, Cal!«
»Und?« Calypso hob die Schultern. »Was sagt uns das?«
»Spürst du das denn nicht?«
Er spürte nur, dass er hungrig war. Seine Blicke wanderten sehnsüchtig zur Küchentür.
»Dass Thomas Dorau den Traum vom eigenen Buch träumt?«
»Du machst dich über mich lustig.«
»Mach ich nicht. Sag mir, was es bedeutet.«
»Das Tattoo ist so ungewöhnlich und so … besonders, dass es für den Toten wesentlich mehr gewesen sein muss als ein bloßer Körperschmuck oder reiner Ausdruck von Sentimentalität. Ich werde das recherchieren. Aber eins weiß ich jetzt schon: Das ist die Geschichte. Und sie gehört mir. Ist das nicht Wahnsinn?«
Calypso lief das Wasser im Mund zusammen, denn er sah, wie die Kellnerin mit einem dampfenden Teller auf ihn zuschwebte. Und tatsächlich setzte sie ihn vor Calypso auf dem Tisch ab.
»Lass es dir schmecken«, sagte sie mit einer Stimme, in der unzählige Zigaretten ihre Spuren hinterlassen hatten.
Darauf konnte sie wetten. Er nahm den ersten Bissen und hätte fast gegrunzt vor Wohlbehagen.
»Übrigens«, sagte er mit vollem Mund, »ich werde die Banklehre schmeißen.«
2
Schmuddelbuch, Dienstag, 11. November
Lange mit Cal geredet. Bis draußen die ersten Motorengeräusche ertönten. Und dann die letzten beiden Stunden der Nacht tief und fest geschlafen. Fühl mich irgendwie abseits von allem. Hellhörig. Hellfühlig (gibt es das?). Hellsichtig. Die Geräusche sind nicht wie sonst, nicht so voll und prall. Sie sind wie eine Erinnerung an Geräusche, die man einmal gehört hat, früher.
Cal will Schauspieler werden.
Ich hab immer schon gewusst, dass er Talent hat. Wer liest schon freiwillig Dramen von Schiller und Kleist?
Mein Plan für heute: Rausfinden, wer die drei weiteren Toten dieses Sommers waren. Klingt einfach. Ist es aber nicht.
Romy hörte das Gurren der Tauben vor dem Küchenfenster. Es war ein junges Vogelpaar mit blaugrauem Gefieder und runden, glatten Köpfen, das sich auf den Fensterbänken, dem Dach und den Balkonen des Hauses eingerichtet hatte. Romy mochte ihre stillen, sanften Laute und ihren freundlichen Blick. Da konnten die Taubenhasser hundertmal behaupten, Tauben seien gefährliche Krankheitsüberträger, sozusagen die Ratten der Vogelwelt.
Cal war schon in der Bank. Romy musste erst um zehn in die Redaktion. Greg führte kein allzu strenges Regiment. Ihm war wichtig, dass die Artikel pünktlich abgeliefert wurden und überzeugten. Wann sie geschrieben wurden und wo, war ihm egal.
Während Romy frühstückte, warf sie einen Blick in den Kölner Anzeiger. Ingo hatte den Aufhänger für das Magazin geschrieben, eine tägliche Beilage mit Themen, die immer einen großen Zusammenhang hatten, diesmal die Mode: Zum Sterben schön - Alltag eines Models.
Gleich nach den ersten Sätzen hatte Ingo Romy an der Angel. Sie verschlang Wort für Wort. Als sie am Ende des Artikels angelangt war, empfand sie leises Bedauern. Sie hätte stundenlang weiterlesen können.
Da war Ingo ein ausgezeichnetes Porträt gelungen. Mit einer für ihn absolut untypischen Feinfühligkeit hatte er die Sehnsüchte des Models beschrieben und sie der Kälte des Modemarkts gegenübergestellt. Er hatte gezeigt, wie die einzelnen Räder ineinander griffen, wie Agentur, Designer, Fotografen und Medien Einfluss nahmen auf ein Leben, das ein ehrgeiziges Mädchen sich lange erträumt hatte und das nun doch ganz anders war.
Ingo. Derselbe Mann, der keine Gelegenheit verstreichen ließ, um einen seiner frauenfeindlichen Sprüche abzusondern. Der Mann, der den Begriff Macho erst mit Leben füllte. Der sämtliche Frauen anmachte, die bei drei nicht auf den Bäumen waren. Ausgerechnet Ingo schrieb sensibel beobachtend über Modediktat und Schlankheitswahn.
Romy würde ihn später anrufen, um ihm zu gratulieren.
Sie trank noch eine Tasse Kaffee, verrieb einen Klecks Gel in ihrem streichholzkurzen blonden Haar, bis es struppig in alle Richtungen abstand, schnappte sich ihre Tasche und verließ die Wohnung.
Im Treppenhaus begegnete ihr C.C., der sie mit einem freundlichen Lächeln grüßte. Er war Mitte siebzig und sah aus wie der junge Charly Chaplin mit weißem Haar. Er hatte genau denselben eigentümlich watschelnden Gang.
C.C. kam und ging freundlich und still. Vielleicht kannte er den Spitznamen, den die Hausbewohner ihm gegeben hatten, denn seine Aufmachung war jedes Mal dieselbe, als wollte er ihre Erwartungen nicht enttäuschen: Anzug, Mantel, Aktentasche, Stockschirm und Hut. Sein Lächeln hatte oft etwas Spitzbübisches, Eingeweihtes.
Niemand wusste, wie er die Tage verbrachte. Keiner hatte bislang mehr als eine Handvoll Worte mit ihm gewechselt. Seine ganze Haltung signalisierte unmissverständlich den Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden, und den respektierten sie alle.
Es war ein uraltes und ganz besonderes Haus mit besonderen Bewohnern, und Romy liebte es sehr. Sie hatte sich unter dem Dach eingerichtet, und die übrigen Hausbewohner waren ihre neue Familie. Das Leben hier war gut. Es ließ kaum Sehnsucht nach ihren Eltern aufkommen.
Und wenn sie Björn vermisste, rief sie ihn einfach an, und sie unterhielten sich eine Weile. Wenn das nicht ausreichte, verabredeten sie sich und trafen sich in Köln oder Bonn, wo er Informatik studierte.
Sie waren Zwillinge. Nachdem die Eltern ausgewandert waren, hatten die Geschwister sich darauf geeinigt, die Symbiose zu verlassen, in der sie ihre Kindheit verbracht hatten. Sie hatten das Bedürfnis gehabt, komplett neu anzufangen und ein Leben auf eigenen Füßen zu wagen. Für einen radikalen räumlichen Abstand jedoch hatte ihnen bisher der Mut gefehlt.
Aber Björn träumte schon länger von einem Umzug nach Berlin, wo Maxim lebte, seine große Liebe. Romy durfte sich das gar nicht vorstellen. Björn war ein Teil von ihr. Ihn zu verlieren, wäre eine Katastrophe. Ohne ihn war sie nur halb. Sie hatte keine Ahnung, ob sie als halber Mensch überleben konnte.
Während sie die alten, grauweißschwarz gesprenkelten Steinstufen hinunterging, fragte sie sich, warum es ihr nichts ausgemacht hatte, ihre Eltern zu verlieren.
Weil ich sie nicht wirklich verloren habe, dachte sie.
Ihre Eltern hatten ein Vagabundenleben geführt und waren ständig umgezogen. Vom Rheinland nach Hessen, von Hessen ins Ruhrgebiet, von dort nach Nordfriesland und vom Meer in die Berge, nach Oberbayern. Für Romy und Björn hatte das permanenten Schulwechsel bedeutet. Immer wieder waren sie in fremden Städten und Dörfern gelandet, wo die Leute Dialekte gesprochen hatten, die sie nicht verstanden.
Kaum hatten sie Freundschaften geschlossen, hatte der Vater eine neue Firma gegründet oder einen neuen Job angenommen, wurden wieder Koffer und Kisten gepackt, stand eines Morgens wieder der Möbelwagen vor der Tür.
Schließlich waren die Geschwister in ein Internat gesteckt worden, das von Augustinerinnen geleitet wurde. Die liberale Erziehung der Eltern war angesichts der Strenge der Nonnen zur Erinnerung verblasst. Die Zwillinge hatten sich verzweifelt aneinander festgehalten.
Bis heute.
Die Eltern hatten nicht bemerkt, wie unglücklich ihre Kinder waren. Sie waren zu beschäftigt gewesen. Geld war ins Haus geströmt und wieder hinaus geflossen. Man konnte das am neuen Hobby des Vaters erkennen. Er hatte angefangen, Oldtimer zu sammeln, die er in einer eigens zu diesem Zweck erbauten Halle aufbewahrte. Es wurden immer mehr.
Und dann kam der Gerichtsvollzieher und ließ einen nach dem andern abtransportieren.
Die unterschiedlichen Berufe des Vaters konnte Romy kaum alle aufzählen. Er hatte als Koch gearbeitet, als Teppichhändler, als Versicherungsvertreter, Vermögensberater und Firmenmakler. Er hatte eine Firma für Gebäudereinigung besessen, hatte Software verkauft und einen Frisiersalon für Hunde aufgemacht.
Seine Frau hatte ihn tatkräftig unterstützt.
Im letzten Jahr dann waren sie nach Mallorca ausgewandert, wo sie in einer alten Finca am Meer eine Kunstgalerie eingerichtet hatten.
Möglich, dass sie morgen auf die Herstellung von Tubensenf oder Tiefkühlpizza umsteigen würden. Es war Romy gleichgültig. Sie mochte ihre Eltern, aber sie brauchte sie nicht in ihrer Nähe. Ein Anruf ab und zu war ihr genug. Mehr als ein paar Worte zwischendurch hatte sie ohnehin nur äußerst selten von ihnen bekommen.
Romy und Björn hatten sich nie wirklich aufgelehnt. Sie hatten ja nichts anderes gekannt. Und trotz der Unfähigkeit ihrer Eltern, sich irgendwo endgültig niederzulassen und Verantwortung zu übernehmen, trotz ihrer Weigerung, ihren Kindern ein halbwegs normales Familienleben zu bieten, hatten sie doch auch ihre guten Seiten. Sie waren fröhlich und lebensbejahend, voller Einfälle und berstend vor Energie.
Eine Weile hatten sie versucht, ihre Kinder zu sich nach Mallorca zu locken, doch inzwischen hatten sie es aufgegeben. Sie versuchten zu akzeptieren, dass die Zwillinge anders waren als sie selbst und dass sie eine Sehnsucht nach Beständigkeit verspürten.
Die letzten Stufen, und Romy war im Erdgeschoss angelangt. Sie schloss ihren Briefkasten auf, obwohl sie schon durch die gelochte Leiste am unteren Ende der verbeulten Blechtür erkennen konnte, dass er leer war.
Sie erhielten die Post nicht regelmäßig zu einer bestimmten Uhrzeit. Mal kam sie schon morgens um neun, mal gegen Mittag, und manchmal mussten die Hausbewohner bis zum späten Nachmittag warten. Das nervte Romy ziemlich oft, aber der Postbote wirkte immer so bemüht und abgehetzt, dass ihr Bedürfnis, sich zu beschweren, nie lange anhielt.
Romy verschloss den Briefkasten wieder und zog die schwere Haustür auf. Eiskalte Luft schlug ihr ins Gesicht. Sie blinzelte in den verhangenen Himmel, von dem ein paar einsame Schneeflocken herunterschwebten. Dann stülpte sie sich die Mütze über den Kopf, schlang sich den Schal fester um den Hals und schob die Wollstulpen über die Finger.
Wie gut, dass es bis zur Redaktion nicht weit war.
Sie dachte an den Toten aus dem See. Was für ein schreckliches Ende, bei dieser Kälte zu ertrinken.
Er streifte sich das Messgewand über.
Raschelnde Seide.
Schwarz.
Der November war seit jeher der Monat der Toten.
Auch sein Haar war schwarz. Einzig sein Gesicht und seine Hände waren hell.
Er sah sich gern so.
Todesengel, dachte er.
Und begann leise zu summen.
Eine wehmütige Melodie.
Das Leben war ein einziger Kampf. Gegen das Böse, das überall lauerte. In den schlechten Filmen, die Gewalt verherrlichten. In den Büchern, die die Wahrheit verschleierten. In den Bordellen der Städte und Dörfer. Den Bars und Striplokalen. In den Machtzentren der Welt. Auf den Straßen. In den Wohnungen und den Herzen der Menschen.
Der Teufel hatte sein Gift versprüht. Er hatte blühende Pflanzen ausgerupft und schweflige Ödnis hinterlassen. Er hatte den Menschen die Seele aus dem Leib gerissen und ihnen stattdessen einen Stein eingepflanzt.
Und niemand sah die Zeichen.
Dabei war die Zeit längst gekommen, dem unheiligen Treiben Einhalt zu gebieten.
Licht ins Dunkel zu bringen.
Dem Satan die gestohlenen Seelen zu entreißen.
»Ich bin gekommen, euch zu erretten«, murmelte er.
Die Last lag schwer auf seinen Schultern.
Er war der Fackelträger in finsterer Zeit. Aber würde er den Stürmen trotzen können?
Als er sich von seinem Spiegelbild abwandte, scheuerte seine Kleidung auf der Haut, und er unterdrückte ein Stöhnen.
Da lag sie noch, die Rute, mit der er sich gegeißelt hatte. Sie hatte ihm tief ins Fleisch geschnitten. Er würde sich um die Wunden kümmern müssen.
Später.
Nachdem er allen seinen Rücken gezeigt hatte.
»Herr«, sagte er. »Ich bin dein.«
Doch heute antwortete der Herr ihm nicht.
Pia tunkte die Bürste ins Wasser und schrubbte weiter. Der Küchenboden war mit groben Fliesen belegt, die das gesamte Farbspektrum warmer Braun- und Rosttöne abdeckte. Wie in einem dieser bretonischen Bauernhäuser, die man für die Ferien mieten konnte. Pia hatte als Kind einmal mit ihren Eltern einen Sommer in einem solchen Haus verbracht.
Damals. Als die Welt noch klar und geordnet war.
Als nichts ihr wirklich Angst machen konnte.
Als die Eltern noch Riesen waren und unbesiegbar. Als sie Pia noch beschützt und behütet hatten.
Pias Hände waren rot und fast schon ein bisschen angeschwollen. Sie reagierte allergisch auf Seifenlauge, doch sie durfte bei dieser Arbeit keine Gummihandschuhe tragen. Er hatte es ihr verboten.
Auf den Knien, hatte er befohlen. Bis ich dir sage, dass du fertig bist.
Wie lange schrubbte sie schon? Drei Stunden? Vier?
Sie hatte kein Gefühl mehr für die Zeit, die vergangen war.
Ihre Knie brannten. Ihr Rock war klatschnass.
Verdorben. Nie wieder würde sie ihn tragen können. Dabei war er der einzige noch halbwegs schöne, den sie besaß.
Sie hatte sich nicht umziehen dürfen.
Lerne Demut!
Ihre Nase lief. Sie hatte kein Taschentuch bei sich und wischte sich den Rotz mit dem Rocksaum ab. Jetzt war sowieso schon alles egal. Die Haare klebten ihr im Nacken. Tränen hatten kribbelnde Spuren auf ihren Wangen hinterlassen.
Sie wagte nicht, sich zu kratzen. Sie durfte nichts tun, was sie von der Arbeit abhielt.
Hier hatten die Wände Augen.
Lerne Gehorsam!
Deshalb hatte er sie zu sich geholt. Um ihr Gehorsam beizubringen. Und Demut. Und all die anderen Tugenden, die sie nicht besaß.
Dein Herz ist voller Eitelkeit.
Seine Stimme klang traurig, wenn er so etwas sagte. Und etwas schwang in ihr mit, das sie vor Furcht erbeben ließ. Es war unklug, ihn zu reizen und seinen Zorn auf sich zu ziehen.
Sie wusste bloß nicht, wie sie es vermeiden konnte.
Er verbot ihr, sich zu schminken. Er untersagte ihr, sich hübsch anzuziehen.
Du wirst lernen, eine Dienerin des Herrn zu sein.
Pia kannte dieses Wort nur noch aus alten Büchern. Sie las leidenschaftlich gern. Deshalb hatte er ihr auch die meisten ihrer Bücher genommen
Hast du mich verstanden?
Ja, Vater.
Sie alle mussten ihn Vater nennen. Selbst diejenigen, die älter waren als er. Er war ihr Hirte. Er führte sie durch jedes noch so finstere Tal. Sie brauchten sich nicht zu fürchten.
Sagte er.
Aber Pia fürchtete sich. Sie hatte eine Angst, so groß, dass sie sich ihr Ausmaß nicht einmal vorstellen konnte. Eine Angst, höher als der höchste Berg. Fest und massiv und unverrückbar.
Wie sollte sie die bewältigen?
Das war nicht immer so gewesen.
Anfangs hatte sie ihn sogar geliebt. Nein. Verehrt. Wenn er sie angeschaut hatte, war sie voller Freude gewesen. Ein einziges Lächeln, das ihr gegolten hatte, hatte sie durch den ganzen Tag begleitet.
Er hatte ihr schon lange kein Lächeln mehr geschenkt.
Ich bin unvollkommen, dachte sie.
Ihre Gedanken waren nicht, wie sie sein sollten. Sie waren anders als die Gedanken der andern.
Ich muss mich ändern.
Es war Sünde, die meisten Sätze mit Ich zu beginnen. Es war Sünde, als Mitglied dieser Gemeinschaft nicht glücklich zu sein. Es war Sünde, die liebevolle Fürsorglichkeit des Vaters als einengend zu empfinden.
Pia hatte ja versucht, sich zu bessern. Hatte nicht mehr so viel Zeit mit ihren Büchern verbracht und sich stattdessen in die Lektüre der Bibel vertieft. Hatte die Freundschaften außerhalb der Gemeinschaft unter fadenscheinigen Vorwänden beendet. War fast nur noch in Begleitung eines Mitbruders oder einer Mitschwester zu den Vorlesungen gegangen.
Und schließlich hatte sie restlos alles aufgegeben und war hierher gezogen.
Pia gab sich alle Mühe, nicht zu heulen. Sie versuchte, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Wenn sie sich anstrengte, seine Erwartungen zu erfüllen, würde er sie vielleicht nicht zwingen, auch noch ihr Studium abzubrechen, damit sie Demut und Gehorsam lernte.
Erschrocken bemerkte sie, dass sie alle zu täuschen versuchte. Sie wollte unbedingt etwas behalten, das ihr selbst gehörte und das ihr wichtig war.
Ihr Studium, das sie letztes Jahr begonnen hatte.
Sie war nicht demütig und würde es niemals sein.
Oh Gott, dachte sie und schrubbte verzweifelt weiter.
Aber Gott schien sie vergessen zu haben.
Kriminalhauptkommissar Bert Melzig hielt den Obduktionsbericht in den Händen. Der Tod Thomas Doraus war durch Ertrinken eingetreten. Würgemale am Hals und Hämatome an Armen und Schultern deuteten darauf hin, dass er ertränkt worden war.
Bert hatte Mühe, das zu verdauen. Seine Augen hatten wahrhaftig schon schreckliche Dinge gesehen, und er hatte Mordfälle aufgeklärt, die ihn wohl nie wieder loslassen würden. Doch das hier erschütterte ihn über die Maßen.
Er stellte sich die Hände vor, die den Kopf des Toten unter Wasser gedrückt hatten. Ihre Erbarmungslosigkeit. Ihre furchtbare Kraft.
Doktor Christina Henseler, die junge Rechtsmedizinerin, die die Leiche obduziert hatte, ging von mehreren Tätern aus. Das machte diesen Mord noch entsetzlicher. Das Opfer hatte nicht die geringste Chance gehabt, seinen Mördern zu entkommen.
Bert zog die Schultern zusammen, doch ihm wurde dadurch nicht wärmer.
Der Tod des jungen Mannes kam einer Hinrichtung gleich.
Es hatte allerdings ein Kampf stattgefunden. Thomas Dorau hatte sich verzweifelt gewehrt. Unter seinen Fingernägeln waren winzige Hautschuppen gefunden worden und ein einzelnes weißes Haar. Ein kleines Wunder, nachdem die Leiche mehrere Tage im Wasser getrieben hatte.
Thomas Dorau war in den Abendstunden des 6. November gestorben.
Bert legte den Obduktionsbericht auf den Schreibtisch, lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und rieb sich mit beiden Händen über das Gesicht. Jedes einzelne Mordopfer kam ihm gefährlich nah. Der Schock bei ihrem Anblick kroch ihm unter die Haut und machte ihn für eine ganze Weile unberührbar. Eigentlich war er eine Zumutung für seine Umgebung, solange eine Ermittlung dauerte.
Er stand auf und ging zum Fenster. Er öffnete es weit und schaute hinaus in das Grau, das von winterlichem Weiß durchsetzt war.
Ohne wirklich einen Blick dafür zu haben.
Er hatte Lust zu laufen. Seit er in Köln lebte, tat er das täglich. Lief, lief und lief. Weg von allem. Weg von der Erinnerung. Weg von sich selbst.
Sein Körper hatte sich verändert. Er hatte Fett verloren und Muskeln aufgebaut. Das Laufen war zur Sucht geworden. Wie vor langer Zeit das Rauchen, das er sich mit Hilfe seines Freundes, Tennispartners und Arztes Nathan schließlich erfolgreich abgewöhnt hatte.
In letzter Zeit überfiel ihn der Drang zu laufen oft mitten in den alltäglichsten Situationen. In Besprechungen. Während einer Befragung. Es war schwierig, ihn zu unterdrücken. Was half, war Konzentration.
Thomas Dorau, dachte er. Was hast du getan, um so zu sterben?
Im Nachhinein versuchte er, die Mordopfer zu schützen. Wenn sie schon ihr Leben lassen mussten, so sollten sie doch zumindest ihre Würde bewahren. Er schirmte seine Fälle so lange und so gut es ging vor den Medien ab, achtete peinlich genau darauf, dass über das Privatleben der Toten nichts oder doch so wenig wie möglich nach außen drang.
Niemand sollte ihre Schwächen ins Licht der Öffentlichkeit zerren, niemand sie so wehrlos sehen.
Und niemand sollte den Tätern ein Forum bieten, auf dem sie sich selbst darstellen konnten.
»Wann hast du dir jemals so viele Gedanken über mich und die Kinder gemacht?«, hatte Margot ihn gefragt, wieder und wieder.
Er hatte ihr nicht begreiflich machen können, dass das eine mit dem andern nichts zu tun hatte, dass die Situationen nicht vergleichbar waren. Und irgendwann hatte er nicht mehr das Bedürfnis gehabt, seiner Frau überhaupt noch irgendetwas zu erklären.
Sein Job hatte ihn seine Ehe gekostet, ihm die Kinder genommen, das Haus und letztlich auch seine alte Stelle. Er war zur Kripo Köln gewechselt und hatte eine Wohnung im Stadtteil Ehrenfeld gemietet.
Seit zwei Monaten und sieben Tagen lebte er nun allein, und dass sein Gehirn darüber so genau Buch führte, beunruhigte ihn. Es bedeutete, dass er von seiner neuen Situation noch immer überwältigt war.
Allerdings fehlte ihm die Zeit, darüber nachzudenken. Er musste sich an die Arbeitsweise in diesem Präsidium gewöhnen, die neuen Kollegen mit all ihren Eigenheiten kennenlernen, sich mit der Stadt vertraut machen, sich komplett neu organisieren. Das erforderte eine Menge Kraft.
Im Kreis seiner Kölner Kollegen kam er sich oft vor wie ein Landei, und im Grunde genommen war er das ja auch. Das Tempo hier war wesentlich höher. Davon abgesehen wurde aber auch in der Großstadt nur mit Wasser gekocht, und Bert war nicht der Typ, der sich von den äußeren Umständen hetzen ließ.
Es gab eine Reihe von Menschen, die ihm fehlten. Vielleicht würde er deshalb eines Tages beschließen, wieder aufs Land zurückzukehren, aber im Augenblick war er hier und das war gut so. Er vermied es, zurückzublicken, denn es brachte kein Glück, ein neues Leben im Schatten des alten zu beginnen.
Die Kälte war ihm in den Körper gekrochen. Er schloss das Fenster, kehrte zum Schreibtisch zurück und beugte sich wieder über den Bericht. Der Abgleich der DNA von Hautschuppen und Haar mit der DNA-Kartei des Bundeskriminalamts hatte kein positives Ergebnis gezeigt.
»Wär auch zu schön gewesen«, murmelte Bert.
Es gab inzwischen vier ungeklärte Morde, die alle in diesem Sommer in Köln verübt worden waren. Für jeden war ein eigenes Untersuchungsteam zusammengestellt worden. Bert leitete die Ermittlungen im Fall Thomas Dorau.
Seine Arbeit wurde scharf beobachtet. Man begegnete dem Neuen nicht gerade misstrauisch, aber doch mit Skepsis und Vorsicht. Und obwohl Bert genug über gruppenspezifische Verhaltensmuster wusste, war es etwas ganz anderes, wenn man selbst derjenige war, dem die allgemeine Neugier galt.
An einer Wand seines Büros hatte Bert seine Pinnwand angebracht. Sie gehörte zu seiner Arbeit wie der Schreibtisch und das Telefon, wie sein Kopf und seine Hände. Sie war eine Stütze für sein Gedächtnis und ein Quell der Inspiration.
Bislang war sie noch so gut wie leer. Doch das würde sich ändern. Schritt für Schritt würde er sich an die Wahrheit herantasten. Den Toten kennenlernen. Sein Leben aufrollen. Sein Umfeld beleuchten. Seine Geheimnisse aufstöbern. Sich seinen Träumen nähern und seinen geheimsten Gedanken.
Da draußen war ein Täter, den er finden musste. Und er würde ihn finden. Es war ein Versprechen, das er dem Toten gegeben hatte. Bisher hatte er noch jedes Versprechen gehalten.
cbt ist der Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House
Verlagsgruppe Random House
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
1. Auflage 2009
© 2009 cbt Verlag, München
Alle Rechte vorbehalten Umschlagbild: ••• Umschlagkonzeption: ••• st · Herstellung: WM
eISBN : 978-3-641-03790-1
www.cbt-jugendbuch.de
Leseprobe
www.randomhouse.de