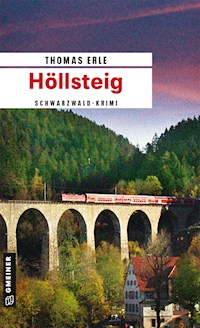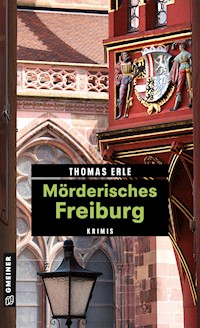Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Weinhändler Lothar Kaltenbach
- Sprache: Deutsch
Aschermittwoch. Am Kandel, dem sagenumwobenen Schwarzwaldberg, wird unterhalb der Teufelskanzel die Leiche eines jungen Mannes im Hexenkostüm gefunden. Die Polizei ist ratlos und vermutet das tragische Ende einer Mutprobe. Lothar Kaltenbach, Musiker und Weinhändler aus Emmendingen bei Freiburg, glaubt nicht an einen Unfall. Gemeinsam mit der Schwester des Toten versucht er, die wahren Zusammenhänge aufzudecken, und kommt dabei einem düsteren Geheimnis auf die Spur …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Erle
Teufelskanzel
Kaltenbachs erster Fall
Zum Buch
Die Wächter der Berge Der Kandel, sagenumwobener Schwarzwaldberg vor den Toren Freiburgs – angeblich tanzten hier einst die Hexen in der Walpurgisnacht. Am Morgen des Aschermittwochs wird am Fuße der Teufelskanzel die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Die Polizei vermutet das tragische Ende eines Fasnetscherzes, aber die Nachforschungen bleiben ohne Ergebnis. Düstere Ahnungen lassen Lothar Kaltenbach an den Erklärungsversuchen zweifeln. Der Emmendinger Weinhändler und Musikliebhaber sieht dunkle Wolken über dem Schwarzwald aufziehen. Seltsame Vorkommnisse während der Beerdigung bestätigen seine Vermutungen. Zusammen mit Luise, der rätselhaften Schwester des Toten, begibt er sich auf die Suche nach den wahren Hintergründen. Als es ein weiteres Opfer gibt, muss Kaltenbach erkennen, dass der Schwarzwald Geheimnisse birgt, die tief in die Vergangenheit zurückreichen …
Thomas Erle, in Schwetzingen geboren, verbrachte Kindheit und Jugend in Nordbaden. Nach dem Studium in Heidelberg zog es ihn auf der Suche nach Menschen und Erlebnissen rund um die Welt. Es folgten 30 Jahre Tätigkeit als Lehrer, in den letzten Jahren als Inklusionspädagoge. Parallel dazu entfaltete er ein vielfältiges künstlerisches Schaffen als Musiker und Schriftsteller. Seit Ende der 90er Jahre verfasste er zahlreiche Kurzgeschichten, von denen die erste 2000 veröffentlicht wurde. 2008 erschien sein erster Kurzkrimi. 2010 gehörte er zu den Preisträgern beim Freiburger Krimipreis, 2011 folgte die Nominierung zum Agatha-Christie-Krimipreis. Thomas Erle ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt am Rande des Schwarzwalds bei Freiburg.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir:
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Stefan Arendt – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4108-0
Zitat
El sueño de la razón produce monstrous
Francisco de Goya
(Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer)
Prolog – Zwei Jahre zuvor
Das Tier in ihm lag ruhig, aber es lauerte. Er hatte es abgerichtet in all den Jahren. Abgerichtet darauf, dass es nur noch ihm gehorchen würde, ihm und sonst niemandem auf der Welt.
Keinem Sterblichen.
Der Mann mit den kurz geschnittenen Haaren und dem grauen Gesicht sah auf die Uhr. Das letzte Frühstück hatte er abgelehnt. Die letzte Wohltat der staatlich verordneten Gutmenschen um ihn herum, die sich anschickten, ihm mit aufmunternden ›Alles Gute‹-Worthülsen den Abschied zu erleichtern. Vielleicht meinten sie es wirklich so.
Er hatte sie von Beginn an verachtet, eine Verachtung, die sich von jenem Hass distanzierte, den andere, mindere Geister in einer solchen Situation entwickelt hätten. Nur ein gleichrangiger Gegner ist es wert, den Hass des Großen zu empfangen. Diese hier waren für ihn nur Würmer, weiße Maden, die in den Höhlen des hundert Jahre alten Baues herumkrochen, in den sie ihn gebracht hatten.
Er war nie aggressiv geworden, diesen Gefallen hatte er ihnen nicht getan, den Gelehrten, den Wissenden, den Herren und Deutungsaposteln des menschlichen Geistes. Sie wussten nichts über ihn. Niemals würde ein Geringerer einen Hochstehenden erkennen. Er hatte sich immer im Griff gehabt, die ganze Zeit über. Er hatte die Medikamente entgegengenommen und dann heimlich im Zimmerwaschbecken hinuntergespült, er hatte sich an den Gesprächen willig beteiligt, in denen sie versuchten, seine Seele zu erreichen und nach ihren Vorstellungen umzuformen. Es war genauso vergebens gewesen wie die Beschäftigungen am Nachmittag, die er in scheinbar kindlicher Einfalt vollzog. Er wurde zum Musterschüler, weil er selbst es so wollte.
Nie wieder sollte ein anderer über ihm stehen, nie wieder würde er sich das Gesetz des Handelns aus der Hand nehmen lassen.
Der Mann zwang sich zu einem letzten Händedruck, ehe er den Umschlag mit den Papieren entgegennahm und achtlos in die Tasche seines hellgrauen Mantels steckte. Als er das Büro verließ und die Schranke passierte, blickte er nicht ein einziges Mal zurück.
Er hatte keine weitere Zeit zu verlieren.
Aschermittwoch, 21. Februar
»Overhead the albatross hangs motionless upon the air …«
Das Licht der frühen Morgensonne kroch durch die Fensterscheiben, fing sich in dem kleinen, orange gestreiften Teppich vor dem Bett und vermischte sich mit den getragenen Klängen von Pink Floyds Musik und dem sanften Gluckern eines 250-Liter-Aquariums.
Obwohl er bereits wach war, hielt Lothar Kaltenbach die Augen noch für eine Weile geschlossen. Er spürte, wie die Februarsonne ihren unverwechselbaren Vorfrühlingsoptimismus im Schlafzimmer ausbreitete. Die Helligkeit drang durch seine Lider und zwang ihn sanft, aber unerbittlich, sich von seinem Traum zu verabschieden und sich mit der Realität des Hier und Jetzt vertraut zu machen. Als er schließlich die Augen öffnete, hatte er die Begegnung mit den Wesen der Nacht bereits vergessen und genoss lediglich das Gefühl, dass sie angenehm gewesen war.
Seine Träume hatten sich spürbar verändert in diesem Jahr. Sie waren ruhiger und zusammenhängender geworden, ein Zeichen, dass nach seinem Verstand nun auch seine Seele den Abschied von Monika bewältigt hatte. Immer seltener kam dieses Gefühl der Einsamkeit, das ihn am Abend durch leere Straßen laufen ließ, vorbei an Häusern, die er nicht kannte und deren Klingelschilder unleserlich waren.
Kaltenbach wälzte sich zur Seite, um seine Augen besser an die Helligkeit zu gewöhnen. Das säuerlich riechende Glas neben dem Bett erinnerte ihn an gestern Abend. Der Spätburgunder war zwar kein herausragender Jahrgang, doch immerhin ein Produkt der hiesigen Winzer, die sich mit Stolz als Deutschlands beste Rotweinbauern bezeichneten. Ein Grund, weswegen er seit geraumer Zeit und etlichen Versuchen zu Kaltenbachs Hauswein avanciert war, von dem er immer eine Flasche in der Küche stehen hatte.
Er blinzelte. Die Helligkeit am frühen Morgen war noch ungewohnt nach den langen trüben Tagen. Kaltenbach setzte sich auf die Bettkante und streifte seine Armbanduhr über. Es war kurz vor sieben. Er gähnte und streckte sich ausgiebig. In der Küche nahm er eine Henkeltasse aus dem Schrank über dem Herd, blies kurz hinein und stellte sie unter die Auslaufstutzen seiner nagelneuen ›DeLonghi‹. Er entschied sich für schwarzen Kaffee, drückte den Knopf und setzte sich an den Tisch. Die neue Maschine wirkte etwas deplatziert auf dem Buffet der mit alten Holzmöbeln stilvoll eingerichteten Küche. Doch Kaltenbach war mächtig stolz auf seine neueste Errungenschaft. Er hatte richtiggehend gespart darauf, was ihm wegen seiner ständigen Geldsorgen nicht einfach gefallen war. Heutzutage kostete eine gute Kaffeemaschine mehr als früher ein gebrauchter Kleinwagen. Doch bei solchen Entscheidungen gab es kein Überlegen. Ein guter Kaffee am Morgen gehörte neben dem Rotwein am Abend zu seinen Leidenschaften.
Während die Maschine dagegen leidenschaftslos vor sich hin ratterte, genoss er den einzigartigen Ausblick, der sich ihm von seinem Platz aus bot. Direkt vor dem kleinen Balkon, auf dem ein zerzauster Oleander tapfer der morgendlichen Kühle trotzte, lagen die Felder und Streuobstwiesen vom Emmendinger Stadtteil Maleck, wo Kaltenbach seit Jahren wohnte. In südöstlicher Richtung über dem Tal mit den Zaismatthöfen breitete sich der lang gestreckte Hügel des Hachbergs aus, auf dessen Kamm die stattliche Ruine der Hochburg thronte. Auf deren Söller flatterte deutlich sichtbar die badische Fahne im Morgenwind. Dahinter begann die Kette der Schwarzwälder Randberge mit dem Kandel. Obwohl dessen Westseite, die nach Maleck herüberschaute, noch in diffuses morgendliches Schattengrau gehüllt war, sah Kaltenbach, dass oben auf über 1.000 Meter noch Schneereste lagen. ›Der Glänzende‹, das war der Name, den ihm bereits die keltischen Siedler gegeben hatten.
Kaltenbach saß gerne hier und genoss diesen Ausblick, der Vergangenheit und Gegenwart zu einer großartigen Kulisse verschmolz. Bald würde es wieder so weit sein, dass er den Balkon benutzen konnte. Kaltenbach seufzte, als er vorsichtig den ersten Schluck des brühend heißen Kaffees versuchte. Er mochte den Winter nicht sonderlich. Seit er vor vielen Jahren den Wintersport in allen Formen aufgegeben hatte, gab es nichts mehr, was ihn an dieser Jahreszeit reizen konnte, weder die dicken Pullover und Jacken noch die matschbedeckten Straßen. Vor allem die endlos grau verhangenen Tage drückten ihm aufs Gemüt. Seit er wieder alleine lebte, hatte er das Lesen wiederentdeckt. Wenn es gerade keinen Krimi im Fernsehen gab, ging er öfter früh zu Bett und verlor sich in den magischen Welten lateinamerikanischer Autoren. Dort oben im Schwarzwald, wo an manchen Orten die Zeit verwunschen schien und uralte Geschichten unter Bäumen, Moos und Fels verborgen lagen, drehte sich die Zeit unendlich langsam, gerade wie in den schwülen, dumpfen Urwäldern Kolumbiens, in denen ein Autor wie García Márquez seine Erzählungen angesiedelt hatte. Die Einsamkeit der Jahrhunderte, in denen sich die Zeit dehnte, verformte und wiederholte.
Er stellte seine Tasse erneut unter die beiden Wasserdüsen und drückte den Startknopf. Im Schrank fand er noch einen Rest Baguette vom Vortag, aus dem Kühlschrank holte er Margarine und Frischkäse, strich beides darauf und biss halbherzig hinein. Mit dem Brot in der Hand lief er kauend zurück in das Zimmer. Er wischte die Krümel an seinen Fingern an der Schlafanzughose ab, hob den Plexiglasdeckel seines alten Dual-Plattenspielers, nahm vorsichtig die schwarze Vinylscheibe herunter und steckte sie zurück in die Hülle, auf der ein überdimensionales grünliches Ohr unter Wasser abgebildet war. Nach kurzem Überlegen griff er in die Reihen seiner stattlichen Plattensammlung, zog Cat Stevens hervor und senkte die Nadel in die Lücke vor ›Morning has broken‹, dem Lied, mit dem er schon Tausende Male den Morgen begonnen hatte. Während die ersten Gitarrenakkorde ertönten, öffnete er das Fenster. Dann lief er zurück in die Küche und setzte sich wieder an den Tisch.
Inzwischen war es kurz vor halb acht. Nach der zweiten Tasse war Kaltenbachs Müdigkeit einigermaßen vertrieben. Er zog sich den Morgenmantel über, stieg barfuß die knarrende Holztreppe hinunter und öffnete die Haustür. Was er sah, sah gut aus. Der Himmel war fast wolkenfrei und ein frischer, würziger Duft lag in der Luft. Die Schneeglöckchen im Vorgarten schienen es genauso zu sehen und reckten ihre Blüten mutig dem Morgen entgegen.
»Sali!« rief es vom Garten des Nachbarhauses herüber. Herr Gutjahr stand in voller Montur bereit für seinen täglichen Morgenspaziergang. Der Frührentner, der seit 40 Jahren mit seiner Frau in dem einfachen Bungalow gegenüber lebte, war zuckerkrank und hatte von seinem Arzt Bewegung an der frischen Luft verordnet bekommen, einen Ratschlag, den er gewissenhaft zweimal täglich befolgte.
Kaltenbach setzte sein Gute-Laune-Lächeln auf und grüßte zurück.
»Sali! Wie wird’s hit?«
»Nit schlecht!«
Nach dieser erschöpfenden Auskunft zum Tageswetter holte Kaltenbach die Zeitung aus dem Briefkasten. Beim Hochgehen überflog er die Schlagzeilen. Das Übliche – ein Tankerunfall vor der koreanischen Küste, ein Anschlag auf eine Botschaft in Islamabad, Parteiengezänk um Koalitionen und Steuererhöhungen. Kaltenbach fragte sich, wen dies überhaupt interessierte. Er selbst las außer dem Sport- und Kulturteil wenig, und für das Regionale hatte er die Nachbarn, vor allem Herrn Gutjahr und seine Frau. Eigentlich hätte er die Zeitung abbestellen können. Aber sie war inzwischen zur Gewohnheit geworden wie so vieles. Zu vieles.
Als er in die Küche zurückkam, war Cat Stevens inzwischen verstummt. Kaltenbach warf die Zeitung auf den Tisch und schlurfte ins Bad. Auf sechseinhalb Quadratmetern drängten sich eine Wanne, die kleine Waschmaschine, ein Waschbecken und die Duschkabine. All dies stellte in den 60er-Jahren, als Nachbar Gutjahr das Haus baute, durchaus eine Andeutung von Luxus dar. In der heutigen Zeit wirkte diese Enge altertümlich und schreckte jeden potenziellen Mieter ab, Käufer sowieso. Kaltenbach fand das beruhigend. Er war zufrieden und die Miete hielt sich in überschaubaren Grenzen.
Kaltenbach zog seinen Morgenmantel und seinen burgunderroten Schlafanzug aus, warf ihn in das Waschbecken und stellte sich unter die Dusche. Mit zusammengebissenen Zähnen ließ er die ersten, noch kalten Wasserstrahlen über seine Füße laufen. Mit zunehmender Erwärmung bezog er dann Waden, Beine und Bauch mit ein, ehe er sich mit undefinierbaren Ächz- und Stöhnlauten in sein Schicksal ergab. Er hängte den Brausekopf zurück in die Wandvorrichtung, schloss die Augen und hob sein Gesicht der sanften Massage entgegen.
20 Minuten später nahm er einen letzten Schluck Kaffee und zog sich rasch an. Er verschob das Fischefüttern, fand seine Handschuhe nicht und hastete zur Bushaltestelle.
Aschermittwoch, 21. Februar, nachmittags
Als Kaltenbach von dem Toten am Kandel erfuhr, hatte er eben gerade einen Abschluss getätigt, von dem er annehmen musste, dass er ihn noch tiefer in finanzielle Nöte stürzen würde. Zumal es auf das Monatsende zuging und der Umsatz in ›Kaltenbachs Weinkeller‹ im Emmendinger Westend in den letzten Tagen nicht eben gerade gut gelaufen war. Doch solche Überlegungen waren in den Hintergrund getreten angesichts der Gelegenheit, die sich unverhofft geboten hatte. Eine 124 Exemplare starke Sammlung Vinyl-Platten aus den 50er- und 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Als er vor ein paar Tagen die Annonce im ›Emmendinger Tor‹, dem örtlichen Anzeigenblatt, gelesen hatte, hatte er sich zusammenreißen müssen, um nicht laut loszujubeln. Als der Student bei seinem Anruf dann noch seine Preisvorstellung genannt hatte, war Kaltenbachs einzige Sorge gewesen, der unbedarfte Jüngling würde es sich in letzter Minute anders überlegen.
Nun war das Geschäft unter Dach und Fach. Es war kurz nach fünf, der Feierabend in Sichtweite und Kaltenbach machte sich daran, seine neuen Schätze liebevoll vor sich auszubreiten. Es war eine kleine, feine Sammlung aus der Zeit, als Vinyl das gängige Musikmedium war und die Plattencoverdesigner noch viel Raum hatten und ihren kreativen Ideen freien Lauf lassen konnten. Kaltenbach hatte seinen ersten Plattenspieler bekommen, als er 14 war, und eine nagelneue, glänzende Neil-Young-Platte mit dazu. Er hatte sie hoch und runter gehört bis er alle Melodien und Texte auswendig konnte und seine Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs standen. Dass er sich kurz darauf eine Gitarre wünschte und einige Zeit später mithilfe aller Tanten und Onkel auch bekam, war nur folgerichtig. Seither bestimmte die Musik Kaltenbachs Leben. Seine Plattensammlung nahm in seiner Malecker Wohnung inzwischen eine ganze Zimmerwand ein.
Vor ihm auf dem Tisch lagen Platten von den Everley Brothers und den Beach Boys, von den Animals und von B. B. King, dem alten Bluesmeister, allesamt Erstausgaben und wenig gespielt. Die bestens erhaltenen Stücke ließen sein Herz höher schlagen. Er saß auf der Fensterbank und bewunderte die Schwarz-Weiß-Fotografien der jungen Beatmusiker mit ihren Topffrisuren, die in den 60er-Jahren als Inbegriff der Verruchtheit und Aufsässigkeit verurteilt wurden, als hinter ihm die Glocke seiner Ladentür ihr lautes Gebimmel ertönen ließ. Unwillig drehte er sich um und schalt sich, dass er den Laden zur Feier des Tages früher hätte schließen sollen. Es war zu spät. Der Türeingang wurde von einer massigen Gestalt verfinstert. Die untere Hälfte zumindest. Erna Kölblin war, wie man hier in der Gegend liebevoll sagte, ein ›Mordswib‹, das heißt, in Größe, Breite und Tiefe etwa gleich, was ihr zusammen mit dem zeltartigen Kleid und ihren rollenden Bewegungen das Aussehen einer überdimensionalen Bowlingkugel verlieh.
Die füllige Dame im ewig besten Alter blieb einen Moment unter der Tür stehen und schnaufte hörbar. Dann ließ sie sich mit einem aus tiefster Seele hervordrängenden Seufzer in den bedenklich aussehenden Ohrensessel fallen, der in der Ecke neben dem Regal mit den Roséweinen stand. Die Federn quietschten verdächtig, doch zu Kaltenbachs Erleichterung hielt der alte Knecht stand.
Noch einmal seufzte sie ausgiebig, schüttelte dann den Kopf, zog ein winziges, zartblaues Spitzentaschentuch aus den Tiefen ihrer Strickjacke und putzte sich die Nase. Kaltenbach unterdrückte den aufkommenden Ärger, als er seinen Gast erkannte. Stattdessen lächelte er, legte die Jethro-Tull-Platte auf den Stapel zu den übrigen und wartete gespannt, was kommen würde. Er wusste, dass seine Nachbarin aus dem Westend ihm etwas Wichtiges mitteilen würde, sobald sie wieder zu Atem gekommen war. Wie stets in so einem Fall hatte die Frau rote Bäckchen, die ihr das Aussehen eines schüchternen Backfisches verliehen, und das ihr, wie Kaltenbach fand, nicht schlecht stand. Doch etwas schien heute anders zu sein. Frau Kölblin wirkte ziemlich verstört.
»Horch, hesch es mitkriegt …« Wieder nahm sie ihr Taschentuch und tupfte sich die Nase. »Also waisch …«
Kaltenbach wartete.
»Nai, also sell isch …«
Doch auch den dritten Versuch brach sie ab, schnaufte erneut und schüttelte den Kopf. Kaltenbach stand auf und legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. Er kannte sie lange genug, um zu wissen, dass er ihr Zeit lassen musste. Heute schien es um mehr zu gehen als den üblichen Westendklatsch.
Vor ein paar Jahren hatte Kaltenbach den ehemaligen Laden in der Fußgängerzone übernommen und zu einer Weinhandlung umfunktioniert. Frau Kölblin war damals eine der ersten gewesen, die gekommen waren, zunächst nur aus Neugier. Doch dann hatte sie den schüchtern wirkenden ›jungen Mann‹, der damals Anfang dreißig war, unter ihre Fittiche genommen. Ihr verdankte Kaltenbach nicht nur eine lückenlose Aufzeichnung der Geschichte des Emmendinger Westends, seiner Häuser und seiner Bewohner, sondern auch, was für ihn wichtiger war, die Vermittlung von Kunden sowie ab und zu ein paar belegte Brote (›Dass ebbis wird üs dir!‹). Inzwischen lief Kaltenbachs Weinkeller ganz ordentlich, doch ihre Fürsorge war ihm erhalten geblieben.
Frau Kölblin war von Anfang an sicher, dass ein Ladenbesitzer, der täglich mit vielen Menschen zu tun hatte, eine vielversprechende Quelle für Neuigkeiten sei. Es störte sie nicht weiter, dass meist sie selbst es war, die etwas loswerden musste und wollte.
»Was ist denn los?«, versuchte er sie zu beruhigen. »Ist etwas passiert? Ein Unfall? Moment, ich hole etwas.«
Kaltenbach verschwand hinter einem Perlenvorhang, der hinter dem kleinen Verkaufsraum ein noch kleineres Hinterzimmer abtrennte. Nach kurzer Zeit kam er mit zwei Tassen Kaffee zurück, von denen er eine auf die umgedrehte Weinkiste stellte. Frau Kölblin nahm den Kaffee dankbar entgegen. Aus der hinteren Ecke schleppte er einen zweiten Sessel heran, setzte sich und versuchte es noch einmal. »Etwas Schlimmes?«
»Ebbis Schlimms?« Erna Kölblin richtete sich im Sessel auf, sodass sie beinahe ihre stattliche 151 Zentimeter Stehgröße erreichte. Ihre Augen blickten wirr.
»Ebbis Schlimms? Des hetts noch nie gä!« Sie betonte das ›nie‹ in einer Weise, die keinen Widerspruch erlaubte. »Sitt mirs denkt!«, fügte sie unmissverständlich hinzu.
Kaltenbach stellte seine Kaffeetasse ab, lehnte sich zurück und machte es sich auf seinem alten Sessel so bequem wie möglich. Er wusste, das könnte dauern. »Erzählen Sie!«, sagte er.
Eine knappe Viertelstunde später verabschiedete sich Frau Kölblin immer noch reichlich atemlos und sichtlich aufgeregt, um noch ›e paar wichtigi Sache‹ zu erledigen. Kaltenbach wusste, was das bedeutete. Schließlich war er nicht der Einzige, bei dem sie ihre Neuigkeiten loswerden musste. Wenn Erna Kölblin etwas wusste, erfuhr es innerhalb eines halben Tages garantiert die halbe Stadt. Zumindest das Westend.
Kaltenbach blieb einigermaßen verwirrt zurück. Natürlich verstand er unter Nachbarschaft, dass man sich gegenseitig zuhörte, auch dass man immer wieder einmal über andere lästerte, das reinigte die Seele, war gut gegen Magengeschwüre und stärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das war eine der ersten Lektionen gewesen, die Kaltenbach gelernt hatte, als er sich damals entschlossen hatte, von Freiburg hierher zu ziehen und diesen Laden aufzumachen. Mit den Leuten reden und den Leuten zuhören. Was sich anderswo für jeden guten Wirt gehörte, war im Breisgau Gemütlichkeitskitt. Unter anderem.
Doch dieses Mal war etwas zurückgeblieben. Etwas von dem, was er von Frau Kölblin gehört hatte, ließ Kaltenbach aufhorchen. Ein unbestimmtes Gefühl setzte sich in ihm fest, das er nicht einordnen konnte.
Wenn er alles richtig verstanden hatte, war heute früh oben im Schwarzwald auf dem Kandel ein junger Mann im Narrenkostüm, dem Häs, wie man es hier nannte, tot aufgefunden worden. Er war mit seinem Freund in der Nacht hochgestiegen und dabei im Dunkel von der Teufelskanzel heruntergestürzt. Aus Emmendingen sei er gewesen, aber sie wisse noch nicht wer, und sein Freund sei aus Waldkirch. Der sei im Krankenhaus und man wisse noch nichts Genaues. Die ganze Angelegenheit sei sehr geheimnisvoll, denn man habe noch Reste eines Feuers entdeckt und ein zerbrochenes Kruzifix gefunden, und natürlich Blut, aber nicht nur unten an der Absturzstelle, sondern auch noch oben auf dem Felsen. Ihre Freundin Marianne meinte, die seien besoffen gewesen, und sie, Frau Kölblin, glaube eher an die Kandelhexen, aber nicht die von der Fasnet, sondern die echten, die dort oben rumspukten, vor allem an Fasnet, das müsse man doch wissen, wodurch sich nach Frau Kölblins Meinung die Lösung des Falles schon ergebe. Mit diesem vielsagenden Ausbruch von tief sitzendem Volksglauben hatte sie ihn zurückgelassen.
Kaltenbach sah durch sein Fenster eine junge Frau, deren kleiner Sohn mit wachsender Begeisterung auf einer Schneckenskulptur herumkletterte. Aus deren Maul speiste sich im Sommer Wasser für das Bächle, das vom Marktplatz her durch die Lammstraße plätscherte.
Düsterer Tod und unschuldiges Leben! Als regelmäßiger TV-Krimi-Seher konnte er nicht genug davon bekommen, diese menschlichen Urgewalten wieder und wieder aufeinanderprallen zu sehen. Auf der einen Seite das Böse, leicht erkennbar und doch unergründlich, zielgerichtet und trotzdem oft unberechenbar, auf der anderen Seite die unerschütterlichen Hüter der Gerechtigkeit, die mit derselben Energie und derselben Überzeugung das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen mussten. Bei den TV-Krimis wetteiferte er gerne mit den Kommissaren um die Lösung eines Falles. Auf dem Bildschirm war es manchmal ganz schön kompliziert. Doch nach spätestens 90 Minuten hatten es die Ermittler geschafft, den Fall zu lösen. Das Drehbuch, die Regie und die vorgeschriebenen Zeitfenster der Fernsehanstalten verlangten das. Kaltenbach seufzte und wandte sich wieder dem Innenleben seines Ladens zu. Im richtigen Leben war es komplizierter. Es konnte Wochen und Monate dauern, bis es eine Lösung gab. Wenn überhaupt. Hier gab es keine Regie, die die Richtung vorgab. Oder etwa doch?
Zusammen mit den letzten Fahrgästen des Tages verließ Kaltenbach den Bus an der Endhaltestelle vor der ›Krone‹ in Maleck. Er winkte dem Busfahrer zu, der sich sichtlich auf seinen wohlverdienten Feierabend freute. Nach ein paar Schritten stand er vor seiner Haustür.
Nach diesem Tag war er zufrieden, wenigstens am Abend keine Hektik mehr zu haben. Im Kühlschrank fand er genau das, was er suchte und dazu brauchte. Er holte eine Schale mit eingelegten schwarzen Oliven hervor, dazu eine dicke Scheibe Schafskäse und zwei Tomaten. Dann sah er auf die Uhr. Es war noch eine halbe Stunde bis zum Tatort-Beginn. Heute gab es eine ältere Folge, die er aber noch nicht kannte.
Kaltenbach trug das Tablett in sein Wohnzimmer, stellte es neben dem Sofa auf einen kleinen Rattantisch und schaltete das Dritte Programm ein, wo gerade die Fanfare zur ›Landesschau‹ ertönte. Doch zuerst wollte er sich noch ein Glas Wein einschenken.
Auf dem Weg zur Küche hörte er im Hintergrund die Stimme des Sprechers. ›Wie bereits mehrfach gemeldet, wurde heute in den frühen Morgenstunden auf dem Gipfel des Kandel bei Waldkirch im Südschwarzwald die Leiche eines jungen Mannes gefunden …‹
Kaltenbach drehte sich um und rannte zurück zum Sofa. Die Bilder vom Kandelgipfel waren ihm vertraut, schließlich war er oft genug oben gewesen, zuletzt bei einer Vespatour mit seinem Stammtischkollegen Dieter Rieckmann im Spätherbst. Die TV-Aufnahmen gaben leider nicht viel her. Seit Tagen war es wolkenverhangen auf den schneebedeckten Höhen des Schwarzwaldes, sodass man nur wenige graue Schemen erkannte. Es gab ein paar Bilder vom Kandelfelsen, der im Volksmund ›Teufelskanzel‹ genannt wurde, ebenso von der Absturzstelle. Dazu ein kurzes Interview mit einem der Männer von der Bergwacht, die den Toten geborgen hatten. Am Ende wurde das Bild des Opfers eingeblendet, eines etwa 25-jährigen Mannes. Eine Reporterin bat die Zuschauer um Mithilfe bei der Identifizierung. Allgemein wurde ein tragischer Unfall angenommen. Leichtsinn am Fasnetsdienstag. Das war alles.
Während er anschließend mit halber Aufmerksamkeit die Tagesschau verfolgte, schossen ihm nie zuvor gekannte Gedanken durch den Kopf. Da war ja etwas los im beschaulichen Südwesten! Nicht dass es zwischen Schwarzwald und Vogesen keine Verbrechen gab, das war es nicht. Es gab Diebstähle, Überfälle, Schmuggel, ja selbst Morde – wie überall sonst auch in der Republik. Freiburg stand sogar in der Kriminalitätsstatistik des Musterländles noch vor Stuttgart an oberster Stelle, wobei dies allerdings hauptsächlich auf die Einnahme verbotener Substanzen und die gefühlten 3.000 Radfahrer ohne Licht in den Einbahnstraßen zurückzuführen war.
Kaltenbach schenkte sich das erste Glas des Abends ein, ein gut temperierter Durbacher Roter. Er hob das Glas und betrachtete die funkelnde Farbe vor dem Licht der flackernden Mattscheibe. Dann hob er die Nase über die Öffnung und sog das vertraute Aroma ein. Jedes Glas Spätburgunder verkürzte ihm die Wartezeit auf den Frühling. Er nahm ein paar Tropfen in den Mund, ließ den Wein zwischen Gaumen, Zunge und Wangen hin und her gleiten und schluckte dann genießerisch. ›Sürpfle‹ war eines seiner Lieblingsworte der alemannischen Sprache. Selbst wer nicht wusste, was das hieß, konnte es allein am Klang erahnen. Außer ein Biertrinker vielleicht.
Kaltenbach hob das Glas erneut an die Lippen und nahm einen größeren Schluck. Ein findiger Drehbuchschreiber könnte daraus durchaus etwas machen. ›Tod am Teufelsfelsen!‹, warum nicht?
Er stellte sich innerlich die Eingangsszene vor, wie der Vollmond sein fahles Licht auf düstere Tannen warf und irgendwo auf dem Gipfel das Grauen wartete. Doch daraus würde nichts werden. Seit Jahren hatte sich Kaltenbach geärgert, dass sein geliebtes Südbaden in der Krimilandschaft äußerst stiefmütterlich behandelt wurde. Der Tatort bewegte sich auf der Linie Ludwigshafen–Stuttgart–Konstanz und ließ südwestlich davon ein kriminalistisches Niemandsland. Vielleicht wegen der vielen Touristen, denen man ihren Urlaub nicht vermiesen wollte, vielleicht trauten die Autoren schlichtweg den Alemannen zu wenig Potenzial an Heimtücke zu. Selbst in Bad Tölz, Rosenheim und Kitzbühel schien mehr los zu sein.
Kaltenbach verwarf seine Gedanken und machte es sich bequem, während auf dem Bildschirm das vertraute Augenpaar in das vertraute Fadenkreuz genommen wurde. Heute waren mal wieder die Münchner dran. Er trank einen weiteren Schluck, stopfte eine dicke schwarze Olive hinterher und nahm sich vor, den Fall schneller zu lösen als die Spezialisten auf der Mattscheibe.
Donnerstag, 22. Februar
Die unruhigen Gedanken ließen Kaltenbach auch den nächsten Tag nicht los. Nicht einmal die Kundschaft verschaffte ihm ein wenig Abwechslung. Im ›Weinkeller‹ herrschte eine geradezu unnatürliche Betriebslosigkeit. Er stürzte sich in die ungeliebten routinemäßigen Arbeiten – Bestellungen und Abrechnungen überprüfen, von Kunden herausgezogene Flaschen mit dem Etikett nach vorn wieder einsortieren, Sonderangebotskisten neu zusammenstellen. Als gegen 11 Uhr der Briefträger kam und ihm einen Stapel Umschläge in die Hand drückte, war dies keineswegs die Abwechslung, die er gebraucht hätte.
»Hesch es ghert, obe am Kandel …«
»Ja, der Tote. Soll ein Unfall gewesen sein«, antwortete Kaltenbach einigermaßen höflich.
»Seller isch vu Ämmedinge gsi. E Student!«
So wie er es sagte, erwartete der Briefträger eine wohlwollende Bestätigung für diese Nachricht, deren Verbreitung er sich an diesem Morgen offenbar zur Aufgabe gemacht hatte.
Kaltenbach wusste um die Wichtigkeit eines wohlgesonnenen Postbeamten, und so entspann sich ein kurzer Dialog darüber, wie überrascht man sei, und dass man das doch eher von einem Auswärtigen gedacht hätte, und na ja, es war eben ein Student, und allein diese Eigenschaft war schon grenzwertig in den Augen unbescholtener Bürger. Zu Kaltenbachs Erleichterung schien dem Briefträger dies zu genügen. Er nickte sichtlich befriedigt und war kurz darauf wieder verschwunden.
Am frühen Nachmittag hängte Kaltenbach das ›Geschlossen‹-Schild hinter die Eingangstür und fuhr mit dem Stadtbus zurück nach Maleck. Es war ihm klar geworden, dass er dabei sein musste. Vor Ort. Er musste dieses Ereignis sehen, spüren, erfahren. Ohne Verzögerung. Die innere Stimme ließ sich nicht mehr unterdrücken.
Gegen halb drei stellte er seine silbergraue Vespa auf dem großen Parkplatz auf dem Kandelpass ab. Er verschloss den Helm in der Kofferbox, seine Wollmütze, die er während der Fahrt darunter getragen hatte, behielt er auf. Unten im Elztal war das Rollerfahren in der letzten Februarwoche einigermaßen auszuhalten. Der Asphalt war trocken und Kaltenbach hatte mit dem Fahren keine Mühe. Doch spätestens auf dem Anstieg am Gasthof in Altersbach, wo die schmale Straße unter das Dunkel der großen Fichten eintauchte, wurde es kalt. Im oberen Teil verdichteten sich die vereinzelten Schnee- und Eisreste am Straßenrand zu einem schmutzig grauen Saum, der Kaltenbach bis zur Baumgrenze begleitete und sich auf dem Passsattel zu großen, zusammenhängenden Schneeinseln ausbreitete.
Auf über 1.200 Metern Höhe war es empfindlich kalt. Der Himmel hielt sich bedeckt, und ein böiger Wind frischte in unregelmäßigen Abständen auf. Bis zur Teufelskanzel war es ein gutes Stück zu laufen. Hinter dem Parkplatz musste er zunächst an dem leer stehenden ehemaligen Kandel-Hotel vorbei. Es zeigte an den oberen Fenstern immer noch die schwarzen Rußreste des einige Jahre zurückliegenden Brandes und wartete seither sehnlichst auf einen Investor, der ihm wieder zu altem Glanz verhelfen würde. Kaltenbach war immer gern hier gewesen, hatte in dem geräumigen Wintergarten zur Westseite hin vor dem allzeit blasenden Kandelwind Schutz gesucht und bei einer dampfenden Schale Gulaschsuppe den Drachenfliegern zugeschaut, die direkt hinter dem Haus ihre Startrampe hatten. Doch die Küche blieb seit Jahren kalt und für die Drachenflieger war es noch zu früh im Jahr.
Hinter der verschneiten Hotelterrasse zweigte der Fußweg ab hinunter zu dem spektakulären Felssturz unterhalb des eigentlichen Gipfels. Zum Glück hatte er daran gedacht, seine gefütterten Lederstiefel anzuziehen, sodass seine Socken einigermaßen trocken bleiben würden. Auch sonst war es weniger anstrengend, als er befürchtet hatte. Offenbar hatten seit gestern noch andere dieselbe Idee gehabt, denn der Weg war ziemlich ausgetreten. Unter dem Schutz der tief herabhängenden Äste kam er gut voran.
Nach einer Viertelstunde sah er im Halbdunkel der Baumstämme vor sich etwas Rotes schimmern. Ein paar Schritte weiter hörte er vereinzelte Stimmen, deren undeutliches Gemisch sich seltsam fremd in der verschneiten Stille des Waldes ausbreitete. Beim Näherkommen entpuppte sich das farbige Geflatter als Teil des wohlbekannten rot-weiß gestreiften Absperrbandes, das in abenteuerlichen Windungen um Stämme, Büsche und Baumstümpfe geschlungen war. Direkt am Ende des Weges standen zwei dick in Winterjacken, Handschuhe und Schals eingehüllte Polizisten, die der undankbaren Aufgabe nachkommen mussten, die Neugierigen vom Ort des Geschehens fernzuhalten. Etwa 20 Sensationshungrige drängten sich auf der engen Lichtung oberhalb des Felsens, der von hier aus steil nach unten abfiel. Kameras wurden in allen möglichen Körperverrenkungen in Stellung gebracht, Thermosflaschen, aus deren Öffnung der heiße Dampf aufstieg, machten die Runde. Einige sprachen wild gestikulierend in ihr Handy. Ein Fernsehteam von TV Südbaden versuchte, das spärlicher werdende Tageslicht für ihre Aufnahmen zu nutzen, während zwei Zeitungsreporter abwechselnd die beiden Polizisten, die Umstehenden und sich gegenseitig befragten.
»Jetzt seid doch vernünftig, Leute«, hörte man den größeren der beiden Polizisten zum wiederholten Mal seine Stimme erheben. »Ihr dürft hier nicht weiter!« Sein Kollege baute sich derweil unmissverständlich vor der drängenden Meute auf. Sofort erhob sich ein forderndes Durcheinander verschiedener Stimmen.
»Nur ein Foto von der Absturzstelle, das ist doch nicht zu viel verlangt!«
»Pure Schikane, was willst du denn von den Bullen anderes erwarten!«
»Es soll hier Blutflecken geben! Wo ist das Kruzifix?«
»Guter Mann, wir sind vom Fernsehen. Sie werden doch nicht unseren Zuschauern das Recht auf Informationen verweigern?«
»Ich war schon hier oben, da warst du noch nicht mal in der Planung!«
»Bürokraten! Dickschädel!«
Die beiden Polizisten ließen sämtliche Wünsche und Wertschätzungen an ihrer stoischen Dickfelligkeit abprallen. Es blieb ihnen auch gar nichts weiter übrig. Der Unfallort musste gesichert werden, so lauteten ihre Anweisungen. Offenbar waren die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.
»Kommt morgen wieder, ab morgen früh ist die Unfallstelle freigegeben!« Mit diesem Schlussappell gab der Große ein eindeutiges Zeichen, dass er nicht weiter zu diskutieren bereit war. Die beiden nickten sich zu. Bis es dunkel wäre, mussten sie aushalten, spätestens dann würde die Meute frierend nach Hause gehen.
Kaltenbach hatte nicht damit gerechnet, an diesem Ort noch weitere Menschen anzutreffen. Diese jahrmarktähnlichen Szenen standen in völligem Gegensatz zu der Stimmung, mit der er heraufgekommen war. Für einen Moment spielte er mit dem Gedanken, umzukehren, nach Hause ins Warme zu flüchten und das Ganze zu vergessen. Unschlüssig trat er von einem Fuß auf den anderen und schlug die Hände mit den Handschuhen aneinander, denn die Kälte wurde allmählich unangenehm. Dann hatte er eine Idee.
Zur Talseite gab es neben dem Felsen einen Pfad, auf dem im Sommer die Wanderer aus dem Elztal heraufkamen. Normalerweise war er um diese Zeit unpassierbar. Doch Kaltenbach sah, dass der Weg immerhin so weit ausgetreten war, dass er ihn benutzen konnte.
Bereits nach wenigen Schritten verklang das Stimmengewirr. Die meisten Menschen wollten nur sehen, was sie wussten, dachte er. Und jeder machte am liebsten, was alle machten. Herdentrieb. Was war es, was die beiden jungen Männer in jener Nacht hier oben wollten? Ob sie sich gegenseitig angestachelt hatten, als sie am Abend mit ihren Kumpels beim Fasnetstreiben waren? Oder ging es um eine Wette? Ein Mädchen vielleicht? Alkohol? Für einen der beiden war der Preis des Andersseins der Tod.
Kaltenbach musste stehen bleiben und sich an einem Baum festhalten. Obwohl er viele Jahre hier wohnte, war er erst vor zwei Jahren zum ersten Mal hier oben an dem imposanten Felsabbruch gewesen. Mit Unbehagen erinnerte er sich an die Angst, die ihn überwältigt hatte, als er oben zwischen den beiden Felsen gestanden und hinunter ins Elztal geschaut hatte. Die Angst vor der Höhe war an ihn herangeschlichen, seit er die 30 überschritten hatte. Eine Angst, die ihm die Kehle zuschnürte und kalten Schweiß über den Rücken trieb.
Meter um Meter stolperte er vorwärts. Die Baumstämme um ihn herum bildeten einen unüberschaubaren Stangenwald, endlos in seiner Ausdehnung und ohne Orientierung für das Auge. Die letzten spärlichen Sonnenstrahlen kämpften sich eben durch die tief hängenden Wedel der mächtigen Fichten am Westhang des Berges. Mühsam krempelte er den Jackenärmel hoch, um auf die Uhr sehen zu können.
Es war kurz vor fünf. Ein paar Schritte weiter konnte er endlich den unteren Teil des Abbruchs sehen, dessen Fuß mit wild durcheinander gewürfelten Fels- und Steinbrocken übersät war. Erst vor wenigen Jahren war ein beträchtlicher Teil des Überhangs, der dem Felsen sein typisches Aussehen verliehen hatte, in einer Nacht abgebrochen und heruntergestürzt. Allein der Gedanke ließ Kaltenbach erneut schwindeln. Doch dieses Mal ging es schnell vorüber, zumal er inmitten der schneebedeckten Geröllhaufen jemanden umherklettern sah. Den Bewegungen nach zu schließen schien es eine Frau zu sein. Sie war dick eingemummt in eine gefütterte helle Jacke, dazu trug sie eine Art Skihose und Pelzstiefel. Auf dem Kopf hatte sie eine hellbraune Inka-Mütze, wie Kaltenbach sie von früher aus seinen Studententagen kannte.
Die Frau schien etwas zu suchen. Sie kletterte zwischen den verschneiten Felsbrocken herum, wobei sie mehr als einmal abglitt und sichtlich Mühe hatte, festen Tritt zu finden. Dazwischen blickte sie immer wieder nach oben zum Rand der Felskanzel, den Kaltenbach von seinem Platz aus nicht sehen konnte. Kurze Zeit später hatte die Frau offenbar gefunden, was sie suchte. Sie beugte sich herab und fuhr mit der Hand über den Schnee, ein zwei Mal, wie ein Streicheln. Dann stand sie wieder auf und verharrte, die Hände in den Jackentaschen vergraben, den Kopf gesenkt.
Kaltenbach war verblüfft. Wer war diese Frau? Und wie war sie dorthin gekommen? Vor allem, was wollte sie? Konnte sie von der Bergwacht sein oder von der Polizei? Vielleicht kam sie gar nicht wegen des Unglücks, sondern wegen des Toten.
Im selben Moment hatte Kaltenbach das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Wie heimlich durch ein Fenster das Leben eines fremden Menschen zu beobachten. Er wagte kaum, sich zu bewegen, um den seltsamen Zauber des Bildes nicht zu zerstören.
Der Anblick der Frau, die noch immer regungslos dastand, ließ ihn nicht los. Erst als es von den Füßen kalt heraufzog, kam er wieder zu sich. Er spürte, dass ihm das linke Bein eingeschlafen war und verlagerte das Gewicht auf die andere Seite. Dabei trat er in einen unter dem verharschten Schnee verborgenen Hohlraum und rutschte ab. Im selben Moment durchzuckte ein heftiger Schmerz sein Knie. Er musste seine ganze Beherrschung aufwenden, um nicht laut aufzuschreien. Mit Schmerz verzerrtem Gesicht versuchte er, die Balance wiederzufinden, rutschte jedoch weiter, verlor vollends das Gleichgewicht und fiel rückwärts in den Schnee wie ein nasser Sack.
Im ersten Moment befürchtete er, dass ihn die Frau gehört hatte. Er wusste nicht, was ihm unangenehmer war – das heimliche Beobachten einer Fremden oder die groteske Stellung, in die er sich manövriert hatte. Einige Sekunden blieb er regungslos liegen. Dann merkte er, dass es gar nicht einfach war, wieder hochzukommen. Für einen Moment schoss es ihm siedend heiß durch den Kopf, dass keiner von seiner Gegenwart hier wusste. Niemand hatte ihn den Weg herunterklettern sehen.
Vor etlichen Jahren war eine englische Schulklasse mit ihrem Lehrer unterhalb des Schauinslandgipfels bei Freiburg vom Weg abgekommen, hatte sich verstiegen und in einem plötzlich aufkommenden Schneesturm nicht mehr nach Hause gefunden. Einige waren in der Nacht erfroren, andere trugen schwere Schäden davon. Als die Vermissten schließlich geborgen worden waren, wurde das Entsetzen über diesen tragischen Vorfall noch überschattet von der furchtbaren Erkenntnis, dass der rettende Pfad nur wenige Meter von der Gruppe entfernt gewesen war. Kaltenbach war selbst einmal am ›Engländerdenkmal‹ gewesen, das bis heute die Erinnerung wachhielt. Wie viele andere hatte auch er, als er zum ersten Mal von der Geschichte gehört hatte, dies auf die scheinbare Ignoranz ausländischer Touristen abgeschoben, denselben, die in ihrer Heimat noch nie von Winterreifen oder Schneeketten gehört hatten und die regelmäßig im Winter mit ihren liegen gebliebenen Wohnwagenzügen und Lkw die Straßen um Feldberg und Belchen blockierten.
Er musste Ruhe bewahren. Es war inzwischen merklich dunkler geworden, die Schatten des Waldes hatten sich zu einer zusammenhängenden, schattenwerfenden Decke vereint. Es wurde empfindlich kalt. Er versuchte, den Schmerz in seinem Knie zu ignorieren, und ruckte vorsichtig hin und her, bis es ihm gelang, seine Schulter ein wenig anzuheben. Nach weiteren schmerzhaften Versuchen bekam er seinen rechten Arm frei, sodass er den dünnen Stamm einer jungen Esche packen konnte. Er schloss die Augen und hoffte inständig, dass das Holz sein Gewicht aushalten würde, und zog sich keuchend Zentimeter für Zentimeter hoch, bis er sich endgültig hochgestemmt hatte.
Mit keuchendem Atem und heftigem Herzklopfen lehnte er sich an einen Baum, bis er wieder zu Kräften kam. Dann kletterte er auf allen vieren die wenigen Meter hoch zu dem Weg, von dem er abgerutscht war.
Als er wieder sicheren Tritt unter den Füßen hatte, schüttelte er den Schnee aus seinen Haaren und klopfte Jacke und Hose ab. Das Knie schmerzte höllisch, doch er biss die Zähne zusammen. Er musste sich beeilen, nach oben zu kommen, solange er noch ein bisschen sehen konnte.
Die Sonne verschwand rasch hinter den aufziehenden dicken grauen Wolken, der Tag hüllte sich in das traurige Grau des Februarabends. Tief unten im Waldkircher Tal flammten die Straßenlaternen auf, in einzelnen Häusern brannte das Licht. Die Silhouette der Kastelburg war in der aufziehenden Dämmerung bereits kaum mehr zu erkennen.
Er sah noch einmal zurück zu dem Felsabhang. Die Geröllbrocken hatten ihre Konturen verloren, alles lag still. Die Frau war verschwunden. Dort, wo sie gestanden hatte, flackerte der winzige Lichtschein einer Kerze.
Freitag, 23. Februar
»Der Walter, der wird 60 heut, da kommen zum Gratulieren alle Leut!«
»Ach nein, das schreiben doch alle. Hab ich schon hundertmal gelesen. Es muss was Originelles sein. Pass auf, wie wäre es damit: ›60 werden ist nicht schwer, für den Walter aber sehr!‹«
»Ist zu pessimistisch.«
»Na und? 60 ist 60. Früher hat der auch ›Trau keinem über 30!‹ verkündet. Jetzt hat er selber schon das Doppelte. Lothar, sag doch auch mal was! Du bist doch unser Dichter, du kannst das doch.«
Kaltenbach hatte bisher nur wenig beigetragen. Dabei waren die Stammtisch-Kumpels früher als gewohnt zusammengekommen, um Walter Macks Geburtstag am nächsten Wochenende vorzuplanen. Markus hatte eine der üblichen hiesigen Zeitungsannoncen vorgeschlagen, an der sie sich nun bereits seit über einer halben Stunde abmühten. Der Hinweis auf den Dichter war Kaltenbach peinlich. Bei einer ihrer vielen Stammtischrunden hatte er sich dazu hinreißen lassen, von seinen lyrischen Versuchen zu erzählen. Seither hatte er seinen Titel weg.
»Ich muss noch was trinken, sonst wird das nichts.« Dieter gab mit seinem leeren Glas ein Zeichen zum Tresen hinüber. Markus tat es ihm nach, und im nächsten Moment waren beide wieder beschäftigt, die gut gemeinten Glückwünsche an den ersten Sechziger in ihrer Runde in Worte zu fassen. Trotz Kaltenbachs Bedenken hatten beide darauf bestanden, das Ganze in Reimform zu halten.
»Du bist jetzt cool und nicht mehr lechzig, deine Jahre zählen 60 …«
Die meiste Zeit hatte er nur mit halbem Ohr zugehört. Das Erlebnis auf dem Kandel beschäftigte ihn weit mehr, als er gedacht hatte. Es war weniger das schmerzende Knie, das ihn seither zu einem langsameren Gang zwang und das Markus und Dieter gleich mit entsprechenden Kommentaren bedacht hatten. Heute morgen waren wieder die Gedanken an den Toten gekommen. Er spürte, dass es da etwas gab, was ihn tief berührte. Es war wie ein fernes Rufen, das er noch nicht entziffern konnte. Und da war diese Frau.
»Eine Schorle sauer, ein Bitter Lemon.« Evangelos, der bezopfte Kellner, stellte die gewünschten Getränke vor den beiden auf, nickte vielsagend mit dem Kopf in ihre Richtung und grinste Kaltenbach zu, ehe er sich nach hinten verzog.
»Es ist verflixt kompliziert, warum reimt sich denn nichts auf 60?«
»Dann nehmen wir eben ›60 Jahre‹! Pass auf: ›Der Walter wird heut 60 Jahre, und nicht mehr lange, dann liegt er auf der Bahre!‹«
Prustendes Gelächter.
Je mehr sich die beiden in ihre Knittelverse à la Hans Sachs hineinsteigerten, desto weniger Lust hatte Kaltenbach, sich zu beteiligen. Vielleicht hatten sie ja recht. Es gab viele Rituale der Milderung, mit denen die Menschen versuchten, das Älterwerden und die Unabänderlichkeit des Todes zu kompensieren, sei es durch die jährliche Erinnerung an die Geburt.