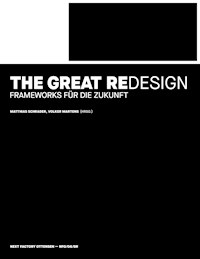
The Great Redesign E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Edition NFO
- Sprache: Deutsch
Wir leben in einer Welt, die ständig neu gestaltet wird. Das Redesign von heute ist der Vintage-Look von morgen. Aber Krisenzeiten ändern schlagartig das Bild. Plötzlich ist die ganze Welt dringend auf ein neues Design angewiesen. Von Kapitalismus bis Kommunikation, von Arbeit bis zu Wertschöpfungsketten, von Städten bis zu Büroräumen - es ist schwer, einen Bereich unseres Lebens zu finden, der nicht überholt werden muss. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine riesige Chance: eine bessere Welt zu gestalten. Herausgegeben von Matthias Schrader und Volker Martens. Mit Beiträgen von Payal Arora, Axel Averdung, Kristina Bonitz, Azeem Azhar, Genevieve Bell, Amy McLennan, Benedict Evans, Daisy Ginsberg, Rafael Kaufmann, Sohail Inayatullah, David Mattin, Miriam Meckel, Léa Steinacker, Thomas Müller, Ramez Naam, Tijen Onaran, Pamela Pavliscak, Ben Sauer, Laëtitia Vitaud, Albert Wenger.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort von Matthias Schrader
Die Neugestaltung von “The New Never Normal”
Vorwort von Volker Martens
Halt and Catch Fire
Miriam Meckel und Léa Steinacker
Nashörner, Völlerei und Quantenzustände: Wie wir die Gegenwart neu erfinden
Albert Wenger
Der große Übergang
David Mattin
Designs für das Leben
Thomas Müller
Wir müssen unsere Zukünfte jetzt gestalten
Sohail Inayatullah
Eine komplizierte Geschichte oder ein grundlegender Vorteil?
Covid-19 und die Auswirkungen auf Zukunftsstudien
Axel Averdung und Kristina Bonitz
Keine Gravity bei Innovationen?
Payal Arora
Den Menschen von den Ketten der globalen Wertschöpfung befreien
Benedict Evans
Covid-19 und erzwungene Experimente
Azeem Azhar
Der Abgesang auf die Megacity wäre verfrüht:
Städte werden lernen und sich anpassen
Ramez Naam
Die Solarenergie der Zukunft ist wahnsinnig billig
Laëtitia Vitaud
Zukunft der Arbeit: Die fünf Chancen und Risiken der heutigen Krise
Tijen Onaran
Diversity jetzt!
Pamela Pavliscak
Technologie-Redesign und die Kunst menschlicher Beziehungen
Ben Sauer
Vorsicht Metapher!
Genevieve Bell und Amy McLennan
Die neue Kybernetik: Lehren aus dem letzten großen Redesign
Rafael Kaufmann
Gaianomics, oder die sich selbst gestaltende Erde
Alexandra Daisy Ginsberg
Auf der Suche nach besseren Welten
Vorwort von Matthias Schrader
DIE NEUGESTALTUNG VON “THE NEW NEVER NORMAL”
In dem Buch Transformationale Produkte habe ich 2017 die exponentiellen Eigenschaften der Digitalisierung beschrieben.1 Damals schrieb ich, dass exponentielles Wachstum keine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, die auf dem Moore’schen Gesetz basiert („Rechenleistung verdoppelt sich alle 18 Monate“). Stattdessen ist die Digitalisierung im Kern ein Netzwerkphänomen: Der Wert digitaler Produkte und Dienstleistungen steigt exponentiell mit ihrer Verbreitung. In der Praxis wird diese exponentielle Verlaufskurve jedoch zu einer S-Kurve gebogen, weil die Marktnachfrage oder die Ressourcen begrenzt sind.
In den letzten Jahrzehnten haben wir drei primäre digitale Transformationszyklen erlebt: den PC (1975–1995), das Web (1995–2010) und Mobile (2010–2020). Diese Zyklen können in drei aufeinanderfolgenden S-Kurven abgebildet werden. Sie bauten aufeinander auf und verdoppelten sich vertikal (das heißt 20 Millionen PC-Nutzer, 40 Millionen Web-Nutzer, 80 Millionen Smartphone-Nutzer in Deutschland) und wurden zunehmend horizontal komprimiert (das Smartphone benötigte nur zehn Jahre, um zum allgegenwärtigen Internetgerät zu werden). In jedem Zyklus haben wir die jeweilige digitale Realität als The New Normal beschworen – das Motto unserer NEXT Conference 2014 über den Siegeszug des Smartphones.
2020 ist jedoch das Jahr, in dem kein neuer Zyklus, keine neue S-Kurve begann. Wir leben jetzt in The Never Normal. Wenn die Dinge umstürzen, sich überlagern und überholen, müssen wir uns grundlegend mit anderen Mechanismen, Fähigkeiten und kulturellen Dimensionen befassen. Vor allem müssen wir unsere Haltung radikal ändern. Und uns kristallklar darüber werden, was geschehen ist. In Europa sind wir bereits 2001 – als die New Economy ihre Krise erlebte und die Unternehmenswerte zusammenbrachen – in einen digitalen Lockdown geraten. Und wir haben uns nie davon erholt.
Wir haben es uns in dieser Situation bequem gemacht. Wir haben die technologische Entwicklung in Europa in den letzten zwei Jahrzehnten als Scheinbewegung erlebt. Wir haben aus dem Fenster geschaut und die Züge aus den USA und China links und rechts an uns vorbeifahren sehen. Dadurch hatten wir den Eindruck, dass wir uns auch bewegten, während wir tatsächlich nicht aus dem Bahnhof herauskamen.
Dieses Buch soll uns Anregungen geben, wie wir uns aus dieser Sackgasse herausarbeiten können. Dafür gibt es keine Abkürzungen. Es ist eine schwere Aufgabe. Die Zeiten für das übliche Innovationstheater mit Design-Thinking- und Wohlfühl-Workshops sind vorbei. Nur eine radikale Haltung und die Rebellion gegen den Status quo werden helfen.
Bild: Jack Anstey (Unsplash)
Felder zur Gestaltung gibt es zur Genüge: In Europa – wie auch andernorts – haben wir allein in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Mobilität die Chance, das Leben vieler Menschen mit innovativen Ideen deutlich besser oder zumindest annehmlicher zu gestalten. Eine Corona-Warn-App, ein Algorithmus zur Erkennung rechtsextremer Propaganda, ein Portal für MS-Kranke, eine Strategie für gelingende Elektromobilität von morgen – auch vermeintlich kleine Projekte können einen positiven Einfluss auf das Leben Einzelner haben oder Keimzelle zur Transformation ganzer Städte sein.
Ich wünsche Ihnen Mut bei der Neugestaltung von The New Never Normal. Und einen Blick für das große Ganze. Denn für echte Veränderung braucht es einen langen Atem. Unternehmerische Kurzsichtigkeit hilft uns nicht weiter. Nach der ersten Idee stellt sich der Erfolg in der Regel nicht umgehend ein, sondern es folgt eine längere Strecke geduldigen Verprobens und stetigen Verbesserns, um Innovationen durchzutragen und zu etablieren. Bleiben Sie dran. Das kann großartig sein.
Matthias Schrader leitet Accenture Interactive DACH. Vor bald 25 Jahren gründete er die Agentur SinnerSchrader, die mittlerweile zu Accenture Interactive gehört, sowie 2006 die renommierte NEXT Conference (www.nextconf.eu).
Literaturhinweis
1 Schrader, Matthias (2017). Transformationale Produkte. Next Factory Ottensen.
Vorwort von Volker Martens
HALT AND CATCH FIRE
Im Dezember 2019 haben wir Halt and Catch Fire zum Motto unserer NEXT Conference 2020 gewählt. Der Begriff bezeichnet einen Computerbefehl, der zum Systemabsturz führt und einen radikalen Reset erfordert. Obwohl noch niemand an Corona dachte, hatten wir das Gefühl, dass die Welt auf einen Moment des Innehaltens zusteuert. Aber dass dieser Break so plötzlich kommen und so radikal ausfallen würde, hatte sich wohl niemand vorgestellt.
Jetzt, bald ein Jahr später, sitzt das Staunen über den plötzlichen Stillstand immer noch tief; aber auch die dankbare Verwunderung darüber, dass der äußere Stillstand nicht zu einer geistigen Lähmung geführt hat. Im Gegenteil! Mit der Pandemie sind auch Kreativität und Klugheit förmlich explodiert. Parallel zur physischen Bedrohung wuchs die geistige Widerstandskraft. Je mehr die äußere Welt schrumpfte, umso weiter wurde der Geist. Mit der Klarheit der Luft nahm auch die Klarheit der Gedanken zu. In der Stille der äußeren Welt wurden immer mehr kluge Stimmen hörbar. Und je mehr Grenzen geschlossen wurden, desto grenzenloser wurden die Debatten.
Bild: Jonathan Gallegos (Unsplash)
Auch dieses Buch ist Ausdruck dieser intellektuellen Eruption. Und es spiegelt den weltumspannenden Wunsch wider, dass wir diesen Systemabsturz nutzen, um nicht nur einen Reset, sondern einen echten Neustart zu wagen. Doch der erfordert zunächst eine Reflexion des Status quo. „Wir sind so schnell gelaufen, dass wir nie angehalten haben, um zu hinterfragen, ob die Richtung noch stimmt“, schreiben Miriam Meckel und Léa Steinacker. Und schlagen vor: „Was wäre, wenn wir diese Pause nicht zuerst als tragischen Produktivitätsverlust betrachteten – sondern als Gelegenheit, darüber nachzudenken und Bilanz zu ziehen, wo wir stehen und wer wir geworden sind?“ 1
Tatsächlich war das Unbehagen darüber, wer wir geworden sind und was wir der Welt dadurch antun, zuletzt fast überall spürbar. Doch es wurde immer wieder vom Lärm des Alltags übertönt. Und obwohl wir eigentlich jede Freiheit hatten, unser Leben bewusst zu gestalten, fehlte letztlich das Zutrauen in unsere eigene Gestaltungskraft. Paradoxerweise mussten erst unsere Freiheiten radikal beschnitten werden, bevor wir uns die geistige Freiheit zurückerobern konnten und der Gestaltungswille zurückkehrte.
Covid-19 hat viele unserer Gewissheiten auf brutale Weise erschüttert. Das bleibt eine schmerzliche Erfahrung, aber auch eine heilsame. Denn mit der Pandemie wurde vieles möglich, was zuvor undenkbar schien: In einem Land wie Deutschland, das bei der Digitalisierung des Bildungswesens hoffnungslos hinterherhinkt, wurden Lehrer und Schüler von heute auf morgen in digitale Lernwelten katapultiert. In einer vom Primat der Präsenzkultur geprägten Arbeitswelt wurden Tausende Arbeitnehmer über Nacht ins Homeoffice entlassen. Dienstreisen, die vorher unverzichtbar schienen, wurden ersatzlos gestrichen; Meetings, Konferenzen, ja selbst Hauptversammlungen und Gerichtsprozesse in den virtuellen Raum verlagert.
Zwischen März und April 2020, also binnen nur eines Monats, stieg die Zahl der Deutschen, die in der Digitalisierung eine Chance für die Gesellschaft sehen, von 49 auf 57 Prozent. Kein Wunder. Während der harten Phase der Pandemie hat wohl praktisch jeder die Vorzüge digitaler Technologien hautnah erlebt. Digitale Technologien haben in dieser Zeit nicht nur unser persönliches Leben deutlich bereichert, ohne sie wäre die Welt wohl wirklich zum Stillstand gekommen. Gleichzeitig hat Covid-19 unser Verhältnis zu Technologie aber auch relativiert. Denn schnell wurde klar, dass im Kampf gegen das Virus vor allem andere
Waffen zählen. Wirkungsvoller als die Corona-App schützt uns ein Stückchen Stoff vor Mund und Nase. Und mehr als alles andere zählen menschliche Einsicht und die Verantwortung des Einzelnen. Vielleicht ist es genau diese Erfahrung, die jetzt unser Zutrauen in die eigene Gestaltungskraft stärkt.
In der Corona-Krise haben wir durch bewusstes Verhalten und den Verzicht auf persönliche Freiheiten das Leben anderer und insbesondere älterer und schwächerer Menschen geschützt. Diese generationenübergreifende Solidarität ist für mich eine der positivsten Lehren aus der Pandemie. Im Konflikt um den Klimawandel hat sich die ältere Generation bisher gegen die Fridays-for-Future-Bewegung durchgesetzt. Vielleicht entsteht jetzt eine neue Verpflichtung aufseiten der Älteren und die Corona-Krise wird zur Grundlage für einen New Generational Deal, wie das Zukunftsinstitut vorschlägt.2
„Nichts könnte schlimmer sein als die Rückkehr zur Normalität“, schreibt die indische Schriftstellerin Arundhati Roy in einem viel beachteten Aufsatz in der Financial Times, wir haben jetzt „die Chance, die Weltuntergangsmaschine, die wir für uns selbst gebaut haben, neu zu überdenken.“3 Was kann uns dabei helfen? „Umsichtiges und zielgerichtetes Handeln, das Signale aufnimmt, auf Fakten und Vernunft gründet, von Fantasie inspiriert ist: Das ist es, was wir derzeit am dringendsten brauchen“, schreibt Thomas Müller in diesem Buch.4 Als Kommunikator möchte ich hinzufügen: und neue Narrative, die Mut machen – und Lust auf eine andere Zukunft.
Die Blaupause für ein solches Narrativ lieferte der niederländische Historiker Rutger Bregman mit seinem neuen Buch Im Grunde gut.5 Mit dieser „neuen Geschichte der Menschheit“ widerlegt Bregman den Mythos vom stets auf den eigenen Nutzen bedachten Homo oeconomicus und tritt den Beweis an, dass Menschen (wenn man sie nur lässt) höchst soziale, empathische und kooperative Wesen sind. 6 Den unzähligen Beweisen, die Bregman für seine These anführt, könnte man nun auch noch das überwältigend solidarische Verhalten der allermeisten Menschen während der Pandemie hinzufügen.
Neue Narrative bieten auch die Autoren dieses Buchs. Die Strategen, Designer, Forscher und Philosophen, Praktiker, Unternehmer und Künstler blicken aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt. Doch sie alle eint der Wunsch, diese historische Chance für einen echten Neustart zu nutzen – und die Zuversicht, dass dieser gelingen kann.
Volker Martens ist einer der Gründer und Vorstand der Hamburger Kommunikationsagentur FAKTOR 3. Gemeinsam mit seinen Partnern Sabine Richter und Stefan Schraps verfolgt er seit Jahren die zentralen Kommunikationsinhalte und Strömungen einer digitalisierten Welt. Gemeinsam mit Accenture Interactive ist FAKTOR 3 Ausrichter der NEXT Conference (www.nextconf.eu).
Literaturhinweise
1 siehe Kapitel I
2 Horx, Matthias (2020). 10 Zukunftsthesen für eine Post-Corona-Welt. Zukunftsinstitut.
3 Roy, Arundhati (2020). The pandemic is a portal. Financial Times.
4 siehe Kapitel IV
5 Bregman, Rutger (2020). Im Grunde gut: Eine neue Geschichte der Menschheit. Rowohlt.
6 kritisch dazu Arora, Payal in Kapitel VIII
Miriam Meckel und Léa Steinacker
NASHÖRNER, VÖLLEREI & QUANTEN- ZUSTÄNDE WIE WIR DIE GEGENWART NEU ERFINDEN
Bilder: Keith Markilie und Tom Barrett (Unsplash)
Was wir nicht sehen wollten
Es macht einen großen Unterschied, ob man einen schwarzen Schwan oder ein graues Rhinozeros vor sich hat – nicht nur was die akute Gefährdung des eigenen Lebens angeht. Vielmehr scheint es ein Leichtes, am schwarzen Schwan vorbei in die Zukunft zu schauen, während das Rhinozeros einem doch in seiner physischen Wucht den Blick verstellt.
Tatsächlich verhält es sich genau umgekehrt. Der schwarze Schwan gilt als Metapher für das Unvorhersehbare, für die große Krise, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Der US-Risikoanalyst Nassim Nicholas Taleb definiert in seinem gleichnamigen Buch den schwarzen Schwan als ein Ereignis, das durch drei Kriterien bestimmt wird: Es ist extrem selten, extrem wirkungsvoll und erst in der Retrospektive erklärbar.1 In dieser Lesart hat sich das Tier auch als beliebtes Fabelwesen in der Zoologie der menschlichen Ausflüchte etabliert. Als anerkanntes Narrativ der Entscheidungen, die Menschen in Führungspositionen nicht treffen konnten, weil das, was da kam, einfach nicht absehbar war.
Meistens stimmt das gar nicht. Meistens ist durchaus absehbar, was da auf uns zukommt. Dann haben wir es nicht mit einem schwarzen Schwan zu tun, sondern mit einem Rhinozeros. Das steht dick und fett im Bild. Es zu sehen ist nicht eine Frage des Könnens, sondern eine des Wollens.
Das gilt auch für Covid-19. Die Virusinfektion ist eben nicht der schwarze Schwan, auf den man nicht gefasst sein konnte, wie es die Beteiligungsgesellschaft Sequoia in einem gleichnamigen Beitrag formulierte.2 Man hätte wissen können. Nicht alles, aber vieles. Wenn man hingeschaut hätte. Eine Risikoanalyse der deutschen Bundesregierung aus dem Jahr 2012 hat eine umfassende Dokumentation zu einer möglichen „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ vorgelegt.3 Das Robert Koch-Institut und weitere Bundesbehörden erarbeiteten ein Szenario mit sechs Millionen erkrankten Deutschen auf dem Höhepunkt der Krise. Natürlich spiegelt dieses „Maximalszenario“ nicht eins zu eins die aktuelle Entwicklung von Covid-19, aber sie ist das Rhinozeros, das seither unbeachtet im Raum stand.
US-Tech-Unternehmer Bill Gates warnte in einem TED-Talk 2015 vor einer Virusepidemie als größter Bedrohung für die Menschheit und kam zu dem Ergebnis: „Wir sind nicht darauf vorbereitet“. 4 Und US-Regierungsbehörden spielten erst 2019 ein groß angelegtes Szenario unter dem Decknamen „Crimson Contagion“ durch. Es ähnelt erschreckend der Coronakrise: Ein neues Grippevirus wird von China aus durch Reisende in die USA importiert. 110 Millionen Erkrankte und fast 600.000 Tote sowie viele Mängel in der Zusammenarbeit und im Krisenmanagement der Behörden hätten Grund genug sein können, genauer hinzuschauen.5 Da stand es, das große graue Tier, direkt vor unser aller Augen.
Die erste Einsicht dieser Krise lautet somit: Man hätte etwas wissen können von der Relevanz und Dramatik, die eine Viruspandemie mit sich bringt, wenn sie eine hochvernetzte Welt trifft. Vielleicht hätte man Teile der Entwicklungsdramaturgie sogar anhand einer klugen Interpretation der vorliegenden Szenarien voraussehen können. Das wollte offenbar niemand. Deshalb gilt: Die Situation ist nun, wie sie ist.
Zumindest jetzt aber kann man einmal innehalten und fragen: Warum wollte niemand wirklich hinschauen? Und was nun?
Der Yale-Geschichtsprofessor Frank Snowden brachte im vergangenen Jahr ein Buch heraus, in dem er sich mit der Historie von Epidemien beschäftigt. Sie hielten der Menschheit den Spiegel vor, sagte Snowden dem Magazin New Yorker.6 Und was wir da im Angesicht von Covid-19 im Spiegel sehen, muss uns missfallen.
Weltweite Völlerei
Wir sind eine globale Gesellschaft, die exponentielles Wachstum nicht nur für möglich, sondern für erstrebenswert hält; deren ökonomische Systeme und Maßstäbe für unternehmerischen wie individuellen Erfolg auf derselben Kurve basieren: immer aufwärts, in einem unendlichen faustischen Streben nach mehr.
Kapitalismus braucht Wachstum, das leuchtet sogar Nichtökonomen schnell ein. Wenn unsere Kinder besser leben sollen als wir, brauchen wir fortwährend einen Zuwachs. Aber geht es darum? In vielen Teilen der Welt haben die Wachstumswünsche von graduell auf exponentiell umgestellt. Für die meisten Lebens- und Arbeitsbereiche gilt: immer mehr, immer schneller, immer noch mehr, immer noch schneller.
Deshalb sind unsere Arbeitstage vollgepackt mit Besprechungen, Anrufen, E-Mails und vollen Aufgabenlisten – alles Formen des Exzesses. Wir opfern unsere Gesundheit, unsere Beziehungen und unser geistiges Wohlbefinden, um möglichst produktiv zu sein.
Viele rasen rastlos um die Welt, nicht um den Weg oder das Ziel kennenzulernen, sondern um Zehntausende von Meilen von der Heimat entfernt wenige Stunden an Flughäfen, in Taxis und Hotelzimmern zu verbringen und Geschäfte abzuschließen. Erdbeeren und Avocados fliegen durch die Nacht, um 24 Stunden später auch in kalten Wintermonaten die Supermarktregale zu füllen.
Arbeitstage füllen sich weit über die Ränder eines gesunden On- und Off-Zeiten-Wechsels mit Meetings, die oft ergebnisarm versanden. Man sammelt Kontakte, ob auf Stehempfängen mit vorbeifliegenden Häppchen oder in sozialen Netzwerken, darunter viele Menschen, die man im realen Leben zuvor noch nie gesehen hat und auch niemals treffen wird. Hauptsache, das Netzwerk wächst. Technologie vergrößert unseren unstillbaren Hunger nach Exzess noch zusätzlich mit unendlich konsumierbaren Inhalten. All die Netflix-Shows, die wir gucken, all die Spotify-Playlisten, die wir hören, und das Wissen, dass all das, was wir uns erträumen könnten, immer nur einen Amazon-Prime-Klick entfernt ist.
Und jetzt befindet sich die Welt plötzlich im Stand-by-Modus. Zum sporadischen Stillstand gebracht ausgerechnet von einem Virus, dessen Ambition unserem eigenen Ehrgeiz auf gespenstische Weise ähnelt – es nutzt menschliche Zellen, um sich rasend schnell zu vervielfachen und um den Globus zu verteilen. Seine gesamte Existenz beruht auf exponentiellem Wachstum. Sars-CoV-2 schlägt die Menschheit mit ihren eigenen Mitteln. Eine beinahe unheimliche Parallele zu einer vernetzten globalen Ökonomie, die besessen ist von einer Existenz auf der Überholspur und sich nicht um Grenzen schert.
Aber diese Grenzen, egal ob von Immunsystemen oder Intensivstationen, erweisen sich nun als verletzlicher als gedacht. Juliette Kayyem, Sicherheitsexpertin an der Harvard Kennedy School of Government, drückt es so aus: „Eine Krise trifft eine Gesellschaft immer so, wie sie ist – und nicht so, wie wir sie uns wünschen würden.“ 7
Wir haben jedes Angebot und jede Erfahrung, unsere Umgebung, ja sogar einander und unsere individuellen Ressourcen über Jahrzehnte hinweg mit viraler Dynamik ausgereizt. Die zweite Einsicht dieser Krise lautet also: Wir wollten immer noch mehr. Quantität war uns wichtiger als Qualität. Diese Gier hat Obsession und Exzesse freigesetzt, die vor allem einem ähneln: der Todsünde der Völlerei.
Im Quantenzustand
Und jetzt, welch absurde Ironie, soll eine Weltbevölkerung, die auf Überstunden konditioniert ist, vom Gegenteil überzeugt werden. Nur wenn weniger getan, gewollt und konsumiert wird, sind die Lieben und die Nachbarschaft noch zu retten. Eine Botschaft, die der Ideologie von konstanter Arbeit, persönlichen Opfern und dem ständigen Verlangen nach mehr radikal widerspricht.
Jahrelang konnten viele von den natürlichen Ressourcen, der digitalen Infrastruktur, expansiven Geschäftsstrategien nie genug bekommen. Manch einer weigert sich noch immer beständig, die endlose Geschäftigkeit als das zu sehen, was sie wirklich ist: ein Bewältigungsmechanismus, um in einer Welt zu überleben, in der das ständige Streben nach mehr auch bedeutet, dass das, was man gerade tut, niemals genug ist.
Das Virus ist agnostisch und egalitär unterwegs. Es bevorzugt nicht. Menschen aber tun das. Und so deckt Covid-19 unsere diskriminierenden Systeme auf. Das Motto „immer mehr“ ist nicht nur Verbreitungsmodus von Sars-CoV-2, es ist auch das Mittel, mit dem eine Weltgesellschaft auf der Überholspur sich davon freikauft, über den eigenen Sinn nachzudenken, nicht nur nach dem Wie und Wohin zu fragen, sondern einfach einmal nach dem Warum und dem Wozu.
Wozu also könnte die Krise gut sein? Was wäre, wenn wir diese Pause nicht zuerst als tragischen Produktivitätsverlust betrachteten – sondern als Gelegenheit, darüber nachzudenken und Bilanz zu ziehen, wo wir stehen und wer wir geworden sind? Wir sind so schnell gelaufen, dass wir nie angehalten haben, um zu hinterfragen, ob die Richtung noch stimmt.
Eine einfache Antwort auf diese komplexe Krise gibt es nicht. Das zeigen die vielzähligen Modelle, die den Verlauf des Virus zu errechnen versuchen. Kleinste Schwankungen einzelner Faktoren können große Auswirkungen auf die Folgen bedeuten. Sie ist ein Paradebeispiel für ein chaotisches System.
Die dritte Einsicht lautet: Die Welt befindet sich im Quantenzustand. Sie tickt längst nicht mehr binär.
Historisch gibt es vielfältige Beispiele für das Denken und Handeln in binären Gegensätzen. Schon im Matthäus-Evangelium steht geschrieben: „Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich.“ Europa hat Jahrzehnte in der Spaltung durch den Kalten Krieg gelebt, zwischen den Alternativen Ost und West.
Der Siegeszug des digitalen Computers seit den Fünfzigerjahren hat unser Weltverständnis da nur konsequent ergänzt: Jedes Wort, jedes Bild und jeder Ton lassen sich in ein Entweder-oder, eine Reihe von Nullen und Einsen verwandeln. Die Welt ist binär. Technologie ist aber nicht nur Medium, sondern auch Metapher für den Wandel der Lebensverhältnisse. Als Google im vergangenen Herbst kundtat, man habe Quantum Supremacy erreicht, war das ein Vorbote für einen bevorstehenden Paradigmenwechsel, einen grundsätzlichen Wandel unserer Lebensverhältnisse. Hinter dem martialischen Begriff verbirgt sich enorme Rechenleistung: Googles Quantencomputer Sycamore brauchte 200 Sekunden für eine Aufgabe, für die der derzeit weltbeste Supercomputer, gebaut von IBM, 10.000 Jahre benötigen würde. Das ist ein unpraktischer Zeitaufwand, wenn man als Mensch in den Genuss des Ergebnisses kommen möchte.
Quantencomputer unterscheiden sich sehr grundsätzlich von bisherigen Computern. Sie sind nicht nur viel schneller, sondern können Millionen von Berechnungen gleichzeitig vornehmen. Sie arbeiten nicht mit dem Bit als Informationseinheit in der Unterscheidung von 0 und 1, sondern mit Quanten-Bits. Diese Qbits können alle Zustände zwischen 0 und 1 annehmen. Zukünftige Computer werden sich also von den Fesseln des binären Codes befreien und sich für alle vorstellbaren Überlagerungszustände öffnen, Superposition genannt. Die ehemalige IBM-Chefin Ginni Rometty sagt dazu: „Quantum ist die physikalische Variante von Shades of Grey (und es sind mehr als 50).“
Der österreichische Physiker Erwin Schrödinger hat 1935 in einem Gedankenexperiment am Beispiel einer Katze versucht, die Regeln der Quantenphysik auf die materielle Welt anzuwenden. Gelänge das, müsste man die Katze in einen Zustand versetzen können, in dem sie gleichzeitig tot und lebendig wäre. Das klingt absurd. Und doch steckt in diesem Paradoxon der Qbits eine Erkenntnis, die unseren Blick auf die Welt auch jenseits der Computertechnologie verrückt.
„Bisherige Computer arbeiten, wie wir eine Münze werfen“, sagt der US-Journalist und New-York-Times-Kolumnist Thomas Friedman. „Heraus kommt immer Kopf oder Zahl. Beim Quantencomputer dreht sich die Münze endlos auf dem Tisch,
Bild: Mak (Unsplash)
dabei sind immer beide Seiten präsent.“ Für Sundar Pichai, CEO von Alphabet und Google, arbeitet auch die Natur in vielerlei Hinsicht wie ein Quantencomputer. Nicht mit der binären Unterscheidung zwischen 0 und 1, sondern mit vielen Zwischenzuständen. „Quantum wird es uns erlauben, die Welt, die uns umgibt, tiefergehend zu verstehen und zu simulieren“, so Pichai. Das erlaubt uns, den technischen Fortschritt wieder mit der biologischen und sozialen Evolution zu versöhnen.
Zwei Psychologen der Yale-University haben 2018 eine Menge unterschiedlicher Eigenschaften untersucht, von Schnabelformen bei Tieren bis zur menschlichen Neigung, Risiken einzugehen. Dabei zeigte sich, dass alle diese Eigenschaften nicht in der binären Ausprägung normal oder unnormal vorkommen, sondern als mannigfaltige Variationen auf einem Kontinuum der Möglichkeiten. „Wir argumentieren, es gibt keine festgesetzte Normalität“, sagt Avram Holmes, leitender Forscher der Studie.9 „Es gibt auch kein universelles optimales Profil, wie ein Gehirn funktioniert.“
Ein Weg voraus: endlose Grautöne
Die Zukunft des Computers wird zur Metapher dafür, wie unsere Welt sich verändert und wir unser Denken verändern. Es gibt unzählbare Zwischenzustände, die sich überlagern und verschränken. Diese merkwürdige Zeit ließe sich nun also nutzen, um einen echten wirtschaftlichen und sozialen Wandel anzustoßen: Traditionelle Institutionen, Politik, Wirtschaftsordnung, auch die Medien, können lernen, mit den Grautönen der Gegenwart umzugehen. Wir brauchen mehr Zwischentöne und weniger Absolutismus in dem, was wir sagen und tun. Wir könnten die Völlerei überwinden und uns bewusst für gesunde Arbeitszeiten, nachhaltiges Reisen und achtsame soziale Interaktion entscheiden. Das könnte die dringend notwendige Neukalibrierung einer sozialen Marktwirtschaft sein, die ihren Namen endlich wieder verdient.
Aus ökonomischer Sicht müsste sich die neue Werteordnung an einer Experience Economy orientieren, die auf Qualität statt Quantität setzt. Nur wenn sich diese zurechtgerückte Prioritätensetzung auch im Markt spiegelt, wird sie mittelfristig zu Veränderungen führen. Unter den neuen Bedingungen müsste beispielsweise die Preisbildung aus Angebot und Nachfrage ziemlich anders aussehen.
Flüge und Reisen, auch nachhaltig erzeugte Lebensmittel würden dann sehr viel teurer werden.
Das wäre auch gut so, birgt aber ein Problem: Es trifft in seinen Auswirkungen nur die Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen, nicht aber die Wohlhabenden. Die bezahlen halt mehr für ihre Flüge um die Welt und merken es kaum. Wenn die neue Experience Economy aber ein inklusives Angebot an die ganze Gesellschaft sein soll, kann das nicht funktionieren.
Ein Teil der Verantwortung wird also auch im Zusammenspiel von Unternehmen und Politik liegen. Bis zur Finanzkrise 2008 und zum Teil weit darüber hinaus folgte der Tanz aus Regulierung und Selbstregulierung einem sehr einfachen Schrittmuster: so lange über die Probleme hinwegspringen, wie es irgend geht. Weiter managen, bis alles wieder an die Wand fährt, ohne die Ursachen wirklich anzugehen. Wenn nun riesige Bail-out-Programme aufgelegt werden, dann müssten alle diese Unterstützungsmaßnahmen mit Anforderungen an ein zeitgemäßes Geschäfts-, Umwelt- und Ressourcenmodell verbunden werden. Politik kann gestalten, wenn sie denn will.
Führung 2020 ff: Auge in Auge mit kolossalen Aufgaben
Zurück zum Rhinozeros: Die US-Autorin Michele Wucker beschreibt das Tier als Phänomen, das die Gefahren unserer Zeit verkörpert.10 Wer hinsieht, erkennt es. Dafür muss man den Blick schulen, aber auch die innere Bereitschaft, die
Bild: Scott Evans (Unsplash)
notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Um auf sie vorbereitet zu sein, bedarf es einiger Führungs- und Entscheidungskompetenzen, die in Krisenzeiten besonders wichtig werden: Gibt es jemanden, den man hinzuziehen kann, um vertrauensvoll miteinander zu reden und Entscheidungsszenarien durchzuspielen? Gibt es jemanden im eigenen Team, der einem sagt, was man selbst nicht hören möchte, aber unbedingt hören sollte? Und ist das Team, das in die Entscheidung einbezogen wird, divers genug, um die Entscheidungswege aus unterschiedlichen Richtungen zu denken und auf die Probe zu stellen?
Wer sich in einer Führungsposition diese Fragen mit Ja beantworten kann, ist gut vorbereitet, um dem grauen Rhinozeros ins Auge zu sehen. Wer noch immer glaubt, Führung äußere sich am eindrucksvollsten durch einsame despotische Entscheidungen in einem Festakt der eigenen Großartigkeit, wird das Horn des Tieres alsbald zwischen den eigenen Rippen zu spüren bekommen. Das Problem ist: Hat das Rhinozeros erst einmal Schwung genommen, fegt es nicht nur die blinde Führungskraft hinweg, sondern auch viele Menschen, die ihr anvertraut sind. So gehen Unternehmen unter oder ganze Wirtschaftszweige brechen ein, wie es in der Finanzkrise ab 2008 zu erleben war. Auch da war kein schwarzer Schwan im Spiel. Vielmehr dachten viele Beteiligte, sie könnten auf dem Rhinozeros mit vollen Taschen und in einem Vakuum der Verantwortungslosigkeit in die Abendsonne reiten. So entstehen aus Führungs- und Entscheidungskrisen systemische Risiken.
Auch diese Vertreter eines falschen Führungsverständnisses gilt es zu erkennen. In der Zoologie der menschlichen Ausflüchte sind sie der weiße Elefant. Ihn sehen alle, aber keiner traut sich so recht anzusprechen, dass er da ist. Ein Exemplar sitzt derzeit an der Spitze der Regierung der Vereinigten Staaten. Und wir beobachten täglich, was es bedeutet, wenn ein Entscheider nichts von anpassungsfähiger Führungskultur versteht oder von den Dingen, über die er zu entscheiden hat. Diese weißen Elefanten nähren sich nicht aus den Anfechtungen des nützlichen Widerspruchs, sondern beißen lieber die Hände ab, die sie wohlwollend füttern wollen. Wer widerspricht, wird entlassen. Der US-Wissenschaftler Larry Brilliant, einer der weltweit führenden Epidemiologen, der unter anderem geholfen hat, die Pocken auszurotten, beschreibt Trumps Gebaren in der Krise sehr direkt als „das unverantwortlichste Verhalten eines gewählten Präsidenten, das ich in meinem Leben je gesehen habe.“ 11
Wann immer es um die großen Krisen geht, die uns in der historischen und sozialen Revolution der Menschheitsgeschichte immer wieder befallen werden, brauchen wir Entscheider, die das Rhinozeros sehen können. Wir brauchen auch solche, die den weißen Elefanten nicht nur sehen, sondern sagen, dass er da ist. Dafür bedarf es der Empathie, eines klaren Blickes und der Fähigkeit zur Anpassung an neue Bedingungen. Auch für Führungspositionen gilt in Anlehnung an Charles Darwin: Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern eher diejenige, die am ehesten auf Veränderungen reagiert. Adaption wird zur Kernkompetenz der Zukunft.
Der Zeitpunkt für eine Neubesinnung ist gekommen: Wie kann uns eine Erfahrung des Mehr gelingen, die nicht allein auf Quantität setzt? Die aktuelle Krise könnte ein Katalysator sein, um den Geist und die Struktur der Gesellschaft von morgen zu verändern. Sie könnte dabei helfen, soziale Immunität zu entwickeln gegen das „immer mehr“, das uns niemals satt macht, sondern uns irgendwann auffressen wird. Sie könnte uns alle auch darin schulen, genauer hinzuschauen, wenn ein großes Tier sichtbar vor uns steht und uns in unserer ganzen Apathie zu überrennen droht.
Dr. Miriam Meckel ist Gründungsverlegerin von ada, einer Bildungsinitiative, die sich mit der Zukunft der Arbeit und dem sozio-technologischen Wandel befasst. Zuvor war sie Chefredakteurin und Herausgeberin der WirtschaftsWoche, Deutschlands führendem wöchentlichen Wirtschaftsmagazin. Seit 2005 ist sie Professorin für Unternehmenskommunikation an der Universität St. Gallen in der Schweiz.
Léa Steinacker ist Chief Strategy Officer und Mitglied des Gründungsteams von ada. Sie erwarb Hochschulabschlüsse in internationalen Beziehungen und öffentlicher Politik an der Princeton University und der Harvard Kennedy School of Government. Gegenwärtig ist sie Doktorandin an der Universität St. Gallen und erforscht die sozialen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz.
Literaturhinweise
1 Taleb, Nassim Nicholas (2007). The Black Swan. Random House.
2 Sequoia (2020). Coronavirus: The Black Swan of 2020. Medium.com.
3 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (2012). Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz. bbk.bund.de.
4 Gates, Bill (2015). The Next Outbreak? We’re Not Ready. TED.com.
5 Sanger, David E. et al. (2020). Before virus outbreak, a cascade of warnings went unheeded. New York Times.
6 Chotiner, Isaac (2020). How pandemics change history. NewYorker.com.
7 Our Daily Planet (2020). Interview of the Week: Juliette Kayyem on What To Expect Now With Coronavirus. OurDailyPlanet.com.
8 Arute, Frank et al. (2019). Quantum supremacy using a programmable super conducting processor. Nature 574, 505–510.
9 Holmes, Avram J. et al. (2018). The myth of optimality in clinical neuroscience. Trends in cognitive sciences 22.3: 241–257.
10 Wucker, Michele (2016). The gray rhino: How to recognize and act on the obvious dangers we ignore. Macmillan.
11 Levy, Stephen (2020). The doctor who helped defeat smallpox explains what’s coming. Wired.com.
Albert Wenger
DER GROSSE ÜBERGANG
Bilder: Joshua Brown und Youssef Naddam (Unsplash)
Das Jahr 2020 hat grundlegende Fragen dazu aufgedeckt, was nach Francis Fukuyama „Das Ende der Geschichte“ sein sollte. 1 Einige marktbasierte Volkswirtschaften mit demokratischen Regierungen waren schockierend unvorbereitet auf eine globale Pandemie und ihre Reaktionen haben das historisch hohe Maß an Wohlstands- und Einkommensungleichheit weiter verschärft. Unterdessen stellt die Klimakrise eine zunehmende Bedrohung für die Menschheit dar. Wie Mark Twain gesagt haben soll: „Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich oft.“ Wir könnten fragen, worauf sich die gegenwärtige Periode reimt und warum. In diesem Kapitel wird behauptet, dass wir uns in einem Übergang befinden, der so tiefgreifend ist wie der zwischen dem Agrarzeitalter und dem Industriezeitalter.
Wie hat sich dieser vorherige Übergang vollzogen? Jeder Aspekt der industriellen Revolution ist untersucht worden, aber die Einzelheiten der Geschichte sind weitgehend Ablenkungen. Sie sind wie das Rauschen des täglichen Nachrichtenzyklus, das das zugrunde liegende Signal verdunkelt. Das Ziel einer historischen Untersuchung sollte vielmehr darin bestehen, ein größeres Muster aufzudecken, das uns helfen kann, die Gegenwart zu verstehen.
Ein Ansatz zum Erkennen eines Musters besteht darin, eine Kraft zu bestimmen, die die Geschichte bewegt. Diese Idee ist von der klassischen Physik inspiriert. Wenn man die Kraft kennt, die auf ein Objekt wirkt, kann man auf der Grundlage seiner gegenwärtigen Position vorhersagen, wo es sich in Zukunft befinden wird. Diese inhärent deterministische Perspektive findet sich bei so unterschiedlichen Denkern wie Karl Marx und Kevin Kelly, wobei Ersterer sie auf die Wirtschaft und Letzterer sie auf die Technologie anwendet. 2, 3 Meine eigene Perspektive wird durch einen relativ neuen und etwas spekulativen wissenschaftlichen Ansatz namens Constructor Theory geprägt. 4, 5 Im Wesentlichen untersucht sie mögliche und unmögliche Transformationen, anstatt sich deterministischen Bewegungsgesetzen zu verschreiben.
Aus dieser Sicht verändert der technologische Fortschritt das, was möglich ist. Es kann keine Luftfahrtindustrie geben, bevor das Flugzeug erfunden ist, aber wenn es Flugzeuge gibt, kann es viele verschiedene Arten von Luftfahrtindustrien geben. Dasselbe Denken gilt für Gesellschaften als Ganzes – eine Reihe von neuen technologischen Fähigkeiten ermöglicht neue Lebensformen.
Frühere Übergänge
Dies ist am leichtesten im Hinblick auf den früheren Übergang vom Zeitalter der Jäger und Sammler zum Agrarzeitalter zu verstehen. Homo sapiens lebte vor rund 250.000 Jahren als Sammler. Seine Gesellschaften waren Nomaden, die in kleinen Stämmen mit minimaler Hierarchie lebten. Die Menschen waren promiskuitiv und folgten animistischen religiösen Überzeugungen, in denen Objekte und Tiere von Geistern bewohnt waren. Dies blieb weitgehend unverändert, bis vor etwa 10.000 Jahren eine Reihe von technologischen Innovationen stattfand, die das ermöglichte, was wir heute als Landwirtschaft betrachten. Dazu gehörten Pflügen und Säen, Bewässerung, Lagerung von Getreide und Nahrungsmitteln sowie die Domestizierung von Tieren – dies alles ermöglichte eine völlig neue Art von Gesellschaft. Eine Gruppe wurde nicht mehr durch die Nahrung eingeschränkt, die sie vorfand, sondern vielmehr dadurch, wie viel Ackerland sie kontrollierte. Und Nahrungsmittelüberschüsse machten es möglich, dass es Menschen gab, die überhaupt nicht in der Landwirtschaft arbeiteten, sondern Soldaten, Handwerker oder sogar Künstler waren.
Die Agrargesellschaften unterschieden sich radikal von den Gesellschaften der Jäger und Sammler, die ihnen vorausgegangen waren. Sie waren sesshaft statt nomadisch. Sie waren hierarchisch, tendierten eher zur Monogamie als zur Promiskuität und erfanden Institutionen wie die Ehe. Und sie entwickelten theistische Religionen mit klar definierten Gottheiten anstelle unbegrenzter Geister. Auf ihrer Suche nach Land haben die Agrargesellschaften in vielen Teilen der Welt die Gesellschaften der Jäger und Sammler ausgelöscht. Dennoch wäre es irreführend, zu behaupten, dass die Agrartechnologie die Struktur der Gesellschaften im Agrarzeitalter bestimmt hat. Innerhalb dieser groben Umrisse konnten sich die Agrargesellschaften dramatisch unterscheiden. Einige waren nach innen gerichtet, während andere aggressiv expansionistisch waren. Einige waren diktatorisch, während andere Elemente der Demokratie aufwiesen.





























