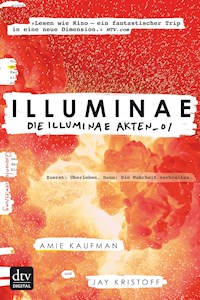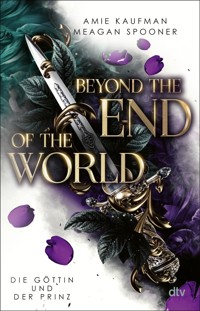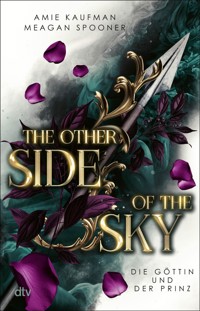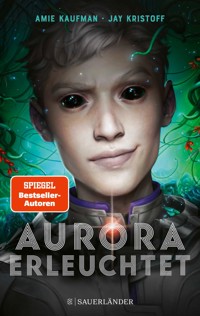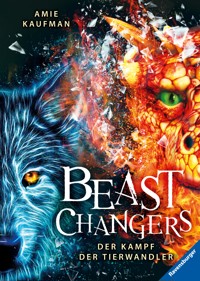14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Isles of the Gods
- Sprache: Deutsch
Magie, Romantik und schlummernde Götter treffen aufeinander in dieser fesselnden Fantasy-Dilogie auf hoher See – von der New York Times-Bestsellerautorin von »These Broken Stars«, den »Illumniae-Akten« und »Aurora« Selly ist nur ein Schiffsmädchen auf der Kleinen Lizabetta, aber sie träumt davon, eines Tages selbst Kapitänin zu sein. Da betritt ein Fremder das Schiff, und mitten in der Nacht setzen sie heimlich die Segel. Der Fremde ist Prinz Leander von Alinor, der mächtigste und leider auch der attraktivste Magier des Reiches. Ausgerechnet er soll die Götter besänftigen und einen drohenden Krieg verhindern? Ehe sie sich's versieht, wird Selly zur Anführerin einer lebensgefährlichen Mission, und notgedrungen kommen Leander und Selly sich näher ... »Verpasst dieses Buch nicht!« Alexandra Bracken, #1 NYT-Bestsellerautorin von »Lore« »Ich habe es verschlungen. Wann kommt der zweite Band?« Garth Nix, NYT-Bestsellerautor von »Sabriel« Band 1 von 2
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Amie Kaufman
The Isles of the Gods
Band 1
Biografie
Amie Kaufman wuchs in Australien und Irland auf und hatte als Kind das Glück, in der Nähe einer Bücherei zu wohnen. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Hund Jack in Melbourne und schreibt Science-Fiction- und Fantasy-Romane für Jugendliche. Sie liebt Schokolade und Schlafen, hat eine riesige Musiksammlung und einen ganzen Raum voller Bücher.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »The Isles of the Gods« bei Knopf Books for Young Readers, einem Imprint von Penguin Random House, New York
Copyright © 2023 by Amie Kaufman
Covergestaltung: Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden unter Verwendung der Originalillustration von Aykut Aydoğdu
Übernahme Originalcover. Anpassung des Schriftzugs durch Jeanette Wolfrum
Coverabbildung: Aykut Aydoğdu
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-0546-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Vor fünfhundertundeinem Jahr …
Fünfhundertundein Jahr später …
Teil Eins Glitzer und Dreck
Selly
Der Königliche HügelKirkpool, Alinor
Jude
Das Wirtshaus Zum schönen JackHafenstadt Naranda, Mellacea
Selly
Die LizabettaKirkpool, Alinor
Laskia
Der letzte SchliffHafenstadt Naranda, Mellacea
Jude
Die MietskasernenHafenstadt Naranda, Mellacea
Selly
Die LizabettaDas Halbmond-Meer
Keegan
Die LizabettaDas Halbmond-Meer
Leander
Die LizabettaDas Halbmond-Meer
Selly
Die LizabettaDas Halbmond-Meer
Laskia
Die Faust des MaceanDas Halbmond-Meer
Keegan
Die LizabettaDas Halbmond-Meer
Selly
Die LizabettaDas Halbmond-Meer
Teil Zwei Die Stadt der Erfinder
Keegan
Die Kleine LizabettaDas Halbmond-Meer
Leander
Die Kleine LizabettaDas Halbmond-Meer
Jude
Die Faust des MaceanDas Halbmond-Meer
Selly
Die Kleine LizabettaDas Halbmond-Meer
Laskia
Der letzte SchliffHafenstadt Naranda, Mellacea
Leander
Die HafenanlageHafenstadt Naranda, Mellacea
Selly
Der MarktplatzHafenstadt Naranda, Mellacea
Leander
RubinrotHafenstadt Naranda, Mellacea
Selly
RubinrotHafenstadt Naranda, Mellacea
Jude
Wirtshaus Zum schönen JackHafenstadt Naranda, Mellacea
Keegan
Das SalzhausHafenstadt Naranda, Mellacea
Selly
Das DiplomatenviertelHafenstadt Naranda, Mellacea
Leander
Das SalzhausHafenstadt Naranda, Mellacea
Laskia
Skyline DinerHafenstadt Naranda, Mellacea
Keegan
Das SalzhausHafenstadt Naranda, Mellacea
Leander
Das SalzhausHafenstadt Naranda, Mellacea
Selly
Das SalzhausHafenstadt Naranda, Mellacea
Leander
Das HafenviertelHafenstadt Naranda, Mellacea
Teil Drei Ein Schiff am Horizont
Jude
Die MietskasernenHafenstadt Naranda, Mellacea
Selly
Das HafenviertelHafenstadt Naranda, Mellacea
Keegan
Hafenstädtchen Cathar, Mellacea
Laskia
Die schwarze SeepockeHafenstädtchen Cathar, Mellacea
Selly
Die EmmaDas Halbmond-Meer
Jude
Die SeejungfrauDas Halbmond-Meer
Selly
Die EmmaDas Halbmond-Meer
Teil Vier Die Inseln der Götter
Leander
Die Insel der BarricaDie Inseln der Götter
Selly
Der Tempel der BarricaDie Inseln der Götter
Laskia
Der Tempel der BarricaDie Inseln der Götter
Keegan
Die Stillen WasserDie Inseln der Götter
Leander
Die Insel der MuttergöttinDie Inseln der Götter
Jude
Die Insel der MuttergöttinDie Inseln der Götter
Selly
Der Tempel der MuttergöttinDie Inseln der Götter
Laskia
Der Tempel der MuttergöttinDie Inseln der Götter
Selly
Der Tempel der MuttergöttinDie Inseln der Götter
Jude
Der Tempel der MuttergöttinDie Inseln der Götter
Selly
Die EmmaKirkpool, Alinor
Laskia
Die SeejungfrauDas Halbmond-Meer
Danksagung
Für Eliza, Ellie, Kate, Lili, Liz, Nicole, Pete und Skye
Vor fünfhundertundeinem Jahr …
»Es ist ja nicht so, als hätte ich gedacht, ich werde ewig leben. Ich habe nur nicht erwartet, auf diese Art und Weise zu erfahren, wann ich sterben werde.«
»Zur siebten Hölle, Anselm«, murmelt Galen, bricht ein Stück von dem Schiffszwieback ab, den die Seefahrer uns mitgegeben haben, und zerbröselt es dann zwischen seinen Fingern. Wir sehen zu, wie die Krümel auf dem moosbedeckten Boden zu unseren Füßen landen.
An einem so heiligen Ort wie diesem mit etwas so Profanem wie Essen beschäftigt zu sein, mutet seltsam an. Andererseits haben wir womöglich das Anrecht erworben, zu tun, was immer wir wollen.
Zusammen sitzen wir vor dem Tempel, den schwarzen, abgewetzten Stein im Rücken. Die Lichtung liegt mitten im Dschungel, der dicht und üppig und genauso leuchtend grün ist wie die magischen Male, die sich meine Arme hochschlängeln. Hier ist es viel wärmer und schwüler als auf den weiten Fluren zu Hause.
Unten in der Bucht liegt unser Schiff vor Anker und mein bester Freund hat zusammen mit mir den Gipfel der Insel erklommen.
Ich wollte sehen, wo es morgen geschieht.
Barrica ist auch mitgekommen, obwohl sie nicht gesagt hat, warum. Unsere Göttin steht auf der anderen Seite der Lichtung und blickt auf das funkelnde blaue Meer hinab. Sie ist einen ganzen Kopf größer als ich, und ich bin der größte Mann, den ich kenne. Für die Gottheiten gelten andere Maßstäbe. Sie sind größer als wir, von unendlicher Schönheit, auf eine Weise, die man erst begreifen kann, wenn sie direkt vor einem stehen.
Früher fiel es mir schwer, mich in Barricas Gegenwart zu konzentrieren, ihre Anwesenheit hat meine Gedanken verwirrt, doch im Laufe des Krieges habe ich mich an ihre Gesellschaft gewöhnt.
Wie eine Statue steht sie da, wunderschön trotz ihrer Traurigkeit. Ich weiß, dass sie sich von ganzem Herzen wünscht, sie müsste mir das nicht zumuten. Und dennoch sind wir hier. Es gibt keinen anderen Weg. Nicht nach dem, was mit Valus geschehen ist. Und in Vostain.
Dann blicke ich meinen Freund an. Früher, vor all dem, war sein Priestergewand schlicht, in Alinorisch Blau. Doch irgendwann im Laufe des Krieges hat unser Klerus angefangen, sich ähnlich zu kleiden wie die Soldaten, um unserer Kriegsgöttin zu huldigen.
Seine Uniform steht am Hals offen, wie üblich ist die Jacke nicht ganz zugeknöpft. Seine Kleidung war immer unordentlich, schon als wir noch Kinder waren, und das hat sich nicht verändert.
Er ist mir so vertraut. Seine Gegenwart so ein Trost.
Wie sind diese zwei kleinen Jungen, die wir einmal waren, überhaupt herangewachsen, um sich in so einer Situation wiederzufinden?
»Ich habe Angst, Galen«, sage ich leise.
»Ich weiß, mein König.« Er atmet langsam aus. »Ich auch.«
Eine Weile lang sind wir beide still, die Sonne versinkt immer tiefer hinter dem Gewirr aus grünen Blättern. Wir haben keine Laterne mitgenommen – bald werden wir mit dem Abstieg beginnen müssen.
Ich bin derjenige, der schließlich unser Schweigen bricht. »Als wir noch jung waren und die Priester uns von den Helden von einst erzählt haben, kamen die mir immer so erhaben vor. Keiner von ihnen war ängstlich oder wütend oder unsicher.«
»Sie waren auch nicht so schmutzig«, sagt Galen nachdenklich und blickt an sich runter. »Und haben bestimmt besser gerochen.«
Ich schnaube. »Ich habe mich immer gefragt, was sie denken. Jetzt wissen wir es wohl. Wenn du diese Geschichte erzählst, dann mach aus mir einen echten Menschen, ja?«
»Versprochen.«
Es ist seltsam, sich eine Zukunft vorzustellen, in der ich nicht vorkomme. Es ist schon seltsam, sich den morgigen Abend vorzustellen, ohne mich. Meine Schwester wird eine gute Königin abgeben. Das hätte ich zu gern miterlebt. Doch mir wird so viel fehlen.
Bald, eines Tages, werden die Köche in Kirkpool wieder meine Lieblingstarte backen, einen ganzen Schwung davon, prallvoll mit Beeren, die einem die Finger rosa färben. Alle werden sie genießen und ich … ich werde nicht da sein.
Werden sie an mich denken?
»Ach, und noch etwas«, sage ich und greife unser Gespräch der vergangenen Tage wieder auf. »Ein Amselpaar baut jedes Jahr vor meinem Schlafzimmerfenster sein Nest. Ich will ihnen ja nicht zu nahetreten, aber ehrlich gesagt sind sie nicht besonders gescheit. Ich lege ihnen meistens irgendetwas Flauschiges auf die Fensterbank, damit sie ihr Nest auspolstern können.«
»Ich werde mich darum kümmern«, sagt Galen leise und schließt die Augen. Seit wir an Bord des Schiffs gegangen sind, fallen mir immer wieder kleine Aufgaben ein, die jemand übernehmen muss, wenn ich nicht mehr da bin.
Nie bringt er mich zum Schweigen, nie sagt er mir, dass sich alles schon ordnen wird. Er nimmt es einfach zur Kenntnis und verspricht mir, sich darum zu kümmern.
»Galen, wie konnte es so weit kommen?«, flüstere ich, spreche die Frage aus, die ich mir selbst wieder und wieder stelle.
Während er über seine Antwort nachdenkt, bietet er mir schweigend ein Stück von seinem Zwieback an. Es ist nichts als Mehl und Wasser und ein wenig Salz, das so lange gebacken wird, bis es dermaßen hart ist, dass man sich daran die Zähne ausbeißt. Es ist die Nahrung der Seefahrer, der Soldaten, und wir sind inzwischen beides. Doch Essen interessiert mich kaum noch, als wüsste mein Körper bereits, dass er es nicht mehr brauchen wird.
»Nun, am Anfang war die Muttergöttin«, antwortet er mit eintöniger Stimme, als wolle er damit androhen, die ganze Geschichte zu erzählen. Er versucht so, die Stimmung zu heben.
Als er innehält, ziehe ich die Knie an und lasse mein Kinn darauf ruhen. »Erzähl weiter.«
Er blinzelt, wirft mir einen Blick zu und hebt dabei die Augenbrauen.
»Ich glaube, ich möchte hören, wie du die Geschichte von einst noch einmal erzählst«, sage ich leise und schließe die Augen, um mich auf seine Stimme zu konzentrieren.
Er lässt sich erweichen, die Worte fließen ihm leicht von den Lippen. »Am Anfang schuf die Muttergöttin die Welt und sah, wie sie gedieh. Die leidigsten – aber zu unserem Glück auch die unterhaltsamsten – ihrer Geschöpfe forderten mehr und mehr ihre Aufmerksamkeit. Also tat sie das, was alle guten Anführer tun.«
»Sie gab die Verantwortung weiter.«
»Das tat sie. Sie brachte sieben Kinder hervor: Barrica und Macean, die zwei Ältesten, zur gleichen Zeit geboren, rangelten immer um die Oberhand. Dann kamen Dylo, Kyion, Sutista, Oldite und schließlich …« Seine Stimme stockt und dann zwingt er sich weiterzusprechen. »… Valus, der Jüngste, der Lachende.«
In manchen Nächten kann ich ihn immer noch schreien hören.
»Erzähl weiter«, sage ich leise.
»Sie nahmen sich der Völkerschaften an, aus denen einmal Länder hervorgehen würden, erhörten Gebete, segneten die Ernte, heilten Krankheiten. Das übliche göttliche Geschäft. So konnten sie keinen Unfug anstellen – für eine Weile, jedenfalls.«
»Doch die Götter verbrachten viel zu viel Zeit in unserer Gegenwart und nahmen unsere üblen Angewohnheiten an«, stimme ich mit ein; die Stelle, an der die Kinder, die sich sonst immer um meinen Freund scharen, üblicherweise das Wort ergreifen, um damit anzugeben, wie gut sie die Geschichte kennen. Da huscht ein Lächeln über sein Gesicht.
»Auf die eine oder andere Art fing der Neid an, an ihnen zu nagen«, stimmt er mir bei und seine Stimme verklingt. Nun, da er bei dem Teil der Geschichte angekommen ist, die unser eigenes Leben betrifft, gibt es keine vertrauten Worte mehr, die er aufsagen, keine ausgetretenen Pfade, die er beschreiten kann, um zum Ende der Geschichte zu kommen.
Macean hat es nicht genügt, dass sein Volk von den Bergen hinabgestiegen ist und ihm ein neues Land am Meer erschlossen hat. Barrica war der grünen Hügel ihres Landes müde; Oldite von ihrem tiefen, dunklen Wald gelangweilt, Kyion von der Steilküste und fruchtbaren Erde sieses Königreichs, Dylo von ihrer azurblauen See. Jeder von ihnen hatte seine eigene Klage.
Was als Gerangel begann, endete im Krieg.
Während Valus, der Gott der Heiterkeit, der Kunststücke ist, ist Macean ein Spieler, der Gott des Risikos – und er ging in der Tat ein Risiko ein, als seine Armeen die Ländereien seiner Geschwister für sich in Anspruch nahmen. Unsere Göttin, Barrica, ist die Kriegerin, und wir wurden ihre Soldaten.
Doch so sehr wir auch selbst zu kämpfen vermögen, zu bluten und zu sterben, war das doch nichts im Vergleich zu der Verheerung, die die Götter auf dem Schlachtfeld anrichten konnten.
Ich bin König und Magier – ich gebiete nicht nur über ein, sondern über alle vier Elemente. Doch an der Seite meiner Göttin und ihrer Geschwister war ich wie ein Kind mit seinem Spielzeug.
Kriegsflotten wurden vernichtet, Schiffe sprangen über das Meer wie Steine über einen Teich.
Armeen vergingen im Feuer.
Und Maceans Streitkräfte drohten Vostain einzunehmen, die Ländereien seines lachenden jüngeren Bruders Valus. Um Vostain zu verteidigen, trat seine Schwester Barrica ihm entschieden entgegen und …
Ich werde diesen Tag niemals vergessen.
Die Schlacht, die daraufhin entbrannte, verwüstete ganz Vostain und wir alle hörten Valus schreien, als seine Ländereien in Schutt und Asche gelegt wurden; das Öde Land wie wir es inzwischen nennen.
Es fühlt sich an, als wäre das vor einer Ewigkeit geschehen.
Dabei ist es erst einen Monat her.
Barrica hielt Valus in ihren Armen und rief mich zu sich, den Herrscher ihres Volkes. Und wir sprachen miteinander. Und allmählich wurde mir bewusst, was ich tun musste.
»Schade, dass du nicht dabei warst, als wir Vostain vor ein paar Jahren besucht haben«, sage ich und schrecke Galen aus seinen Gedanken auf. »Schade, dass du nicht die Möglichkeit hattest, es zu sehen. Ich kann nicht aufhören an die Menschen dort zu denken.«
»Wer ist dir denn im Gedächtnis geblieben?«, fragt er. Er lacht so gerne, Galen – was für einen wunderbaren Priester hätte er für Valus abgegeben, wäre er woanders, wann anders geboren worden –, dennoch, er ist niemand, der dem Schmerz ausweicht. Deswegen ist er jetzt hier, an meiner Seite, nun, da ich ihn am meisten brauche.
»Die Köchin der Königin hat ein Früchtebrot gemacht, und da war etwas drin – ich bin nie darauf gekommen, was, und ich habe ein halbes Dutzend Diener losgeschickt, um sie zu bestechen. Ich bin sogar selbst runter in die Küchenräume gegangen, aber auch ich konnte es ihr nicht entlocken.«
»Das kann nicht dein Ernst sein«, kichert er. »Wer hat dir denn je etwas abgeschlagen?«
»Nun, gerade am heutigen Tag will ich nicht verhehlen, dass das einmal vorgekommen ist. Zweimal, wenn ich Lady Kerlion miteinbeziehe, als wir beide vierzehn waren.«
»Wen hast du noch kennengelernt?«
»Vor meinem Quartier gab es einen Wachmann«, murmele ich. »Er hat mir seinen Umhang geliehen, damit ich mich unerkannt in die Stadt davonstehlen konnte, und ich habe ihm weise Ratschläge erteilt, wie er seiner Liebsten am besten den Hof macht. Hoffentlich hat er sie beherzigt.«
»Hoffentlich.«
»Ich mochte Königin Mirisal«, sage ich leise und werfe Barrica einen Blick zu, die immer noch regungslos dasteht. »Valus und sie haben so viel miteinander gelacht – sie haben sich unaufhörlich gegenseitig geneckt. Damals habe ich mich gefragt, ob ihr Gott dafür gesorgt hat, dass die Königin so unbeschwert ist, ob Barrica aus mir einen Soldaten gemacht hat oder ob das einfach die Rollen waren, die uns zugedacht waren.«
»Ich habe aus dir nie einen Krieger gemacht, Anselm.«
Wenn ich nicht in ihrer Gegenwart bin, gelingt es mir nie, Barricas Stimme zu beschreiben. Manchmal klingt sie wie eine einfache Melodie, manchmal wie ein feierlicher Choral. Doch weder Galen noch ich sind sonderlich überrascht, als sie die Lichtung überquert und auf uns zukommt. Sie kann uns immer und überall hören. Sie sieht nur – irgendwie – aus wie wir. Das bedeutete nicht, dass wir uns gleichen.
Galen hat sich nie so wirklich daran gewöhnt, in ihrer Gegenwart zu sein, und jetzt schlägt er die Augen nieder, während ich in das Antlitz der Göttin blicke, der wir beide dienen.
»Nein?«
»Ich bin das Spalier, an der die Rebe sich emporwinden kann.«
»Du gibst also nur eine Richtung vor?«
»Ja. Doch es gibt viele Wege, die du hättest gehen können.«
Sie lässt sich im Schneidersitz vor uns nieder. Ihre unfassliche Anmut erinnert an ein Raubtier, aber ich habe mich in ihrer Gegenwart immer sicher gefühlt. Mein Glaube – der Glaube ihres gesamten Volkes – ist das, was ihr Kraft gibt.
Das ist es, worum es morgen geht.
Ich werde mich opfern, und das wird meiner Göttin Kraft und Stärke schenken, und so wird sie ihren Bruder Macean in den Schlaf versetzen, damit er nie wieder einen Krieg führen kann. Und dann werden sie und ihre Geschwister sich aus unserer Welt zurückziehen und nicht mehr unter uns wandeln.
Aus Barrica, der Kriegerin, wird Barrica, die Wächterin werden. Sie wird die Tür einen Spaltbreit offen stehen lassen, über ihren Bruder wachen, während er schläft, dafür sorgen, dass er bleibt, wo er ist. Dafür sorgen, dass der Gott des Risikos seinen letzten Trumpf nicht ausspielen kann. Vielleicht erhört sie ab und zu ein Gebet oder segnet ihr Volk, aber die Zeiten des unbefangenen Gesprächs werden für immer vorbei sein.
»Für immer ist eine lange Zeit«
sagt Barrica und unterbricht meine Gedanken. Sie konnte sie immer schon lesen, doch das hat mich nie gestört. Ich schenke ihr meinen Glauben, und sie gibt mir einen festen Platz im Leben.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie es für alle sein wird, wenn sie nicht mehr da ist, aber nur wenige kennen sie wie ich. Sie wird ihnen nicht fehlen, wie sie mir fehlen wird.
»Wohl wahr, Göttin.«
»Und der morgige Tag wird vielleicht gar nicht so, wie du ihn dir vorstellst.«
Ich werfe ihr einen flehenden Blick zu, und sie lässt das Thema fallen, neigt den Kopf, während sie sich erhebt. Sie steht vor mir, so schön wie eh und je. Ich kann mir nie merken, welche Farbe ihre Augen haben, aber nun kann ich sehen, dass sie so blau sind wie das Meer um uns herum.
Sie hält mir ihre Hand hin, und Kraft flutet durch mich hindurch, als sie mir auf die Füße hilft.
Langsam beginnen wir drei den Abstieg durch den Dschungel und machen uns auf den Weg dorthin, wo unser Schiff vor Anker liegt, zu unserem letzten Mahl.
Heute Nacht werde ich wohl nicht schlafen, aber es wird guttun, die Gestirne zu beobachten. Hier auf den Inseln ist der Himmel sternenklar.
Ich hoffe wirklich, dass Galen die Amseln nicht vergisst. Sie brauchen jemanden, der sie im Auge behält.
Fünfhundertundein Jahr später …
Teil EinsGlitzer und Dreck
Selly
Der Königliche HügelKirkpool, Alinor
Die Frau, die magisches Zubehör verkauft, irrt in ihrem kleinen Marktstand umher, als hätte sie ihre Landkarte verlegt. Als wäre jeder Gegenstand, auf den sie trifft, von den aufgeschichteten dicken grünen Kerzen bis hin zu den Gefäßen voller leuchtender Glasperlen und Kieselsteinen, eine überraschende Entdeckung.
»Ein halbes Dutzend Kerzen, sagtest du?«
Sie hält inne, um über die Schulter zu gucken, strafft den Knoten ihrer Schürze, was völlig unnötig ist. In der Hoffnung, dass mir noch etwas anderes ins Auge fallen könnte, zieht sie alles unnötig in die Länge. Doch obwohl das unruhige, angespannte Stimmengewirr der Stadt mir durch und durch geht, werde ich nicht die Beherrschung verlieren. Dafür habe ich keine Zeit.
»Ja, bitte.«
Ich versuche meine zusammengebissenen Zähne in ein Lächeln zu verwandeln, aber an dem Gesichtsausdruck der Frau kann ich erkennen, dass das wohl nicht funktioniert. Aber mal ehrlich, wenn das so weitergeht, kann ich sie auch gleich fragen, wie sie heißt und wie sie am liebsten ihren Tee zu sich nimmt, denn wir beide werden zusammen alt werden.
Wenn überhaupt, scheint sie noch langsamer zu werden, hebt eine Zeitung hoch und betrachtet die Kiste darunter.
»Die hier sind die besten in der ganzen Stadt. Die werden in der Tempelanlage gegossen, weißt du? Sind die für dich, junge Dame?«
In meinen fingerlosen Lederhandschuhen balle ich die Hände zu Fäusten und werfe unwillkürlich einen Blick darauf, um zu überprüfen, ob sie die magischen Male auf meinen Handrücken verbergen.
»Für unsere erste Offizierin. Unsere Magierin an Bord.«
Heute wecken diese Worte kaum den alten vertrauten Schmerz in mir. Heute habe ich zu viele andere Dinge im Kopf.
»Ach, wirklich?«
Das erregt die Aufmerksamkeit der Marketenderin, und mögen die Geister mir beistehen, denn jetzt hält sie inne, um mich interessiert zu mustern.
»Ich hätte gleich sehen sollen, dass du salzblütig bist – sieh dir diese Kleidung an. Wo kommst du her?«
Ihr Blick flackert zurück zu der Zeitung und plötzlich wird mir klar: Sie ist gar nicht zerstreut. Sie ist besorgt.
An jedem Markstand waren es heute die gleichen Fragen. Es gibt seltsame Engpässe, die Preise schwanken, und Gerüchte über neue Steuern und Beschlagnahmungen machen auf dem Marktplatz die Runde. Und über einen Krieg.
Sobald sie meine Kluft sehen – das Hemd, die Hosen und die Stiefel einer Seefahrerin, die mich von den Stadtmädchen in ihren maßgeschneiderten Kleidern abheben –, fragen mich alle, wo ich herkomme und wie es dort war.
»Wir haben gerade einen kurzen Abstecher nach Trallia gemacht«, erzähle ich der Frau und wühle in meiner Tasche nach ein paar Kronen. »Ich bin ehrlich gesagt etwas in Eile. Ich muss noch zur Hafenmeisterei, bevor die schließt, sonst wird meine Kapitänin gar nicht glücklich sein.«
Irgendwo da draußen hebt Kapitänin Rensa bestimmt gerade den Kopf und hält die Nase in den Wind, um meine Lüge zu erschnüffeln, aber die Marketenderin schüttelt sich, als würde sie gerade aufwachen.
»Und hier quassle ich und quassle ich. Dann sollten wir wohl mal – wie sagt ihr jungen Leute immer? Irgendwas mit Automobilen?«
Als es ihr einfällt, leuchtet ein Lächeln auf ihrem Gesicht auf, aber dennoch kann ich sehen, wie angespannt sie ist.
»Dann sollten wir mal Gas geben.«
Eine Minute später sind meine Kerzen verpackt, und ich bin auf dem Weg. Ich lasse das laute Flattern der Geisterflaggen und den überfüllten Marktplatz oben auf dem Königlichen Hügel hinter mir, lasse mich vom Schwung vorantreiben, während ich an der prächtigen Fassade des Tempels der Barrica vorbeilaufe, und meine Stimmung steigt mit zunehmender Geschwindigkeit.
Die Priesterinnen und Priester stehen in ihren Soldatenuniformen davor, ihre Abzeichen glänzen, während sie die Gläubigen zur Nachmittagsandacht rufen, um für den Frieden zu beten. Voller Besucher sind die steinernen Stufen des Tempels allerdings nicht gerade, und ein Schild neben dem Eingang verkündet, dass im Versammlungsraum nebenan heute Abend eine Tanzveranstaltung stattfindet, mit einer Liveband. Mir war nicht bewusst, wie stark die Besucherzahlen zurückgegangen sind.
Ich lasse eine Kupfermünze für die Göttin in den Opferstock fallen, als ich vorbeieile – wir Seeleute wissen, was sich gehört –, und laufe weiter, ohne dem Blick des Priesters zu begegnen, der danebensteht. Ich habe heute keine Zeit, mein Freund.
Meine Kapitänin hat mir eine lange Liste von Besorgungen mitgegeben und kaum genug Zeit, um alles zu erledigen – ihre Art mich von der Hafenmeisterei fernzuhalten.
»Seit dem Tag, an dem wir vor Anker gegangen sind, lungerst du da herum«, hat sie heute Morgen geschnauzt. »Heute kannst du zur Abwechslung mal ein bisschen arbeiten.«
Zur Abwechslung, Rensa? Im Ernst?
Bei meiner Göttin, seit einem Jahr erledige ich jede Aufgabe, die meiner Kapitänin in den Sinn kommt, habe mich durch jeden Zentimeter meines eigenen Schiffs gearbeitet, vom Kielraum bis zum Bugspriet. Und jetzt ist endlich Schluss damit. Muss Schluss sein – die Geister mögen mir beistehen, wenn ich noch einen weiteren Augenblick unter der Tyrannei dieser Kapitänin verbringen muss. Das muss heute der letzte Tag sein.
Heute werde ich in der Hafenmeisterei die Nachricht an der Tafel vorfinden, auf die ich warte. Alles andere wäre unerträglich.
Ich überquere eine schmale Gasse, wo die Gebäude enger zusammenstehen, die oberen Stockwerke sich über die Straße beugen, die Fensterkästen voller Blumen. Irgendwo im zweiten Stock tönt ein Radio, ich kann die strenge Stimme einer Nachrichtensprecherin hören, aber ihre Worte kann ich nicht verstehen.
Ich biege in die Allee der Königin ein, bleibe stehen, als eine Bierkutsche an mir vorbei bergab rumpelt, und lehne mich dann nach vorne, um den nicht abreißenden Verkehr in Augenschein zu nehmen. Die Hafenstadt Kirkpool umspielt eine Reihe von Hügeln am Meer, goldene Sandsteingebäude versammeln sich in den Tälern dazwischen. Vom Wasser aus kann man sehen, wie die Allee der Königin vom Hafen am Fuß des Königlichen Hügels den ganzen Weg bis zum Palast auf dem Gipfel führt, der wie ein Großmast in den Himmel ragt.
Straßen führen wie Spiere davon ab, jede davon ein Hort für eine Ansammlung von kleinen Läden und Ständen – Schneider, Bäcker, Händler, die Gewürze aus aller Welt verhökern. Menschen von überall her leben und handeln in Kirkpool, und die zwanglose Mischung aus so vielen verschiedenen Kulturen fühlt sich heimischer an als jeder andere Hafen.
Eine Frachtkutsche rollt an mir vorbei, und ohne zu zögern, greife ich nach dem hinteren Geländer und schwinge mich wie ein Lakai für die holprige Fahrt hinauf. Ich erhasche einen Blick auf die Augen der Fahrerin im Rückspiegel, als ihr auffällt, wie sich das Gewicht verändert, und sie versucht mich abzuschütteln, während wir über die Pflastersteine klappern – aber ich bin es gewohnt, auf einem schwankenden Deck zu stehen, also gehe ich in die Knie und bleibe, wo ich bin.
Als wir an der Straße der Bäcker vorbeirollen, werde ich von einer heißen Böe erfasst und auch von einer Erinnerung. Als ich klein war, bin ich hier immer mit meinem Da hingegangen, jedes Mal, wenn wir in Kirkpool vor Anker lagen. Oben von seinen Schultern aus, nahm ich die Menschenmengen in Augenschein und tat so, als würde ich im Krähennest sitzen, und dann kaufte er mir eine Zuckerschnecke.
Sie rollen den Teig zu einer Spirale zusammen, bepinseln ihn mit Zuckerguss, voller Gewürze, die immer verschwommene Erinnerungen an eine Reise in den Süden in mir wecken, als ich noch viel kleiner war – so winzig, dass meine wackligen Schritte sich dem Seegang Lizabetta vollkommen anglichen. Lange bevor ich an Land richtig laufen konnte, hatte ich schon meine Seebeine gefunden.
Wir biegen um die nächste Ecke, und ich erhasche einen kurzen Blick auf das Meer am Fuße des Königlichen Hügels. Meine Gedanken springen wieder zur Hafenmeisterei und zu der Nachricht, die dort auf mich warten muss. Und dann gleitet mein Blick auf meine Hände, meine Handschuhe, die sich an der Kutsche festhalten. Ich kann nicht anders, als mir vorzustellen, das Leder wäre verschwunden, und die formlosen grünen Male auf meiner Haut lägen entblößt. Ich beiße die Zähne zusammen und schiebe den Gedanken beiseite.
Das spielt keine Rolle. Er ist auf dem Weg. Doch früher war es einfacher zwischen uns, zwischen meinem Da und mir.
Ich gehe in die Knie und stütze mich ab, als wir ausscheren, um einen langsamen Karren zu überholen, aber vorne mucken die Pferde auf und wiehern, und ich bin zwar gewarnt, als die Kutsche plötzlich schleudernd zum Stehen kommt. Mein Griff lockert sich, und ich spüre, wie ich anfange zu kippen – eine schreckliche Sekunde lang schwebe ich in der Luft, mit rudernden Armen, lande auf dem Boden, und Schmerz durchzuckt mich. Schnell komme ich auf alle viere und krabble in die Gosse, bevor mich die nächste vorbeifahrende Kutsche plattmacht.
»Ich wusste gar nicht, dass ihr Seeleute fliegen könnt«, ruft eine Frau, die sich über mir aus dem Fenster lehnt, und um uns herum ist Gelächter zu hören. Mit meiner hellen Haut wird die Röte, die mir ins Gesicht schießt, nicht zu übersehen sein, und ich ziehe ein böses Gesicht, während ich mir den Dreck von den Kleidern klopfe.
Jetzt kann ich selbst sehen, warum es hier nicht weitergeht. Eine lange Schlange aus schnittigen schwarzen Automobilen schlängelt sich den Hügel zum Hafen runter, treibt wie eine Flotte in der Flaute aufs Wasser zu – bewegt sich also geradezu gar nicht –, weil ein Pferdefuhrwerk vor ihnen her stapft und alles aufhält.
»Wer zur siebten Hölle ist das?«, rufe ich der Frau im Fenster zu, und bin mir schon halbwegs sicher, was ich gleich hören werde.
»Prinz Leander.« Sie stützt das Kinn auf die Hand und beobachtet mit verträumtem Blick die Automobile, als könnte sie durch die getönten Scheiben gucken und den Prinz selbst bewundern. »Man würde ja meinen, dass jemand mal diesen Gaul aus dem Weg schafft.«
»Diesen Gaul?« Ich blicke nach oben und hebe eine Augenbraue. »Soweit ich das sehe, ist dieses Pferd das einzige, das hier anständig Arbeit leistet. Was genau trägt denn Seine Königliche Hoheit zu unserer Gesellschaft bei?«
Da beachtet sie mich nicht mehr.
Man sagt, dass der Prinz die Nächte durchfeiert und bis mittags schläft. Dass allein seine Garderobe ein eigenes Appartement braucht. Dass sein Privatsekretär Nachrichten verschickt, die auf einer vergoldeten Schreibmaschine geschrieben werden, um die vielen Heiratsanträge abzulehnen, die täglich eintreffen.
Wenn alle anderen diese Geschichten hören, sagen sie: So ein Leben will ich auch haben. Alles, was ich denken kann, ist: Was soll das Ganze?
Ich gehe durch eine Seitenstraße vorbei an einer Schneiderwerkstatt nach der nächsten und ihren Tuchballen aus fernen Häfen, bis ich einen anderen Weg gefunden habe, der vom Königlichen Hügel runter zum Hafen führt. Rensa wird mich inzwischen zurückerwarten und sie wird mich zur siebten Hölle schicken, wenn sie herausbekommt, dass ich mich nicht an ihre Anweisungen gehalten habe.
Die Hafenmeisterei ist ein hohes, breites Gebäude inmitten der Hafenanlage. Im oberen Stockwerk ist das Büro des Hafenmeisters selbst mit Fernrohren an verschiedenen Ausguckposten, die alle auf die Hafeneinfahrt gerichtet sind. Wenn sie ein einlaufendes Schiff sichten, dann rennen sie nach unten zu den riesigen Kreidetafeln und vermerken ihre Ankunft. Doch heute interessiert mich nur das untere Geschoss.
Hier riecht es nach Seefahrern – nach Kattun und Segeltuch mit einem Hauch von muffigem Moder –, und normalerweise würde ich mich nun entspannen, jetzt, wo ich die Stadt hinter mir gelassen habe und in meiner eigenen Welt angekommen bin. Aber ich bin in den letzten drei Tagen immer wieder hierhergekommen, seit wir vor Anker gegangen sind, und jedes Mal werde ich noch angespannter.
»Suchst du die Fortüne, Selly?« Es ist Tarrant von der Gebenedeiten, ein weiteres Schiff meines Vaters. Ein Lächeln blitzt in seinem dunkelbraunen Gesicht auf, während er einen Finger hochhält. »Nein, warte! Du bist auf der Suche nach deiner Fortüne! Wusste ich doch, dass da irgendwo eine Pointe zu finden ist. Ganz schön kurz vor knapp, meinst du nicht auch?«
»Sie wird hier sein«, sage ich und klopfe ihm auf die Schulter, während ich mich vorbeidränge, um näher an die Tafeln zu kommen. Dann fällt mir etwas ein und ich drehe mich noch mal um. »Tarrant!«
Er wirft einen Blick auf mich zurück, ist schon auf dem Weg zur Tür.
»Du hast mich heute hier nicht gesehen.« Ich versuche, es nicht wie eine Bitte klingen zu lassen.
Er zuckt zusammen. »Sitzt dir die Kapitänin wieder im Nacken?«
»Wann nicht?«
»Viel zu voll hier, um irgendjemand anzutreffen, besonders nicht ein mageres kleines Schiffsmädchen, das sowieso nur aus Sommersprossen besteht«, verspricht er und zwinkert mir zu, bevor er sich davonmacht.
Ich schiebe mich weiter durch die Menschenmenge auf die Kreidetafeln zu.
Mein Vater ist nun schon seit einem Jahr auf der Fortüne unterwegs, und Tarrant hat recht – er ist ganz schön knapp dran. Er kundschaftet im Norden neue Handelsrouten für die Flotte aus, und es bleibt ihm nur noch ein kurzes Zeitfenster, um zurückzukehren. Bald wird die Nordpassage durch die Winterstürme unpassierbar sein, und durch die tödlichen Eisberge, die diese Jahreszeit mit sich bringt.
Als er Richtung Norden aufgebrochen ist, hat er mich ein ganzes Jahr lang bei Rensa zurückgelassen. Erst dachte ich, dass er mich verlassen hat, weil er so enttäuscht von mir war, aber am Abend, bevor er aufgebrochen ist, hat er das Gegenteil behauptet.
»Wenn ich wieder zurück bin, wirst du dir deinen Knoten als erste Offizierin verdient haben, mein Mädchen. Ein Neuanfang.«
Und das ist es, was wir beide brauchen. Jahrelang haben wir vergeblich darauf gewartet, dass ich aus meiner Magie etwas mache. Inzwischen müssen wir beide akzeptieren, dass ich stattdessen meine Fähigkeiten als ganz normale Seefahrerin unter Beweis stellen werde. Wir müssen endlich die langen Jahre des schmachvollen Scheiterns hinter uns lassen und uns auf das konzentrieren, was ich tatsächlich tun kann.
Nur dass Rensa mir gar nichts beigebracht hat – nichts, um mich auf die Pflichten einer ersten Offizierin vorzubereiten. Stattdessen verbringe ich meine Tage damit, lauter Aufgaben auf dem Schiff zu erledigen, die mich nicht weiterbringen, zu schrubben und zu nähen und Wache zu halten.
Irgendwann in den nächsten paar Tagen wird mein Da mich fragen, was ich gelernt habe, und was soll ich ihm dann antworten? Auf der Fortüne habe ich neben ihm am Steuerrad gestanden. Auf der Lizabetta – die mein Zuhause war, als ich aufgewachsen bin und die das Schiff ist, über das ich eines Tages selbst die Befehlsgewalt haben will – bin ich wie eine Rekrutin behandelt worden.
Im Moment ist mir das jedoch egal. Ich will ihn einfach nur wiedersehen. Seit wir angekommen sind, habe ich die Tafeln gewissenhaft kontrolliert, jedes Mal davon überzeugt, dass ich nun endlich dort die Fortüne in Kreideschrift stehen sehen werde, und jedes Mal werde ich wieder aufs Neue enttäuscht.
Ich bin mir sicher, dass mich Rensa morgen nicht von Bord lassen wird, und am Tag danach legen wir ab, und dann werde ich Da verpasst haben.
Drei Kreidetafeln sind an der Wand befestigt, alle mit ordentlicher Handschrift beschrieben. Nackte Glühbirnen hängen darüber, eine flackert, als würde ihr letzter Augenblick kurz bevorstehen – mal ehrlich, da bringt das Licht, das durch die Fenster dringt, mehr, wenn man auf den Tafeln etwas erkennen will.
Auf der einen sind die Schiffe aufgeführt, die heute den Hafen verlassen, auf der anderen, die, die angekommen und auf der dritten Tafel, die Schiffe, die gesichtet worden sind – von denen, die bereits vor Anker gegangen sind, und berichtet haben, wer noch auf dem Weg ist und wie weit draußen sie noch sind.
Die Tafel mit den Abfahrten ist voller Schiffe, die bereit sind, nach Trallia auszulaufen, nach Fontesque, nach Beinhof oder zu den Fürstentümern – oder sogar zu einer inzwischen riskanten Reise nach Mellacea aufzubrechen, trotz des drohenden Krieges – und daneben ist vermerkt, ob sie Passagiere aufnehmen oder anheuern. Nur ein einziges Schiff wird sich auf den Weg nach Holbard machen: die Freya riskiert die Reise zurück in den Norden, bevor das Eis den Weg unpassierbar machen wird.
Ich überfliege die Tafel mit den Ankünften, und in mir zieht sich alles zusammen, als ich das Ende der Liste erreiche, ohne die Fortüne zu entdecken. Ich arbeite mich durch die Aufstellung der gesichteten Schiffe, mein Blick huscht ungeduldig über die ordentlich in Kreide aufgeführten Namen. Bitte, Da, bitte.
Er lässt es wirklich drauf ankommen, aber er wird es schon schaffen. Kein Kapitän kann die Nordpassage besser bewältigen als Stanton Walker.
Und er hat es versprochen. Es ist ein Jahr vergangen.
Ich lese die Tafeln, dann wieder, blinzele und lese dann ein weiteres Mal alles durch, während sich mein Herz immer weiter zusammenschnürt. Irgendjemand muss das Schiff wenigstens gesichtet haben. Muss einfach.
Zum ersten Mal ergreift mich eine neue Angst. Haben die Winterstürme dieses Jahr vielleicht früher eingesetzt? Mein Vater kann ein Schiff durch einfach alles steuern, aber es gibt einen Grund dafür, dass niemand der Meerenge trotzt, wenn die Kälte kommt. Man sagt, die Wellen schlagen bis zur Mitte des Hauptmastes hoch.
»Selly! Selly Walker! Hier drüben, Mädchen!« Jemand ruft meinen Namen über das Geplapper der Seeleute hinweg, und ich drehe mich um, um mich zu orientieren. Die Stimme klingt vertraut, und ich kann eine der Angestellten ausmachen, die hinter den Tresen arbeitet, die die eine Seite des Raumes einnehmen. Sie zeigt auf die Postwand, also drehe ich mich um und mache mich auf den Weg durch die Menge, schubse mich mit neuer Dringlichkeit durch, drängle mich an Matrosen vorbei, die stehen geblieben sind, um alte Freunde zu begrüßen und Nachrichten auszutauschen. Jeder hat etwas zu sagen, nun, da die Stimmung in den Hafenstädten auf der ganzen Welt jeden Tag wechselt, aber ich lasse mein Ziel nicht aus den Augen.
An der Postwand werden die Briefe befestigt, die die Seefahrer für andere Schiffe mitbringen. Ich ducke mich unter dem Arm eines geschwätzigen Bootsmannes durch und stehe dann direkt davor. Ich sehe den Brief sofort, und es ist so, als wüsste mein Körper Bescheid, bevor es mein Gehirn tut.
Ich bekomme plötzlich keine Luft mehr, und meine Augen brennen, als ich nach der Stecknadel greife und sie rausziehe. Daneben steckt ein weiterer Brief, adressiert an Kapitänin Rensa von der Lizabetta, und so wie meiner ist er viel zu dick, um eine kleine Notiz zu sein, auf der steht, wann wir ihn in Kirkpool erwarten können.
Das hier ist kein Anreisedatum. Das hier ist eine Ausrede.
In dem Gedränge werde ich zur Seite geschubst und gegen die Wand gedrückt, während ich mit zitternden Fingern den Brief aufmache und das Bündel Papier fast fallen lasse. Ich falte es auf, hoffe noch immer, dass dort stehen wird …
Liebe Selly,
ich weiß, dass das nicht die Nachricht ist, auf die Du gehofft hast, aber …
Aber. Mein Atem kommt schnell und stoßweise, während ich den Inhalt des Briefes überfliege.
Aber hier lässt sich ein Vermögen verdienen.
Aber so können wir ein weiteres Schiff kaufen, vielleicht eins, das Dir noch besser gefällt als die Lizabetta.
Aber hier gibt es ein paar sehr begabte Magierinnen und Magier, und ich kann mir die Chance nicht entgehen lassen, sie anzuwerben.
Aber ich werde hier überwintern müssen, weiter Handel treiben, weiter meine Arbeit verrichten.
Aber es wird noch ein weiteres halbes Jahr dauern, bis ich nach Hause komme.
Aber ich bin mir sicher, dass Rensa Dir weiterhin mehr beibringen wird als jede andere, und Kyri ist ja eine sehr begabte Magierin, also vielleicht …
Ich zerknülle den Brief mit einer Hand, schiebe ihn in die Tasche zu den Kerzen und greife dann nach Rensas und lege ihn dazu.
Das kann doch einfach nicht wahr sein.
Ich beiße so sehr die Zähne zusammen, dass es weh tut, drücke mir den Arm auf den Mund, um meinen frustrierten Schrei zu dämpfen. Plötzlich ist die Menge um mich herum zu laut, zu nah, und ich suche verzweifelt nach einer Lücke, durch die ich fliehen kann, nach draußen an die frische Luft, um wieder das Meer zu atmen.
Doch dann landet mein Blick auf der Tafel mit den Abfahrten, und ich betrachte sie nun mit anderen Augen.
Die Freya läuft in der Morgendämmerung aus, das letzte Schiff Richtung Norden, bevor es wieder Frühling wird. Und das bedeutet, ich habe noch eine Chance, dass alles wieder gut wird.
Wenn mein Da nicht zu mir kommen will, dann gehe ich eben zu ihm.
So oder so werde ich an Bord sein, wenn die Freya morgen früh ausläuft.
Ich stolpere hinaus in den hellen Nachmittag, das Blut hämmert mir noch immer in den Schläfen. Auf der Tafel steht, dass die Freya im nördlichen Teil der Hafenanlage liegt, und ich bahne mir einen Weg in die Richtung.
Kirkpool gehört zu den großen Hafenstädten der Welt und ist die Hauptstadt von Alinor – der Heimathafen der Handelsflotte meines Vaters. Die Hafenanlage bildet einen Halbkreis um die Bucht, der Naturhafen mündet im Westen in das Halbmond-Meer.
Meine Lizabetta liegt am südlichen Kai vor Anker, deswegen wird niemand diesen Besuch mitbekommen, erst recht nicht über das Wasser hinweg.
Der Kapitän der Freya wird der Tochter von Stanton Walker nichts abschlagen, und seine Zustimmung zu bekommen, anstatt als blinder Passagier mitzusegeln, wird die Reise einfacher machen. Zur Hölle, wenn sie mich an Bord lassen, bleibe ich da, bis sie ablegen. Es gibt nichts auf der Lizabetta, von dem ich mich nicht trennen könnte.
Ich werde immer schneller, weil ich es so eilig habe, haste an Schiffen aus allen Häfen der Welt vorbei, sie liegen Seite an Seite, aus Kethos und Escium, sogar aus der Hafenstadt Naranda, und der Seewind zupft mir die blonden Strähnen aus meinem geflochtenen Zopf und peitscht sie mir ins Gesicht.
Das da hinten muss die Freya sein, eingequetscht zwischen zwei dreckigen Dampfschiffen. Ihr robuster Rumpf ist wie dafür geschaffen die Nordpassage zu durchqueren. Meine Schritte werden schneller, als ich um die Kurve der Hafenanlage in ihre Richtung biege.
Und direkt in eine Barrikade reinrenne, die sich quer über die Mündung der Hafenanlage zieht.
Dahinter ist genau jene Flotte, zu der sich Prinz Leander aufgemacht hat – eine Gruppe von eleganten Schonern, ihre Takelage blumenbekränzt und voller Flaggen. Ich habe sie in den letzten paar Tagen quer über den Hafen beobachtet, aber nun sehe ich sie zum ersten Mal von nahem.
Um sie herum geht es zu wie in einem Bienenstock – Matrosen schleppen Kisten, über ihnen hieven klapprige Kräne Netze mit Frachtgut an Bord, schwingen sie hin und her, um sie auf dem Deck runterzulassen. Ein Lastwagen fährt langsam rückwärts an den Rand des Hafenbeckens, während drei Deckarbeiter ihn emsig reinwinken. Auf dem Vorderdeck des nächstgelegenen Schiffes spielt jemand eine Schallplatte auf einem Grammophon ab. Mädchen in leuchtenden Farben tanzen, werfen die Arme in die Luft und wiegen sich in den Hüften, so dass die Fransen an ihren Kleidern sich auffächern, und lachen lauthals auf, als sie die Schritte ein weiteres Mal versuchen. Sie beachten das Gewimmel um sie herum gar nicht, während eine Schar von Arbeitern sich abmüht, die Flotte zum Auslaufen bereit zu machen.
So viel Wirbel für einen verwöhnten Schnösel.
Die Königin schickt ihren kleinen Bruder los, damit er die Regenten von Alinors Nachbarstaaten charmiert; und er scharwenzelt herum, als würde er zu einem Tanztee aufbrechen, zusammen mit ein paar Dutzend von seinen engsten Freunden, und er merkt gar nicht, welche Anspannung in der Luft liegt.
Die Flotte wird gewiss nicht so töricht sein, bis nach Mellacea zu reisen, damit die Schiffe nicht durchsucht und besteuert werden, so wie uns Seeleuten das in den letzten Monaten ergangen ist. Mein Vater weiß nichts von dieser Veränderung – einer von vielen Gründen, warum er zu uns hätte zurückkehren sollen, als er es noch konnte. Trotzdem, ich werde es ihm sagen, wenn ich bei ihm ankomme.
Ein paar Leibgardisten der Königin überwachen die Barrikade, glänzend und pompös in ihren königlich blauen Uniformen. Und es gibt sofort Ärger.
»Ich habe geschäftlich mit dem Kapitän der Freya zu tun«, sage ich so höflich, wie ich nur kann.
Die Frau hebt eine Augenbraue und zieht wichtigtuerisch eine Liste aus ihrer Tasche. »Name?«
»Selly Walker, aber ich stehe da nicht drauf.«
»Nein?«
»Nein.« Mir gelingt es nicht die Genervtheit in meiner Stimme zu verbergen, aber ich kann jetzt schon sehen, wie das enden wird. Das ist ein vertrautes Gefühl – dabei zuzusehen, wie etwas seinen Lauf nimmt, aber dennoch nicht in der Lage zu sein, mir auf die Zunge zu beißen und zu überlegen, wie ich das hinkriegen könnte, bevor es schiefläuft.
»Es tut mir leid, aber dein Name steht nicht auf der Liste, und du hast auch kein Crew-Armband, deswegen können wir dich hier nicht durchlassen«, informiert sie mich, klingt aber nicht im Geringsten so, als würde es ihr leidtun.
»Hört mal, wenn ihr dem Kapitän der Freya nur sagen könntet, dass Selly Walker – die Tochter von Stanton Walker – hier ist, bin ich mir sicher, dass …«
»Ich bin nicht dazu da, um Botengänge zu erledigen, Mädchen«, schneidet sie mir das Wort ab. Als sie mich von Kopf bis Fuß mustert, hebe ich die Hand, um mir das windzerzauste Haar zurückzustreichen, und wünsche mir dann, ich hätte es gelassen. Ihr Blick bleibt an den dreckigen Knien meiner Hose hängen, ein Andenken an meinen Sturz von der Frachtkutsche. Eine weitere Sache, die ich Seiner Hoheit zu verdanken habe.
»Ab mit dir«, sagt sie, als ihr Kamerad endlich den Blick von den tanzenden Mädchen an Deck abwendet und mich aufmerksam beäugt, »oder müssen wir dich begleiten?«
Ich beiße mir so fest auf die Zunge, dass ich überrascht bin, kein Blut zu schmecken, deute eine formvollendete Verbeugung an, die dem nichtsnutzigen Haufen von Aristokraten dort oben auf dem Deck gerecht wird, und wende mich ab. Wenn die mich nicht durchlassen wollen, werde ich eben einen anderen Weg finden.
Während ich den Hafenkai runtergehe, werfe ich einen prüfenden Blick über die Schulter und sehe, dass die Leibwächterin mich im Auge behält, doch als ich ein weiteres Mal zurückblicke, hat sie das Interesse verloren.
Ich tauche hinter einem langen Stapel Packkisten ab, die darauf warten, verladen zu werden. Wenn ich irgendwo in der Nähe der Barrikade haltmachen kann, gelingt es mir mit ein bisschen Glück vielleicht, an ihnen vorbeizuschlüpfen und die Freya zu erreichen. Dazu muss ich aber ein Stück näher herankommen.
Ich quetsche mich mühsam zwischen zwei Kisten durch und schnelle dann aus dem winzigen Zwischenraum hervor, wie ein Korken aus einer Champagnerflasche, und direkt in etwas rein – in jemand –, der seinerseits zurückstolpert und die Arme um mich wirft, damit wir nicht beide zu Boden gehen. Als wir wieder ins Gleichgewicht kommen und mir bewusst wird, dass ich in seiner Umarmung liege, treffen sich unsere Blicke.
Er ist etwa in meinem Alter, mit warmer brauner Haut, goldfarben wie der Sandstein von Kirkpool, als wäre er ein Teil der Stadt selbst. Braune Augen funkeln unter elegant verwuschelten schwarzen Haaren, und das unbeschwerte Lächeln auf seinen Lippen besagt, dass er sehr wohl weiß, wie gut er aussieht.
Ich hasse es, wenn Leute so lächeln.
»Na endlich«, sagt er fröhlich, und es scheint ihn nicht zu kümmern, dass eine Seefahrerin plötzlich in ihn reingekracht ist. »Ich dachte, du würdest nie kommen.«
Ich versuche wieder Luft zu bekommen, starre ihn an, etwas abgelenkt von seinem Gesicht. Dass seine Wimpern so lang sind, ist einfach nicht gerecht.
Sein Mund zuckt, als würde ihn etwas amüsieren – ich, wahrscheinlich –, und das reicht, um sofort wieder zu mir zu kommen. Ich lege eine Hand auf seine Brust und schiebe ihn weg, während ich aus seiner Umarmung zurückweiche.
»Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich habe keine Zeit für dich«, murmele ich. »Warum, zur siebten Hölle, versteckst du dich hinter einem Stapel Kisten?«
»Nun, ich habe gehört, dass du hier sein wirst«, sagt der geheimnisvolle Störenfried, ohne zu zögern, und weist mich ganz höflich nicht darauf hin, dass auch ich mich verstecke.
Mir ist nicht ganz klar, wer er sein könnte. Er ist angezogen, als würde er zum Hafen gehören – die Hemdsärmel hochgerollt, schwarze Hosenträger und dunkelbraune Hosen –, aber sein weißes Hemd ist viel zu sauber, der Stoff seiner Hose zu fein, und er klingt zu hochgestochen. Vielleicht ein Bediensteter aus dem Palast, der hier unten nicht auffallen will?
Ich habe keine Zeit, mich aufhalten zu lassen, egal, wie irritierend schön er auch ist. Mit einem letzten Blick auf ihn drängle ich mich also vorbei und greife nach dem Rand der nächstgelegenen Kiste. Ich halte mich fest, hieve mich hoch und auf die Packkiste drauf. Bestimmt muss er meinen strampelnden Beinen ausweichen, während ich nach oben krabbele und nach Halt suche. Ich werde schnell genug wissen, ob er Alarm schlägt.
Von hier aus kann man die Leibgarde der Königin viel besser beobachten. Oben auf den Packkisten ist alles voller Blumen, in Bündeln aufgehäuft. Sie sind dazu vorgesehen, die Takelage der Prinzen-Flotte zu verschönern, und geben eine wunderbare Tarnung ab. Ich niste mich zwischen ihnen ein und stelle mich aufs Warten ein.
»Wonach suchen wir?«, fragt eine Stimme neben mir. Ich falle fast von der Kiste runter.
Schon wieder dieser lästige Mensch. Als ich aushole, weicht er meiner Hand aus, sie trifft auf nichts. Er greift um meine Taille, gibt mir Halt und zieht mich zurück in das Nest von Blumen. Als er meinen Gesichtsausdruck sieht, lacht er.
»Was machst du hier?«, will ich wissen.
»Ich konnte nicht wegbleiben«, antwortet er mit einem Grinsen. »Außerdem dachte ich, du hättest mitbekommen, wie ich auch hochgeklettert bin, tut mir leid.«
Erst als er seine Hand zurückzieht, sehe ich, dass er die magischen Male auf den Unterarmen und Handrücken trägt, smaragdgrün leuchten sie auf dem hellen Braun seiner Haut. Etwas in meinem Inneren windet sich bei dem Anblick.
Solche vielschichtigen Male habe ich noch nie zuvor gesehen, sie sind so verschlungen, dass ich nicht einmal ausmachen kann, welches Element sie zu erkennen geben sollen. Kein Wunder, dass er so eingebildet ist. Aber wenn ich ehrlich bin, reicht dafür allein schon sein Aussehen.
Mit meiner behandschuhten Hand stütze ich mich ab, um wieder richtig ins Gleichgewicht zu kommen, und unterdrücke das Verlangen, zu fragen, was er hier zu suchen hat, denn dann wird er mich das Gleiche fragen und das wird nicht so ausgehen, wie ich das gern hätte.
»Lady Violet Beresford«, sagt mein Begleiter im Plauderton, und als ich seinem Blick folge, sieht er zu einem Mädchen auf dem Schiff, das ein Kleid in den silberblauen Farben des Meeres in der Dämmerstunde trägt. Sie steht der Tanzgruppe vor, lachend wirft sie den Kopf zurück.
»Na, wie schön, dass sich wenigstens irgendjemand gut amüsiert.«
»Du etwa nicht?«
»Hast du heute auch nur einen Augenblick in der Stadt verbracht?«, frage ich gereizt und schiebe mich durch das Blattwerk, um nach den zwei Leibgardisten zu gucken, die viel dienstbeflissener sind, als mir das gefällt. Während ich sie beobachte, kommt aus Richtung der Stadt ein dritter den Hafenkai entlanggetrottet, um mit ihnen zu sprechen.
»Was ist denn los?«
»Wer, abgesehen von den Aristokraten da, geht gerade nur seinem Vergnügen nach? Ich bin erst seit ein paar Tagen wieder an Land, aber alle, mit denen ich geredet habe, fragen nach den anderen Hafenstädten, wollen wissen, was in den Ländern um das Halbmond-Meer gesagt wird. Ob Mellacea mit uns einen Krieg anfangen wird. Wenn ich mir das hier ansehe, verstehe ich allmählich, warum sich alle solche Sorgen machen.«
Er lehnt sich neben mir nach vorne, um sich die Segelschiffe genauer anzusehen, seine warme Schulter eng neben meiner. Lady Violet tanzt noch immer, fordert ihre Gefährtinnen auf mitzumachen, während die Musik sich fröhlich überschlägt. »Wieso, was siehst du denn?«
Ich schnaube. »Kannst du das nicht sehen? Seine Schiffe sind voller Blumen.«
»Du musst zugeben, es sieht … Wieso, was hast du gegen Blumen?«
Unter uns führt die Leibgarde gerade ein hitziges Gespräch mit dem Neuankömmling. Besteht etwa die Hoffnung, dass er sie weglockt?
»Über Blumen habe ich mir noch nicht wirklich eine Meinung gebildet«, sage ich in dem Bewusstsein, dass ich so klinge, als wäre das doch so.
»Bist du also einfach von Natur aus griesgrämig?«
»Hör zu.« Es wäre falsch, ihn jetzt einfach von der Kiste zu schubsen. »Jedes Handelsschiff im Hafen weiß, wie schwierig die Situation gerade ist, wie angespannt die Lage in jedem neuen Hafen ist, den wir anlaufen. Alinor ist in Schwierigkeiten. Das Land hat sich in der Nachmittagssonne ein kleines Schläfchen gegönnt, und drüben in Mellacea stehen sie auf, bevor der Morgen dämmert, das kannst du mir glauben. Und was macht die Königin?«
»Nun, sie …«
»Sie hat dem kleinen Prinzen die Aufgabe überlassen. Als wollte sie absichtlich scheitern.«
»Das ist jetzt schon ein bisschen hart, findest du nicht?«
Ich schnaube. »Wir reden hier von jemandem, der sich bei der Sonnenwendfeier dreimal umgezogen hat. An einem Abend!«
»Ich habe gehört, es war viermal und dass er einen unvergesslichen Mantel getragen hat, der mit goldenen Pailletten besetzt war.«
»Glaubst du wirklich, dass irgendetwas an deiner Aussage das irgendwie besser macht?«, stoße ich entrüstet hervor.
»Ich muss schon sagen, du scheinst ja eine Menge über ihn zu wissen«, sagt er nachdenklich.
»Ich kann nichts dafür, die Leute reden ja über nichts anderes.«
»Und du auch, und du scheinst ihn nicht einmal zu mögen.«
»Das spielt doch überhaupt keine Rolle«, schnauze ich zurück und zwinge mich, meine Stimme wieder zu senken. »Von mir aus kann er jeden Schneider um das Halbmond-Meer in Lohn und Brot halten, solange er seine Aufgabe erfüllt.«
»Vielleicht tut er das ja«, wirft er ein, obwohl sein Ton zu verstehen gibt, dass die Beweislast auf meiner Seite liegt.
»Hast du sie noch alle? Er hat beschlossen, seine gesamte Flottille mit dem Inhalt der königlichen Gärten zu schmücken – und wir stehen kurz vor dem Wintereinbruch, also möchte ich gar nicht wissen, wie viele Gewächshäuser für solch eine Dummheit geleert werden mussten –, hat einen Küchenmeister aus Fontesque und eine Handvoll seiner Kumpel miteingeladen, um die Küste abzuklappern und mit unseren Nachbarn Freundschaft zu schließen.«
»Soll er sich mit unseren Nachbarstaaten nicht anfreunden?«, fragt er und runzelt die Stirn angesichts der vielen Leibgardisten, die den Hafenkai runterrennen, um sich zu den anderen zu gesellen.
»Er sollte dafür sorgen, dass wir aus unseren Nachbarn Verbündete machen«, schieße ich zurück. »Aber es wird ihn ja auch keiner ernst nehmen. Tut das überhaupt jemand?«
»Aua«, murmelt er, und ich drehe den Kopf, um ihn mir genauer anzusehen, wie er da hockt, eingerahmt von Blumen.
Er ist immer noch unglaublich schön, aber nun achte ich mehr auf seine Stimme. Sie klingt nach Geld. Kennt er den Prinzen etwa?
Plötzlich fällt mir ein, wie oft Rensa mir schon gesagt hat, ich soll meine Zunge hüten, besonders bei Menschen, die ich nicht kenne. Wenigstens hat er keine Ahnung, wie ich heiße.
Ich weiß, dass ich gerade all die Enttäuschungen dieses Tages, die endlosen Anordnungen meiner Kapitänin, die Tatsache, dass mein Vater mich verlassen hat, dass der Weg zur Freya versperrt ist – all das an ihm auslasse. Und ich weiß, dass ich das nicht tun sollte.
Anderseits besteht er ja darauf, sich mir in den Weg zu stellen.
Unter uns sammeln sich immer mehr Leibgardisten – inzwischen sind es ein Dutzend und einer zeigt in alle Richtungen und schickt sie überallhin. An ihnen vorbeizuschlüpfen, kann ich vergessen – das gesamte Hafengebiet wimmelt nur so von ihnen.
Dann werde ich mir in der Dunkelheit einen Weg suchen müssen und heimlich an Bord schleichen, denn jetzt erwische ich den Kapitän der Freya ganz bestimmt nicht mehr.
»Ich glaube, so allmählich ist hier ein bisschen viel los«, sagt der Junge und beobachtet nachdenklich die stetig wachsende Zahl der Leibgardisten. »Sieht so aus, als wäre ihnen etwas abhandengekommen.«
»Sieht so aus«, murmle ich. Alles gut. Ich werde die Freya schon noch heute Nacht erreichen. Im Schutze der Dunkelheit wird es einfacher sein, und sie segelt erst im Morgengrauen. Ich kann mich an Bord verstecken, bis sie auf dem offenen Meer sind, und dann wird es zu spät sein, mich von Bord zu schicken.
Jetzt sollte ich mich aber beeilen, zurück zur Lizabetta zu kommen, bevor Rensa merkt, wie lange ich schon weg bin, und die Geduld mit mir verliert.
»He, guck mal«, sagt die Nervensäge neben mir plötzlich mit lauter Stimme, und ich drehe mich schnell um, um seinem Blick zu folgen.
»Was? Was meinst du?«
Er zeigt auf das Deck des nächstgelegenen Schiffes, wo die bunte Menge der Adeligen sich um eine Frau drängt, die einen eleganten kleinen Handkarren Richtung Bug schiebt. »Jetzt gibt es Erfrischungen. Ich wette eine halbe Krone, dass da Tarte aus Fontesque dabei ist.«
Das Geräusch, das ich von mir gebe, klingt wie ein würgendes Knurren, und er verstummt.
Ja, er gehört ganz sicher zur Aristokratie, der ist kein Bediensteter im Palast. Der Rest der Stadt summt geradezu vor Sorge, wir sind in einem Hafen voller Schiffe, die alles zu verlieren haben, falls ein Krieg ausbricht, und anstatt sich darüber Gedanken zu machen, wie man all unsere Probleme lösen könnte, versammeln sie sich da unten auf der königlichen Seeflotte – so nennen alle die Schiffe, die sich als Zeichen des guten Willens auf diese Reise begeben – zu ihrem Tanztee, wie Möwen im Kielwasser eines Fischkutters.
»Erst Blumen und jetzt Tarte«, sagt er und mustert meine düstere Miene. »Was magst du außerdem nicht, kleine Kätzchen?«
»Ich … kannst du bitte einfach verschwinden?«
Er grinst. »Ich glaube, du wirst feststellen, dass ich zuerst hier war. Und außerdem, als du hier angekommen bist, hast du dich buchstäblich in meine Arme geschmissen.«
Ich könnte ihn einfach aus unserem kleinen Nest stoßen, aber in seinem Fall wäre das wohl etwas zu subtil. Ich schenke ihm ein zu süßes Lächeln, greife in das Nest von Blumen um uns herum und pflücke eine zarte Blüte in Saphirblau, das königliche Blau von Alinor.
Er behält mich vorsichtig im Auge.
»Da.« Ich lehne mich über ihn und stecke sie ihm hinters Ohr. »Alles Nichtsnutzige hier ist so wunderschön geschmückt. Da sollst du dich nicht ausgeschlossen fühlen.«
Da entspannt er sich, und um seinen Mund zuckt wieder dieses kleine Lächeln. Dieser Tunichtgut macht den Eindruck, als würde er jeden Unfug auf dieser Welt kennen und die Hälfte davon selbst anrichten.
Seine braunen Augen bleiben auf meine gerichtet, und als meine Fingerspitzen sein Haar streifen, habe ich ein ganz seltsames Gefühl im Bauch. Muss die Sonne sein.
Wir halten beide einen Moment lang inne und sehen einander an.
»Dann kommst du also nicht auf einen kleinen Imbiss vorbei?«, fragt er und löst die Anspannung auf.
Ich werde das Gefühl nicht los, bei diesem Austausch verloren zu haben, und ich weiß nicht, warum. »Das war mehr als genug Aristokratie für einen Tag.« Ich verlagere schon mein Gewicht, bereit, in einer Geschwindigkeit wieder herunterzuklettern, die sich ein wenig wie eine Flucht anfühlt, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin.
»Hoffen wir mal, dass mehr an deinem Prinz dran ist, als es scheint«, kontert er.
»Das bezweifle ich«, antworte ich, und bevor er darauf etwas erwidern kann, springe ich in den Zwischenraum zwischen den Packkisten und mache mich auf den Weg zurück.
Ich habe das unglaubliche Bedürfnis zurückzugucken, aber ich zwinge mich, meinen Blick stur geradeaus zu richten. Ich habe keine Zeit, über ihn nachzudenken. Nur eine einzige Sache ist wichtig, und die liegt am nördlichen Ende der Hafenanlage vor Anker.
Selbst wenn ich durch das Hafenbecken schwimmen und an ihrer Seite hochklettern muss wie ein Pirat, werde ich, sobald die Sonne aufgeht, auf der Freya gen Norden segeln.
Jude
Das Wirtshaus Zum schönen JackHafenstadt Naranda, Mellacea
Wie ein Monster brüllt die Menge auf, als ich auf ihn losgehe, in letzter Sekunde drehe ich mein Handgelenk so, dass ich mit dem Handballen anstatt mit den Fingerknöcheln zuschlage.
Nicht gerade fair.
Ist mir egal.
Der andere Typ stolpert zurück, spuckt Blut und ruft »Foul«, während das Menschenmengen-Monster um uns herum wogt und ich vor ihm hin und her tänzele, ihn verhöhne.
Der Box-Ring liegt unterirdisch, das einzige Licht kommt von den Laternen, die an der Decke schwingen. Mein langer Schatten wiegt sich neben mir hin und her, während ich darauf warte, dass er sein Gleichgewicht wiederfindet. Mein Atem geht schnell. Es ist zu früh, um zum entscheidenden Schlag auszuholen – das Monster muss erst gefüttert werden; mein Puls hämmert, meine Haut ist glitschig vor Schweiß und ich fühle mich unglaublich lebendig. Mehr als bereit, dem Monster seine Mahlzeit zu servieren.
Er wischt sich mit der nackten Hand das Blut vom Mund, hinterlässt eine purpurne Spur auf seiner Wange und hebt wieder die Fäuste. Diesmal taxiert er mich mit mehr Vorsicht, sein flackernder Blick mustert mich von oben bis unten.
Ja, ich bin nur halb so groß wie er. Aber doppelt so schnell.
Ich streiche mir die verschwitzten schwarzen Haare aus der Stirn und gucke ihm direkt in die Augen. Und er ist derjenige, der wegguckt.
Um uns herum verschwimmt die Menge, aber sie wird immer mehr mein Monster, so wie jedes Mal wieder – brüllt Ratschläge und erhebt Einspruch, schließt Wetten ab und ruft nach Drinks. Die Gläser funkeln im Licht der Laternen, der beißende Geruch von Zigarrenrauch wabert durch den Raum, und wieder gehe ich auf ihn los.
Die Faust des großen Mannes schwingt furchterregend schnell, und mit einer ruckartigen Bewegung weiche ich aus, so dass meine Zähne aufeinanderschlagen, mir ein scharfer Schmerz durch den Kopf schießt. Bevor er wieder zuschlagen kann, greife ich ihn an, nutze den Moment, in dem er aus dem Gleichgewicht ist, und treffe ihn diesmal über dem Auge; seine Haut platzt auf, das Blut fließt in Strömen und das Gebrüll des Monsters wird ohrenbetäubend.

![Beast Changers. Im Bann der Eiswölfe [Band 1 (Ungekürzt)] - Amie Kaufman - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/32cdaf81ad5376bcfc2bbc3d2164cfa2/w200_u90.jpg)

![Beast Changers. Im Reich der Feuerdrachen [Band 2 (Ungekürzt)] - Amie Kaufman - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8b453ba36123aed1dc60f5b024bf9ed8/w200_u90.jpg)
![Beast Changers. Der Kampf der Tierwandler [Band 3 (Ungekürzt)] - Amie Kaufman - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c6042a3cd95ed9f7945d8b7182aab6fe/w200_u90.jpg)
![The other side of the sky. Die Göttin und der Prinz [Band 1 (Ungekürzt)] - Amie Kaufman - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bf62a7f016e42e923aa9b576bafb5b7/w200_u90.jpg)



![Die Göttin und der Prinz. Beyond the End of the World [Band 2 (Ungekürzt)] - Amie Kaufman - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/202a874cc99d58ccb78024a6bd5919f6/w200_u90.jpg)