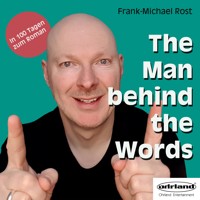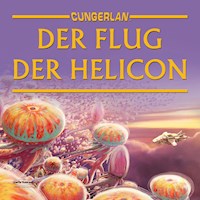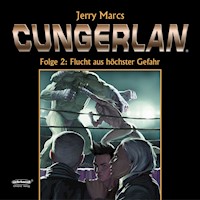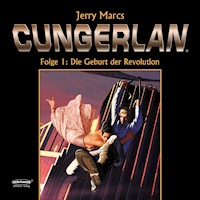6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In 100 Tagen zum Roman. Das ist das Versprechen, das Autor und Produzent Frank-Michael Rost mit diesem Sachbuch abgibt. Lerne anhand seiner Arbeitsmethode, wie du dein eigenes Buchprojekt unabhängig vom Genre aus der reinen Vorstellung in gedruckte Form bringen kannst. Mit etwas gutem Willen und Selbstdisziplin kann jeder es schaffen, in 100 Tagen die erste Fassung seines Romans zu schreiben. Trotz Mehrfachbelastung durch Arbeit, Studium oder Familie. Der Autor Autor schafft einen Bogenschlag von der Ausgangsfrage „Was ist eine Geschichte?“ über das benötigte Handwerkszeug, um selbst schriftstellerisch tätig werden zu können, bis hin zu Erläuterungen, wie die eigenen Texte am besten veröffentlicht werden können. Viele leicht nachvollziehbare Praxisbeispiele ergänzen dieses Buch, das sich selbst irgendwo zwischen Ratgeber und Unterhaltung verortet. Unabhängig davon, ob du selbst schreibst oder einfach nur neugierig auf die Arbeitsweise des Autoren bist, dieses Buch wird dich begeistern. In insgesamt 5 Kapiteln wird der Weg von der Ideenfindung über die Figurenentwicklung bis hin zur Frage, was Testleser sind und wie du sie für dein Projekt begeistern kannst, vorgestellt. Du erfährst, was du alles benötigst, um dein Manuskript einer Agentur oder einem Verlag anzubieten und wie du den strukturellen Aufbau von Geschichten erkennen und für dein eigenes Schreiben nutzen kannst. Die Informationen sind leicht verständlich und auf den Punkt gebracht. Umfangreichs Vorwissen wird nicht vorausgesetzt. THE MAN BEHIND THE WORDS - In 100 Tagen zum Roman versteht sich als Begleitbuch zum YouTube-Kanal youtube.com/@themanbehindthewords.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
The Man behind the Words
The Man behind the Words
Frank-Michael Rost
Impressum
© 2023 Frank-Michael Rost
Coverdesign von: Ohrland Design, ohrland.de
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
ISBN 978-3-384-03785-5
Hardcover ISBN 978-3-384-03784-8
Softcover ISBN 978-3-384-03783-1
Großdruck ISBN 978-3-384-03786-2
Audiobook ISBN 978-3-941335-55-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Frank-Michael Rost, Josef-Zilken-Str. 56, 50374 Erftstadt, Germany.
Vorwort
Glück ist die Summe aus Vorbereitung und Gelegenheit.
Kapitel 1 – Was ist eine Geschichte?
Sage ich Menschen, dass ich Geschichtenerzähler bin, ist ihre nächste Frage häufig „Aha, und was machen Sie beruflich?“.
Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Abwesenheit von Geschichtenerzählern keine unmittelbaren Auswirkungen auf das tägliche Leben hätte. Ein Beispiel: Die Abwesenheit der Müllabfuhr würde man schon nach kurzer Zeit bemerken. Dagegen fiele es kaum auf, wenn sämtliche Schriftsteller, Dichter und Denker über Nacht von diesem Planeten verschwänden. Daraus ließe sich schließen, dass die Tätigkeit der Müllwerker einen Wert besitzt, die der Schriftsteller, Dichter und Denker hingegen nicht oder nur einen sehr geringen.
Erschwerend kommt hinzu, dass der überwiegende Teil der Geschichtenerzähler hinsichtlich der Einkommenssituation gegenüber einem durchschnittlichen Müllwerker deutlich schlechter gestellt ist. Du kennst solche Sätze wie „Die wenigsten Schriftsteller können vom Schreiben leben.“. Das stimmt. Anderer Leute Dreck wegzuräumen bringt deutlich mehr ein und lässt sich darüber hinaus auch wesentlich leichter erlernen. Warum erzählen Menschen dann Geschichten?
Die ältesten überlieferten Geschichten sind Schöpfungsmythen. Darin erklären sich Mitglieder eines Stammes, wie es zur Existenz der Erde und des Stammes kam. In den meisten Fällen sind höhere Wesen, also Götter, mit im Spiel. Fast immer läuft es darauf hinaus, dass ein höheres Wesen gerade nichts Besseres zu tun hatte und aus einer Laune heraus erst die Erde und dann den Stamm geschaffen hat. Das ist nicht besonders originell, aber wenn es oft genug wiederholt wird, glauben Menschen das irgendwann.
Das ist dann auch die wichtigste Funktion von Geschichten, sie sind identitätsstiftend. Indem sich Menschen Geschichten erzählen, werden aus mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelten Individuen erst Gruppen, dann Stämme, Völker, Nationen und schließlich „die Menschheit“.
Die Erklärung der Gegenwart erfolgt aus der Konstruktion einer gedachten Vergangenheit. Das hat den Zweck einer gewünschten Ausrichtung auf die Zukunft. Stark vereinfacht könnte das so lauten:
„Wir, die H’rümpf, beherrschen die Ebene des Pumm, weil unser Gott Grogg uns erschaffen und auserwählt hat. Darum müssen wir alle Nicht-H’rümpf auslöschen oder uns zu Diensten machen, damit wir auch weiterhin die Ebene des Pumm beherrschen.“
Ausgestattet mit diesem Mindset werden die H’rümpf sich vermutlich so lange gegen alle anderen behaupten, bis sie die dominante Gruppe in ihrer Region sind. Sich eine solche Geschichte zu erzählen bringt also einen nicht zu unterschätzenden Überlebensvorteil.
Abgesehen davon ist das Erzählen von Geschichten auch unterhaltsam. Gerade in den Anfangsjahren der Menschheit, also bevor es Radio, Fernsehen und das Internet gab, kamen die Mitglieder des Stammes gern am Lagerfeuer zusammen und lauschten den mündlich vorgetragenen Erzählungen. Manche dieser Geschichtenerzähler machten es so gut, dass sie von der täglichen Arbeit ausgenommen und für ihre Tätigkeit vom Stamm mit Nahrung und Zuwendung versorgt wurden. Das klappte umso besser, wenn die Geschichtenerzähler behaupteten, dass das, was sie da erzählten, übernatürliche Wahrheiten seien, die nur sie völlig durchblickten. Das klappt auch heute noch, sogar außerhalb organisierter religiöser Kontexte. Es wird dann von „Erfolg“ oder „Wissenschaft“ statt „Göttern“ und „Dämonen“ gesprochen. Der smarte Geschichtenerzähler passt sich eben der Erwartungshaltung des Publikums an.
Geschichten sind also identitätsstiftend, bringen einen Überlebensvorteil und sind darüber hinaus auch noch unterhaltsam. Kann die Müllabfuhr da mithalten? Eher nicht.
Geschichten zu erfinden und vorzutragen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass der Mensch spricht. Alles, was über die Kommunikation gerade stattfindender Gefühlszustände bzw. Bedürfniserfüllungswünsche hinausgeht – also zum Beispiel „Ich Hunger! Ich Essen!“ – ist letztlich eine Geschichte. Jeder Gedanke, jede Meinungsäußerung, jede tiefere Gefühlsregung, jede Lüge; einfach alles, was mit Hilfe der Sprache anderen Menschen mitgeteilt werden kann. In Kombination mit einer aufgeschriebenen Sprache, also der Schrift, können diese Geschichten sogar über den Tod des Individuums hinaus anderen Menschen mitgeteilt werden. So kommt es, dass uns Sorgen und Nöte von Menschen, die seit Tausenden von Jahren tot sind, noch immer beschäftigen. Wenn es eine zutiefst „menschliche“ Eigenschaft gibt, dann ist es die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen und zu tradieren. Das macht den Menschen überhaupt erst zum „Menschen“.
Dass sich die gebildeten Schichten für Erzählungen von dahergelaufenen Individuen interessieren, die keine Könige, Philosophen oder Gottesleute sind, ist ein menschheitsgeschichtlich recht neues Phänomen. Sicherlich wird es das schon immer gegeben haben, nur wurden diese Texte nicht überliefert. Das änderte sich spätestens im 18. Jahrhundert. Der Buchdruck war inzwischen etabliert und hinlänglich viele Menschen konnten lesen. Dadurch wurde es wirtschaftlich sinnvoll, Bücher in größeren Auflagen zu drucken und zu verkaufen.
Mit der Individualisierung ging auch ein entscheidender Wandel in der Sicht auf Geschichten einher. Statt das große Ganze im Blick zu haben, ging es zunehmend um die ganz spezielle Sichtweise genau eines Menschen. Dieser war seinen Lesern zudem oft namentlich und durch einige Eckdaten seiner Biografie bekannt. Dadurch entsteht nach und nach eine neue Qualität hinsichtlich der Rezeption von Geschichten. Während bei Schöpfungsmythen zumindest noch behauptet werden konnte, dass sie eine objektive „Wahrheit“ repräsentieren, ist das bei literarischen Werken von Einzelpersonen kaum mehr möglich. Selbst, wenn die erzählte Geschichte auf tatsächlichen Ereignissen beruht ist klar, dass es sich um eine subjektive Schilderung, eine individuelle Sicht auf die Dinge handelt. Einem solchen Werk kann von vornherein die Allgemeingültigkeit abgesprochen werden.
Dennoch stehen heutige Geschichtenerzähler in der Tradition ihrer archaischen Vorgänger. Menschen interessieren sich für andere Menschen, für ihre Schicksale, Träume, Wünsche, Hoffnungen und Gefühle. Es spielt keine Rolle, ob es erfundene Menschen sind, zeitgeschichtliche oder historische Figuren. Wobei Figuren letztlich immer erfunden sind. Sei es von den Autoren oder von PR-Agenturen, die für die Menschen hinter der öffentlichen Person tätig sind oder waren. Wir konstruieren uns eine Vorstellung, eine Fiktion dieses Menschen in unserem Kopf. Den wirklichen Menschen hinter den Worten bekommen wir nie zu Gesicht.
Geschichtenerzähler erfüllen also ein Grundbedürfnis des Menschen und tragen in Summe zu einer neuen Form der Identitätsstiftung bei. Eine Gesellschaft ohne Geschichten könnte funktionieren, aber eben auch nur das. Sie wäre in letzter Konsequenz un-menschlich.
Obwohl jeder Mensch die grundsätzliche Fähigkeit besitzt, Geschichten zu erfinden und zu erzählen, wird nicht jeder den Wunsch verspüren, das dauerhaft oder zum Broterwerb zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Es muss Planer, Strategen, Lenker, Konstrukteure, Erbauer, Erfinder, Tüftler, Erzieher, Aufpasser, Verteidiger oder auch Nasszellenreinigungsfachkräfte geben. Aber es gibt eben auch Menschen, die für nützliche Tätigkeiten nicht geeignet sind.
Die Fähigkeit, Geschichten zu erfinden und zu erzählen, hat auch mit Talent und einer gewissen Begabung zu tun. Aber letztlich ist es eher eine Frage von Disziplin. In den folgenden Kapiteln erhältst du einen Einblick in meine Arbeitsweise. Du erfährst, wie du aus einer Idee einen Roman machen kannst und was du alles beachten solltest, wenn du dein fertiges Werk einem Verlag oder einer Literaturagentur anbieten möchtest. Ich erhebe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Was für mich gut funktioniert, kann für dich schon wieder völlig ungeeignet sein. In der Praxis hat es sich allerdings bewährt, kontinuierlich – am besten jeden Tag – an der Verwirklichung seiner Ziele zu arbeiten. Dieses Buch versteht sich als Ergänzung zu meinem YouTube-Kanal @themanbehindthewords.
Kapitel 2 – Von der Idee zur 1. Fassung
Es gibt mit Sicherheit genauso viele Wege, einen fiktionalen oder nichtfiktionalen Text zu schreiben, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Keiner dieser Wege ist der allein seligmachende. Was für die Einen gut funktioniert, kann für die Anderen schon wieder völlig falsch sein. Ich stelle dir meine Methode vor. Sie versetzt mich in die Lage, einen Roman im marktüblichen Umfang in etwa 100 Tagen zu schreiben. Wäre Schreiben die einzige Tätigkeit der ich nachgehen muss, ginge es bestimmt auch schneller.
Der Arbeitsablauf ist im Grunde immer gleich. Alles beginnt mit der Idee, die mich trotz heftiger Gegenwehr nicht mehr loslässt. Ich suche selten aktiv nach Ideen, die meisten überfallen mich einfach. Im Schlaf, beim Autofahren, in der Badewanne. Mein erster Impuls ist dann immer, an irgendwas Anderes zu denken. Kommt die Idee wieder und lässt mich nicht los, dann ist es etwas, dem ich folgen muss.
Es gibt zwei Arten von Ideen. Entweder dreht es sich um eine interessante Figur, oder es geht um ein Konzept bzw. eine aufregende Handlung. Selten habe ich beides zusammen. Habe ich jedoch die Idee zu einer Figur, dann entwickelt sich daraus fast von allein die Handlung und damit auch die Geschichte.
Hat mich die Idee lang genug verfolgt, beginne ich damit, etwas zu Papier zu bringen bzw. in den Computer zu tippen. Ich arbeite die Figuren aus und schreibe ein Exposé, das die Geschichte auf etwa einer halben Seite erzählt. Figurenbeschreibungen und Exposé fließen dann in das Treatment ein. Das sind dann schon etwa 20 bis 30 Seiten. Ein Treatment ließt sich etwa so wie die Nacherzählung einer Geschichte, wie du sie in der Schule anfertigen musstest. Es ist eine reine Arbeitsgrundlage und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Parallel dazu recherchiere ich alles, was ich mir nicht selbst ausdenke. Lebensdaten historischer Persönlichkeiten, sofern sie in der Geschichte eine Rolle spielen sollen, technische Details von Fahrzeugen oder Waffen, Erscheinungsdaten bestimmter Filme oder Lieder, wenn diese beispielsweise dazu dienen sollen, die Geschichte einer bestimmten Zeitperiode zuzuordnen.
Recherchen machen Spaß, können aber auch frustrierend sein. Die Realität ist unfassbar komplex. Kein Autor, auch wenn er noch so detailliert schreibt, kann diese Dichte künstlich erzeugen. Die Fülle an Informationen zu fast jedem Gebiet kann zudem überwältigend sein und eher dazu führen, das Vorhaben entmutigt aufzugeben.
Ich sehe das inzwischen pragmatisch, trage viel mehr Informationen zusammen, als ich benötige und speichere sie zur späteren Verwendung auf der Festplatte ab. Für die erste Recherche zu einem neuen Roman gebe ich mir selbst 20 Tage Zeit. Was ich bis dahin nicht habe, ist entweder nicht so wichtig oder ich finde es später beim Schreiben. Recherchen sind nie ganz abgeschlossen. Es ist ein offener Prozess.
Figuren, Recherchen und Treatment ergeben zusammen die Handlung für die einzelnen Kapitel einer Geschichte. Ich kann anhand der Art der Geschichte inzwischen recht gut abschätzen, wie viele Wörter ich ungefähr benötigen werde, um die gesamte Handlung zu Papier zu bringen. Stark vereinfacht: Ein Thriller hat etwa 70.000 bis 80.000 Wörter. Ich schreibe in den meisten Fällen Kapitel mit etwa 5.000 Wörtern (10 DIN A 4 Seiten), so dass ich meine Planung auf 14 bis 16 Kapitel ausrichte. Ich arbeite mit einer Tabelle in der jede Zeile ein Kapitel repräsentiert. Die Handlung aus dem Treatment verteile ich auf diese Zeilen. So entsteht nach und nach die Struktur des Romans.
Schreiben ist einsame Tätigkeit. Bist du gern in Gesellschaft und brauchst ständige Ablenkung von außen, dann ist Schreiben nichts für dich. Mein Schreibtag beginnt um 4 Uhr morgens. Nach einem Kaffee und einem kleinen Happen kann ich spätestens um 4:30 Uhr loslegen. Ist es der erste Tag eines neuen Projektes, starre ich dann auf eine leere Seite und überlege, wie zum Teufel ich diese sinnvoll mit irgendwas füllen soll. Meistens schreibe ich dann einen recht gewöhnlichen Satz, z.B.:
„Gloria setzt sich auf den angebotenen Stuhl.“
Der nächste Satz könnte etwas über diese „Gloria“ und die Situation, in der sie sich gerade befindet, verraten. Etwa so:
„Sie streift die blonde Löwenmähne zurück und sieht den drei Anzugträgern vor ihr in die Augen.“
Gloria hat also Haare wie Farrah Fawcett und muss sich mit drei Anzugträgern auseinandersetzen. „Anzugträger“ ist ein Bild für Personen, die Macht ausüben. Als anonyme Gruppe ist diese Macht entmenschlicht, fast schon bedrohlich. Aber welche Art von Macht können diese Anzugträger über Gloria ausüben?
„Es geht um viel. Ihre Zukunft als professionelle Surferin.“
Nach vier Sätzen haben wir eine ungefähre Vorstellung von Glorias Aussehen und kennen ihren Beruf. Außerdem wissen wir, dass sie sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einer anonymen Gruppe von Personen befindet, die die Macht besitzen, über ihre Zukunft zu entscheiden. Nicht schlecht für den Anfang. Alles andere kann sich jetzt nach und nach daraus entwickeln. Das sind übrigens die ersten Sätze, die ich für meinen Thriller „Geiseln“ (Rost, F.-M.: Geiseln, 2023, unveröffentlicht, Roman) geschrieben habe.
Gegen 6:30 Uhr gibt es Frühstück. Danach setze ich meinen Schreibtag bis 10:30 Uhr fort. Dann werden die Reports ausgefüllt und die Datensicherung durchgeführt. Gewöhne dir an, alles was du schreibst doppelt und dreifach auf verschiedenen Datenträgern und Speichermedien zu sichern. Ab 11:00 kann ich mich anderen Aufgaben widmen. An den Wochenenden steht etwas mehr Zeit zur Verfügung, wobei du auch dein Privatleben nicht vergessen solltest. Ich habe ausgerechnet, dass mir auf diese Weise jedes Jahr 2.184 Stunden fürs Schreiben zur Verfügung stehen. Nicht schlecht, oder?
Ich schreibe durchschnittlich 900 Wörter pro Tag. An Spitzentagen schaffe ich um die 2.600 Wörter. Es gibt auch Tage, da sind es gerade mal 42. So oder so halte ich nach etwa 100 Tagen die erste Fassung meines neuen Romans in der Hand. In den meisten Fällen ist diese weit davon entfernt, gut zu sein. Aber zumindest gibt es jetzt etwas, das solange verbessert werden kann, bis es reif für eine Veröffentlichung ist.
Der Prozess der Überarbeitung startet mit dem Korrekturlesen, gefolgt von einem Lektorat. Inhalt, Struktur, Grammatik und die allgemeine Lesbarkeit des Textes werden verbessert. Parallel dazu sollten Testleser eingebunden werden. Manche Autoren fragen dazu andere Autoren. Ich bevorzuge Feedback von ganz normalen Lesern. Professionelles Feedback erhalte ich durch das Lektorat. Wie viel von diesen Rückmeldungen und Eindrücken du letztlich annehmen willst, bleibt allein dir überlassen. Dein Name steht als Autor über der Geschichte. Also ist es allein deine Verantwortung.
Wie viele Überarbeitungen nötig sind, hängt von vielen Faktoren ab. Es gibt Autoren, die schreiben ihre Manuskripte fünfzig Mal um. Andere geben ihren Text ohne Korrekturen an den Verlag und es werden trotzdem Bestseller. Es gibt hier also keinen allgemeingültigen Weg. Ich stelle meine Texte nicht vor der vierten oder fünften Überarbeitung vor. Bis sie marktreif sind können weitere fünf bis zehn Überarbeitungen dazukommen. Allerdings darf der Text auch nicht „zu Tode verbessert“ werden. Manche Schwächen müssen einfach akzeptiert werden. Manchmal sind es gerade diese „Schwächen“, die einen Text einzigartig machen.
Um den Text letztlich zu veröffentlichen gibt es zwei Wege. Du kannst ihn einem Verlag anbieten, entweder direkt oder über den Umweg einer Literaturagentur oder du wirst Selfpublisher. Beide Wege haben Vor- und Nachteile. So oder so kommen Eigenwerbung, Interviews, Lesungen usw. on Top dazu. Ob du nun willst oder nicht, aber Social Media wird dein ständiger Begleiter sein. Hier solltest du dich auf ein oder zwei Kanäle konzentrieren, die für deine Bedürfnisse am besten geeignet sind. Ich habe mich für Instagram und Youtube entschieden. Du benötigst eine klare Strategie und solltest entsprechend Zeit für Social Media einplanen. Das alles ist nicht Bestandteil des eigentlichen Schreibprozesses, gehört aber heute zum Leben als Autor dazu. Je früher du dich daran gewöhnst, desto besser.
2.1 Eine Idee finden
Alles, was du brauchst, ist eine Idee. Klingt logisch. Aber was ist eine Idee? Einfach ausgedrückt ist es Anfang und Ende von allem. Anfang, weil du ohne eine Idee niemals beginnen wirst und Ende, weil eine „schlechte“ Idee zu nichts führt. Die Idee ist es, die dich dazu bringt, überhaupt etwas zu schreiben.
Es nützt nichts, ausschließlich Techniken zu erlernen oder bestimmte Werkzeuge zu nutzen. Bevor du anfängst, brauchst du eine Vorstellung davon, was du erschaffen willst. Ein Bildhauer hat die Statue im Kopf, bevor er sie aus dem Stein herausmeißelt. Ein Tischler hat eine Vorstellung von einem Stuhl und beginnt erst dann, ihn zu bauen. Als Autor ist es genauso. Du hast eine Idee von der Geschichte, die du erzählen willst.
Wie kommst du an eine Idee? Es gibt eine bewusste und eine unbewusste Methode. Die bewusste Methode ist einfach. Du suchst in Zeitschriften, Blogs oder den Nachrichten nach Meldungen, die dich inspirieren. Ob all das tatsächlich den Tatsachen entspricht, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass es dich dazu bringt, eine Geschichte erzählen zu wollen.
Aus der Schlagzeile „Feuerwehrmann rettet Kind aus brennendem Haus“ lässt sich alles mögliche machen. Es kann ein Sozialdrama sein, eine romantische Liebesgeschichte, ein Thriller, sogar Fantasy, denn wer sagt denn, dass der Feuerwehrmann ein normaler Mensch sein muss? Es könnte auch ein Vampir sein, ein Ork oder ein Zauberer. Außerdem verändert sich die Geschichte je nachdem, an welcher Stelle das „... rettet Kind aus brennendem Haus“ kommt. Ist es der Aufhänger, also der Anfang deiner Geschichte? Dann will man wissen, was danach passiert. Oder ist es der Höhepunkt? In diesem Fall wird deine Geschichte auf genau diesen Showdown hinarbeiten. Der Leser will dann unbedingt wissen, ob das Kind aus den Flammen gerettet wird oder nicht.
Die bewusste Methode eignet sich besonders für Projektvorschläge, die sich an Literaturagenturen und große Publikumsverlage wenden. Hier schaust du einfach, welche Bücher gerade die Bestsellerlisten anführen, veränderst die Grundidee ein wenig (um eventuellen Plagiatsvorwürfen zu entgehen) und machst daraus „deine“ Idee. Beispielsweise könntest du aus einem historischen Roman, der sich um eine mobile Prostituierte dreht, einfach eine Geschichte basteln, die im 18. Jahrhundert spielt und eine sesshafte Prostituierte als Hauptfigur hat. Du änderst die Namen, stellst ein paar Handlungselemente um und schon hast du einen potentiellen Bestseller in Händen. Aber Vorsicht! Sollte jemand deinen Vorschlag gut finden, musst du das Buch auch schreiben.