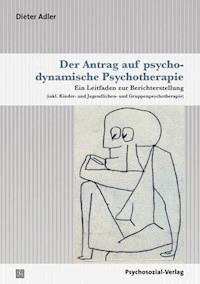47,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unentdeckte Schätze der psychotherapeutischen Praxis Einzigartig als "Lehrbuch": Lebendige Praxis statt graue Theorie Nehmen Sie die Abkürzung: Wie man seine psychotherapeutische Identität schneller findet Das Buch, besonders geeignet für angehende Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, steckt voller Erfahrungen. Adler, langjähriger Psychoanalytiker, Lehrtherapeut und Supervisor, befasst sich mit Fragen, die Sie in der Ausbildung und im Therapiealltag wirklich beschäftigen. Fragen nach dem Umgang mit bestimmten (Ausnahme-)Situationen sind die am häufigsten gestellten. Erfahren Sie zum Beispiel, wie man sich mit Hochgeschwindigkeit entschleunigt, die Zweimeinungsmethode anwendet oder mit Halbwahrheiten in der Therapie umgeht. Entdecken Sie auch, wie ein gesundes Maß an Egoismus im therapeutischen Kontext hilfreich sein kann. Es gibt mehr als das, was Therapeutinnen und Therapeuten in ihrer Ausbildung lernen. Das Buch schließt eine Lücke, die herkömmliche theorielastige Lehrbücher offen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Dieter Adler
The Missing Manual
Das Handbuch der besonderen, aber weniger bekannten psychotherapeutischen Interventionen
Schattauer
Die digitalen Zusatzmaterialien haben wir zum Download auf www.klett-cotta.de
bereitgestellt. Geben Sie im Suchfeld auf unserer Homepage den folgenden Such-Code ein: OM40181
Impressum
Dieter Adler
Heckenweg 22
53229 Bonn
Besonderer Hinweis
Die Medizin unterliegt einem fortwährenden Entwicklungsprozess, sodass alle Angaben, insbesondere zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren, immer nur dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung des Buches entsprechen können. Hinsichtlich der angegebenen Empfehlungen zur Therapie und der Auswahl sowie Dosierung von Medikamenten wurde die größtmögliche Sorgfalt beachtet. Gleichwohl werden die Benutzer aufgefordert, die Beipackzettel und Fachinformationen der Hersteller zur Kontrolle heranzuziehen und im Zweifelsfall einen Spezialisten zu konsultieren. Fragliche Unstimmigkeiten sollten bitte im allgemeinen Interesse dem Verlag mitgeteilt werden. Der Benutzer selbst bleibt verantwortlich für jede diagnostische oder therapeutische Applikation, Medikation und Dosierung.
In diesem Buch sind eingetragene Warenzeichen (geschützte Warennamen) nicht besonders kenntlich gemacht. Es kann also aus dem Fehlen eines entsprechenden Hinweises nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Schattauer
www.schattauer.de
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltungskonzept: Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg
Cover: Jutta Herden, Stuttgart
unter Verwendung einer Abbildung von © iStock/Bluberries
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
Lektorat: Karla Seedorf
Projektmanagement: Dr. Nadja Urbani
ISBN 978-3-608-40181-3
E-Book ISBN 978-3-608-12280-0
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20668-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Danksagung
Genderhinweis
Teil 1
Auswahl geeigneter Patienten und Therapieverfahren
1 Vorbemerkungen: Gibt es Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Schulen? Was »vereint« alle Psychotherapien?
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Über-Ich, Es, Umwelt, Beziehung, Verstärkung, System und Entwicklung
3 Ursachen psychischer Erkrankungen
3.1 »Brennpunkte« der Konflikte
4 Psychotherapeutische Wirkfaktoren
4.1 Allgemeine Wirkfaktoren
4.2 Weitere Wirkmechanismen »aus der eigenen Werkstatt«
4.3 Die authentische Beziehung als Grundvoraussetzung – und wesentlicher Heilfaktor
4.4 Über Objektfunktionen
4.5 Folgen der korrigierenden emotionalen (Bindungs-)Erfahrung
4.5.1 Wie viel von sich zeigen?
4.6 Rahmenbedingungen
4.6.1 Die Bedeutung von Rahmenbedingungen in der Psychotherapie
4.6.2 Welche Rahmenbedingungen sind wichtig und hilfreich?
4.7 Weitere Rahmenvereinbarungen der Behandlung
4.7.1 Schweigepflicht
4.8 Wer trägt die Verantwortung für den Erfolg oder Misserfolg einer Therapie?
4.9 Entwicklungsaufgaben in der Psychotherapie
4.10 Wer Hunger hat, braucht eine Angel
4.11 Einige Anmerkungen zur Frustrationstoleranz
4.12 Patienten finden und auswählen
4.12.1 Kriterien bei der Auswahl der Patienten
4.13 Der »Abwehrauftrag« des Patienten
4.13.1 Die Rolle der Partner in der Psychotherapie
4.13.2 »Berühmte Patienten«
4.13.3 Zu viele Therapien
4.14 Zur Unterscheidung zwischen Krise, Depression und Leid
4.15 Wenn andere einen Termin ausmachen
4.16 Werden Sie einer von uns: Wie man als Therapeut zum Komplizen des kranken, vermeidenden Systems werden kann
4.16.1 Exkurs: Wie Sie als Patient ganz schnell und zielsicher einen Therapieplatz bekommen
4.17 »Wegschicken« – Darf man das? Man muss!
4.17.1 »Wegschicken« zu Beginn
4.18 Ohne Identifizierung läuft nichts
4.19 Das Gutmenschenherz und das angeborene schlechte Gewissen von Therapeuten
4.19.1 Exkurs: Blind Date mit einem Unbekannten
4.20 Die Wut des »Abgewiesenen«
4.21 Die Rache des Patienten – Anzeige bei der Kammer, Kasse oder der KV
4.22 Wann darf man Patienten wegschicken und wie macht man das?
4.23 Weitere gute Gründe, einen Patienten nicht anzunehmen
4.24 Ich überlege es mir – und Sie es sich auch!
4.25 Mit dem Latein am Ende – Patienten »wegschicken«, wenn die Therapie nicht fruchtet
4.26 »Ich bringe jeden Therapeuten zu Fall«: Der »Koryphäenkiller«
5 Auswahl des Verfahrens
5.1 Einzel- oder Gruppentherapie?
5.1.1 Die Gruppe: Stiefmütterliches Angebot oder wirkungsvolle Methode?
5.1.2 Die Facettenvielfalt der Gruppe
5.2 Auswahl des Therapieverfahrens
5.2.1 Psychodynamische Psychotherapien
5.2.2 Tiefenpsychologisch oder psychoanalytisch?
5.2.3 Verhaltenstherapie
5.2.4 Systemische Psychotherapie
5.2.5 Davanloos raffinierter Kniff
6 Therapieplanung
6.1 Besprechen der Vorbedingungen
6.2 Therapiebedingungen, die nicht im »Lehrbuch« stehen
6.3 Schriftlicher Vertrag – ja oder nein? Einige Überlegungen
6.4 Die Vergabe von Terminen
6.5 Mitbestimmungsrecht: Wer bestimmt über wen?
6.6 »Rechte« des Patienten?
6.7 Zwangspause: Der Urlaub des Therapeuten
6.8 Stunden vorbereiten?
6.9 Besondere Behandlungstechniken
6.9.1 Therapie mit Transsexuellen
6.10 Stunden- beziehungsweise Verlaufsprotokolle
6.10.1 Inhalt und Länge der Protokolle
6.10.2 Zum Zeitpunkt des Protokollschreibens
Teil 2
Theoretische und praktische Überlegungen
7 Übertragungsbasierte versus interaktionelle Therapie
7.1 Versorgungsorientierte Psychotherapie
7.2 Entwicklungsfördernde Therapien
7.3 Erwartungen des Patienten
7.4 Wirkmechanismen der Psychoanalyse
7.4.1 Schweigen in der Psychoanalyse
7.4.2 Der Unterschied: niederfrequent – hochfrequent
7.4.3 Psychoanalytische Wirkfaktoren der Therapie
7.4.4 Über den Sinn der Couch
8 Wirkfaktoren der Behandlung
8.1 Therapieziele nach Yalom
8.2 »Alles ist nur schlecht« – Warum defizitorientiertes Arbeiten nicht hilft
8.3 Wozu Traumen gut sein können: Konfrontation und posttraumatisches Wachstum
8.4 Über den Therapieverlauf psychodynamischer Psychotherapien
8.5 Therapie versus Persönlichkeitsentwicklung
8.6 »Gedeut« oder gedeutet – habe ich den Patienten manipuliert?
9 Therapeutische Herausforderungen
9.1 Die Aufgaben des Therapeuten
9.2 Das Unbewusste versteht nur einfache Worte
9.3 Keine Angst vor Aggression
9.4 Wie viel Aktivität darf ein Therapeut zeigen – wie viel muss er zeigen – wann wird es übergriffig oder grenzverletzend?
9.4.1 Der Patient kommt nicht
9.4.2 Helm ab zum Gebet – Patient kommt ohne Fahrradhelm
9.4.3 Streit in der Gruppe
9.4.4 Das Messer und der Fahrradreifen
9.5 Die Leichen im Keller des Therapeuten – Fehler machen andere, ich doch nicht!
9.5.1 Hurra, der Patient hat abgesagt!
9.5.2 Termin verschwitzt – oder doppelt belegt
9.6 Wie nah darf ich Ihnen kommen? – Nähe und Distanz in der Behandlung
9.6.1 Dann am besten gleich per du?
9.7 Dialektisches Arbeiten
9.8 Therapieaufgaben – Neurotische Frustrierung infantiler Einstellungen und Muster
9.9 Der Therapeut als Spiegel- und Hilfs-Ich
9.10 Missbrauch des Therapeuten
9.11 Über den Unsinn von Diagnosen
10 Interventionstechniken
10.1 Die zwei Ebenen im psychotherapeutischen Prozess
10.2 Konfrontation, Ich-Fokussierung und Aktivierung der Ich-Spaltung und der Aktivität beim Patienten
11 Die vier Systeme der menschlichen Psyche
11.1 Unterscheidung zwischen neurotischem und infantilem System
11.2 Das psychische System im Therapiesetting
11.3 Das Mobilisieren der reifen und nicht-neurotischen Ich-Anteile
11.4 Die therapeutische Allianz
11.5 Man ist in der Therapie nie allein
11.6 Therapie als »Labor des Lebens«
11.7 Neurotische Abwehr des Patienten innerhalb der Therapie und innerhalb der Sitzungen
11.8 Verlauf der Behandlung
11.9 Sekundäre Angst – Sekundäre Vermeidung
11.10 Unangenehme Aufgaben in der Therapie
12 Zwei Bereiche des Lebens, die alles entscheiden
13 Abwehrtypen
13.1 Widerstreitende Elemente in der Persönlichkeit
13.2 Das Unvermeidliche oder Unerreichbare als Teil des Schicksals hinnehmen
13.3 Exkurs: Was ist der Unterschied zwischen einem Zyniker und einem Kyniker?
14 »Therapeutische Kniffe«
14.1 Eklektizismus in der Psychotherapie
14.2 Klartext: Das Unbewusste versteht nur einfache und klare Worte
14.3 Direktive Elemente in der Psychotherapie
14.4 Verschiedene therapeutische Techniken
14.5 Lachen in der Therapie – Abwehr oder hilfreiche Kraft?
14.6 Drei Techniken, um den therapeutischen Prozess in Gang zu halten oder »voranzutreiben«
14.6.1 Benennen des nächsten Therapieschrittes oder Fokus
14.6.2 Process Check nach Yalom
14.6.3 »Let’s try a risk« nach Yalom
14.7 Eine weitere »selbstwertfreundliche« Deutungstechnik
15 Weitere therapeutische Techniken
15.1 Identifizierende Deutungen
15.2 Diverse Techniken
15.2.1 Die Ohnmachtstechnik
15.2.2 »Sie müssen nichts verändern«
15.2.3 »Ich möchte Sie genau verstehen«
15.2.4 »Helfen Sie mir!«
15.2.5 »Was wäre, wenn …?«
15.2.6 »Schachmatt«
15.2.7 »Ich glaube Ihnen, dass Sie die Wahrheit sagen; aber nicht die ganze Wahrheit …«
15.2.8 »Wie hoch ist der Preis?«
15.2.9 Die Zwei-Meinungs-Methode
15.2.10 Schneller, höher, weiter – oder: Wie man sich mit Hochgeschwindigkeit entschleunigen kann
15.2.11 Die Stellvertretertechnik
15.2.12 Die Spekulationsmethode
15.2.13 Die 42-Methode
16 Ungewöhnliche Interventionen
16.1 Selbstwirksamkeitserfahrungen einfordern
16.2 Suchen Sie sich Arbeit, auch wenn es keine gibt
16.3 Glück oder Zufriedenheit – Warum Glück nicht zufrieden macht
16.4 Das Glück in Buthan – wie geht das an?
16.5 Die »Eine-Million-Euro-Lottogewinn-Frage«
Teil 3
Schwierige Situationen
17 Schwierigkeiten in der Therapie
17.1 Vorsicht, Externalisierungsfalle
17.2 Psychodynamische Anmerkungen zum Ausfallhonorar
17.2.1 Ausfallhonorar und Infantilität
17.2.2 Weitere Techniken zum Ausfallhonorar
17.3 Über persönliche Begegnungen und die Angst des Therapeuten davor
17.4 Die Angst des Therapeuten vor Nähe
17.5 Verspätungen
17.6 Umgang mit »negativen Verspätungen« = »Verfrühungen«
17.7 Aggression in der Therapie
17.8 »Lieben und Hassen« – auch in der Praxis?
17.9 Positionierungsverweigerung
17.10 »Das tut der Sache keinen Abbruch« – Warum Therapieabbrüche kein Beinbruch sind und trotzdem ernst genommen werden müssen
17.11 Beziehung aufrechterhalten
17.12 Anmerkungen zur Vier-Wochen-Kündigungsfrist
17.13 Das Ende naht – Gedanken zum Ende einer Psychotherapie
17.14 Zur Psychodynamik des Endes der Behandlung sowie zur Psychodynamik der Verleugnung
17.15 Über die Schwierigkeiten mit Borderline-Patienten
17.16 Übernahme des Leidens oder des Leidensdrucks
17.17 Alte Liebe rostet nicht – Patienten, die wiederkommen
18 Die Angst geht um oder: Was eine Pandemie mit Patienten und Behandlern macht
18.1 Video oder Telefon?
18.2 Exkurs: Unbewusste Kommunikation
18.3 Belastung der Psychotherapeuten
18.4 Videotherapie
18.5 Richtig verbunden und gute Übertragung: Telefontherapie
18.6 Zoom-Müdigkeit als neue Zeitkrankheit
19 Weitere schwierige Situationen
19.1 Geschenke
19.1.1 Geschenke als Anerkennung
19.1.2 Geschenke als »Geiselnahme« oder Strafe
19.1.3 Geschenke als »Bestechung«
19.1.4 »Unsichtbare Geschenke«: Geschenke in Form von Vergünstigungen
19.1.5 Tit for tat – Therapie für Kompensationsgeschäfte
19.2 Zur Unterscheidung zwischen gesunder und destruktiver Aggression
20 Ausnahmesituationen in der Therapie
20.1 Der Dritte im Bund: Wenn der Partner mit in die Therapie kommen möchte
20.1.1 Die Stunde ist um – aber nicht für mich. Wenn Patienten nicht gehen wollen
20.2 Zwischen Tür und Angel kommt es häufig zum Gerangel: »Was ich noch sagen wollte …«
20.3 Wenn »Fremde« anrufen
20.4 Übertragungsfallen
20.5 Einladungen
20.6 Sexuelle Angebote
20.7 »Sie müssen dieses Buch unbedingt lesen!« oder: Wie man Therapiestunden »verlängern« kann
20.8 Private Fragen
20.9 »Acting in« und Fehlleistungen
20.10 »Ich würde Sie gerne auch einmal therapieren!«
20.11 »Sagen Sie mir, was zu tun ist!«
20.12 Kulturelle Konflikte – auf zwei Ebenen betrachtet
20.13 Warum Trauma-Opfer so »gerne« umziehen – Vom Umgang mit Scham
21 Das Beenden von Stunden
21.1 Wenn es schwerfällt, ein Ende zu finden
21.2 »Ich hau ab!« – Der Patient beendet die Stunde früher
21.3 Die Fluchtbereitschaft des Borderline-Patienten
21.4 Flucht aus Konfliktvermeidung
21.5 »Es ist alles gesagt«
22 Besondere Fragen
22.1 Protokolle einsehen
22.2 Antragsbericht einsehen
22.3 Akteneinsicht
22.4 »Mobil bleiben« – Sollen wir unsere Mobilfunknummer nennen?
22.5 Ich bin Ausbildungskandidat. Soll ich die Wahrheit sagen?
22.6 Wenn der Therapeut länger krank ist
22.7 Reagieren oder (szenisch) verstehen?
23 Wenn die Therapie ins Stocken gerät
23.1 »Realität schlägt Therapie – immer!«
23.2 Was von Therapeuten oft vergessen wird
23.2.1 Zur Unterscheidung der Ursachen für adaptives Verhalten oder Erleben
23.2.2 »Infantizismus« als neue Kategorie in der Persönlichkeitspsychologie
23.2.3 Sekundäre Angst und Aufgabe des Therapeuten – Was Prometheus und Epimetheus für den therapeutischen Prozess bedeuten
23.3 Weitere Anmerkungen zum Wiederholungszwang
24 Gefürchtete therapeutische Situationen
24.1 Der Patient hat sich verliebt
24.2 Sexuelle Verführungen in der Psychotherapie
24.3 Spannung und Sexualität als Abwehr
24.4 Der schweigende Patient
24.5 Längere Phasen des Schweigens
24.6 Akute Krisensituationen
24.7 Suizidale Krisen
24.8 Suizidankündigung am Ende der Sitzung
24.9 Suiziddrohung außerhalb der regulären Sitzungen
24.10 Der Bilanzselbstmord
24.11 Techniken, einen Patienten vom Suizid abzubringen
25 Guten Tag, Herr Fußabstreifer: Wenn Patienten schlecht mit einem umgehen
25.1 Brüllende Patienten
25.2 Übergriffe von Patienten: Was ist erlaubt, was nicht?
25.3 Gewalttätige Patienten
25.4 »Den bring ich um«: Der Patient droht anderen Gewalt an
25.5 »Schlagende« Argumente: Wenn Patienten handgreiflich werden
25.6 Fehler und Kurskorrekturen
25.7 Therapeutische »Fehler«
25.8 Gegenübertragungsunfälle
25.9 Verfahrene Situationen retten
25.9.1 Vorbeugen gegen Einschlafen
25.9.2 »Da hab ich durch die Finger geschaut« – Dürfen wir gefällte Entscheidungen rückgängig machen?
26 Verwaltungsarbeit
27 Therapeutisches Selbstverständnis
27.1 Von Psychologie und Pädagogik hat jeder Ahnung – warum unser Beruf so belächelt wird
27.2 Gibt es einen Unterschied zwischen ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten?
27.3 Missverständnisse – Verstehen heißt nicht billigen
27.4 Die Täter-Opfer-Falle
27.5 »Negative« Empathie
27.6 Die Paradigmenwechseltechnik
27.7 Die Aggression der Therapeuten
27.8 »Meine Eltern sind an allem schuld« – Warum »Elternbashing« nicht weiterhilft
27.9 Wie hilfreich ist die Schuldfrage?
27.9.1 Der Egoismus der Therapeuten
28 Neue technische Überlegungen
28.1 Abwehrmechanismen
28.2 Vermischung
29 Ethische Fragen
29.1 Dürfen wir ohnmächtig sein?
29.2 Alles verstehen? Wann dürfen wir etwas sagen?
30 Der Schutz des Therapeuten
30.1 Was ist das Wichtigste in der Psychotherapie?
30.2 Die Belastung durch therapeutische Arbeit
30.3 Verrechnet! Psychohygiene: Werden Sie Mathematiker!
31 Erfolg, Misserfolg und Beendigung der Therapie
31.1 »Misslungene« Therapien
31.2 Scheitern in der Therapie – Gibt es das überhaupt?
31.3 Das »Recht« auf Neurose
32 Anmerkungen zu Lebensqualität und psychischer Gesundheit
32.1 Unangepasstheit und Normopathie
32.2 Normopathie: Wenn Überangepasstheit krank macht
32.3 Behandlungstechnische Schwierigkeiten bei Normopathie
32.4 Die Normopathie der Therapeuten – warum Therapeuten keine »Normopeuten« sein sollten
32.5 Rahmenbedingungen für ein zufriedenes Leben
32.6 Werte
32.7 Was ist Erfolg?
32.8 Die Spaltung in zwei Welten
32.9 Exkurs: Was bedeutet eigentlich »Freiheit«?
32.9.1 Fundamentale strukturelle Bedingungen der menschlichen Psyche als Grundvoraussetzungen für Zufriedenheit
32.9.2 Was ist psychische Gesundheit?
32.9.3 Exkurs: Die Geschichte von Goldmarie und Pechmarie
32.9.4 Exkurs: Die »wahre« Geschichte von Ikarus und Dädalus
Literatur
Für Eike, Leah und Fiete, ein weiterer Missing Link in meinem Leben
Vorwort
Dieses Buch ist kein »Lehrbuch« oder Handbuch im eigentlichen Sinn. Kein Buch, das auf wissenschaftlichen Untersuchungen fußt. Auch keins, das verschiedene Möglichkeiten aufzeigt und diskutiert. Dieses Buch fußt auf über 30 Jahren Berufserfahrung als Psychotherapeut. Auf Beobachtungen, Interventionen, die anderen geholfen haben, auf Überlegungen, Philosophien, die ich mir zunutze gemacht habe. Dieses Buch soll Ihnen helfen, Sie in Ihrer Arbeit unterstützen, Sie zum Denken anregen. Und Ihnen in Ihrer therapeutischen Entwicklung oder bei der Bildung Ihrer therapeutischen Identität helfen.
Um dies zu erreichen, werde ich mich vielen Problemfeldern der Psychotherapie sowie deren Erklärungs- und Lösungsansätzen essayistisch nähern. Es ist also eher ein Lesebuch.
Das Buch ist sowohl für Anfänger, also Ausbildungskandidaten – zum Lernen – geeignet als auch für »alte Hasen«, die in manchen Bereichen gerne noch etwas dazulernen möchten.
Außerdem erhebt das Buch keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Ausschließlichkeit. Es soll vielmehr zum Nachdenken anregen.
Es richtet sich nicht ausschließlich an Psychotherapeuten, die interaktionsorientiert oder psychodynamisch arbeiten. Auch für Verhaltenstherapeuten oder »Systemiker« soll es eine Fundgrube sein, die Ideen und Ansätze zur täglichen Arbeit liefert. Die Ansätze und Ideen sind nicht in Stein gemeißelt – ich freue mich über Anregungen von Kolleginnen und Kollegen.
Das vorliegende Buch enthält viele Gedanken und Erfahrungen, die ich in mehrjähriger Arbeit erworben habe. Es entstand aus jahrelanger Tätigkeit als Dozent, Lehrtherapeut und Supervisor an Ausbildungsinstituten für psychodynamische Psychotherapeuten. Es beinhaltet meinen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz, den ich in meiner Praxis gewonnen habe. Ich halte das Buch bewusst praxisorientiert und behandle Fragen, die Ausbildungskandidaten sich stellen. Sie wollen weniger theoretische Konstrukte, die sie auch leicht in Büchern nachlesen können, vermittelt bekommen, als vielmehr praktische Hilfen für den Arbeitsalltag eines Psychotherapeuten: Fragen nach dem Umgang mit bestimmten Situationen sind mit die häufigsten, die sowohl in den Ausbildungsseminaren als auch von Kandidaten in den Supervisionen gestellt werden.
Irgendwann forderten mich Kandidaten auf, meine Erfahrungen doch einmal in einem Buch niederzuschreiben. Das habe ich hiermit getan. Das Buch soll eine Lücke schließen, die herkömmliche Lehrbücher, die sich vorwiegend an der Theorie orientieren und diese erklären, bisher nicht gefüllt haben. Es erhebt wie gesagt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird sicherlich bei weiteren Auflagen ergänzt werden. Großen Wert habe ich auf das Finden der psychotherapeutischen Identität gelegt. Dies ist mir auch in den Ausbildungsseminaren besonders wichtig: Kandidaten sollen ihren Standpunkt, ihre »Position« als Psychotherapeut finden. Sie sollen sich nicht verstellen müssen oder bestimmten Handlungsanweisungen folgen, sondern es geht darum, eine innere Haltung zu gewinnen, die üblicherweise erst im Laufe von vielen Berufsjahren entsteht.
Das Buch wurde aufgrund der neuesten Entwicklung um wichtige Kapitel zum Umgang mit der Coronapandemie und mit der Transgender-Thematik erweitert.
Danksagung
Zunächst möchte ich gerne einigen Menschen danken:
Meinen Patienten, die ich nicht namentlich nennen darf und will.
Meinen Lehrern: Roswitha Georgii, Tilo Grüttner, Hermann-Josef Fisseni, Rudolf Bensch, Eva Poluda-Korte, Werner Dinkelbach, Irvin Yalom sowie einem weiteren Supervisor, der nicht namentlich genannt werden möchte.
Besonderer Dank gilt Frau Christine Schneider für das fachliche Vorablektorat und viele entscheidende Hinweise, die sie mir gegeben hat.
Dank auch an Frau Michaela Kranzl und Frau Stefanie Wagner-Tilch für das geduldige Abschreiben vieler Texte.
Ein besonderer Dank gebührt Freunden, die mir sehr geholfen haben: Sudhir Kakar, der mich ermutigt hat, bei der Stange zu bleiben; Marion Griffiths-Karger und Achim Karger, die mir geduldig in der Abgeschiedenheit ihres Hauses die Abschlussarbeiten ermöglicht haben. Danke auch an Marion Langer für die Unterstützung bei der Endkorrektur und Druckvorbereitung.
Einen ganz besonderen Dank möchte ich dem Kollegen Bernd Kuck für die konstruktive Kritik und die Durchsicht des Manuskriptes aussprechen.
Und meiner Tochter Leah, die für dieses Buch viel Geduld mit mir haben und auf einiges verzichten musste.
Genderhinweis
Wenn ich im Folgenden die männliche Form verwende, so tue ich dies zur Vereinfachung beim Lesen. Gemeint sind immer alle Geschlechter.
Teil 1
Auswahl geeigneter Patienten und Therapieverfahren
»Wer liebt, was er tut, wird nie wieder arbeiten müssen.«
Konfuzius
1 Vorbemerkungen: Gibt es Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Schulen? Was »vereint« alle Psychotherapien?
Während meines Psychologiestudiums gab es noch heftige Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern der Psychoanalyse und denen, die eher von der Verhaltenstherapie überzeugt waren. Diese Auseinandersetzungen fand ich persönlich hilfreich, wenn sie sachlich geführt wurden. Sie trugen zu meiner Identitätsbildung als Psychotherapeut bei. Im Laufe meines Berufslebens hat sich diese Identität stets weiterentwickelt, also verändert. Nach und neben meinen psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Ausbildungen habe ich diverse Zusatzausbildungen beziehungsweise -qualifikationen erworben, z. B. in systemischer Familientherapie, in katathym imaginativer Psychotherapie oder in intensiver psychodynamischer Kurzzeittherapie nach Davanloo, um nur einige zu nennen. Verhaltenstherapeutisch war ich an der Uni »geschult« worden.
Ich habe quasi einen Einblick in die wichtigsten Richtungen und ihre »Denkweise« bekommen. Heute weiß ich, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Therapierichtungen nicht so groß sind, wie es mir einmal vorkam. Zentraler Bestandteil, Fundament sozusagen, ist in allen Therapien die Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Und zentraler Wirkfaktor ist die Interaktion zwischen beiden. Wenn diese beiden Grundvoraussetzungen stimmen, ist es in meinen Augen sekundär, welche Therapiemethode man anwendet. Selbstverständlich meine ich damit vor allem die anerkannten, also weniger die esoterischen Methoden, wobei meine Überzeugung letztes Jahr schwer erschüttert wurde. Eine sehr geschätzte Kollegin, Professorin für Psychologie, hat von einem Tag auf den anderen das Rauchen, ein Laster vieler Psychotherapeuten, die damit die Spannung zwischen den Stunden abbauen wollen, aufgegeben. Ich wollte wissen, wie sie das geschafft hat und war völlig baff, als sie mir sagte: »Mit Hypnose.«
Eine Sitzung habe sie gemacht plus eine Sitzung Akupunktur und seither raucht sie nicht mehr. Eigentlich schien sie gegen alle nicht schulmäßigen Methoden und Ideen immun. Aber es hat gewirkt. Gut, dachte ich mir, das probiere ich auch. Und tatsächlich, obwohl ich den Kollegen von meiner Skepsis vor der Sitzung informiert hatte – ich habe auch aufgehört. Seit der Akupunktur verspüre ich keinen Drang mehr nach einer Zigarette. Eine andere hochgeschätzte Kollegin, die methodenübergreifend arbeitet, sagte einmal zu mir: »Es ist wichtig, dass die seelischen Selbstheilungskräfte beim Patienten aktiviert werden. Es ist egal, wie sie aktiviert werden, Hauptsache, sie werden aktiviert.«
Mir war schon früh klar geworden, dass es auch unser Glaube an den Erfolg des Patienten ist, der ihm die Zuversicht verleiht, die er braucht, um den nicht leichten Weg gehen zu können. Denn ohne diese Kraft, die ihm dieser Glaube verleiht, wird er vorzeitig aufgeben.
Auch meine Erfahrung mit Irvin Yalom hat mich sehr geprägt, weshalb ich heute davon ausgehe, dass wir »interaktionell« arbeiten – egal, mit welcher Methode wir die Probleme des Patienten angehen.1
Und angesichts der Schwierigkeiten, die in der Psychotherapie (immer) auftreten, ist es letztlich auch egal, mit welcher Methode ein Therapeut arbeitet. Insofern ist dieses Buch an alle Therapeuten gerichtet, die in Interaktion mit Patienten treten.
2 Begriffsdefinitionen
Versuchen wir nun, das Verbindende der unterschiedlichen Therapieschulen herauszuarbeiten. Wie gesagt, ich will keine Wertungen analytisch orientierter Verfahren, von Verhaltenstherapie beziehungsweise kognitiv emotional orientierten Verfahren, humanistischen Verfahren oder systemischer Psychotherapie vornehmen. Stimmt die Beziehung zwischen Patient und Psychotherapeut, ist das angewandte Verfahren sekundär. Das haben uns viele Untersuchungen immer wieder vor Augen geführt beziehungsweise bestätigt. Und es gibt auch längst keinen »Grabenkrieg« der einzelnen Schulen untereinander. Sie haben sich nicht nur einander angenähert, sondern verwenden auch die Erkenntnisse der anderen Therapieschulen und arbeiten sie in neue Konzepte, wie die Schematherapie, ein.
2.1 Über-Ich, Es, Umwelt, Beziehung, Verstärkung, System und Entwicklung
Dass das sogenannte »Ich« zentraler Faktor unserer Persönlichkeit und auch der »Zugriffspunkt« unserer therapeutischen Bemühungen ist, braucht wohl nicht extra erwähnt zu werden. Dass dieses Ich im Widerstreit zwischen drei anderen Instanzen ist, dürfte auch schulübergreifender Konsens sein. Das Über-Ich, das auch als Gewissen bezeichnet werden kann, bedarf meiner Ansicht nach noch in einer Unterteilung zwischen einem nicht integrierten Über-Ich, das Normen und Werte von außen ungeprüft übernimmt beziehungsweise aus Angst vor negativen Folgen mit eigenen Regeln versieht. Andererseits würde ich noch eine Unterscheidung zu einem reiferen, integrierten Gewissen machen, das ich als Ich-Ideal bezeichnen möchte. Hierunter wollen wir die vom Menschen selbst entwickelten eigenen Wertvorstellungen verstehen. Diese müssen nicht immer mit den äußeren Gesetzen identisch sein – im Gegenteil: Die eigenen Normen und Werte können und müssen manchmal auch den Gesetzen widersprechen. Ein reifes Ich-Ideal sichert den Bestand und die Stabilität unserer Persönlichkeit. Vereinfacht ausgedrückt: Es sorgt dafür, dass wir morgens in den Spiegel schauen können.
Dass wir über ein »Es« verfügen, ist auch unbestritten. Dieses besteht im Wesentlichen aus unseren unbewussten Motiven – das Wort Triebe erscheint mir etwas antiquiert –, aber auch aus unreifen, infantilen, egoistischen Anteilen, die häufig zu Konflikten mit einer weiteren Instanz, der Umwelt, führen. Doch bevor ich auf dieses Thema zu sprechen komme, sollte einiges nicht vergessen werden. Zum einen haben wir ein Es, das auch stark biologischen Antrieben unterworfen ist, zum anderen verfügen wir über ein Lern-Reaktionssystem, das sich durch Lernprozesse entwickelt und verändert, die sich wiederum aus Verstärkung, Bestrafung und Belohnung und anderen Mechanismen ergeben. Kein noch so konservativ eingestellter Psychoanalytiker wird heute an den »aufrechterhaltenden Bedingungen« vorbeikommen, die er etwa im Wiederholungszwang oder im sekundären Krankheitsgewinn finden kann.
Da wir soziale Wesen sind und ohne Interaktion mit der Umwelt, das heißt, mit anderen Menschen, nicht existieren können, sind Beziehungen für uns das wichtigste Lebenselixier. Auch wenn Freud davon ausging, dass die Sexualität der stärkste Trieb ist und an zweiter Stelle die Ich-Triebe und die Aggression stehen, so lässt sich heute doch feststellen, dass dies biologisch bedingte Antriebe sind, die biologisch gesehen richtigerweise oberste Priorität haben. Psychologisch gesehen stehen jedoch die Beziehungs- und Bindungsbedürfnisse wohl unbestritten an erster Stelle. Kaum ein Paar tut sich zusammen, nur »weil es mit dem Sex so gut klappt«, sondern aufgrund der Beziehung, des Umgangs miteinander, der gemeinsamen Interessen, der Identifizierungen mit dem anderen usw. Wobei wir gleich auch die Themen der humanistischen Psychologie betrachtet haben und nahtlos dazu übergehen können, uns den Begriff »System« anzusehen.
Dass wir alle nicht nur aus singulären Systemen entstammen, sei es die eigene Familie, der frühe Freundeskreis, der Kindergarten, die Schule und so weiter oder seien es die Systeme, in denen wir heute stecken, steht wohl außer Frage. Und auch, dass diese Systeme zwar virtueller Natur sind, aber trotzdem einen großen Einfluss auf uns hatten und immer noch haben, sodass wir uns ihnen schwer oder gar nicht entziehen können, wobei der Einfluss auf uns oft so subtil ist, dass wir ihn gar nicht bemerken. Dennoch hat er enorme Wirkung auf uns Menschen. Veränderungen am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem, im Familiensystem und so weiter haben unmittelbare Auswirkungen auf das Individuum. Nicht immer sind diese negativ, es bleiben aber Beeinflussungen, denen wir uns nicht entziehen können. Kommen wir zum Schluss zur Entwicklungspsychologie des Menschen. Wenngleich sie ursprünglich von der Psychoanalyse betont wurde, so wird heute kaum ein Verhaltenstherapeut daran zweifeln, dass wir in verschiedenen Lebensphasen mit verschiedenen Entwicklungsaufgaben konfrontiert sind und daher auch unterschiedliche Verstärkungen wirksam sind. Denn im Laufe unserer Entwicklung verändern sich auch unsere Motive und Bedürfnisse.
Ich will damit nur darauf hinweisen, dass sowohl die psychodynamischen Ansätze und Betrachtungsweisen als auch die lerntheoretisch orientierte sowie die Psychotherapie, die systemischen Herangehensweisen ebenso wie die humanistische Psychotherapie letztlich im gleichen Wirkungskreis arbeiten und heute auch nicht mehr eine Schule die theoretischen Grundlagen der anderen ablehnt oder verleugnet. In diesem Sinne wünsche ich viel Freude beim Lesen und Nachdenken.
3 Ursachen psychischer Erkrankungen
Freud hat einmal gesagt, dass die Ursache aller Neurosen die Hemmung ist, der Verzicht auf etwas Begehrtes wegen eines inneren Konflikts. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass weitere Ursachen dazukommen: die Deprivation und das Trauma beziehungsweise traumatische Erfahrungen.
Was sind die Ursachen psychischen Leidens?
innere Konflikte, Hemmungen
traumatische, traumatisierende oder deprivierende Erfahrungen
Innere Konflikte dürften aus der allgemeinen Neurosenlehre bekannt sein. »Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust«, hat Goethe schon seinen Doktor Faust sagen lassen. Die Zerreißprobe zwischen dem Guten und dem Bösen war dem Faust schon bewusst, sodass er sie auch bewusst »bearbeiten« konnte. Wäre es ihm nicht bewusst gewesen, so wie es unseren Patienten oft nicht bewusst ist, wäre er neurotisch oder psychosomatisch erkrankt. So was will aber niemand auf der Bühne sehen – viele auch nicht in Kliniken oder Praxen.
Oft ist man sich über den Kernkonflikt schon bewusst, so wie hier im »Faust«, über die dahinterstehenden und sich widerstrebenden Konflikte, die sich in Hemmungen zeigen, jedoch nicht unbedingt. Unsere Aufgabe bei inneren Konflikten stelle ich im nächsten Kapitel dar.
Gegen traumatische Erfahrungen kann man sich meist nicht wehren oder sich darauf vorbereiten. Man sieht zu, wie jemand überfahren wird. Der Schock überlastet unser psychisches Verarbeitungssystem in dem Moment. Je nach Vulnerabilität, also Verletzbarkeit oder Resilienz, führt das Trauma in der Verarbeitung wieder zu normaler Gesundheit, also einer Gesundheit, wie sie vor dem Unglück bestanden hat. Oder zum Ausbruch einer psychischen Erkrankung beziehungsweise der Verschlechterung einer bereits existierenden psychischen Erkrankung.
Unter traumatisierenden Erfahrungen verstehe ich eine permanent wirksame oder regelmäßig auftretende Traumatisierung, die im Lauf der Zeit kumulativ wirken und seelische Erkrankungen auslösen kann, beispielsweise der permanente sexuelle, seelische oder narzisstische Missbrauch eines Kindes oder permanente Entwertungen, Demütigungen, Sadismen usw.
Ebenso wirken auch permanent oder häufige deprivierende Erfahrungen auf unsere seelische Entwicklung.
Darunter verstehen wir bewusste, »zielgerichtete« oder krankheitsimmanente Vernachlässigungen eines Kindes, insbesondere seelische Vernachlässigungen. Häufig sind diese Deprivationen mit traumatisierenden Demütigungen verbunden, was doppelt so schädigend wirken kann.
3.1 »Brennpunkte« der Konflikte
Die Brennpunkte der Konflikte sind eigentlich nur drei Bereiche, in denen Patienten über Schwierigkeiten klagen:
Partnerschaft/Familie
Beruf
Freundeskreis
Und das verwundert auch nicht. Die Bereiche Partnerschaft/Familie und Beruf sind zentral für unsere psychische Gesundheit und unser Wohlbefinden. Der Freundeskreis ist die »Erweiterung« der Familie, einzelne übernehmen auch wichtige Aufgaben für unser seelisches Gleichgewicht, wie der beste Freund, der uns spiegelt, uns unterstützt oder bremst, wenn es notwendig ist, oder uns ergänzt beziehungsweise unser Alter Ego ist.
4 Psychotherapeutische Wirkfaktoren
4.1 Allgemeine Wirkfaktoren
Auch wenn wir häufig die Erfahrung machen, dass Therapien nicht in dem von uns erwarteten Umfang Erfolg bringen, so können wir doch zwei Dinge erreichen und diese dem Patienten mit auf den Weg geben:
Zum einen lernt der Patient »sprechen«: Er erlernt es, seine Befindlichkeiten, Gefühle, Aversionen, seine Abwehr sowie seinen Ärger und sonstige entweder ihm unbekannte oder schwer aushaltbare Dinge zu erspüren, in Worte zu fassen, sie dem Anderen mitzuteilen und mit ihm zu besprechen. Dabei lernt der Patient insbesondere, sich selbst und ebenso den Anderen als jeweils abgetrennte Einheit zu sehen und dies auch gegebenenfalls auszuhalten. Er lernt, die Effekte bei sich zu identifizieren und sie als Effekte sowohl des eigenen Innenlebens als auch der Reaktion auf die Handlungen des Anderen oder der Reaktion auf den Anderen an sich zu erkennen. Modernerweise nennen wir diesen Vorgang schlechthin »mentalisieren«.
In diesem Zusammenhang lernt der Patient auch, in Beziehungen zu leben, sich anzunähern oder Nähe und Distanz zu regulieren. Er erfährt dabei, wie es ist, im Kontakt mit dem Anderen sich selbst zu spüren, ohne mit dem Anderen zu verschmelzen oder sich real trennen zu müssen, wenn trennende Effekte (Dissonanzen) auftauchen.
Diese zwei Effekte treten nach meiner Erfahrung in jeder Psychotherapie auf, wenn sie eine gewisse Dauer hatte. Sie sind unabhängig vom Ziel, das wir oder der Patient sich selbst zu Beginn der Therapie gesetzt haben. Dennoch haben sie insgesamt mehr Wucht als »messbare« Erfolge, weil der Patient fortan in der Lage ist, zwischen sich und dem Anderen zu differenzieren und gleichzeitig seine Wünsche, aber auch seinen Ärger, seine Aversionen und so weiter äußern zu können. Ein wichtiger Punkt ist hier, über den Ärger reden zu können, weshalb es so wichtig ist, die sogenannte »negative Übertragung« gründlich durchzuarbeiten. Ziel ist es, trennende Aspekte und besonders auch vernichtende Impulse und Affekte kanalisieren zu lernen und gleichzeitig in Worte zu fassen, ohne dass sie in ihrem tieferen Ärger oder in ihrer tieferen Enttäuschung verbessert werden, gleichzeitig aber auch den vernichtenden Aspekt zu vermeiden – sodass zwei Menschen sowohl körperlich als auch seelisch und in ihrer Beziehung unbeschadet aus einer Auseinandersetzung herausgehen.
Weitere Wirkfaktoren, die ich einmal mit einer Kollegin entwickelt habe, sind:
Wir nehmen den Patienten so, wie er ist. (Vielleicht sogar als Erste im Laufe seines Lebens.) Andere Menschen reagieren in unterschiedlicher Form auf seine Symptome: entweder ablehnend – oder sie unterstützen ihn in seiner Haltung.
Wir glauben an seine Entwicklungsmöglichkeiten und strahlen dies aus.
Wir zeigen, dass wir bereit sind, mit ihm den langen, beschwerlichen Weg zu gehen.
Ein Kollege hat einmal folgende Faktoren genannt, die im Idealfall nach einer Therapiesitzung auftreten sollten:
Der Patient fühlt sich nach der Stunde deutlich besser und entspannt.
Der Patient fühlt sich aufgeräumter, hat größere Klarheit.
Insgesamt glaube ich heute, nach vielen Jahren enthusiastischen Befürwortens der psychoanalytischen Technik des Aufdeckens und Durcharbeitens, dass die Arbeit in der Vergangenheit nicht direkt entscheidende Veränderungen bringt; wohl aber entscheidende Erkenntnisse, die wiederum zu Veränderungen führen können. Das bleibt unbestritten – sowohl für den Patienten als auch für den Psychoanalytiker: Ohne diese Arbeit hätten wir niemals so viel über die psychischen Mechanismen in unserem Inneren erfahren können. Ich denke aber, dass unsere Erfahrungsmöglichkeiten heute doch genügend und ausreichend sind. Nach meiner Erfahrung gibt es in jeder Therapie zwei Hauptphasen:
die Ursachensuche – meist in der Vergangenheit,
die Umsetzungsphase im Hier und Jetzt.
Während nahezu alle aufdeckenden Therapien die Ursprünge des fehlangepassten Verhaltens, Erlebens oder Verarbeitens in der ersten Phase entdecken, entlarven, enttarnen, erklären können, scheitert ein meiner Ansicht nach nicht unbeträchtlicher Teil der Therapien in der zweiten Phase. In der ersten werden die Mechanismen aufgedeckt; in der zweiten sollten sie aufgegeben und durch gesündere und realitätsnähere ersetzt werden. Früher wurde diese Phase als »Phase des Durcharbeitens« bezeichnet; allerdings zumeist in der Sichtweise, dass die neurotischen oder infantilen Mechanismen zu mächtig sind und sich nicht »kampflos ergeben« beziehungsweise eliminieren lassen.
Nach meiner Erfahrung ist es jedoch weniger die Macht der neurotischen oder infantilen Beharrlichkeit, die sich tief im Unbewussten gegen Veränderung wehrt beziehungsweise diese verweigert: Meist ist es die Angst des Patienten vor dem Neuen und Ungewissen. Deshalb ist mein Blick eher auf die Blockaden im Hier und Jetzt, also auf die Ängste in der jetzigen Zeit gerichtet – und auf die Vergangenheit nur da, wo sich keine Blockaden im Hier und Jetzt finden lassen oder wo diese mir zu schwach für eine derartige Reaktion erscheinen beziehungsweise wo ich andere, eben ältere Blockaden entdecken kann. Dennoch bleibt mein Blick auf das Hier und Jetzt geschärft. Die zentrale Frage, die ich zunächst mir und später dem Patienten stelle, ist: Wenn es Mechanismen aus der Vergangenheit sind, die damals notwendig waren oder gar das Überleben gesichert haben: Warum sind sie heute noch vorhanden?
Häufig beruhen diese Ängste nicht oder zumindest nicht ausschließlich auf mangelnder Erfahrung des Patienten mit gesunden Erfahrungen oder Umgebungen, sondern oft auch (zusätzlich) auf dem Fehlen von Eigenschaften und Fähigkeiten, die aufgrund der neurotischen Verzerrung nicht erlernt werden konnten oder durften. Hier freuen sich die Verhaltenstherapeuten, die damit ja nicht unrecht haben. Aus diesem Grund wende ich in Phase 2 oft Elemente aus der Verhaltenstherapie an, um den Patienten zu den angstbesetzten Erfahrungen zu ermutigen oder zu »verführen« beziehungsweise zu verleiten, mit der Zusicherung, dass er während der noch laufenden Therapie alle Misserfolge, alle Pein, Scham, Enttäuschung, Zurückweisung und Entmutigung mit mir besprechen kann.
Ein Beispiel: Ein unsicherer und gehemmter junger Mann hatte große Schuldgefühle sowohl seiner kranken Mutter als auch seinem Vater gegenüber, dem er viel zu verdanken hatte und den er dann mit dieser alleinlassen würde. Diese Konstellation machte nicht nur die Ablösung von diesen Mustern und die Positionierung den Eltern gegenüber extrem schwierig (zunächst sogar unmöglich), sondern verhinderte zudem, dass der junge Mann die altersentsprechenden Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht machen konnte. Seine tief sitzenden Befürchtungen, er könnte »zielsicher« eine Frau suchen, die wie die eigene Mutter »gestrickt« war, und damit in die unbewusste Falle tappen, die schon seinem Vater zum Verhängnis geworden war, waren ihm bewusst. Und sie waren ja auch nicht unrealistisch. – Übrigens wurden sie ihm bewusst ohne mein Zutun.
Ich intervenierte aber anders, als dies weiter »durchzuarbeiten«, weil ich eine andere Hemmung erahnte und zu sehen begann: Er hatte keinerlei Erfahrung damit, wie er Kontakt zu Frauen aufnehmen konnte. Und er wusste nicht, wie er mit Misserfolgen in diesem Lebensbereich – also mit »Körben« – umgehen konnte. Ich deutete ihm an, dass seine Angst vermutlich nicht unberechtigt ist, aber dass wir bisher noch gar nichts über seine (unbewussten) Präferenzen wissen, sodass wir hier im Dunkeln tappen. Ich gab ihm folgende Aufgabe, die er leicht erfüllen können würde, weil er mittlerweile (weit genug weg von der Mutter) studierte: Er sollte bis zur nächsten Stunde vier Kommilitoninnen in der Cafeteria ansprechen und sie zu einer Verabredung auf einen Kaffee einladen. Und ich bestand auf vier Erfahrungen – egal, wie die ersten ausgehen würden. Er ließ sich darauf ein, machte mich sozusagen zum Hilfs-Ich und steuernden Objekt, weil ich somit die »Verantwortung hierfür trug«. (Bei Patienten, die damit humorvoll umgehen können, sage ich zur Ermutigung zusätzlich auch manchmal schmunzelnd: »Mehr als sterben können Sie nicht.«)2 Das Durchbrechen dieser Angst schien schon für Freud unabdingbar; nur tat dieser meines Wissens nicht das, was ich dem jungen Mann empfohlen hatte, sondern entließ die Patienten mit dieser Aufgabe, welcher sie sich dann selbst stellen mussten.
Der junge Mann machte folgende Erfahrungen: Die erste Kommilitonin lächelte, sagte aber, dass das nicht gehen würde, da sie einen Freund habe. Die zweite war in Eile, bedankte sich jedoch für das Angebot. Die dritte lehnte ohne Begründung, aber auch ohne Abwertung ab. Die vierte sagte zu seiner großen Überraschung zu! Er bekam von ihr die Telefonnummer, verlegte den Zettel aber, womit wir bei der eigentlichen Angst waren: Es war nicht die Angst vor Misserfolg, sondern die Angst vor Erfolg! (»Ich weiß nicht, was ich dann mit ihr hätte reden sollen …«) Damit war klar, was wir als Nächstes zu bearbeiten hätten und vor allem, welche Aufgabe ihm jetzt »blühte«. – Kurz zusammengefasst: Nach meiner Erfahrung ist die Arbeit mit diesen Ängsten im Hier und Jetzt, die häufig deshalb bestehen, weil sie in der dafür vorgesehenen Entwicklungsstufe nicht bewältigt werden konnten (hier in der Pubertät), das Kernstück unserer Arbeit, wenn wir unsere Patienten nicht bloß »schlauer« (»Es liegt bei mir an der Kindheit.«) entlassen wollen, sondern zufriedener, selbstbewusster, kompetenter, sozial potenter usw. Die Verhaltenstherapeuten denken nun vermutlich sofort an Seligmans Konzept der »erlernten Hilflosigkeit«. Interessanterweise hat er das von Bibring übernommen, einem Psychoanalytiker.3
An dieser Stelle möchte ich eines betonen: Jeder Patient hat bei mir das Recht, so zu bleiben, wie er ist (und die meisten behalten auch zumindest einen Teil ihres neurotischen oder infantilen Systems, vgl. das Kapitel 31.3). Ich kann weder Symptome ändern noch Menschen heilen. Ich kann nur helfen, den Weg frei zu machen, beziehungsweise es zumindest versuchen. Dieser Unterstützung kann sich jeder Patient bei mir gewiss sein. Gehen muss er selbst. Und ich werde ihn nicht bedrängen oder nötigen – nur vielleicht ein bisschen »deuen4« (statt deuten!).
Die therapeutischen Wirkfaktoren hierbei: zunächst die Tatsache, dass wir den Patienten so nehmen, wie er ist, mit all seinen Schwierigkeiten, Ängsten, Verschrobenheiten und maladaptiven Kontaktproblemen. Der zweite Faktor ist, dass wir Zutrauen haben in seine Fähigkeiten, sich zu entwickeln und die neurotische Störung zu überwinden. Drittens: unsere Bereitschaft, mit ihm diesen Weg zu gehen und durchzustehen; ihn nicht voreilig aufzugeben, sondern ihm die Perspektive aufzuzeigen, dass wir es ehrlich meinen und ihn dabei begleiten werden – so er es denn will.
In der Therapie macht der Patient eine völlig neue Beziehungserfahrung. Gleichzeitig lernen viele, sich das erste Mal selbst zu fühlen, ihre Gefühle zu differenzieren, zu benennen und darüber sprechen zu können – kurz: Sie »lernen reden«. Später lernen sie, Konflikte zu erkennen, zu spüren, auszuhalten, zu benennen, dafür einzutreten und unterschiedliche Positionen zu »ertragen« und letztlich zu verstehen – diese eventuell sogar für sich nutzen zu können. Sie lernen, ihren Ärger zu spüren, ihn in der Schwebe zu halten und zu neutralisieren, anstatt ihn gegen sich selbst zu richten oder archaisch gegen andere; ihn zu benennen, ohne dass der Affektgehalt verloren geht.
4.2 Weitere Wirkmechanismen »aus der eigenen Werkstatt«
die emotional korrigierende Bindungserfahrung (und Interaktionserfahrung)
die verändernde interaktionale Erfahrung im Hier und Jetzt (als Konterkarierung der früheren Interaktionserfahrungen, Herauslösen aus den ohnmächtigen Mustern und »emotionales Verstehen« der Unsinnigkeit und Überflüssigkeit alter Muster)
das Ausprobieren neuer Muster im direkten Kontakt – besonders in Therapiegruppen (Erfahrung, dass befürchtete Reaktion ausbleibt oder das Gegenteil eintritt, »Entwickeln beziehungsweise Entfalten« neuer Ängste, die realitäts- und situationsadäquater überwunden werden müssen, Erfahrung der eigenen Wirksamkeit im sozialen Kontext)
das Auflösen falscher Vorstellungen vom eigenen Selbst und der Wirkung auf andere sowie das Auflösen der falschen Vorstellungen, die andere über den Patienten haben könnten
die Erfahrung von Nähe im interaktionalen Kontakt – besonders in der Gruppe
das Erfahren und/oder Wiederentdecken und Wiederbeleben von Selbstwirksamkeit – besonders in der Gruppe
4.3 Die authentische Beziehung als Grundvoraussetzung – und wesentlicher Heilfaktor
Das hört sich zunächst banal und selbstverständlich an. Dennoch, jeder füllt in seinem Beruf auch eine Rolle aus. Diese Rolle ist zum einen von beruflichen Anforderungen geprägt. Von einem Psychotherapeuten wird erwartet, dass er seine Aufmerksamkeit während der Arbeit ganz dem Patienten und seinen Schwierigkeiten widmet, eigene Befindlichkeiten, Interessen und Motive unterdrückt, wegpackt, und sich nur für den Patienten interessiert. Umso mehr verwundert es Außenstehende, dass Psychotherapeuten in ihrer Freizeit wieder zu »ganz normalen« Menschen werden, die im Tischtennisverein spielen, ins Kino gehen, im Biergarten ein Bier trinken und eine Bockwurst essen, halt alles machen, was andere auch tun – und sich dabei nicht dafür interessieren, ob jemand am Nachbartisch gerade akut Hilfe braucht.5 Vielleicht meiden sie sogar solche Situationen.
Meine Freunde haben sich anfangs gewundert, dass ich mich weigere, nach Feierabend in Kinofilme zu gehen, in denen eine tiefere menschliche Problematik das Thema ist. Ich schaue lieber absurde Filme, zum Beispiel Wes-Anderson- oder Science-Fiction-Filme, an. Psychohygiene nennt man das, sage ich dann. Manchmal muss man auch das Licht ausmachen, um die anderen zu überzeugen, dass man kein Heiliger ist.
Psychohygiene bedeutet auch, dass ich offen meinen Freunden sagen kann: »Nee, auf die Probleme anderer hab’ ich heut’ wirklich keinen Bock mehr.«
Das dürfen wir keinem Patienten sagen.
»Haben Sie montags auch immer so Schwierigkeiten, in die Gänge zu kommen?« wäre ehrlich und authentisch, aber grenzüberschreitend.
Was ist dann eine authentische therapeutische Beziehung? Authentisch meint im therapeutischen Setting, dass wir zwar persönliche Aspekte unseres Erlebens aus dem Kontakt heraushalten, aber ehrlich zum Patienten selbst sind. Nervt uns ein Patient oder langweilt er uns zu Tode, ist das keine gute Voraussetzung für eine hilfreiche therapeutische Beziehung. Dies merkt man sehr schnell. Ausbildungskandidaten realisieren das manchmal nicht oder ignorieren es, weil sie Angst haben, keine neuen Patienten zu finden. Oder weil die Angst vor der Behandlung selbst verhindert, dass sie dies klar wahrnehmen können. Dabei ist das keine Kunst. Wir können doch alle im Alltag recht rasch sagen, ob die »Chemie stimmt«, ob jemand, den wir zum Beispiel im Urlaub kennenlernen, unsere Zeit stehlen wird oder eine Bereicherung ist. Oder ob er so langweilig ist, dass wir lieber der Farbe beim Trocknen zuschauen würden.
Antipathien nicht zu unterdrücken, ist die erste Voraussetzung für eine authentische Beziehung.
Halten wir fest, dass authentisch in erster Linie bedeutet, dass wir dem Patienten nicht vorgaukeln, dass wir ihn mögen, ihn nicht ablehnen, ihn ernst nehmen, gerne mit ihm arbeiten. Ist das nicht der Fall, müssen wir den Patienten weiterschicken.
4.4 Über Objektfunktionen
Im folgenden Kapitel möchte ich mich mit den Funktionen, die Objekte für uns Menschen haben – hier insbesondere die Objektfunktionen, die der Patient beim Therapeuten sucht –, beschäftigen.
Eine Funktion, die der Patient von uns »einfordert« – beziehungsweise, man müsste sagen: »uns auferlegt« –, ist die des idealisierten Objekts (Idealobjekt). In seiner Wunschvorstellung übernehmen wir die Rolle eines allseits potenten, allseits zugewandten und wenig fordernden Objekts, das nicht nur grenzenlos geben kann, sondern auch möglichst keine eigenen Bedürfnisse hat – außer, dem Patienten zur Seite zu stehen oder ihn zufriedenzustellen. Die »Entzauberung« aus dieser Rolle ist ein Teil des psychotherapeutischen Prozesses, der dem Patienten die Bereitschaft, viele Enttäuschungen zu ertragen, abverlangt, um zu einer inneren Reife, aber auch zu einer Objektbeziehungsreife zu gelangen. Eine andere Funktion ist die des Stabilisierungsobjektes. Das Stabilisierungsobjekt sorgt dafür, dass das psychische Gleichgewicht des Patienten hergestellt beziehungsweise aufrechterhalten wird – oder verhindert, dass es ins Ungleichgewicht gerät.
Der Therapeut ist auch das beobachtende Objekt, das wohlwollend die Entwicklung des Patienten im Blick hat und begleitet – eine Rolle, die uns sicherlich entgegenkommt und uns nicht unangenehm ist. Als Spiegelobjekt übernehmen wir die Funktion, dem Patienten seine Wahrnehmung oder seine Reaktionen und Handlungsweisen oder -muster vor Augen zu führen, und helfen dabei, diese in der Realität (in der dyadischen Beziehung) zu überprüfen, zu verändern oder zu verbessern. Als Zwillingsobjekt dienen wir insbesondere unsicheren Patienten in einer speziellen Form zur Spiegelung. Diese Funktion stammt aus einer sehr frühen Phase, in der zumeist das mütterliche Objekt die Handlungen des Säuglings wiederholt, um ihm so zu zeigen, dass sein Verhalten richtig ist. Das Kind selbst wendet dieses Verhalten in der Funktion des Modelllernens an, wenn es zum Beispiel die Sprache erlernt, indem es die entsprechenden Laute und Wörter ebenso wiederholt.
Der unsichere Patient wird diese Funktion häufig verlangen, um sein eigenes Verhalten als »richtig« anzusehen, was für ihn dann gegeben ist, wenn der Therapeut »genauso denkt« wie er. Allerdings darf hier zunächst keine Differenzierung stattfinden, da der Patient dann verunsichert ist. Dieser unsichere Patient wird sich auch im Laufe der Therapie immer wieder gegen Differenzierungen verwehren. Entweder wird er versuchen, den Therapeuten dazu zu bringen, seine Haltung oder Meinung zu ändern, oder er wird sich dem Therapeuten anpassen (assimilieren im Sinne Piagets). Hier ist eine Nachreifung in der Objektbeziehung notwendig.
Eine weitere Funktion ist die des aufnehmenden Transformationsobjektes: Im Sinne des »bionianischen Containments«6 nimmt der Therapeut die Reaktionen des Patienten auf und wandelt sie in eine ichgerechte oder ichgerechtere Form um: Bizarre Äußerungen des Patienten, unklare Affektreaktionen, widersprüchliche Reaktionen usw. versucht der Therapeut zunächst auszuhalten (aufzunehmen), diese in ihrem Sinn zu entschlüsseln und das Ergebnis dann dem Patienten in Form einer Konfrontation oder Deutung wiederzugeben (Transformation).
Grundsätzlich lassen sich die Objekte der Außenwelt, bezogen auf unsere Bedürfnisse, in vier Kategorien einteilen: Selbstobjekte, Triebbefriedigungsobjekte, Missbrauchsobjekte und Entwicklungsobjekte.
Am einfachsten erklärt ist der Begriff »Triebbefriedigungsobjekt«, den ich in Anlehnung an Freuds Triebtheorie gebildet habe: Gemeint ist hiermit ein Objekt, das der Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses beziehungsweise Triebes dienlich erscheint.
Der Begriff des Selbstobjektes wurde von Heinz Kohut geprägt, der von »Selbstobjektfunktionen« sprach, wenn die Person im Anderen ein Objekt findet, das passager eine bestimmte wichtige Funktion erfüllt, die derjenige noch nicht oder derzeit nicht selbst erfüllen kann – zum Beispiel ihn in seiner Angst stabilisiert, ihm in seiner Verwirrung hilft und ihm damit zum Hilfs-Ich wird usw.
Unter Missbrauchsobjekt verstehe ich alle Objekte, die vom Subjekt nicht in ihrem Recht auf Selbstbestimmung ernst genommen werden, sondern vom Subjekt zur Triebbefriedigung gezwungen werden. Dem Missbrauchsobjekt wird somit jede eigene Existenzberechtigung als individuelle Persönlichkeit abgesprochen, und es wird für den Zweck der jeweiligen Befriedigung des Subjekts gebraucht, ja, degradiert. Wenn wir von Missbrauchsobjekten sprechen, so denken wir in erster Linie an den kindlichen sexuellen Missbrauch. Ich möchte dies jedoch nicht so einschränken, weder auf eine Altersgruppe noch auf eine Art der Triebbefriedigung: Missbrauchsobjekte können Menschen jeden Alters sein oder werden. Missbrauchsziele sind unterschiedlicher Art. Der sexuelle Missbrauch ist hier zwar der bekannteste, aber nicht der einzige. Wie stark schädigend ein Missbrauch ist, hängt nicht von der Art des Missbrauchs ab, sondern von der Intensität und Dauer sowie der Beschaffenheit und der Abwehr der missbrauchten Person und von der psychischen Struktur des Missbrauchenden und seinen Abwehrmechanismen.
Ich unterscheide zwischen sexuellen Missbrauchsobjekten, narzisstischen Missbrauchsobjekten und Machtmissbrauchsobjekten.
Der Begriff sexuelle Missbrauchsobjekte erklärt sich von selbst.
Von narzisstischen Missbrauchsobjekten spreche ich dann, wenn eine Person entweder zur Stabilisierung des eigenen Narzissmus oder zur Aufwertung der eigenen Person missbraucht wird.
Beim Machtmissbrauch oder pekuniären Missbrauch geht es darum, anderen Menschen seinen Willen aufzuzwingen, ohne deren Bedürfnisse und persönliche Wünsche beziehungsweise innere oder äußere Umstände zu beachten. Beim pekuniären Missbrauch werden Menschen ausgebeutet, um den eigenen Besitz zu vermehren. Der pekuniäre Missbrauch ist meines Erachtens langfristig gesehen die schädlichste aller Formen. Pekuniärer Missbrauch, Machtmissbrauch und narzisstischer Missbrauch kommen häufig zusammen vor, sodass das Opfer dann in dreifacher Weise missbraucht wird. Ebenso treten sexueller Missbrauch und Machtmissbrauch gemeinsam auf.
Unter Entwicklungsobjekt verstehe ich eine reifere Beziehungsform, bei der ähnlich wie bei einem Selbstobjekt Funktionen des anderen Objekts abgefragt werden. Das Entwicklungsobjekt gestattet dem »nutzenden Objekt«, sich über den Austausch mit ihm weiterentwickeln zu können. In einer reziproken, also einer wechselseitigen, Entwicklungsobjektbeziehung können sich beide weiterentwickeln. So sollte meiner Ansicht nach die therapeutische Beziehung idealerweise sein. Der Patient löst sich aus alten Mustern, wir machen neue Erfahrungen, vervollständigen unser Bild vom Menschen oder vom Menschlichen, verbessern unsere therapeutischen Fähigkeiten.
4.5 Folgen der korrigierenden emotionalen (Bindungs-)Erfahrung
Eine korrigierende emotionale Erfahrung in der direkten Begegnung führt in der Regel zu einem Überdenken und Verändern der inneren Verarbeitungs-, Erlebens- und Reaktionsmuster des Patienten. Häufig beobachten wir allerdings eine äußerst paradoxe Reaktion: Der Patient zeigt zwar »glaubwürdige Einsicht« in die heutige Unsinnigkeit seines Verhaltens und die Notwendigkeit, dieses zu modifizieren, kann dies aber in seinem realen Umfeld nicht umsetzen. Der Therapeut ist verwundert, und schnell sind wir geneigt, die sekundären Ängste (→Kapitel 11.9) als alleinige Ursache hierfür zu sehen.
Dies trifft sicherlich auch zu, aber ich möchte hier einen weiteren Aspekt anführen, den ich in diesem Zusammenhang für äußerst bedeutsam halte: Dem Patienten fehlt die Erfahrung auf dem neuen Gebiet, man könnte auch sagen, »mit dem neuen Umfeld« (im Levin’schen Sinne). Ich sage Patienten dann häufig, dass sie sich vielleicht im Moment so verhalten wie jemand, der plötzlich aus einer schrecklichen, unwirklichen Stadt in eine neue, schöne oder schönere versetzt worden ist. Er hat aber nur den Stadtplan der alten Stadt und versucht, sich mit diesem in der neuen Stadt zurechtzufinden, was sehr schwierig oder gar unmöglich ist, weil Stadt und Plan nicht mehr übereinstimmen.
Er braucht also einen neuen Stadtplan und eine neue Ortserfahrung. Die alten Regeln gelten nicht mehr, alte »Lösungsmuster« funktionieren nicht mehr, kranke Beziehungen werden als bizarr und fremd erlebt. Kurz: »Die alten Mühlen klappern nicht mehr.« Jetzt gilt es, den Patienten dabei zu unterstützen, das neue Terrain kennenzulernen und ihm vielleicht ein Stück weit auch einen »Stadtplan« zur Verfügung zu stellen oder, besser noch, diesen mit ihm gemeinsam zu erarbeiten, damit er sich leichter und schneller zurechtfindet und nicht aus der Verwirrung aufgrund des noch als fremd erlebten Umfeldes sich wieder zurück in das alte, vertraute Leben begibt. Das ist zwar schlechter, aber er hat den »richtigen Stadtplan« hierfür. Anders ausgedrückt: Viele Patienten neigen dann dazu, nach dem Motto zu handeln: »Besser ein bekanntes Unglück als ein unbekanntes Glück.«
4.5.1 Wie viel von sich zeigen?
Der wichtigste und stärkste Wirkfaktor der Therapie ist das persönliche Verhältnis des Patienten zum Therapeuten: Je besser und je stärker dieses Verhältnis und je tiefer das Vertrauen des Patienten in den kompetenten und erfahrenen Therapeuten ist, desto besser und nachhaltiger werden die Ergebnisse der Therapie sein. Darüber besteht kaum ein Zweifel und erfahrene Therapeuten sowie Patienten bestätigen dies. Die zentralen Wirkfaktoren sind dabei nicht nur die Authentizität und Ehrlichkeit der Beziehung sowie die Kontinuität, sondern auch ein gewisses Maß an Offenheit und Selbstoffenbarung des Therapeuten.
Dies richtig hinzubekommen, ist ein schwieriges Unterfangen – eine Gratwanderung: Zeigt der Therapeut offen und ungefragt alles von sich selbst, wird er womöglich die Therapiemotivation des Patienten untergraben und den Prozess zum Erlahmen bringen oder gar nicht erst in Gang kommen lassen. Zeigt er gar nichts von sich selbst, kann der Patient sich alleingelassen, hilflos und klein fühlen. In stützungsarmen Therapiesettings wie dem klassischen analytischen Setting ist diese Haltung durchaus angebracht und »richtig«: Der Patient wird hier gezwungen, dieses außerhalb der Therapie zu suchen und nur die Erforschung der eigenen Persönlichkeit zum Gegenstand der Behandlung zu machen.
In den mehr stützenden Verfahren hingegen werden wir interaktionaler arbeiten. Insofern kann man zu Recht von der Menge der Interaktionsqualität der Therapie sprechen. Eigene Schwächen offen einzugestehen, hat sowohl Risiken als auch Benefits. Wenn der Patient den Therapeuten als unvollkommen oder gar schwach erlebt, kann es sein, dass er sich mit dessen Fehlern identifiziert und seine Therapiemotivation abnimmt; gegebenenfalls auch die Motivation, sich mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. Wenn der Therapeut selbst nicht sehr gewissenhaft ist oder Schwierigkeiten hat, Sachen zu Ende zu bringen: Warum sollte der Patient, der vielleicht die gleichen Schwierigkeiten hat, ein Interesse daran haben, dies zu tun? Bestenfalls gerät er mit dem Behandler in eine Rivalität und strebt danach, auf diesem Gebiet »besser« als der Therapeut zu werden.
Identifiziert er sich mit ihm und übernimmt die Haltung des Therapeuten als Ideal, hat der Therapeut keine Chance mehr, hieran etwas zu verändern – es sei denn, er korrigiert es später bei sich selbst, sodass der Patient dann auch diesem Ideal folgen und es ebenfalls korrigieren kann. Die Stärke der Selbstoffenbarung im positiven Sinne liegt in einem höheren Maß an Nähe, welche dann auftritt. Hier kann sich der Patient mit der Toleranz des Therapeuten in Bezug auf die Unfertigkeit der eigenen Persönlichkeit identifizieren und infolgedessen selbst milder mit sich umgehen.
Patienten erleben den Therapeuten so authentischer, was die therapeutische Allianz stärkt. Oder er lernt einen anderen Umgang seinen Mitmenschen und sich selbst gegenüber, wenn er einen Fehler gemacht hat: Statt mit Schuldgefühlen oder Schuldabweisung zu reagieren, lernt er, mit der Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber umzugehen.
Neben all diesen Vor- und Nachteilen möchte ich noch andere Gründe anführen, weshalb Offenheit ein sehr günstiges Mittel in der Therapie ist: Neben der schon erwähnten Nähe, die durch Offenheit und Selbstoffenbarungen geschaffen wird, stärkt es das therapeutische Arbeitsbündnis und die Bindung des Patienten an uns, weil der Patient spürt, dass wir es ehrlich mit ihm meinen. Dadurch wächst auch die Fehlertoleranz des Patienten – also seine Bereitschaft, uns oder die Therapie nicht infrage zu stellen, sondern Fehler oder Fehleinschätzungen, Fehldeutungen usw. als ein Bestandteil der Therapie zu sehen, da nun einmal Fehler ein Bestandteil des normalen Lebens sind.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es die Arbeit mit dem Patienten ungemein erleichtert. Auch wenn es sich leicht anhört und so mancher sich vorstellt, dass er nur »lockerlassen« muss, stellt es doch zunächst eine höhere Anforderung an die therapeutische Verantwortung und ist eine mentale Belastung. Zum einen sollte es wohlüberlegt sein, wem und wann wir welche Offenheit oder Selbstoffenbarung zeigen. Und natürlich sollten wir es auch immer wieder reflektieren. Denn es geht ja nicht darum, eine Freundschaft zu pflegen oder herzustellen, sondern den therapeutischen Prozess, den Rapport aufrechtzuerhalten oder gar zu verbessern. Gleichzeitig birgt dies eine Gefahr der Nähe, denn viele Therapeuten haben Angst vor echter Nähe7 und menschlicher Begegnung. Hierzu mehr in Kapitel 17.4.
Zu beachten ist jedoch auch der eigene Raum, den wir als Therapeuten benötigen. Also: Wir müssen, trotz allen Bemühens, einerseits unsere Ängste vor Nähe und Übergriffigkeit des Patienten überwinden, aber andererseits selbstverständlich auch den Schutz, den wir brauchen, beachten. Besonders früh gestörte, kontaktgehemmte Patienten könnten mehr Offenheit als Aufforderung, Einladung oder Genehmigung zum Grenzüberschreiten sehen. Doch auch diesem kann mit Offenheit begegnet werden, indem wir dem Patienten freundlich, aber klar und, ohne ihn zu verletzen, seine Grenzüberschreitungen aufzeigen und ihm gemäß den Regeln der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg verdeutlichen, wie wir uns als Gegenüber damit fühlen. Denn das werden andere Menschen in seinem Umfeld sicherlich ähnlich empfinden. So können wir ihn zu mehr Empathie anleiten und ihm somit zu besseren und dauerhafteren sozialen Kontakten verhelfen.
4.6 Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen sind das tragende – man könnte auch sagen, »väterliche« – Element der Therapie. Der Rahmen muss klar, fest und unverrückbar sein und zu Beginn der Therapie festgelegt werden. Wir sollten uns Zeit nehmen, dies dem Patienten vor Beginn der eigentlichen Therapie genau darzulegen – nicht zu diskutieren, denn die Rahmenbedingungen sind nicht verhandelbar. Es ist jedoch wichtig, dass der Patient diese genau verstanden hat.8
Wenn der Patient erst in der Übertragung ist, können Rahmenbedingungen nicht mehr verhandelt werden. Das heißt aber nicht, dass der Patient nicht daran rütteln wird. Denn im Zustand der Regression, den der Patient nicht nur in der analytischen beziehungsweise psychodynamischen Psychotherapie, sondern auch in der Verhaltens- und der systemischen Therapie und anderen erfährt, wird er in infantile Positionen (die Fixierungen) geraten und den Therapeuten unter Druck setzen, die Bedingungen zu verändern, um letztlich das alte, gute Versorgungssystem, das er entweder verlassen musste oder nie gehabt hat, herzustellen. Es geht schließlich nicht um das Ausagieren der Wünsche oder früher Konfliktsituationen, sondern um das Bewusstmachen und damit Betrauern und Verlassen des Ganzen, damit eine Nachreifung möglich wird.
Nur innerhalb eines festen und damit gesicherten Rahmens ist es dem Patienten wie dem Therapeuten möglich, sich »spielerisch« zu bewegen. Damit ist nicht nur ein Raum für die schwierigen Dinge, die der Patient nicht gerne äußern möchte, geschaffen, sondern auch für seine infantilen Seiten, denen wir eine Möglichkeit zur Entfaltung geben, um sie mit ihm gemeinsam zu verändern. Man könnte den Rahmen der Therapie auch als das erwachsene Element betrachten, das das Realitätsprinzip verkörpert, während das Therapiegeschehen innerhalb des Rahmens zunächst amorph, durcheinander, infantil oder neurotisch sein wird und erst später mehr und mehr dem Realitätsprinzip und der Nachreifung zugeführt wird. Ähnlich wie ein umzäunter Spielplatz, der sowohl das Kind als auch die Erwachsenen vor unbedachten Reaktionen, infantilem Größenwahn und anderen Dingen bewahrt, während innerhalb der Umzäunung des Spielplatzes nahezu alles erlaubt ist.
4.6.1 Die Bedeutung von Rahmenbedingungen in der Psychotherapie
Schon Freud betonte in seinem Aufsatz »Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung«9 die Wichtigkeit von Rahmenbedingungen und legte schon damals zentrale Eckpunkte für die Behandlung fest, die heute noch gültig sind. Daher werde ich mich viel auf ihn, aber auch auf unsere heutige Zeit beziehen und vor allem auf die praktische Umsetzung der Rahmenbedingungen Wert legen. Als Vorbemerkung sei gesagt, dass es bei den Rahmenbedingungen für eine Psychotherapie auch, aber nicht im Wesentlichen um den rechtlichen Aspekt der gegenseitigen Absicherung geht, sondern primär um deren psychodynamische Bedeutung für die Therapie und den Behandlungsablauf und -fortschritt. Die Rahmenbedingungen sind, wie gesagt, das »väterliche Element« – man könnte auch sagen, das männliche Element – in der Psychotherapie; wohingegen das Verstehen, Tragen und das Containen eher mütterliche oder weibliche Elemente sind. Dabei sollten wir ihm nicht die Rolle des väterlich Strengen vorspielen, sondern die Sicherheit einer klaren, festen Beziehung, die keiner Willkür oder einem archaischen Chaos in den Bedingungen unterworfen ist, geben. In der Binnenstrukur, in den Einfällen und Inhalten der Stunde, der Verwirrung und Orientierungslosigkeit des Patienten ist jedoch natürlich schon ein chaotisches Element enthalten.
Dies ist auch so geplant und gewollt, denn es geht ja darum, das im Inneren des Patienten vorhandene Chaos und seine Orientierungslosigkeit, die er nach außen zu vertuschen und zu kompensieren versucht, im Außenkontakt in die Übertragung zu bringen, damit es bearbeitbar und damit veränderbar wird. Dazu bedarf es aber eben eines klaren, stabilen Rahmens. Den therapeutischen Rahmen kann man ähnlich sehen wie die Bretter einer Theaterbühne, die stabil und tragfähig sein müssen; dann kann auch auf der »Bühne« die noch so wildeste und wirrste »Inszenierung« stattfinden. Aber es muss auch »Notausgänge« und eine »Sitzordnung« usw. geben, sonst wird das Theater an sich zum Theater und der Zuschauer zum Mitspieler und kann nicht mehr folgen. Analog hierzu sind die gesunden Anteile des Ichs des Patienten hier der Zuschauer und – eher unbewusst – der Regisseur und Akteur zugleich.
Die Rahmenbedingungen geben nicht nur Sicherheit für den Therapeuten, sondern auch für den Patienten. Für viele früh gestörte oder traumatisierte beziehungsweise missbrauchte Patienten wäre eine Behandlung ohne »Grenzen« gar nicht möglich. Die Grenzenlosigkeit würde die Patienten verunsichern, weil es ja schon andere Menschen in ihrem Leben gab, die ihre Grenzen nicht respektiert haben. Diesen Menschen stiften die Grenzen die Sicherheit, dass es ein klares Umfeld gibt, in dem sich sowohl der Patient als auch der Therapeut bewegen wird und welches beide nicht verlassen werden. Für andere Patienten bedeutet der Rahmen natürlich auch Frustration: zum Beispiel die unersättlichen, gierigen, moralstrukturierten Narzissten, die eigentlich der Meinung sind, dass ein Rahmen oder eine Grenze ihren »Bedürfnissen« widerspricht; sie brauchen diese jedoch mehr als andere. Auch hier wird schon das eigentliche Problem deutlich: der Wunsch nach Grenzenlosigkeit des Anderen, vielleicht aber auch der Unwillen, etwas dafür geben zu müssen. Zwanghaften Patienten wird der Rahmen zunächst sehr entgegenkommen, weil sie vermuten, der Therapeut denke ähnlich wie sie. Allerdings missverstehen sie den Rahmen als ein um seiner selbst willen exekutierendes Gesetz, das die zwanghaft abgewehrte Triebhaftigkeit im Zaum halten soll.
Wir werden dann schnell mit der Absurdität des Ganzen und dem Missverständnis des Zwanghaften konfrontiert, wenn diese den Beginn oder das Ende der Stunden »sekundengenau« erzwingen wollen oder um 23:59 Uhr auf den Anrufbeantworter sprechen, damit die Absageregelung ganz exakt eingehalten wird. Ängstliche Menschen würden durch beides verunsichert: Die Grenzenlosigkeit nährt die eigene Orientierungslosigkeit, die die Quelle ihrer Angst ist; die Grenzen nähren ihre Angst, etwas falsch machen zu können, als Chaot und Unbrauchbarer entlarvt und damit weggeschickt zu werden. Egal, wie die Psychodynamik ausgeht: Die Grenzen und die Rahmenbedingungen sind notwendig. Sie sind der erste beziehungsstiftende Anteil in der Behandlung. Das schafft Beziehungsklarheit und ermöglicht so das Arbeiten und das Regredieren unter klaren Vorgaben.
4.6.2 Welche Rahmenbedingungen sind wichtig und hilfreich?
Formulieren Sie die Rahmenbedingungen zu Beginn der Behandlung, jedoch nicht in der ersten Sitzung. Zunächst sollte es wirklich darum gehen, einen Raum zu schaffen, in dem der Patient sich und seine Neurose oder seine Struktur erst einmal vollkommen entfalten kann und darf. Trotzdem ist auch hierfür ein Rahmen notwendig, den wir setzen müssen. Ich persönlich mache dies im ersten Telefonkontakt, indem ich die Patienten darauf hinweise, wie meine Ausfallregelung ist und dass die Stunden pünktlich anfangen und enden. (Ich habe kein richtiges Wartezimmer, sondern nur einen Wartebereich und möchte aus psychohygienischen Gründen auch nicht, dass in meinen Pausen dort Menschen sitzen, die mit mir die Behandlung in der Teeküche oder in der Toilette beginnen, auch wenn sie dort nicht anwesend sind.)