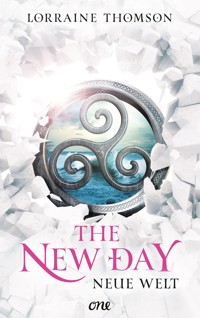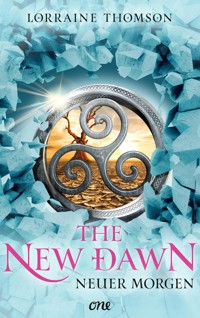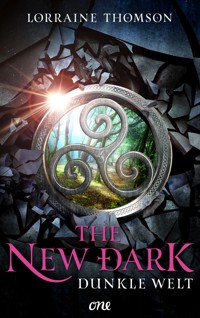
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark-Times-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Keine Schulen, keine Supermärkte, kein Internet - eine globale Katastrophe hat die Zivilisation vernichtet.
Für die 16-jährige Sorrel gibt es nur ihre Familie, ihr Dorf und einige unglaubliche Geschichten aus der Zeit Davor. Eines Tages greifen Mutanten das Dorf an und metzeln fast alle Bewohner nieder. Sorrels kleiner Bruder Eli und ihre große Liebe David werden verschleppt. Wild entschlossen, die beiden zu retten, macht Sorrel sich auf die Suche. Ihr Weg führt sie direkt in die Arme eines skrupellosen Rebellenanführers, der das junge Mädchen für seine Zwecke instrumentalisieren will. Aber welcher Weg ist schon zu weit für die wahre Liebe?
In einer dunklen Welt ist Liebe die einzige Rettung - die spannende Dark-Times-Trilogie von Lorraine Thomson:
Band 1: The New Dark - Dunkle Welt
Band 2: The New Dawn - Neuer Morgen
Band 3: The New Day - Neue Welt
ONE. Wir lieben Young Adult. Auch im eBook.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Titel
Teil Eins – DIE FREIEN
1. Totes Fleisch
2. Beißwerkzeug
3. Straße der Verwüstung
4. Die Freien
5. Wer es findet, darf es behalten
6. Rankendes Grün
7. Schmackhafte Happen
8. Schlüssel
9. Hast du jemals von einem Ort namens Hölle gehört?
10. Letztes Wort
Teil Zwei – VERRAT
11. Schädelknacker
12. Ein dunkler Gang
13. Der Küchenjunge
14. Der Henkersbaum
15. Zäher Bursche
16. Jetzt oder nie
17. Betonwiesen
18. Der Würger
19. Der Luxus der Wahl
20. Die Kreise deines Denkens:
David
Sorrel
Epilog
Über die Autorin
Alle Titel der Autorin bei ONE
Impressum
Über dieses Buch
Keine Schulen, keine Supermärkte, kein Internet – eine globale Katastrophe hat die Zivilisation vernichtet.
Für die 16-jährige Sorrel gibt es nur ihre Familie, ihr Dorf und einige unglaubliche Geschichten aus der Zeit Davor. Eines Tages greifen Mutanten das Dorf an und metzeln fast alle Bewohner nieder. Sorrels kleiner Bruder Eli und ihre große Liebe David werden verschleppt. Wild entschlossen, die beiden zu retten, macht Sorrel sich auf die Suche. Ihr Weg führt sie direkt in die Arme eines skrupellosen Rebellenanführers, der das junge Mädchen für seine Zwecke instrumentalisieren will. Aber welcher Weg ist schon zu weit für die wahre Liebe?
Lorraine Thomson
The New Dark
Dunkle Welt
Aus dem Englischen von Thomas Schichtel
Teil Eins
DIE FREIEN
1.Totes Fleisch
Sorrel sah zu, wie David die Fledermäuse häutete, und sie genoss die Art und Weise, wie sich seine Armmuskeln bei der Arbeit anspannten. Sie widerstand dem Impuls, sich vorzubeugen und ihm mit den Fingern über die Haut zu streichen. Heutzutage versuchte sie stets, ihn nicht anzufassen.
David hatte dunkle Haare und war schlank und sehnig, seine Schultern waren dennoch breit, und er strotzte vor Gesundheit. Sie fragte sich, wie es wohl war, von ihm gehalten zu werden, den Kopf an seine Brust zu legen. Von ihm geküsst zu werden. Vielleicht fand sie es ja bald heraus.
Er arbeitete in einem gleichmäßigen Rhythmus und warf die toten Tiere in einen großen Topf und die Felle auf einen Haufen vor sich. Sie hatten Glück gehabt, dass er die Schlafkolonie der Fledermäuse gefunden hatte. Die Kadaver wurden ausgeweidet und gewaschen, ehe sie im Eintopf landeten, und die Felle und Flügel wurden haltbar gemacht, um als Kleidung zu dienen.
Er schälte ein besonders großes Hautstück ab, an dem noch die Flügel hingen, und bemerkte, dass Sorrel ihn anstarrte. Er lächelte. Sorrel senkte den Blick auf ihre Stiefel, war verlegen, weil er sie ertappt hatte, und empfand als Demütigung, dass ihre Wangen so sehr brannten. Sie kannte David schon ihr ganzes Leben lang, war mit ihm durch die Hügel gelaufen und hatte mit ihm den Rottwald erkundet, dessen Name von seinem verrotteten Zustand herrührte. In jüngster Zeit veränderten sich jedoch ihre Gefühle. Sie bebte innerlich, wenn er sie anblickte, und das Beben breitete sich aus und erhitzte ihr den Leib.
Sorrel widmete sich wieder der Aufgabe, ihr Messer zu wetzen. Metall war in Amat schwer zu kriegen, und Messer aus der Zeit Davor waren noch seltener. Dieses Messer hatte sie von der Großmutter geerbt. Die Klinge war inzwischen dünn, und sie achtete darauf, sie nicht zu sehr zu schärfen und somit brüchig zu machen.
Angestrengt bannte sie das Dunkelrot aus dem Gesicht und bemühte sich, nur auf das Messer zu achten. Sie nahm sich Zeit, es in den Griff zu klappen, ehe sie es in die Tasche ihrer Jacke aus Fledermausfell steckte. Erst dann wagte sie es, David wieder anzusehen.
Er schaute erneut von seiner Arbeit auf. Diesmal hielt sie seinem Blick stand und gestattete sich, sein Lächeln zu erwidern.
»Süße Sorrel.« David streckte die Hand aus und strich ihr übers Gesicht.
Ihre Wangen wurden heiß, als sie seine Hand spürte.
»Es tut mir leid. Ich habe schmutzige Hände. Du wirst dir jetzt das Gesicht waschen müssen.«
Sie fasste an seine Hand. »Es macht mir nichts aus.«
»Wir können zum Fluss im Rottwald gehen, sobald ich fertig bin ... Das heißt, wenn du möchtest.«
Möchten? Sorrel hätte am liebsten einen Freudenschrei ausgestoßen. Er mochte sie also wirklich. Das war seinen klaren blauen Augen eindeutig zu entnehmen. Der Art, wie er sie anlächelte. Seiner Berührung.
Seine Haut auf ihrer zu spüren, ließ ihren Körper wohlig erglühen.
»Sorrel? Sorrel!«
Sie verdrehte die Augen, als sie die altbekannte nörgelnde Stimme hörte.
Sorrels Mutter kam auf sie zu, ein Baby auf der Hüfte, ein Kleinkind auf den Fersen. Ihre Kleidung bestand aus behandelten Fellen und gewebten Stoffen und war von kundiger Hand so geschnitten, dass sie sich perfekt der Figur anpasste, obwohl die Leggings in jüngster Zeit lose zu hängen schienen. David warf Sorrel kurz einen Blick zu, ehe er sich wieder dem schrumpfenden Haufen Fledermäusen zuwandte.
Sorrel stand auf.
»Du solltest mir doch mit deinem Bruder und deiner Schwester helfen, Sorrel.«
»Ich bin beschäftigt.«
»Das sehe ich.«
Ihre Mutter sah David an. Obwohl er sicherlich spürte, wie sich ihr harter Blick durch seinen Schädel bohrte, widmete er sich ganz seiner Arbeit. Sorrel konnte ihm daraus keinen Vorwurf machen. Sie hätte das Gleiche getan, wäre ihr die Wahl geblieben.
Ihre Mutter zischte die Worte zwischen gespannten Lippen hindurch. Dünne tiefe Falten hatten sich in die Haut um ihre Augen und um ihren Mund gegraben, seit Sorrels Vater nicht mehr von einem einsamen Jagdausflug zurückgekehrt war. Die rauen Linien setzten seitdem ihren unnachgiebigen Vormarsch kontinuierlich fort.
»Ich habe mein Messer geschärft.«
»Es ist dein Verstand, der geschärft werden müsste.«
Sorrel schnitt ein finsteres Gesicht. Sie konnte es nicht gebrauchen, dass sich ihre Mutter ausgerechnet vor David an ihr ausließ. Es schien, als machte sie das absichtlich.
Das Baby krähte nach Sorrel. Diese streichelte ihrer Schwester den Kopf. Das Baby war wie Mutter und Bruder blond, die Haare so zart und weich wie eine Pusteblume. Um den Hals trug das kleine Mädchen einen kleinen funkelnden Stern an einer zierlichen Silberkette.
Das Halsband gehörte zu den Geschenken, die ihr Großmutter hinterlassen hatte. Es war einer der seltenen Gegenstände, die sie aus der Zeit Davor hatte, und war durch die Generationen vererbt worden, bis er schließlich an Sorrel fiel. Die Großmutter hatte Geschichten davon erzählt und Sorrel erklärt, dass die fünf Zacken des Sterns für die Wesenszüge stehen würden, die sie zum Überleben brauchte: Stärke, Lebenskraft, Mut, Weisheit und Beharrlichkeit.
Als sie ihr Schwesterchen zum ersten Mal in den Armen gehalten und gesehen hatte, wie klein und schutzlos sie wirkte, hatte Sorrel ihr das Halsband zum Geschenk gemacht und gehofft, es möge ihr all die Wesenszüge verleihen, von denen die Großmutter gesprochen hatte.
»Bella«, flüsterte Sorrel den Namen, den sie ihrer Schwester gegeben hatte.
»Nein, Sorrel, das darfst du nicht.« Ihre Mutter pochte stets auf Regeln, war immer bereit, »Nein« zu sagen, »Tu das nicht«, »Das kannst du nicht« zu sagen.
»Hoch, hoch!« Sorrels Bruder zupfte an ihrer Jacke. Sie warf einen Blick auf das Kleinkind. Von ihrer Beachtung ermuntert hob Eli die Arme und hüpfte. »Hoch!«
Sorrel spielte mit seinen Fingern, ignorierte aber seine Bitte.
»Warum nicht? So heißt sie doch.«
Ihre Mutter runzelte die Stirn. Eli versuchte, hüpfend Aufmerksamkeit zu heischen, als sie erklärte. »Du weißt schon, warum. Es ist zu früh. Wir wissen noch nicht, ob sie lebensfähig ist.«
Sorrel schüttelte den Kopf. »Natürlich ist sie lebensfähig – sieh sie dir doch an! Außerdem nutzen sich Namen ja nicht ab und verbrauchen sich nicht. Warum sollte sie keinen haben dürfen? Ich bin diesen blöden Ort und die blöden Gesetze leid. Und ich bin dich leid. Kein Wunder, dass Dad nicht zurückgekehrt ist.«
Die Worte waren ausgesprochen, bevor sie sie aufhalten konnte. Schon ehe die Verletztheit im Gesicht ihrer Mutter zu erkennen war, wusste Sorrel, dass sie zu weit gegangen war.
Sie schämte sich ihres Ausbruchs, war weiterhin wütend auf ihre Mutter und fühlte sich abgründig gedemütigt, weil sich der Streit vor David abgespielt hatte, und so wandte sie sich ab und stürmte davon.
Kaum hatte sie einige Schritte zurückgelegt, entdeckte sie eine Gestalt, die sich neben der nächststehenden Hütte herumtrieb. Nach dem höhnischen Lächeln zu urteilen, hatte Mara den Wortwechsel verfolgt. Ausgerechnet Mara mit ihren roten Locken, verständnisvollen Augen und ihrem schlauen leisen Lächeln!
Tränen brannten in Sorrels Augen, während sie zwischen den Holzhütten hindurchhuschte, bis sie das hintere Tor im Grenzzaun erreichte. Sie konnte sich bildhaft vorstellen, wie sich Mara an David heranmachte und mit ihm über Sorrel scherzte, während sie das Haar über die Schulter warf und ihm ein affektiertes Lächeln schenkte.
Hinter dem Zaun rannte Sorrel weiter. Sie lief den Rand des Rottwalds entlang, überquerte das Moor auf den Torfbänken und kletterte die Anhöhe hinauf. Sie berauschte sich an der ungestümen Schnelligkeit und sie scherte sich nicht darum, sich den Knöchel oder das Knie zu verrenken, während sie rannte, bis ihre Wut verging. Je höher sie kam, desto freier fühlte sie sich von Amat und seinen dummen Regeln und geistlosen Aufgaben. Ihre Tränen trockneten, und sie warf allmählich die Verletztheit und den Ärger ihrer Mutter und Maras spöttische Blicke von sich. Sie lief weiter, bis sie außer Atem war und einen flachen Stein erreichte.
Sie zog die Jacke aus und legte sich auf den Stein. Ihr Herz wurde langsamer, ihr Atem ging ruhiger, während sie in den dunstigen Himmel blickte.
Sorrels Beine waren müde, der Bauch war leer, aber die gefilterte Sonne brachte Wärme, und Umgebung und Erinnerungen spendeten Trost.
Dieser Stein war ihr Lieblingsplatz. Sie hatte ihn früher zusammen mit Großmutter aufgesucht. Beide saßen sie dann hier oben, blickten über Amat hinaus, über ihren kleinen Flecken Welt, und ihre Großmutter erzählte, und Sorrel lauschte den Geschichten, die Großmutter über das Leben Davor gehört hatte. Obwohl Sorrel nicht alles oder auch nur den Großteil davon glaubte, bereitete es ihr Freude, Großmutter Bellas Geschichten zuzuhören.
Diese hatte ihr von Einrichtungen wie den Großläden erzählt. In diesen riesigen Geschäften fand man Lebensmittel in einer Reihe hinter der anderen, vom Boden bis zur Decke gestapelt. Sorrel hatte schon von den Läden in der Stadt Dinawl gehört, aber die waren nichts, verglichen mit der Zeit Davor, als die Menschen weder jagen noch sammeln mussten, um zu überleben. Damals waren sie einfach in Großläden gegangen, hatten alles, was sie haben wollten, in Schubkarren gepackt und mit nach Hause genommen. Obst aus allen Teilen der Welt wurde mit Metallmaschinen, die wie Fledermäuse über den Himmel flogen, in die Großläden geliefert, oder auch mit riesigen Schiffen, die die Weltmeere befuhren. Die Welt Davor hatte aus einem Gewebe bestanden, das einem Spinnennetz ähnelte, aber das Netz war kaputt, die Stränge zerrissen. Heute lebten die Menschen abgeschieden und hatten nur selten Verbindung zu anderen Siedlungen.
Sorrel wünschte sich, sie könnte ihrer Großmutter mehr Fragen nach dem Davor stellen, aber dies war schon lange nicht mehr möglich. Sie setzte sich auf und fuhr mit den Fingern über das Muttermal am Handgelenk, zog die drei ineinandergreifenden Ringe nach. Großmutter zufolge war dieses Zeichen etwas Besonderes, und sie, Sorrel, war ebenfalls jemand Besonderes, aber so fühlte sie sich gar nicht; sie fühlte sich normal.
Sie zog die Jacke wieder an und strich den Ärmel glatt, sodass er das Muttermal verdeckte. Es war zwar schön, an Großmutter Bella zu denken, aber nicht zu oft und nicht zu lang. Nicht, wenn, wie sie es oft ausgedrückt hatte, noch so viel zu leben war.
Großmutter Bella war tot, aber Sorrel war am Leben. Sie hatte ihre Mutter, sie hatte Eli und sie hatte ihre kleine Schwester mit dem geflüsterten Namen Bella. Und sie hatte David. Wo Leben war, da gab es Hoffnung; manchmal nichts anderes. Oft gab es nichts anderes, besonders in den langen dunklen Wintermonaten. Heute jedoch herrschte Hoffnung und noch mehr.
Sie stellte sich auf den Stein und blickte auf Amat hinunter. Der Rauch der Torffeuer stieg von den morschen Hütten auf, und der erdige Geruch wurde von einem leichten Wind zu Sorrel heraufgetragen. Zeit, zurückzukehren und Frieden zu schließen.
Sie wurde rot, als sie an ihr Verhalten zuvor dachte, aber sie würde es gegenüber ihrer Mutter wiedergutmachen. Sie würde ihre Pflichten klaglos ausführen und mit den Kleinen helfen. Sie würde Eli necken und Baby Bella verhätscheln, und danach würde sie David aufsuchen und ihn fragen, ob er mit ihr einen Spaziergang durch den Rottwald machen wollte. Dort konnten sie Pilze sammeln und Waldkrabben jagen. Die zusätzliche Nahrung würde helfen, die Laune ihrer Mutter zu verbessern und vielleicht einige der so tief in deren Gesicht eingegrabenen Falten zu glätten.
Ärger blitzte kurz in ihr auf, als Mara aus den Schatten ihrer Gedanken auftauchte. Sie waren mal Freundinnen gewesen, aber inzwischen empfand sie Mara als Stein im Schuh, und so sehr Sorrel sich auch bemühte, sie konnte sie nicht abschütteln. Immer war Mara da, lächelte spöttisch, nörgelte, gab ihre Sprüche zum Besten und versuchte stets aufs Neue, Davids Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Die meisten jungen Männer in Amat waren Mara verfallen. So hatte sie die freie Auswahl. Ein dummer Ausdruck überkam jedes Männergesicht, wenn sie vorbeilief. Besonders Hemp litt in ihrer Nähe an Geistesabwesenheit, aber David schien gegen ihre Reize immun zu sein. Trotz Maras schneller Auffassungsgabe, ihres guten Aussehens und der leuchtenden roten Haare hatte sich David für Sorrel entschieden, und Mara hasste sie dafür.
Sorrel holte tief Luft und blickte mit hoch erhobenem Kopf zum Horizont. Sie und David sollten Amat verlassen und sich in die weite Welt hinauswagen. Sie konnten Dinawl besuchen. Vielleicht waren die Geschäfte dort nicht so beeindruckend wie die Großläden von der Zeit Davor, aber sie wären trotzdem etwas, was man bestaunen konnte. Und Sorrel hätte gern diese große Wasserfläche gesehen, die man das Meer nannte. Das wäre toll. Sie malte sich aus, wie sie beide gemeinsam loszogen, ein Bild, das noch schöner wirkte, wenn sie sich dabei vorstellte, wie Mara ihnen hinterherschauen würde, während Sorrel und David Amat verließen, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Sie ergötzte sich an dieser Vorstellung, als eine Bewegung südlich von Amat ihre Aufmerksamkeit weckte und sie aus den Zukunftsträumen in die Realität des Augenblicks zurückrief.
Reisendes Volk? Kurz geriet sie in Aufregung. Fast zwei Sommer lang war kein reisendes Volk nach Amat gekommen. Diese Leute wanderten in kleinen Gruppen durchs Land und boten Neuigkeiten und Artefakte aus der Zeit Davor gegen Nahrung, Unterkunft und ein Stück Trockenfleisch für den weiteren Weg an. Dachs, wenn sie Glück hatten, Dörrmaulwurf, wenn die Jagd schlecht verlaufen war. Sie brachten Geschichten aus anderen Siedlungen mit, darunter welche aus Dinawl. Sie erzählten von Reisenden, denen sie begegnet waren, und den seltsamen Begebenheiten, die sie gesehen hatten, und boten eine willkommene Abwechslung vom erbarmungslosen Kampf darum, Nahrung, Obdach und Verpflegung für alle bereitzustellen. Während Sorrel die Fremden näher kommen sah, schwand jedoch das Lächeln aus ihrer Miene. Ein reisendes Volk wanderte nicht in solch großen Gruppen und ging dabei auch nicht so verstohlen vor ...
Plötzlich war Sorel klar, wer die Fremden waren. Panisch stürmte sie den Berg herunter. Ihr Hals brannte wie Feuer, als sie am Haupttor eintraf.
Sie hielt den Ersten auf, dem sie begegnete, einen gebückten Alten namens Tom. Er blickte finster drein, als sie ihn am Wams packte.
»Was ist denn los, Sorrel?«
Sie deutete nach Süden, während sie schwer atmend hervorstieß: »Wir werden angegriffen!«
»Angegriffen? Wer sollte uns angreifen?«
Der Wind trug jedoch schon die aggressiven Laute der Horde heran. So dicht an der Siedlung bewegte sie sich nicht mehr heimlich, sondern mit offener Feindseligkeit.
Die Einwohner Amats führten gelegentlich Übungen in Voraussicht auf einen solchen Notfall aus, aber sie taten es mit einer Bequemlichkeit und mit mangelndem Eifer, da viele Jahre ununterbrochen Frieden herrschte. Ihre Kämpfe trugen sie mit der Erde aus, ihre Gefechte mit den Elementen. Wenngleich sie mit dem Tod vertraut waren, war ihnen Blutgier fremd, und so zeigten sie sich schlecht auf den Sturm vorbereitet, der über sie hereinzubrechen drohte.
Als die ersten Warnrufe ertönten, liefen sie aufgescheucht umher, brachten die kleinen Kinder in Sicherheit und griffen zu dem notdürftigen Arsenal von Schleudern, Äxten und Keulen. Inmitten des Chaos bezogen sie Stellung auf den spärlichen Befestigungen und machten sich mit zitternden Beinen und entschlossenen Herzen bereit, sich zu verteidigen.
Gerade noch rechtzeitig half Sorrel dabei, das Haupttor zu schließen und zu verrammeln, aber das dürftige Holz aus dem Rottwald zeigte sich dem Ansturm nicht gewachsen. Die Feinde brachen hindurch, als stünde ihnen nicht mehr als der Nebel über dem Moor im Weg.
Sorrel wich zurück, als die Angreifer nach Amat hineinstürmten und dabei den üblen Gestank von verfaultem Fleisch und eiternden Wunden und eine Angst mitbrachten, wie Sorrel sie noch nie erlebt hatte.
Mutanten! Einer von ihnen, der vielleicht bemerkt hatte, wie ihr der Atem stockte, drehte den mächtigen Kopf und warf einen Blick auf sie. Er war ein Mensch, aber nur mit knapper Not.
Die kleinen tief liegenden Augen des Mutanten wurden von einer massigen Stirn getrennt, die so breit wie ein Torfmoor war. Von einer Nase konnte man kaum sprechen, und die Nasenlöcher öffneten sich direkt ins Gesicht, als wären sie dort hineingekratzt worden. Er trug Tierfelle, an denen noch die Klauen und Schwänze der ursprünglichen Besitzer baumelten.
Sorrel drückte sich an den Zaun, während der Mutant auf sie zuging. Er schnaubte, als er sah, wie sie vor ihm erschauerte. Sie befahl ihren Beinen zu laufen, aber sie zitterten, als wären die Knochen aus ihnen herausgesaugt worden, und weigerten sich zu gehorchen.
Der Mutant wandte seine Maulwurfsaugen ab, als ein greller Schrei die Luft durchschnitt. Das genügte Sorrel als Ablenkungsmanöver. Sie nahm ihre Kraft zusammen und rannte davon, ehe der Mutant bemerkte, dass sie fort war. Im Laufen holte sie das Messer aus der Tasche und klappte es auf.
Die Mutanten waren den Bewohnern der Siedlung an Zahl weit unterlegen, aber sie hatten richtige Waffen, viele davon aus Metall. Damit schlugen sie Schädel ein und schlitzten Hälse auf, als häuteten sie lediglich Fledermäuse für den Kochtopf.
Sorrel bahnte sich einen Weg durchs Getümmel und steuerte ihr Haus an. Sie musste ihre Familie finden. Überall herrschte Chaos. Schreckensschreie übertönten das Bersten von Knochen und das raue Gelächter der Eindringlinge, das ihr brutales Gemetzel begleitete.
Sorrel stürmte die Wege zwischen den Hütten entlang und stieß zufällig auf David, der an der Seite seines Vaters kämpfte. Der Mutant war eine riesige Frau mit der zerknitterten Haut einer bleichen Kröte. Sorrel zögerte einen Augenblick, ehe sie das Messer ins Monster rammte. David schrie ihr zu, während das Monster heulte.
»Deine Mutter ... Lauf!«
Sorrel zog das Messer aus dem Fleisch der Mutantin und rannte heimwärts, stoppte aber plötzlich in der schmalen Gasse zwischen den Behausungen der Nachbarn, als ihre Mutter aus der eigenen Hütte kam, der Blick glasig und das Baby fest an sich gedrückt. Da war Rot zu sehen, viel Rot, und Bella rührte sich nicht. Agonie fraß sich in das Gesicht ihrer Mutter, und es zerriss Sorrel das Herz. Einen kurzen Moment lang begegneten sich ihre Blicke.
Ihre Mutter formte mit den Lippen das Wort »Lauf«, aber Sorrel konnte sich nicht bewegen. Sie stand wie angewurzelt, während ein untersetzter Mutant hinter ihrer Mutter auftauchte und ihr so mühelos den Hals brach, als wäre es ein Zweig aus dem Rottwald.
Als ihre Mutter zu Boden sackte, entrang sich Sorrel ein Schrei. Sie presste sich die Hand auf den Mund, unterdrückte ihre Wut und ihre Angst, denn sie begriff instinktiv, dass sie nur überleben konnte, wenn sie still war, klein war, obwohl sie nichts weiter tun wollte, als zu schreien, sodass es den Himmel zerriss. Sorrel drückte sich in die Schatten und verharrte dort zitternd für nicht mehr als zwei Atemzüge, ehe Eli aus der Hütte getapst kam und heulte.
»Mama.«
Der Mutant warf sich herum. Eli blickte zu dem Monster auf, die Augen von Tränen verquollen, das Gesichtchen vom Weinen gerötet. Sorrel sah entsetzt zu, wie ihr Bruder die Arme hob.
»Hoch!«
Der muskelbepackte Mutant starrte auf das Kind hinab. Eli hüpfte.
»Hoch, hoch!« Sein Flehen war eindringlich.
Das Monster lachte, ehe es ihn aufhob und davontrug.
Sorrel sank in die Knie. Warum hatte sie Eli nicht geholfen? Sie hätte den Mutanten angreifen, ihm in den Hals stechen, ihm die Augen herausreißen können, irgendwas. Aber sie hatte nichts getan.
Eine neue Flut von Schreien brandete auf. Jetzt war nicht die Zeit für Reue. Sie konnte sich später noch niedermachen, aber jetzt musste sie loslaufen, ehe aus ihr eine weitere Leiche wurde.
Sie überzeugte sich davon, dass der Weg frei war, ehe sie sich geduckt in die Familienhütte schlich. Ihr Zuhause war verwüstet. Die Möbel waren zerschlagen und umgeworfen, das Geschirr zerschmettert, die Kleidung verstreut. Sorrel suchte sich durch die Verwüstung einen Weg in das, was einmal das Schlafzimmer ihrer Eltern gewesen war.
Schlafzimmer war ein großspuriges Wort für einen durch einen groben Vorhang von der restlichen Hütte abgetrennten Raum. Der Vorhang war in Fetzen geschlitzt. Sorrel schob ihn zur Seite und legte das Chaos dahinter frei. Die Bettwäsche war heruntergerissen, die Matratze aufgehackt und das Füllmaterial aus Heidekraut quoll hervor. War das wahllose Zerstörung, oder hatten die Mutanten nach versteckten Dingen gesucht? Sorrels Herz klopfte heftig, während sie einen Haufen weggeschleuderte Bettwäsche beiseiteschob. Wenn die Mutanten die Truhe entdeckt hatten, blieb Sorrel nichts außer den Kleidern, die sie trug, und dem Messer.
Die schwere Holztruhe lag unberührt unter den weggeworfenen Decken. Vielleicht hatten die Mutanten sie nicht bemerkt oder nicht beachtet, da das Holz der Truhe dunkel und der Schlafraum spärlich beleuchtet war. So oder so war Sorrel erleichtert, das Schloss intakt zu sehen. Sie öffnete es und holte den Rucksack heraus, den ihr Großmutter vermacht hatte. Darunter lag das zusammengefaltete Hochzeitskleid ihrer Mutter. Ein Schluchzen blieb Sorrel im Hals stecken, aber von draußen drang das kehlige Gebrüll und Geschrei der Mutanten herein. Es war Zeit zu gehen.
Sorrel fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen und lief zur Tür. Sie spähte durch den Türspalt, aber bereits durch diese schmale Ritze konnte sie erkennen, dass sie auf diesem Weg nicht fliehen konnte, ohne entdeckt zu werden – zu viele Mutanten trieben sich vor dem Haus herum.
Entschlossen verstärkte sie den Griff um die Messerscheide. Lieber schnitt sie sich selbst den Hals auf, als dass sie ihnen das Vergnügen gönnte, sie umzubringen. Es musste einen Weg hinaus geben, und wenn doch nicht, dann würde sie sich einen schaffen.
Sie hob eine Scherbe des zerschlagenen Tongeschirrs auf und ging damit zur hinteren Hüttenwand, wo sie die Matte zurückzog, die den festgestampften Erdboden bedeckte, und zu graben begann. Sobald das Loch groß genug war, legte sie sich auf den Bauch und warf einen Blick nach draußen. Sie sah nicht viel mehr als den Erdboden vor ihr, aber der Weg schien frei.
Nach ein wenig Arbeit war die Lücke groß genug, um sich hindurchzuzwängen. Sorrel lauschte einen Augenblick lang angestrengt, ehe sie den Kopf ins Freie steckte und sich umsah. Das Getöse lag hinter ihr, aber hier war alles ruhig. Sie konnte es schaffen.
Sie schlüpfte in die Hütte zurück und nahm den Rucksack in die Hand. Sie wollte schon hinauskriechen, als ihr Blick auf den umgekippten Vorratsschrank fiel. Teile davon waren abgesplittert, aber im Großen und Ganzen war er intakt geblieben und die Tür verriegelt. Sorrel öffnete den Schrank und blickte hinein. Ihre Familie würde für den kleinen Vorrat an Trockennahrung, der dort aufbewahrt wurde, keine Verwendung mehr haben, und so packte sie die Beutel in die Tasche. Sie kehrte zum Loch zurück, legte sich auf den Bauch und blickte hindurch. Alles frei.
Die Unterkante der Wand drückte sich ihr in die Schultern und scharrte an ihnen entlang, als sie sich ins Freie zwängte, aber die Jacke schützte ihre Haut, und ein paar blaue Flecken waren ein geringer Preis für ihr Leben.
Sobald die Schultern hindurch waren, wurde es einfacher. Sie schob sich weiter, bis sie ganz frei war, und griff durch die Lücke nach der Tasche, die noch in der Hütte lag. Aber als sie den Arm ausstreckte, fiel ein Schatten auf sie.
Sorrel erstarrte, als zwei gewaltige Füße in ihr Blickfeld traten. Die schwielige Haut, die sich von den Sohlen nach oben zog, war tief verschmutzt, und die breiten Zehenlücken voll mit vermoderndem Zeug. Der linke Fuß hatte sechs Zehen, drei davon winzige Knubbel, zwei grotesk groß; der rechte Fuß war vierzehig, und jeder Zeh hatte einen dicken gelben Nagel, eingerissen und umrahmt von dunklem Dreck.
Sorrel hob den Kopf. Während ihr Blick die Gestalt vor ihr hinaufwanderte, erkannte sie, dass sie es mit dem gleichen maulwurfsäugigen Mutanten zu tun hatte, der sie schon am Zaun in die Enge getrieben hatte. Das Herz donnerte ihr laut in der Brust, als er sie aus zusammengekniffenen Augen musterte, und schien aus ihrem Brustkorb herausplatzen und sich in die Erde vergraben zu wollen. Als der Mutant den Mund öffnete und die zu scharfen Spitzen gefeilten Zähne freilegte, blieb ihr das Herz stehen.
Sie war so gut wie tot.
2.Beißwerkzeug
Ein krächzendes Lachen entwich dem Mutanten durch die Lücken zwischen den spitzen Zähnen. In dem Augenblick, als er sich an Sorrels Not ergötzte, zog sie ihm das Messer über die Rückseite eines Beins. Sie hatte nur einen Versuch, und dieser musste ihr gelingen. Sorrel durchtrennte Haut und Sehnen bis auf die Knochen.
Der Mutant heulte auf und kippte um wie ein gefällter Baum. Er krümmte sich auf der Erde und griff nach Sorrel, während sie ihren Rucksack hervorzerrte. Sie rappelte sich verzweifelt auf, wollte entfliehen, ehe sein Gebrüll die anderen Mutanten alarmieren konnte, aber er packte sie am Fuß, und sie fiel der Länge nach zu Boden. Tasche und Messer flogen ihr aus der Hand. Sorrel wand sich und trat mit dem anderen Fuß nach ihm, aber er hielt sie fest. Er hatte Schaum auf den Lippen und Mord im Blick, während er auf sie zukroch.
Sorrel streckte sich mit aller Kraft nach ihrem Messer, aber der Mutant zerrte fest an ihr. Er robbte auf sie zu und zog dabei eine Blutspur hinterher. Bei einem so hohen Blutverlust müsste er schwächer werden, ganz bestimmt wurde er schwächer, aber sie fand in seinem Gesicht kein Anzeichen davon. Er grinste, während er den Abstand zwischen ihnen verringerte und auf sie zu krabbelte wie eine Spinne auf die Fliege in ihrem Netz.
Sorrel hörte auf zu zappeln und hielt still, bis der Mutant in Reichweite war. Dann trat sie mit dem freien Fuß zu. Sie trat so kräftig sie konnte. Die Schuhsohle traf ihn mitten ins Gesicht. Sein Griff öffnete sich, und Sorrel war schon wieder auf den Beinen, als er losheulte. Eilig sammelte sie Messer und Tasche auf und rannte in dem Wissen los, dass ihr Leben davon abhing.
Sie war schon tief im Rottwald, als sie anhielt. Zunächst hörte sie nichts weiter als den eigenen schweren Atem, aber während sie sich erholte, drangen die Geräusche des Waldes wieder zu ihr durch. Insekten summten und klickten, Blätter raschelten, Zweige knarrten, Flügel flatterten. Sogar ein Vogelgezwitscher war in der Ferne zu hören. Die Laute umkreisten sie und kehrten dann zu der Stelle zurück, wo Sorrels Tränen auf den Mulch des Waldbodens tropften.
Ihre Mutter war tot, Bella war tot. Ihr Heim zerstört. Und was war aus Eli und David geworden? Sorrel müsste zurückgehen und es herausfinden, aber als sie an den Mutanten dachte, der sie gepackt hatte und mit seinen spitzen Zähnen und seinem stinkenden Atem auf sie losgegangen war, weigerte sich ihr Körper, sich zu bewegen.
Also lag sie weiter auf der Erde, grub die Finger in die feuchte Erde und atmete den schweren Geruch verfaulender Vegetation ein. Ein Schwarm Waldkrabben wuselte vorbei, doch sie lag reglos da und rührte sich nicht mal, als eine dicht genug an ihr vorbeilief und mit den Kanten des Panzers ihre Wange streifte.
Waldkrabben – die hatte sie für ihre Mutter jagen wollen. Jetzt konnte sie sich nicht mehr mit ihr versöhnen.
Die Last der Trauer wog zu schwer. Sie spürte, wie sie abschaltete. Taubheit sickerte in ihre Gliedmaßen.
Als sie erwachte, war der Mond aufgegangen. Die Erde hatte Sorrel alle Wärme ausgesaugt, und sie zitterte. Sie hatte kaum ihre Sinne zusammen, als ein Zweig in der Nähe zerbrach. Sie setzte sich auf. Etwas raschelte im Unterholz. Es war bereits in ihrer Nähe und kam noch näher. Die Mutanten, die auf der Jagd nach ihr waren!
Sie tastete nach dem Messer, aber die Finger waren so steif, dass sie sie kaum bewegen konnte. Weiteres Rascheln. Ihr Atem stockte, aber als sie weiter lauschte, wurde ihr bewusst, dass es kein Mutant war. Die Kreatur grunzte, während sie den Waldboden durchwühlte. Vermutlich ein Dachs.
Sorrels Erleichterung war kurzlebig. Ihr war ein Dachs lieber als ein Mutant, aber nicht viel. Dachse waren aggressiv und launenhaft. Nur törichte Menschen würden es allein mit einem aufnehmen. Außerdem war Sorrels Körper taub von Kälte; es war dunkel, und ihr kleines Messer war einem Dachs nicht gewachsen.
So leise wie möglich sammelte sie ihre Sachen ein und bewegte sich rasch von dem Tier weg. Nach einer Weile blieb sie stehen und lauschte, um sicherzugehen, dass ihr die Kreatur nicht folgte. Die Geräusche waren leise und boten keinen Grund zur Sorge. Sie setzte ihren Weg fort, bis sich ihr Körper lockerte und das Blut wieder frei strömte. Sie spürte ihre Gliedmaßen wieder, aber auch den nagenden Hunger. Sie hatte schon lange nichts mehr gegessen. Nicht mehr seit dem gemeinsamen Frühstück aus gerösteten Nüssen und Pilzbrei mit ihrer Mutter und Eli. Bei der Erinnerung an diese schlichte Familienszene fiel sie auf die Knie.
Warum hatte sie ihrer Mutter nicht geholfen? Warum hatte sie den Mutanten nicht getötet, der ihre Familie zerstört hatte? Warum war sie geflüchtet? Warum hatte sie Eli und David im Stich gelassen? Warum, warum, warum? Sie hob den Blick durch den wuchernden Baldachin des Waldes zum Mond und starrte ihm lange und angestrengt ins ausdruckslose Gesicht. Der Mond hatte keine Antwort für sie, aber eine andere Stimme drang in ihren Kopf. Stark und selbstbewusst klang sie, die Stimme ihrer Großmutter. Gib nicht auf, Sorrel. Du musst leben. Du hast noch so viel vor dir.
Sie dachte einen Augenblick darüber nach. Ja, da wartete noch viel Leben auf sie, aber auch viel Sterben. Sie wollte essen, sich ausruhen und sich im bleichen Licht kurz vor der Morgendämmerung auf die Jagd nach den Mutanten machen, die ihr so viel genommen hatten. Sie würde sie finden und jedem Einzelnen die Kehle durchschneiden. Und falls Eli und David noch lebten, würde sie sie finden.
Und wenn nicht? Sie ertrug es nicht, daran zu denken. Sie waren am Leben. Sie mussten einfach am Leben sein. Eli und David waren am Leben ... Die ganze bittere einsame Nacht hindurch klammerte sie sich verzweifelt an diesen Gedanken.
Sorrels angstgetriebene Flucht vor den Mutanten hatte sie tief in den Rottwald geführt, und so war der Rückweg nach Amat länger als erwartet. Die Sonne war schon aufgegangen, als Sorrel aus dem Wald trat. Sie roch Amat, lange bevor sie die Siedlung sah. Diesmal war es nicht der süße Duft des brennenden Torfs, der mit dem Wind herantrieb, sondern der Qualmgestank glimmender Hütten.
Es war still in der verlassenen Siedlung, während sich Sorrel einen Weg durch die Ruinen bahnte. Niemand grüßte sie; kein Kind rief. Sie hätte geweint, wären ihre Tränen nicht längst versiegt.
Einige wenige Hütten standen noch, aber den größten Teil von Amat hatten die Mutanten niedergebrannt oder zertrümmert. Warum hatten sie das getan? Die Menschen von Amat hatten sich vielleicht untereinander gestritten und gezankt, aber zu Fremden waren sie immer freundlich gewesen. Warum waren die Mutanten über sie hergefallen?
Die schlimmsten Zerstörungen fand Sorrel im Zentrum des Dorfs, nahe der Stelle, wo sie vor gerade mal einem Tag zusammen mit David gesessen hatte. Es fiel ihr schwer, daran zurückzudenken, wie sie einander angelächelt und kein größeres Problem gehabt hatten als die Nörgelei ihrer Mutter. Sie war aus Richtung des Kräutergartens gekommen, während Mara sie von hinter einer Hütte beobachtet hatte, die nicht mehr existierte. Was hätte Sorrel nur gegeben, um irgendjemanden von ihnen wieder bei sich zu haben! Selbst Mara.
Dieser Ort, den Sorrel schon ihr ganzes Leben lang kannte, war kaum wiederzuerkennen. Überall lagen Leichen, zurückgelassen, um zu verwesen, wo sie gefallen waren. Glasige Augen starrten blind zum Himmel, während die Sonne über einen Tag hinwegfuhr, den sie nie erleben würden; lautlose Lippen standen offen, als sprächen sie ihre letzten Worte.
Zunächst versuchte Sorrel, die Gefallenen nicht anzusehen, aber dann wurde sie sich bewusst, dass sie es tun musste. Sie musste erfahren, wer unter den Toten war. Während sie von einer Leiche zur nächsten ging, schloss sie ihnen die Augen. Freunde und Nachbarn. Sie wünschte ihnen, Frieden im Tod zu finden, und lief durch den Ort, der einmal Amat gewesen war. Sie entdeckte Davids Vater. Er war in der Nähe der Stelle niedergemacht worden, wo sie ihn zuletzt gesehen hatte. Von David fehlte jede Spur.
Widerstrebend folgte sie ihrem Weg bis dorthin, wo sie die eigene Familie zuletzt gesehen hatte. Die Leiche ihrer Mutter lag noch da, der Kopf in einem unnatürlichen Winkel zum Rumpf, der Mund vor Schreck weit aufgerissen.
Sorrel kniete sich neben sie. Bella lag abgeschirmt unter der Mutter, und dafür war Sorrel dankbar. Sie schloss ihrer Mutter die Augen und stand auf. In diesem Dorf war es Sitte, die Toten zu bestatten, aber es waren so viele, und Sorrel war allein. Die Erde würde sie bald auch so zurückfordern.
Sie wollte gerade fortgehen, als sie ein Funkeln am Erdboden bemerkte. Bellas Halsband. Sorrel hob es aus dem Dreck auf und ließ die zierliche Kette durch die Finger gleiten, bis der silberne Stern auf ihrer Handfläche lag.
Sie hatte sich durch Amat geschleppt, die Glieder schwer vor Gram, aber als sie das Amulett betrachtete, stieg ein flammender Zorn in ihr auf. Er verdrängte die Trauer, brannte sich in ihr Herz, strahlte in die Gliedmaßen und durchdrang alle Fasern ihres Seins.
Von frischer Kraft erfüllt, steckte sie sich Bellas Halsband in die Tasche, ehe sie den Mund öffnete und in die Stille brüllte:
»ELI! DAVID!«
Sie lief durch das geplünderte Dorf und rief immer wieder ihre Namen. Sie erhielt keine Antwort, rief aber weiterhin. Schließlich blieb sie in der Nähe des Kräutergartens stehen, schnappte nach Luft und gönnte ihrer Kehle eine Pause. Während sie sich erholte, hörte sie etwas hinter sich. Einen Laut, ihr wohlbekannt war. Sie fuhr herum.
Der Mutant mit den Maulwurfsaugen lehnte zusammengesunken an der Wand eines zerstörten Schuppens, das verletzte Bein mit Lumpen verbunden. Angst stieg in Sorrel auf, aber trotz seines rauen Lachens war sein Blick teilnahmslos, als liefe alle Lebenskraft aus ihm heraus. Er war am Ende.
Sie hasste diese abscheuliche Kreatur und alle ihresgleichen, und sie verspürte den sehnlichen Wunsch, ihn zu verletzen. Sie würde ihm so wenig Gnade schenken wie er den Menschen von Amat.
Sorrel zog das Messer, um es dem Monster ins Herz zu stoßen. Sie war schon in Griffweite, als sie das listige Glitzern in seinen Augen bemerkte. Sie sprang zurück, als er nach ihr langte. Er versuchte, seine Enttäuschung durch schnarrendes Gelächter zu überspielen, aber sie wusste jetzt, was für ein Spiel er spielte. Sie wich zurück und betrachtete ihn mit kaltem Blick. Der Mutant starrte unverwandt zurück, und sein Hohnlächeln legte die spitzen Zähne frei.
»Deine Freunde halten wohl nicht viel von dir, Mutant. Sie haben dich im Stich gelassen, damit du allein stirbst.«
Der Mutant wich kurz ihrem Blick aus, bevor er sich wieder fing und die Achseln zuckte.
Sorrel umkreiste ihn. Mehrere Töpfe standen an der Wand, daneben etliche Bündel, der Inhalt grob in Felle gewickelt. »Was hast du da, Mutant? Haben deine Freunde dir Nahrung und Wasser dagelassen?«
Sorrel lächelte ihn an. Der Mutant kniff die winzigen Augen zusammen und versuchte sich wahrscheinlich auszurechnen, was sie im Schilde führte. Er schien schnell zu begreifen. Sie wandte ihm den Rücken zu und ging zum Kräutergarten. Die Pflanzen waren herausgerissen und zertrampelt worden, was sie nicht weiter überraschte, aber Sorrel suchte nicht nach Kräutern. Stattdessen zog sie eine stabile Rute aus der Erde. Sie diente als Rankstab für das Flohkraut.
Als sie zurückkehrte, war das höhnische Grinsen des Mutanten einer finsteren Miene gewichen. Sie stieß den ersten seiner kostbaren Wassertöpfe um, und er knurrte und griff nach dem Stock, aber sie war zu schnell für ihn. Sie stocherte nach dem zweiten Topf und täuschte Bewegungen an und zog den Stab zurück, den der Mutant abzuwehren oder zu entreißen versuchte. Sie hatte schon den größten Teil seines Wasservorrats vergossen und war gerade dabei, die Lebensmittelpakete aus seiner Reichweite zu schnippen, als er ausholte. Sorrel wich ihm aus, aber der Mutant konnte den Stock an sich reißen. Ein belegtes Knurren drang ihm aus der Kehle, während er die Zähne bleckte.
Jetzt war es an Sorrel, spöttisch zu grinsen. »Du kannst ihn haben, Mutant. Vielleicht kannst du damit in Kriechweite Wasser auspendeln.«
Er warf sich hin und her und tobte wie eine Hornisse, der man die Flügel ausgerissen hatte. Er riskierte dabei, das bisschen Wasser zu verschütten, das ihm verblieben war. Sorrel feixte bei dieser Vorstellung, während sie um ihn herumhuschte und die Essensbündel einsammelte. Sie stanken wie sein Atem. Was aßen Mutanten überhaupt? Sorrel entschied, dass sie es gar nicht wissen wollte, und warf die ungeöffneten Päckchen in die warme Asche einer glimmenden Hütte. Sie kannte die Familie, die dort gewohnt hatte, hatte ihnen die toten Augen geschlossen. Die Bündel qualmten und zischten eine Weile, ehe sie in Flammen aufgingen.
Sie brauchte sich nicht die Mühe zu machen, der Kreatur ins Herz zu stechen, wenn sie sie genauso gut verhungern lassen konnte. Sobald es Neumond würde, wäre der Mutant entweder tot oder am Sterben. Es würde langsam vonstattengehen, aber er hatte kein schnelles Ende verdient.
Während die letzten Reste seiner Lebensmittel verbrannten, wandte sich Sorrel wieder ihm zu. Er besaß immer noch ein bisschen Wasser, und vielleicht versteckte er hinter seinem massigen Körper noch einen Nahrungsvorrat, aber solche Reserven verlängerten nur ein qualvolles Sterben.
Sie erwartete, dass er heulte und brüllte, während sein Essen verbrannte, oder dass er wenigstens den Stock nach ihr warf. Stattdessen stieß er einen wimmernden Laut aus. Auch ohne Worte verstand Sorrel genau, was er ihr mitteilte. Sie konnte kaum umhin, es zu verstehen, als er die Arme in grausamer Nachahmung hochreckte.
Hoch, hoch!
Eli. Der Mutant wusste, was aus Eli geworden war.
»Wo ist er?« Sorrel schrie die Worte, sodass ihr die Kehle wehtat. »Wo ist er? Wo ist Eli?«
Der Mutant kicherte und wiederholte die Geste, reckte die Arme gen Himmel und wimmerte.
Sorrel hob einen Stein auf und warf ihn dem Mutanten an den Kopf. Er fuhr mit seiner Pantomime fort. Sorrel warf einen weiteren Stein und dann noch einen. Die Haut über der Augenbraue platzte ihm auf. Er hörte auf zu wimmern und knurrte Sorrel an.
»Wo ist er?«, wiederholte sie.
Der Mutant wandte den Blick ab, und als sie noch mehr Steine warf, sank er in sich zusammen und schloss die Augen. Sie konnte zwar weiter Steine auf ihn werfen, bis einem von ihnen die Kräfte ausgingen, aber sie würde ihm nichts entlocken. Er hatte abgeschaltet. Egal, er lag ohnehin im Sterben.
Der Tod umgab sie hier überall, aber von Eli und David fehlte jede Spur. Auch andere waren verschwunden. Sie hatte weder Mara noch Hemp gesehen. Wenn sie darüber nachdachte, dann wurde ihr bewusst, dass nicht viele der jüngeren Einwohner Amats unter den Toten waren. Die Mutanten mussten sie mitgenommen haben. Sorrel dachte lieber nicht über den Grund nach. Sie klammerte sich an den Gedanken, dass Eli und David irgendwo da draußen noch lebten.
Sorrel hob ihre Tasche auf und verließ Amat. Sie drehte sich nicht um, damit sie beim Anblick ihres zerstörten Zuhauses nicht zusammenbrach. Vielmehr waren ihre Augen fest nach vorn gerichtet. Ihre Zukunft lag da draußen hinter dem Horizont.
Zertrampelte Erde zeigte ihr den Weg, den die Mutanten eingeschlagen hatten. Er wies nach Süden. Sie hatten mehr als einen halben Tag Vorsprung, aber sie bewegten sich im Rudel und hatten eine Gruppe Gefangener dabei. Sorrel müsste sie innerhalb eines Tages einholen können.
Wenig später verschmolz der Pfad der Mutanten mit einem Weg aus der Zeit Davor. Die Straße war zerstört und an manchen Stellen nicht mehr sichtbar, aber man konnte ihr nach wie vor folgen. Diese Route führte geradlinig durch das ganze Land, was sie gefährlich machte.
In ihren Kindertagen hatte man Sorrel stets gewarnt, sich an der Straße der Verwüstung aufzuhalten. Die Vorstellung der Gefahr hatte für sie eine solche Verlockung dargestellt, dass sie sich mehrfach dicht herangewagt und jedes Mal enttäuscht festgestellt hatte: Es waren weder Mutanten noch andere Gräuel zu sehen. Diesmal schlich sie nicht an der Straße umher. Sie lief frei. Die Gefahr lag vor ihr.
Als sich die Sonne dem Horizont näherte, war Sorrel schon weiter vorgedrungen als auf allen früheren Reisen. Sie verließ die Straße und suchte nach einer Stelle fürs Nachtlager.
Sie entdeckte einen umgestürzten Baum nicht weit von einem Fluss entfernt. Die Wurzeln hatten die Erde hochgezogen, sodass sie Schutz vor dem Wind bot. Sorrel schnitt Farne, um sich daraus ein Bett zu machen, und sammelte Brennholz. Noch war genug Zeit, bis die Dunkelheit einbrechen würde und sie nach Waldkrabben stöbern könnte. Es war unsinnig, die mitgeführten Vorräte zu benutzen, wenn sie vor Ort frische Nahrung fand. Unter einem vermoderten Baumstamm am Fluss trieb sie einen Schwarm auf. Sie konnte zwei der Krabben auf den Rücken werfen, ehe diese mit den anderen davongekrabbelt waren, und tötete sie mit Stichen durch die Maulpartie.
Sorrel war es gewöhnt, ihren Fang mit anderen zu teilen, aber heute Abend würde sie allein essen. Allein. Sie verbannte dieses quälende Wort rasch aus ihren Gedanken und dachte lieber daran, was für eine zufriedenstellende Mahlzeit die Waldkrabben zu werden versprachen. Sie trug sie zu ihrem Lager und entfachte das Feuer mit einem Feuerstein aus ihrer Tasche. Sobald die Flammen ein wenig heruntergebrannt waren, röstete Sorrel ihre Beute über der Glut, ehe sie sie öffnete und das Fleisch direkt aus den handtellergroßen Schalen verspeiste.
In der Welt Davor waren Waldkrabben viel kleiner gewesen – höchstens so groß wie ein Fingernagel. Sorrels Großmutter hatte oft lachend festgestellt, dass die Welt auf den Kopf gestellt worden war. Kleine Dinge waren riesig geworden, große Dinge wiederum geschrumpft oder ganz ausgestorben.
Nach dem Essen schüttete Sorrel die Tasche aus. Sie beinhaltete etliche kleine, in Blätter gewickelte Päckchen mit Dörrdachs, Pilzen und Kräutern aus dem Vorratsschrank. Diese hatte sie selbst in die Tasche gesteckt, zusammen mit einer aus ausgeschmolzenem Dachsfett gefertigten Kerze. Der übrige Inhalt stammte von ihrer Großmutter: ein Wetzstein für ihr Messer, ein Feuerstein, ein Metalllöffel, ein kleiner Metalltopf, ein Beutel mit einem goldenen Taschenspiegel und am Boden der Tasche ein eng zusammengefalteter Kapuzenmantel aus einem dünnen strapazierfähigen Stoff aus der Welt Davor.
Von diesen Gegenständen faszinierte der Spiegel sie am meisten. Der schwarze Samtbeutel war abgewetzt, aber das goldene Gehäuse wies kaum einen Kratzer auf. Das Gold glitzerte und glänzte im Feuerschein, als Sorrel den Taschenspiegel in der Hand drehte.
Sie öffnete ihn nicht. Sie fand es befremdlich, das eigene Gesicht so klar gespiegelt zu sehen. So sehr, dass David über ihr Unbehagen gelacht hatte; und sie hatte sich gewünscht, sie hätte ihrer Großmutter gehorcht und die Tasche mitsamt Inhalt geheim gehalten. Jetzt hätte sie die Tasche und alles, was sie enthielt, gern dafür eingetauscht, dass David sie erneut neckte.
Sie wickelte sich in den Umhang und legte sich für die Nacht aufs Farnbett.
Als die Sonne am Morgen ihre ersten Strahlen über den Horizont sandte, war Sorrel schon wieder auf der Straße unterwegs. Sie war überzeugt, an diesem Tag die Mutanten zu sichten, aber bei Einbruch der Nacht gab es keinerlei Hinweise, dass der Vorsprung schmolz.
Der dritte Tag verstrich auf ermüdende Art und Weise, sie setzte einen Fuß vor den anderen, immer wieder und wieder. Sorrels Laune war schon so tief gesunken wie die Sonne am Himmel, als sie endlich in der Ferne die Meute erblickte. Sie war überzeugt, sie am nächsten Tag einzuholen.