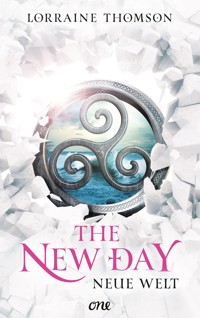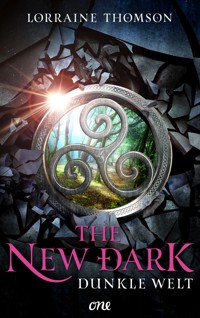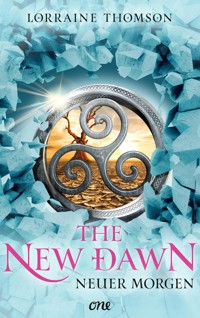
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark-Times-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Sorrels Suche nach ihrem Bruder und ihrer großen Liebe David führt sie nach Dinawl. Die Stadt wird von den geheimnisvollen Monitoren beherrscht und kontrolliert - doch im Untergrund regt sich der Widerstand ...
In einer Welt, in der nichts ist, wie es scheint, wo das Überleben von der Gnade eines Fremden abhängt, und enge Freunde die erbittertsten Feinde sein können, wie kann Sorrel wissen, wem sie noch trauen kann?
Liebe ist die einzige Rettung in einer dunklen Welt - die spannende Dark-Times-Trilogie von Lorraine Thomson:
Band 1: The New Dark - Dunkle Welt
Band 2: The New Dawn - Neuer Morgen
Band 3: The New Day - Neue Welt
ONE. Wir lieben Young Adult. Auch im eBook.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Titel
Teil Drei – RACHE
1. Verbrennungen dritten Grades
2. Wund gerieben
3. Das Aufruhrgesetz
4. Eine Geschichte von noch mehr Leid
5. Freund oder Feind?
6. Offene Fragen
Sorrel
David
7. Zeter und Mordio
Sorrel
David
8. Eintopf mit Sauerampfer
Sorrel
David
9. Engel ohne Flügel
10. Die leere Schlinge
Teil Vier – FREUNDSCHAFT
11. Die Schlinge wartet
12. Seelentot
13. Konsequenzen
14. Wohlstand für alle
15. Alle Menschen sind gleich
16. Ein Schritt zu weit
17. Tief im Wald
18. Mit Trauer gewürzt
19. Die Ödnis
20. Die Güte von Fremden
Epilog
Über die Autorin
Alle Titel der Autorin bei ONE
Impressum
Über dieses Buch
Sorrels Suche nach ihrem Bruder und ihrer großen Liebe David führt sie nach Dinawl. Die Stadt wird von den geheimnisvollen Monitoren beherrscht und kontrolliert – doch im Untergrund regt sich der Widerstand ...
In einer Welt, in der nichts ist, wie es scheint, wo das Überleben von der Gnade eines Fremden abhängt, und enge Freunde die erbittertsten Feinde sein können, wie kann Sorrel wissen, wem sie noch trauen kann?
Lorraine Thomson
The New Dawn
Neuer Morgen
Aus dem Englischen von Thomas Schichtel
Teil Drei
RACHE
1.Verbrennungen dritten Grades
Alles Grauen, das Sorrel jemals erlebt hatte, verblasste neben der Vernichtung des Slums.
Als Dwayne gemeldet hatte, dass die Amtmänner die Barackenstadt überfielen, hatte Sorrel nur den Gedanken gehabt, an die Erdoberfläche zu gehen und zu helfen. Nun war sie da, doch sie wusste nicht, was sie tun sollte.
Einstein wirkte ebenso hilflos, wie er voller Grauen auf die schmutzigen Flammen starrte, die aus brennenden Schuppen schlugen.
Der Rauch wurde mit dem Wind mal dichter, mal dünner. Auf dünne Schwaden folgte dichter Qualm, bei dem Sorrel die Augen tränten und sich ihr Mund mit dem beißenden Gestank verbrannten Holzes füllte.
Ringsherum tobte das Chaos, während das Feuer von einer Behausung zur nächsten sprang. Die Menschen flüchteten aus ihren Heimen; zwischen dem Prasseln der Flammen, dem Bersten einstürzender Dächer und brüchiger Wände ertönen die verzweifelten Rufe nach ihren Lieben.
Manche trugen auf der Flucht aus der Glut ein paar Habseligkeiten, aber die meisten fanden sich mit leeren Händen wieder. Einige wenige rannten nicht davon, sondern standen mit leeren Gesichtern inmitten der Verwüstung, als hätten sie einfach abgeschaltet, unfähig, den Verlust zu verkraften.
»Was können wir tun?«
Einstein öffnete den Mund, brachte aber kein Wort hervor. Stattdessen schüttelte er den Kopf.
Auf einmal erkannte Sorrel im Meer der unbekannten Gesichter die Züge eines Menschen wieder und erlebte einen Augenblick völliger Stille, in der jedes Geräusch aus dem Slum ausgeblendet war. In diesen Sekunden blieb ihr sogar das Herz stehen.
Sie schloss die Augen, hielt den Anblick für einen grausamen Streich, glaubte, die enorme Hitze des Brandes würde ihr den Verstand kochen. Sie musste Halluzinationen haben, aber als sie die Augen öffnete, war er wieder da.
David.
Sie wusste nicht recht, ob sie den Namen ausgesprochen oder nur gedacht hatte. Selbst wenn sie ihn ausgesprochen hatte, konnte er ihn durch den chaotischen Lärm nicht gehört haben. Und doch drehte er sich um. Durch den Hitzeschleier, der aus der Glut einer einstmaligen Behausung aufstieg, begegneten sich ihre Blicke.
Er war dünner geworden, seit sie ihn zuletzt gesehen hatte. Dunkle Höhlen hatten sich ihm in die Wangen und die Augen gegraben, unterstrichen durch die Prellungen vieler unruhiger Nächte, die sich im ausgezehrten Gesicht abzeichneten. Um den Hals trug er einen Metallring, und sogar durch die Glut des Feuers hindurch erkannte Sorrel die roten Schwielen am Hals. Der Schmerz, den sie empfand, bohrte sich ihr wie ein Holzsplitter ins Herz.
David, was ist dir widerfahren?
Unvermittelt krachte der Lärm wieder über sie herein. Das Prasseln und Spucken und Zischen brennenden Holzes, klagende und schreiende Stimmen, Sorrels donnerndes Herz, das ihr das Blut durch die Adern trieb.
Sorrel streckte die Hand nach David aus. David spiegelte die Geste. Keiner von ihnen lächelte, während sie jeweils in den Blick des anderen stürzten. Die Trennung durch die tobenden Flammen machte aus der physischen Nähe jedoch einen grausamen Scherz.
»Komm!« Einstein packte Sorrel am Arm. »Die Bude hier geht gleich hoch.«
Sie blickte ihn an. »Nein, ich ...«
Ein lautes Ächzen ertönte, als die Wand einer weiteren Hütte in die Glut stürzte. Funken stiegen wirbelnd auf, gefolgt von emporspringenden Flammen. Die Hitze des Feuers versengte Sorrel das Gesicht, während sie durch das Inferno zu blicken versuchte.
»Jetzt!«, brüllte Einstein, während er sie wegzerrte, sie zwang, David zurückzulassen.
Sie stürzten davon. Eine Explosion schoss ihnen eine Druckwelle voller Nägel, Holzstücke und Schutts hinterher. Ihr Körper war in Gefahr, aber ihre Gedanken allein bei David.
»Hier, hier herein!«, brüllte Einstein.
Er zerrte Sorrel hinter eine der soliden gebauten Hütten. Sie versuchte sich innerlich zu sammeln, während Schreie durch die rauchverhangene Luft trieben.
»Ich habe ihn gesehen ... Ich habe David gesehen.«
»Wo?«
»Dort hinten. Er hat einen Ring um den Hals getragen. Er hat ausgesehen wie ... Ich weiß nicht, aber wir müssen zurückgehen und ihn finden.«
Einstein schüttelte den Kopf, als sie in die Flammen zeigte.
»Das können wir nicht. Die ganze Gegend brennt. Wer sie jetzt nicht verlässt, wird sie nie mehr verlassen. Wir müssen weg.«
Ein Paar lief vorbei und ihre aneinandergeklammerten Körper zeichneten sich als Schatten vor dem flammenden Hintergrund ab.
»Aber ...«
»Kein Aber, Sorrel, wir müssen weg von hier! Wenn David klug ist, wird er nicht mehr dort drüben zu finden sein. So wenig wie wir auf dieser Seite. Komm weiter!«
Einstein schob sie vor sich her, während sie durch ein Labyrinth aus Gassen vor dem Brand davonliefen.
»Weiter, Sorrel, oder das Feuer holt uns ein!«
Sie lief um Haufen verstreuter Kleidung und Gebrauchsgegenständen herum. Verlorene Habseligkeiten jener, die aus ihren Behausungen vertrieben worden waren.
Der Brand lag ein Stück hinter ihnen, als Sorrel auf einer Kreuzung stehen blieb. Von Einstein war ein Uff zu hören, als er in sie hineinlief.
»Wieso ...?«, keuchte er.
Sie hob eine Hand. »Hör mal.«
Einstein runzelte die Stirn. »Was willst du damit ...« Dann änderte sich seine Miene.
Ein schrilles Quieken erfüllte die Luft.
»Ich höre es ... Schnell weg!« Er schubste Sorrel durch die Gasse zurück. Die ersten Tiere jagten über die Kreuzung. Dann folgte eine Flut dieser Kreaturen. Sie rannten dicht über der Erde dahin. Die kleinen stämmigen Leiber waren von rauem braunem Fell bedeckt, abgesehen von den Schwänzen, die lang und haarlos waren.
Sorrel wich weiter zurück.
»Was ist das?« Sie fragte es im Flüsterton, denn sie fürchtete, die Kreaturen würden in ihre Richtung strömen, wenn sie sie hörten.
»Ratten«, sagte Einstein. »Man trifft sie in Dinawl häufig an, und einige laufen auf zwei Beinen.«
Sorrel sah ihn an, fand aber nicht die Zeit, nachzuhaken, denn der Rattenstrom dünnte aus und bestand nur noch aus wenigen Nachzüglern.
Als die letzten Tiere vorbeigelaufen waren, überquerten Sorrel und Einstein die Straße. Eine sterbende Ratte lag mitten auf dem Weg.
Sorrel blieb stehen und nahm sie in Augenschein. Das Tier war etwa so lang wie ihr Schienbein, und der Schwanz erreichte ebenfalls diese Länge. Der Schwanz war rötlich und schuppig, dick im Ansatz und spitz auslaufend. Gelbe Nagezähne ragten aus dem Maul, als die Kreatur ihren letzten Atemzug tat.
Sorrel verzog das Gesicht. »Ich mag Ratten nicht.«
»Sie sind recht schmackhaft, wenn man sie gut kocht.«
Sie sah ihn misstrauisch an. »Sie sehen aber nicht appetitanregend aus.«
»Fledermäuse vielleicht?«
Sie blickte auf die eigene Jacke hinab. Sie hatte sich nie darüber Gedanken gemacht, wie schmackhaft Fledermäuse aussahen. Sie waren einfach Fledermäuse und eine gute Quelle für Nahrung und Felle.
»Vielleicht nicht, aber Ratten sehen irgendwie nicht richtig aus.«
Einstein grinste. »Liegt es vielleicht am Schwanz?«
Sie blickte auf die tote Ratte. »Kann sein.«
Der Anblick des Schwanzes weckte in ihr Übelkeit, aber auch von den gelben Zähnen bis zu den scharfen Krallen hatte die Kreatur nichts an sich, was Sorrel entzückt hätte.
»Niemand mag Rattenschwänze. Komm, es wird Zeit, dass wir weitergehen.«
Während sie ihrem Weg folgten, trafen sie auf immer mehr Menschen. Vor dem Nordtor herrschte Gedränge.
»Was geht hier vor?«, fragte Einstein jemanden in der Menge.
»Die Amtmänner lassen niemanden in die Stadt.«
Sorrel betrachtete Gesichter in der Menge und suchte nach David, fand aber keine Spur von ihm. Nur gelegentlich trieb etwas Rauch heran, und die Stimmung war angespannt. Sorrel blickte Einstein an. Er zeigte eine grimmige Miene – er spürte es also auch. Sorrel hielt sich dicht bei ihm, während sie sich einen Weg durch das Gedränge zu dem Bereich des Slums bahnten, der östlich des Tores lag. In den Gassen drängten sich die Vertriebenen. Sie liefen wütend und frustriert durcheinander, und einige von ihnen versuchten, sich Zutritt zu den Behausungen ringsherum zu verschaffen.
»Bitte lasst uns rein!«
»Meine Frau ist verletzt!«
»Wir haben alles verloren!«
»Ihr seid ja fein raus. Ihr habt noch ein Zuhause!«
»Ich kenne dich, ich habe dir mal einen Gefallen getan, lass mich rein!«
Menschen weinten um ihre Lieben, die sie verloren hatten. Zank und Schlägereien brachen aus.
»Wir müssen von hier verschwinden, ehe es richtig übel wird«, brummte Einstein Sorrel ins Ohr.
»Warte. Sieh mal da!« Sorrel deutete auf einen Schuppen mit einem Lumpenvorhang als Tür. Eine Frau hatte den Vorhang gerade zur Seite gezogen und schrie hinein:
»Raus hier. Diese Bleibe gehört euch nicht!«
Hinter dem schmuddeligen Vorhang kauerten einige Kinder im düsteren Innenraum des Schuppens.
»Wir können hier nichts tun«, sagte Einstein. »Wir müssen wieder die Metro erreicht haben, sobald es zu einem Aufruhr kommt.«
»Wir müssen etwas tun!«, blaffte Sorrel. »Es sind doch nur Kinder. Wir müssen ihnen helfen.«
Die Kinder duckten sich, als die Frau sie erneut anschrie. »Das ist mein Zuhause! Raus hier!«
Die Kinder schreckten zurück, als die Frau zu einem Schlag ausholte.
»Wir dürfen sie nicht im Stich lassen!« Sorrel war schon neben der Frau, ehe Einstein sie zurückhalten konnte. »Stopp! Was tust du hier? Sie sind doch so klein.«
Die Augen der Frau blitzen mordlustig, als sie zu Sorrel herumfuhr, aber als die Frau sah, mit wem sie es zu tun hatte, lachte sie und entblößte den Mund voller schwarzer Stümpfe und abgebrochener Zähne.
Es war Sadie, die Frau von der Hinrichtung.
»Nun, wenn das nicht das neue Mädchen ist!« Sadie schob ihr Gesicht vor Sorrel. Ihr Atem stank so sauer, dass selbst die beißenden Rauchschwaden im Vergleich süß wirkten. »Ich habe dir ja gesagt, dass etwas Übles geschehen wird. Ich hatte es in den Knochen.«
Sorrel wich vor ihr zurück. »Wer sind die?«
Sadie grinste höhnisch und warf einen Blick auf die Kinder. »Leere Bäuche und hungrige Mäuler, das sind sie.«
»Du kannst sie nicht einfach hinauswerfen ... Wo sind ihre Familien?«
Sadies Augen funkelten, als sie den Kopf schüttelte. »Du weißt wirklich gar nichts, neues Mädchen. Familien, pah! Das Beste, worauf dieses Gesindel hoffen kann, ist, von den Amtmännern aufgegriffen und auf dem Sklavenmarkt an jemanden verkauft zu werden, der sie nicht zu Tode prügelt. Gehört der Mutant zu dir?«
Sadie deutete mit dem Kopf auf Einstein. Dieser blickte an Sadie vorbei in den Schuppen.
»Ja«, antwortete Sorrel. »Er gehört zu mir.«
»Mach dich nützlich, Mutant. Schaff dieses Gesindel aus meinem Heim.«
Einstein sah Sorrel an.
»Weshalb siehst du sie an?«, fragte Sadie.
Einstein knurrte: »Damit ich mir nicht die Augen verbrenne, indem ich dich angucke.«
Sadie gluckste, und es klang, als klapperten trockene Knochen in ihrem Mund. »Ihr seid schon ein Paar, wie? Der Mutant und das neue Mädchen, beide mit pfiffiger Lippe. Ich frage mich, wie lange ihr am Leben bleibt.« Sie zog ein rostiges Messer unter ihrem Umhang hervor. »Schafft sie hinaus, oder ich schneide ihnen die Hälse durch und benutze die Leichen als Bett!«
Einstein packte sie am Handgelenk. »Versuche es, und du wirst schon sehen, was passiert.«
»Vergeude nicht deine Zeit mit ihr«, sagte Sorrel.
Die Kinder, die das Gespräch verfolgt hatten, blickten ihr argwöhnisch entgegen, als sie den Schuppen betrat.
»Habt keine Angst. Ich kann euch zu einem sicheren Platz bringen.«
Als sich Sorrels Augen an das matte Licht gewöhnt hatten, erkannte sie, dass diese schmutzigen und heruntergekommenen Kinder selbst verglichen mit dem niedrigen Standard des Slums in einem schlimmen Zustand waren.
Es waren sieben. Obwohl sie von kleiner Statur waren, zweifellos durch Unterernährung, hatten sie sicherlich zwischen sechs bis zehn Sommer hinter sich.
»Ihr könnt nicht hierbleiben, versteht ihr das? Aber wir, mein Freund und ich, können helfen.«
Sadie wurde beim Zank mit Einstein draußen lauter.
»Habt ihr Angst, weil er ein Mutant ist? Ist schon okay. Ihr könnt ihm – und mir – vertrauen.« Sie streckte eine Hand zum nächststehenden Kind aus. »Bitte, kommt mit.«
Das Kind wich zurück, aber eines der anderen beugte sich vor und starrte auf Sorrels Handgelenk.
Sorrel warf einen Blick auf ihr Muttermal und dann auf das Kind. »Erkennst du das? Hast du diese Zeichnungen in Dinawl gesehen?«
Das Kind nickte vorsichtig.
»Dann weißt du, dass du mir trauen kannst.«
»Schaff sie da raus, neues Mädchen!«, kreischte Sadie.
»Gib mir nur ein Zeichen, Sorrel, und ich breche dieser Frau den Hals«, knurrte Einstein.
»Verschwende nicht deine Zeit auf sie, Einstein!«, rief Sorrel. »Wir gehen.« Sie sah die Kinder an. »Oder?«
Das Kind, das ihr Muttermal entdeckt hatte, blickte die anderen an, und eine Runde Kopfnicken folgte.
»Also«, sagte Sorrel. »Gehen wir.«
Einstein betrachtete die Kinder, während sie aus dem Schuppen zum Vorschein kamen. »Ich schätze, wir tun also letztlich doch etwas.«
Sorrel grinste ihn an.
»Viel Glück, neues Mädchen«, höhnte Sadie, ehe sie im Schuppen verschwand. »Du wirst es brauchen.«
Sorrel blickte Einstein an und verdrehte die Augen. »Ich kann diese Frau wirklich nicht leiden.«
»Sie spricht in den höchsten Tönen von dir.« Einstein zwinkerte. »Also, was machen wir jetzt mit denen hier?«
Sorrel betrachtete die Kinder. »Hat irgendjemand von euch ein Zuhause, wohin er könnte? Freunde oder Familie?«
Ein oder zwei schüttelten die Köpfe, aber die meisten starrten sie einfach nur an.
»Das ist schon in Ordnung. Ihr könnt mit uns kommen.«
»Das wird Niven nicht gefallen«, sagte Einstein.
Sorrel zuckte die Achseln. »Das braucht es auch nicht.«
»Die Amtmänner kommen!«, ertönte es ringsherum.
Nach den Alarmrufen zu urteilen, drangen die Amtmänner vom Nordtor aus in den Slum vor, und Brände tobten weiterhin im westlichen Viertel. Der einzige Weg in die Metro, den Sorrel kannte, führte durch den Schacht.
»Zur Müllhalde!«, sagte Sorrel.
»Den Weg, durch den dich Yolanda geschickt hat?«
Sorrel nickte.
»Findest du ihn wieder?«
Sorrel warf einen Blick auf die Kinder. »Das muss ich.«
Das war leichter gesagt als getan. Der Feuerschein des brennenden Westviertels erhellte den dunkler werdenden Nachthimmel, aber der Brandgeruch wehte nur von fern herüber, und die Brände schienen nicht näher zu kommen.
»Sie haben wohl eine Brandschneise geschlagen«, sagte Einstein.
Er sagte überhaupt vieles und hielt eine fortwährende Erzählung aufrecht, während sie ihres Weges gingen. Sorrel wusste nicht recht, ob er sich damit an sie wandte, an sich selbst oder die Kinder, und sie scherte sich nicht besonders darum. Ihre Gedanken drehten sich darum, den richtigen Schuppen – und David – zu finden. Aber während sie ihre Gruppe auf einen falschen Weg nach dem anderen führte, stieg Panik in ihr auf und vertrieb David aus ihren Gedanken. Sie bemühte sich um Konzentration, aber Einsteins monotone Stimme ging ihr allmählich auf die Nerven.
Seine Worte surrten ihr um den Kopf wie fette hartnäckige Fliegen. Er sollte lieber den Mund halten, damit sie sich erinnern konnte, wo der Schuppen war, aber als sie sich umdrehte, stellte sie fest, dass Einstein nicht sich selbst zuliebe redete, sondern mit dem Gespräch ein Band zu den Kindern knüpfte und eine beruhigende Decke um sich wickelte. Obwohl die Luft voller Grauen war, steckten sie alle zusammen in der Sache.
Sie schluckte, als ihr Tränen in die Augen stiegen. Es war hier irgendwo, das wusste sie, aber wo genau?
»Sorrel?«, flüsterte Einstein. »Weißt du, wohin es geht?«
Panik flatterte in ihrer Brust, während sie ihn ansah. Und da entdeckte sie hinter ihm eine Behausung, die kurz vor dem Einsturz schien.
»Da drüben!« Sie schob sich an Einstein vorbei, als er sich selbst gerade umwandte. »Kommt!«
Das grob gezimmerte Bettgestell war immer noch da, auch wenn die Lampe fehlte. Egal, noch reichte das Licht der Abenddämmerung, um sich ans Werk zu machen, wenn auch nur knapp.
Einstein führte die Kinder in den Schuppen, während Sorrel die Sackleinenmatte zur Seite zog und das Gerümpel wegräumte, um die Metallluke freizulegen.
»Hilf mir mal.«
»Geh zur Seite. Ich mach das schon.«
Eine plötzliche Sorge stieg in ihr auf, als er die ringförmigen Griffe der Luke packte. Er sollte nicht hier draußen sein, er ist immer noch nicht voll genesen!
Ein Grunzen jedoch, und die Falltür stand offen.
Einstein blickte Sorrel an und erkannte die Sorge in ihrer Miene. »Ich bin in Ordnung, Sorrel. Der Körper hat das Gift ausgeschieden.«
»Bist du sicher?«
»Ich bin sicher. Wir müssen zusehen, dass wir weiterkommen.«
Sorrel blickte in das dunkle Loch. »Dort ist eine Leiter, siehst du? Sie führt nicht ganz nach unten – am Schluss folgt ein kurzer Sturz, aber nicht tief. Wenn du als Erster hinabsteigst, kannst du die Kinder von der Leiter heben. Folge dann dem Korridor. Man kann nur in eine Richtung gehen. Er führt euch zur Metro.«
Einstein runzelte die wuchtige Stirn. »Wozu die Wegweisung? Du kommst doch mit?«
»Jemand muss zurückbleiben und den Zugang hinter euch schließen und tarnen.«
»Das kann ich machen, und du nimmst die Kinder.«
»Nein, du musst gehen.«
»Sorrel, was führst du im Schilde?«
»Ich gehe David suchen.«
Einstein seufzte. »Hör mir gut zu. Ich weiß, was das für dich bedeutet, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Der Slum ist schon zu den besten Zeiten ein gefährlicher Ort, und wir haben nicht die beste Zeit. Eine Muschel am Strand wird leichter zu finden sein als David.«
Einsteins Worte riefen ihr sofort Ulbroom in Erinnerung. Dort lag der einzige Strand, den Sorrel jemals besucht hatte. Es ärgerte sie, dass egal wie sehr sie versuchte, Ulbroom aus ihrem Gedächtnis zu streichen, es immer noch da war, sie heimsuchte und ihrer spottete. Sie konnte das nicht zulassen.
Sie baute sich kerzengerade vor Einstein auf. »Ich bin hergekommen, um Eli und David zu finden, und nachdem ich jetzt endlich einen von ihnen gesehen habe, werde ich nicht aufgeben.«
»Ich werde nach ihm suchen.«
Sorrel verdrehte die Augen. »Wie willst du ihn finden? Du weißt doch nicht mal, wie er aussieht. Ich mache mich auf die Suche.«
Ein verzagtes Lächeln schlich sich in Einsteins Züge. »Du wirst tun, was du tun musst, Sorrel, egal was ich sage. Sparen wir Zeit, indem wir nicht darüber streiten. Aber nur, wenn du zulässt, dass ich dir helfe.«
Sorrel warf einen Blick auf die Kinder. »Aber du musst erst ihnen helfen.«
»Ich bringe sie in die Metro und komme dann zurück, aber wenn niemand da ist, der den Weg hinter uns wieder tarnt, können wir nicht noch mal hier hineinsteigen. Der Westeingang wird durch die Brände blockiert. Kennst du sonst einen Weg vom Slum in die Metro?«
Sorrel schüttelte den Kopf. »Ich weiß, dass es zumindest noch einen weiteren Zugang gibt, aber jedes Mal, wenn ich Niven danach gefragt habe, schien ihn etwas abzulenken, ehe er antworten konnte.«
»Ich habe diese Eigenheit auch bei ihm beobachtet, aber ich werde dafür sorgen, dass er nicht abgelenkt ist, wenn ich mit ihm rede, und dann komme ich zu dir zurück – und zu David, falls du ihn findest. Einverstanden?«
»Ich werde ihn finden, aber ja, ich bin einverstanden.«
»Dann sind wir uns einig.«
Sorrel sah sich auf einmal vor lauter Zuneigung zu Einstein überwältigt. Sie warf die Arme um ihn und kniff die Augen zu, um die Tränen zurückzuhalten, und dabei sah sie wieder das Bild vor sich, wie sie David durch die Flammen hindurch gesehen hatte, einen Metallring um den Hals und einen benommenen Ausdruck im Gesicht. Was ist ihm widerfahren?
»Einstein, der Ring um Davids Hals – was bedeutet der?«
»Es ist eine Sklavenschelle, Sorrel. Es bedeutet, dass er jemandem gehört.«
»Jemandem gehört?«
Einstein nickte. »Es tut mir leid, dir das zu sagen, aber ja, es heißt, dass jemand ihn für Münzen gekauft hat. Eingehandelt wie ein Stück Fleisch oder ein Stapel Felle.«
Sorrel verstand das einfach nicht. Wie war das möglich? Sie schüttelte den Gedanken ab. David war am Leben, und das reichte vorläufig.
»Wie wirst du uns finden?«, fragte sie Einstein.
»Ich bin überzeugt, dass man mindestens einen weiteren Zugang im Westen findet. Wir treffen uns zur Morgendämmerung am Henkersbaum, und ich führe dich zurück.«
Draußen kreischte jemand, gefolgt von wütendem Gebrüll. Die Stimmen kamen dem Schuppen näher. Zu nahe.
Sorrel blickte Einstein an. »Ihr müsst sofort aufbrechen.«
Einstein wandte sich an die Kinder. »Ich steige als Erster hinab und helfe euch am unteren Ende, versteht ihr?«
Fünf Kinder nickten, zwei starrten nur hohl.
»Es ist dort sehr dunkel«, erklärte Sorrel. »Aber ihr findet auf diesem Weg zu einer sicheren Zuflucht. Fasst euch an den Händen, sobald ihr unten seid, und bleibt zusammen.«
Einstein stieg die ersten paar Sprossen hinab, hielt noch mal an und blickte zu Sorrel hinauf. »Tut mir leid, das eben. Du hattest recht – wir mussten etwas tun.«
Sorrel lächelte. »Bis bald.«
»Bis bald.«
Nachdem er in die Dunkelheit hinabgestiegen war, schickte sie ihm das erste Kind nach. »Es ist alles gut, nehmt euch ruhig Zeit. Einstein wartet unten auf euch.«
Das erste Kind stieg hinab, dann das zweite. Das dritte sträubte sich.
»Keine Sorge«, redete ihm Sorrel ruhig zu. »Es ist alles gut.«
Das Kind schüttelte den Kopf. »Ich möchte Nora.«
Sorrel blickte die anderen an. »Wer ist Nora?«
»Sie ist tot.« Die Worte waren ausdruckslos.
»Sie ist verbrannt«, sagte ein anderes Kind.
Sorrel hockte sich vor das Kind. »Das tut mir sehr leid, aber sie würde sich wünschen, dass du in Sicherheit bist. Du musst hinabsteigen.«
»Nein.«
Sorrel wandte sich hilfesuchend an die übrigen Kinder. Sie starrten zurück, aber ihre Blicke verrieten in der Dunkelheit nichts.
»Wir müssen einander helfen. Es ist wichtig.« Sie zeigte ihnen ihr Muttermal. »Erinnert ihr euch?«
Ein-, zweimal wurde genickt.
»Es bedeutet, dass wir zusammenarbeiten und einander helfen müssen. Das ist unsere Stärke. Versteht ihr?«
Eines der anderen Kinder schob sich nach vorn. »Ich geh rein.«
»Gut. Du als Nächster«, wandte sie sich an den zögernden Jungen.
Er widersetzte sich nicht, als sie ihn auf die Leiter hob. »Halte dich gut fest, und es wird alles in Ordnung sein. Mach einen Schritt nach dem anderen, und du kommst sicher an.«
Das Kind nickte ganz leicht und trat langsam auf die nächste Sprosse.
Sorrel seufzte erleichtert. »So ist es gut. Mach einfach so weiter.«
Endlich stieg das letzte Kind auf die Leiter und kletterte ein paar Sprossen weit hinab, ehe es stehen blieb und zu Sorrel aufblickte.
»Alles in Ordnung?«, fragte Sorrel.
»Danke.«
Sorrel setzte ein Lächeln auf, war aber nicht sicher, wie gut es ihr gelang. »Kümmere dich um die anderen.«
Als die Dunkelheit das Kind verschluckt hatte, schleifte Sorrel die Luke wieder an Ort und Stelle und deckte sie ab. Jetzt musste sie David finden.
2.Wund gerieben
Sobald David die drei Kreise sah, die auf die Wand gemalt worden waren, wusste er, dass sie mit Sorrel zu tun haben mussten. Und sobald er die Gerüchte hörte, die auf Märkten und in Viktualienhäusern gemurmelt wurden, wusste er auch, wo er suchen musste. Niemand verstand genau, wofür die Kreise standen, aber der Konsens lautete, dass sie einen einzigen Ursprung haben mussten: den offenen Rinnstein vor der Stadtmauer, den Slum. Endlich hatte er einen Hinweis für seine Suche.
Er verließ schnurstracks die Stadt; aber obgleich sein Instinkt darauf beharrte, dass sich Sorrel dort irgendwo herumtreiben musste, blieb seine Suche fruchtlos. Wie zuvor schon, redete niemand mit ihm. Bei seiner Rückkehr hielt ihn erneut der Torwächter mit den hängenden Schultern und dem schlaffen Gesicht auf.
»Papiere!«
»Du hast sie heute Morgen schon gesehen.«
»Vielleicht habe ich das, vielleicht auch nicht. Ihr schäbigen Sklaven seht für mich alle gleich aus. Wer kann außerdem wissen, ob du sie nicht im Slum verkauft hast?«
Der stämmige Wachmann, der dem Torwächter unterstand, baute sich neben diesem auf, während er noch redete. David übergab seine Papiere.
Der Torwächter warf einen Blick darauf. »Tritt ein.«
David nahm die Papiere wieder entgegen und betrat die Stadt. Solange er die Sklavenschelle um den Hals trug, würde niemand im Slum mit ihm reden oder ihn überhaupt zur Kenntnis nehmen. Wenn sie ihn sahen, sahen sie nur einen Sklaven, einen Sklaven der Stadt, vermutlich einen Spion. Er musste das Ding loswerden.
Kochgerüche hingen schwer in der Luft, während er den Straßen folgte. Aroma von Eintopf mit frischen Karotten und wildem Knoblauch kündete von einem Festschmaus, von dem er nur träumen konnte. Seine Hungerqualen stiegen durch den einen oder anderen Duft von Fleisch, das neben dicken Scheiben glänzender Zwiebeln in Bratpfannen brutzelte.
Durch offen stehende Türen und Fenster konnte er Eindrücke vom Familienalltag erhaschen, Eltern und Kinder, die sich zum Abendessen am Tisch versammelt hatten. Dieser Luxus blieb ihm verwehrt. Gegrillte Ratte erwies sich inzwischen als zu teuer. Er würde sich mit einem Stück harten Brots und einer Schüssel mit dünner Brühe zum Abendessen begnügen müssen. Die Unterbringung hatte er in ähnlicher Weise reduzieren müssen. Geld rann einem in Dinawl leicht durch die Finger, und nicht mal mehr ein geteiltes Bett konnte er sich inzwischen leisten. In dieser Nacht würde er auf dem Fußboden der Herberge schlafen, und morgen ging es dann zurück in den Slum, um nach Sorrel zu suchen.
Die wandernden Füße trugen ihn zurück in die Straße, wo der Schmied Quirke mit seiner Frau Goneril wohnte. Peter konnte nicht den einzigen Schlüssel haben; Quirke hatte die Sklavenschelle hergestellt, also besaß er bestimmt auch einen.
David ging an der Werkstatt vorbei und sah Quirke an seiner Schmiede arbeiten. Goneril war nicht zu sehen. Vielleicht war sie irgendwo im Haus, aber David wollte nicht riskieren, dass Quirke ihn entdeckte. Dieser Mann sah so aus, als wäre sein Gesicht gekocht und abgeschält worden. Goneril strahlte vor Lebensfreude. Wenn du jemals einen Freund brauchst, weißt du, wo du mich findest.
Na, er brauchte jetzt einen Freund, das stand fest!
David trieb sich auf der Straße herum, wanderte langsam von einem Ende zum anderen und betrachtete dabei Auslagen, als wäre er auf einem Botengang für seinen Herrn. Dieser Gedanke, dass eine Person eine andere besitzen konnte wie ein Wams oder eine Tasche, ärgerte ihn jedes Mal.
Bei diesem Gedanken wanderte seine Hand unbewusst zu Sorrels Rucksack. Er trug ihn überall bei sich und benutzte ihn nachts als Kopfkissen, teils zum Schutz vor seinen langfingrigen Zimmergenossen, teils um etwas von Sorrel bei sich zu haben. In der ersten Nacht hatte er tief Luft geholt und gehofft, dass vielleicht noch eine Spur von ihr am Rucksack zu erschnuppern war, ein Zufallsduft, der sie ihm wieder näher brachte, aber falls so etwas ja daran gehaftet hatte, dann hatte es sich längst verflüchtigt.
Der wund geriebene Hals pochte wie durch den Gedanken an Sorrel aktiviert. Er hätte Stofffetzen um das Metall wickeln und so verhindern können, dass es auf der Haut scheuerte, wie die Serviererin im Viktualienhaus zu den Drei Ratten erklärt hatte, aber er wollte, dass das Ding schmerzte, dass die Wunde offen blieb, damit sein Zorn in gleicher Weise entzündet wurde. Er wollte niemals das Unrecht vergessen, das man ihm angetan hatte – zumindest nicht, ehe er Rache genommen haben würde.
Er ging schneller, während seine Erregung aufwallte. Beinahe hatte er das Haus des Schmieds aus den Augen verloren, als er sich wieder fing. Er zwang sich, wieder umzukehren. Quirke arbeitete immer noch in der Schmiede, als er dort vorbeiging, und von Goneril war weiterhin nichts zu sehen. Wenn sie nicht bald auftauchte, musste er gehen oder riskieren, dass er seinen Platz in der Herberge für diese Nacht verlor. Er blieb vor einer Konditorei stehen. Die Fensterläden standen noch offen; der Inhaber hoffte wohl auf späten Umsatz. Tabletts voller in Honig gebackener Ameisen und Raupen in Haselnusskrokant zeichneten sich im Licht der Laternen ab.
»Hungrig, mein Lieber?«
David fuhr zusammen, als ihm Gonerils Stimme ins Ohr sickerte.
»Verzeihung, ich wollte dich nicht erschrecken.«
David lächelte. »Ist schon in Ordnung.«
Goneril lächelte ebenfalls; ihre gelben Locken glänzten im Schein der Straßenlampen. »Wie geht es dir, mein Lieber?«
David fasste an die Sklavenschelle.
»Oh, das ist aber eine sehr wunde Stelle, die du da hast. Macht dir zu schaffen, wie?«
David sah sich um, ehe er antwortete. »Du hast gesagt: Falls ich jemals einen Freund bräuchte ...«
»Ich entsinne mich. Was kann ich für dich tun?«
»Das hier ...« David zog an der Metallschelle. »... kannst du es aufschließen?«
Gonerils Augen blitzten auf. »Das kann ich nicht machen.«
»Bitte. Du musst doch einen Schlüssel haben!«
»Und was würde aus meinem Quirke, wenn ich herumlaufen und alle seine schön gefertigten Sklavenschellen aufschließen würde? Wir wären nicht mehr lange im Geschäft, nicht wahr?«
»Bitte, Goneril ... Ich dürfte so etwas nicht tragen müssen.«
Goneril schnalzte mit der Zunge. »Das sagen sie alle, mein Lieber. Ich kann dir nur eine Salbe für deinen armen Hals geben. Wie wäre das?«
Ein harter Zug zeigte sich unter ihren rosigen prallen Wangen. David würde bei ihr auch nicht mehr erreichen, als er es bei Quirke getan hätte.
»Bring dich nicht in Schwierigkeiten.«
Die Tür zur Konditorei ging auf, und ein blonder Mann mit einem runden Gesicht kam zum Vorschein. Er trug über der Alltagskleidung eine Lederschürze.
»Belästigt dich dieser Sklave, Goneril?«
»Ganz und gar nicht, Hector. Wie laufen die Geschäfte?«
Hector musterte David vom Eingang aus finster. »Ganz gut bis mittelmäßig, Goneril. Und eure?« Er riss sich schließlich von Davids Anblick los und sah die Frau des Schmieds an.
»Können uns nicht beklagen, Hector.«
Hector blickte in beide Richtungen die Straße entlang. »Ruhige Nacht. Glaube nicht, dass ich heute noch viele Geschäfte machen werde. Wenn du mich fragst, hat dieser ganze Unfug aus dem Slum mit diesen Kreisen und was nicht allem die anständigen Leute aufgewühlt.«
»Da könntest du recht haben, Hector.«
»Das möchte ich wohl behaupten. Um den Slum hätte man sich schon längst mal kümmern müssen. Er macht nichts als Schwierigkeiten ... Nun, wenn du überzeugt bist, dass alles in Ordnung ist, dann schließe ich jetzt mal meinen Laden.«
»Bei mir ist alles prima. Mach du mal schön mit deinem Laden weiter.«
Der Konditor warf noch einen Blick auf David, ehe er sich in seinen Laden zurückzog.
»Es tut mir leid«, sagte David zu Goneril. »Ich hätte dich nicht belästigen dürfen.«
»Mach dir deswegen keine Sorgen, mein Lieber. Ich würde dir gern helfen, aber ich kann nicht. Das ist eine Frage der Reputation, verstehst du? Aber komm mit zur Werkstatt. Ich gebe dir die Salbe.«
David wandte sich schon ab, während er antwortete. »Ist schon in Ordnung. Trotzdem vielen Dank.«
Goneril packte ihn am Arm und musterte ihn. »Tu, was du willst, aber höre auf den Rat einer Freundin und probiere keine komischen Sachen. Mein Süßer kennt sich mit Schlössern aus. Solltest du dich selbst daran zu schaffen machen, wirst du deinen Hals stärker verletzen als die Metallschelle an sich. Hast du das verstanden?«
David entzog ihr seinen Arm. »Ich habe das verstanden.«
»Gut.« Ein feistes Lächeln lief über Gonerils Gesicht. »Sei vorsichtig, mein Lieber.«
Am nächsten Morgen empfand David das Gewicht der Halsschelle als besonders erdrückend, als er an drei dürren Sklaven vorbeikam, die unter dem strengen Blick eines Amtmannes arbeiteten.
Die Sklaven schrubbten die frisch aufgemalten Kreise von einer Wand. Der Amtmann wurde durch Davids Neugier aufmerksam und verlangte, dessen Papiere zu sehen. Das geschah häufiger, seit die Kreise aufgetaucht waren.
Am Nordtor musste David die Papiere erneut vorzeigen, ehe er die Stadt verlassen durfte.
Als David an diesem Vormittag den Slum erreichte, war die Atmosphäre anders als sonst. Die Blicke, die ihm galten, waren nicht freundlicher, doch anstatt der grimmigen Mienen, waren sie jetzt eher von höhnischem Grinsen begleitet.
Niemand redete mit ihm, während er den schmalen Gassen zwischen den Behausungen folgte. Die Menschen wandten sich von ihm ab, wenn er sie anzusprechen versuchte, und verstummten, wenn er vorbeikam; aber trotzdem trug der Wind geflüsterte Stimmen heran. Besonders ein Wort verfolgte ihn auf seinem Streifzug. Dieses Wort lautete Aufstand.
Die Luft um ihn knisterte, und Davids Herz klopfte schneller. Die drei Kreise, Sorrel, der Aufstand – die Verbindung war eindeutig. Etwas braute sich zusammen. Er spürte es tief in sich. Und mehr, er wollte, dass es geschah. Wenn eine Chance bestand, den Sklavenmarkt zu zerstören und zudem alle, die ihn unterstützten – die Wachleute, den Schwarzen Angus und seinesgleichen, die Amtmänner, die Freien -, dann wollte er ein Teil davon sein.
Je tiefer er in den Slum wanderte, desto mehr verdichtete sich die Stimmung. Endlich begegnete er einer Frau, die bereit war, mit ihm zu reden.
Obwohl ihr Gesicht runzlig wie ein vertrockneter Johannisapfel war, leuchtete eine kraftvolle Jugendlichkeit in ihren Zügen, als könnten die verstrichenen Jahre oder die düstere Umgebung nicht das junge Mädchen bändigen, das sie einst gewesen war.
Sie saß vor einer kleinen Hütte auf einer Kiste und rührte in einem Topf auf dem Herd, wobei ein würziger Duft aufstieg. Als sie sich nicht abwandte, während David näher kam, sprach er sie an.
»Das sieht nach einer leckeren Mahlzeit aus.«
»Wohl wahr. Möchtest du etwas, Sklave?« Tiefe Falten lagen um die Augen, die die Farbe hochwinterlicher Wolken hatten.
»Ich möchte dir nichts wegessen.«
»Heute gibt es reichlich. Nimm etwas.« Sie schöpfte einen Haufen blauschwarzer Muscheln aus dem Topf und füllte den Teller. »Komm, nimm dir eine.«
Sie lächelte, als David zögerte.
»Das geht so«, erklärte sie, nahm eine Muschel, öffnete sie und schaufelte sich das Fleisch in den Mund. Während sie kaute, erzeugte sie anerkennende Laute.
David folgte ihrem Beispiel, griff nach einer Muschel und brach die Schale auseinander. Das Innere präsentierte sich ihm in Schattierungen von schillerndem Weiß und Blau, und es enthielt dickes rosafarbenes Fleisch.
»So was schon mal gesehen?«
Er schüttelte den Kopf.
»Man nennt es eine Miesmuschel.«
David zog das Fleisch aus der Schale und kaute es. Es schmeckte salzig und köstlich, und als ihm die Frau eine weitere anbot, nahm er sie. Eine dritte lehnte er jedoch ab.
»Bist du sicher?«
Er hätte gern mehr gegessen, aber er wollte die Frau nicht ihres Mahles berauben. »Ja, aber du kannst mir erzählen, was es Neues gibt, wenn du möchtest.«
»Weißt du es denn nicht, Sklave? Die Versorgungsgüter, die nach Dinawl verschifft werden sollten, sind umgeleitet worden.« Ein Funkeln glomm in ihren Augen, während sie erst die leeren Muschelschalen und dann wieder David anblickte.
David grinste. »Also hat es angefangen?«
Sie erwiderte das Lächeln nicht. »Am besten kehrst du in die Stadt zurück. Die Menschen im Slum sind erhitzt, und Leute deines Schlages sind hier nicht mehr gern gesehen.«
»Ich gehöre nicht zu denen. Ich möchte helfen.«
»Dann sieh zu, dass du den Kragen loswirst.«
David presste die Kiefer zusammen. »Ich habe es versucht. Ich möchte ihn ja nicht tragen ... aber ich verstehe nicht, inwiefern mich das überhaupt zu einem von denen macht. Sie behandeln mich so schlecht wie jeden Slumbewohner, vielleicht schlechter. Ich gehöre nicht nach Dinawl.«
Die Frau zuckte die Achseln. »Sklaven können nicht im Slum leben. Zumindest nicht mit einer Metallschelle um den Hals. So einfach ist das.«
Ehe er noch mehr sagen konnte, drangen wütende Stimmen durch die Straßen.
Die Frau stand auf, die Miene ernst. »Du hattest recht. Es hat angefangen. Am besten ziehst du deiner Wege.«
»Kommst du denn klar?«
»Besser als du, Sklave. Ich habe hier Freunde.«
Ich auch, dachte David, während er weiterging – nicht zurück in die Stadt, sondern tiefer in den Slum.
In der Ferne kündete ein Chor aus Geschrei den Ausbruch eines Brandes.
David starrte durch die Glut die junge Frau an, die im Hitzeschleier waberte. Zunächst konnte er nicht glauben, was ihm seine Augen zeigten. Er dachte, dass ihm die Hitze und der Rauch einen Streich spielten, aber sie war es. Es war Sorrel!
Sein Herz machte einen Satz, als sie die Augen schloss. In diesem Moment glaubte er, sie hätte ihn nicht erkannt, aber als sie sie wieder öffnete, blickte sie ihn geradeheraus an, und sogar über die brennenden Reste des Schuppens hinweg spürte er die Verbindung zwischen ihnen.
Sorrel.
Die Haare hatte sie zu einem Zopf geflochten, wie er es von ihr kannte. Sie sah aus, wie er sie in Erinnerung hatte, und doch irgendwie verändert, als hätte jemand sein Gedankenbild überarbeitet und schärfere Kanten und dunklere Schatten hinzugefügt.
Sie blickte die Sklavenschelle um seinen Hals an, und seine Scham strahlte von der roten Wunde darunter aus. Zorn stieg in ihm auf. Es war nicht recht, dass dies der erste Eindruck war, den sie nach solch brutaler Trennung von ihm erhielt.
Ein Sturzbach von Gedanken und Gefühlen strömte ihm durch den Kopf. Er hasste die Freien. Er hätte Sorrel gern erklärt, dass er von Martin wusste, dass sie auf der Flucht vor diesem war. Dass er, David, sie liebte, was auch immer geschehen war. Ja, er liebte sie! Mit welchem Wort könnte man das, was er für sie empfand, sonst beschreiben? Er musste ihr das erklären, denn sie sollte wissen, dass er auf ihrer Seite stand und immer stehen würde, was auch immer geschehen war.
Er blickte sich nach einer Möglichkeit um, zu ihr zu laufen, aber das Feuer war weitläufig und breitete sich noch weiter aus. Sorrel streckte eine Hand nach David aus, als wollte sie durch die Flammen eine Verbindung zu ihm erhalten. Er erwiderte diese Geste, aber Enttäuschung überwältigte ihn. Sie mussten einfach einen Weg hindurch finden!
Er schrie ihr etwas zu, aber seine Worte gingen im Tosen des Feuers und im Tumult der Schreie und Rufe unter. Er versuchte es erneut, aber als er diesmal losbrüllte – aus einem rauchgeschädigten Rachen, der so wund war wie die Haut unter dem Metall -, tauchte ein Mutant an Sorrels Seite auf, und plötzlich war sie verschwunden.
David lief los, versuchte sie wiederzufinden, aber in diesem Augenblick schlug das Feuer Funken und schleuderte eine Wolke prasselnder Glut hoch. Er hatte jede Spur von Sorrel verloren.
Er musste sie einfach wiederfinden, aber ehe er irgendwas tun konnte, zerriss eine Explosion die Luft und schleuderte ihn zu Boden. Während er auf der Erde lag und es in seinem Kopf klingelte, erreichten ihn die Geräusche aus dem Slum nur noch von fern und gedämpft, aber was seinen Ohren entging, das bekamen seine Augen mit.
Er sah eine Frau durch die Gegend stolpern; sie hatte die Hände nach vorn ausgestreckt, der Mund war nur noch ein dunkler Abgrund, und Blut strömte ihr aus einer klaffenden Kopfwunde. Eine andere Frau hatte ein Stück Holz in einem Auge stecken. Er sah verbranntes Fleisch und leckende Wunden, schmerzverzerrte Gesichter; Menschen, deren Kleidung ihnen auf dem Rücken brannte, während sie aus dem Inferno flohen. In ihrer Qual und Angst ähnelten sie einer Heerschar aus Toten und Sterbenden, die aus einstürzenden Schuppen und rauchverquollenen Hütten strömten. Selbst wenn sie diese Nacht überlebten, waren ihre Verletzungen so schlimm, dass sie sich am Morgen wünschen würden, der Tod hätte sie geholt oder würde sie schnell ereilen.
David rappelte sich auf, während die Hitze zunahm. Er musste von hier fliehen, solange es ihm noch möglich war.
Er folgte den Verwundeten, deren Klagen immer lauter wurden, je mehr das Klingeln in seinen Ohren nachließ. Einige stürzten am Wegesrand. Er versuchte, einer Frau auf die Beine zu helfen, landete aber selbst am Boden, als sie sich an seinen Arm klammerte und er dabei das Gleichgewicht verlor.
»Steh auf, du musst aufstehen!«
Er widerstand dem Impuls, sie wegzustoßen, aber als sie sich an ihm festkrallte, wurde seine Abneigung stärker. Sie kam mit ihrem Gesicht näher, und er bemerkte, dass es zur Hälfte fehlte. Er wich zurück, als sie stöhnte und sich ihre Augen verdrehten.
»Du musst hier weg, verstehst du?« Er wiederholte diese Worte, während er sich aufrappelte und dabei achtgab, außerhalb der Griffweite ihrer verzweifelten Hände zu bleiben. Dann drehte er sich um und rannte weg.
David war schon nahe am Nordtor, als er bemerkte, dass er Sorrels Rucksack verloren hatte. Er blickte zurück, sah ihn aber nirgendwo. Er konnte ihn überall verloren haben, am ehesten aber, als er der Frau zu helfen versucht hatte. Er konnte dorthin zurücklaufen, aber wahrscheinlich war der Rucksack inzwischen fort.
Der Verlust lastete schwer auf ihm, während er zum Tor hinüberblickte. Niemand hier jammerte, aber eine unterschwellige Spannung lag in den Menschen, die in den schmalen Gassen umherirrten. Harte Blicke trafen ihn, wo er vorbeiging. Die Sklavenschelle markierte ihn als Außenseiter.
Er war inzwischen kalte Schultern und harte Blicke gewöhnt. Er hatte mehr als genug abbekommen, während er den Slum auf der Suche nach Sorrel durchkämmt hatte, aber wenn er die Atmosphäre zuvor schon für aufgeladen gehalten hatte, so war sie inzwischen explosiv. Als er sich umsah, stellte er fest, dass sich hinter ihm noch mehr Menschen zusammendrängten und er sich nicht mehr im äußeren Bereich der Menge befand. Die wenigen, die seinen Blick fanden, musterten ihn finster, und so wandte er sich ab und achtete darauf, ins Leere zu blicken, um nicht noch mehr unerwünschte Aufmerksamkeit zu erhalten.
Eine Welle von unruhigen Ausrufen lief durch die Menge, als sich etwas am Tor bewegte.
»Amtmänner.«
»Sie werden etwas verkünden.«
»Wir werden uns nicht beugen!«
»Diesmal nicht.«
Anscheinend hatte man eine Plattform vor dem Tor errichtet. David erhaschte einen kurzen Blick auf den Amtmann mit rotem Kragen, der jetzt auf der Plattform stand und ein steifes Pergament hielt.
Ein zorniges Murren lief durch die Menge.
»Das Aufruhrgesetz.«
»Sie werden das Aufruhrgesetz vorlesen.«
Die Menge wurde still, als der Amtmann mit seiner Proklamation loslegte.
»Im Namen unserer ehrenwerten Anführer, der Bewahrer, erteile ich hiermit allen versammelten Personen die Anweisung, sich sofort, ohne zu zögern oder zu klagen, friedlich auseinanderzugehen und unverzüglich in ihre Behausungen zurückzukehren. Jede Person, die dieser Anweisung nicht Folge leistet, wird als Aufrührer angesehen, und es werden erbarmungslos die geeigneten Maßnahmen ergriffen. Aller Lobpreis den Bewahrern!«
Ein paar Augenblicke quälender Stille folgten auf diese Bekanntmachung. Jedes Gesicht in Davids Umgebung verzerrte sich vor Zorn. Er versuchte, sich langsam aus der Menge zu entfernen, aber er tat zu wenig, und er tat es zu spät. Der Mob war eine brodelnde Masse aus Wut und Widerwillen, und er steckte tief darin, als der elektrisierende Ruf ertönte:
»Nieder mit den Bewahrern!«
Die Menge explodierte. David sah sich in der Woge gefangen, als die Menschen nach vorn drängten.
»Nieder mit Dinawl!«
»Keine Amtmänner mehr!«
»Nahrung statt Hunger!«
»Versorgt unsere Kinder!«
Eine gewaltige Kakofonie breitete sich aus, während die Amtmänner auf die Menschen in der vordersten Reihe einprügelten. Die Menschen brüllten, als würden ihnen die noch schlagenden Herzen aus dem Leib gerissen. Die Brandung schlug auf den Mob ein, riss ihn auseinander; Menschen strömten nach links und rechts in Wellen von aufbrandenden Scharmützeln. David wurde in einen Strudel gesogen, während sich Amtmänner mit Schilden und Schlagstöcken einen Weg durch die Menge bahnten. Als David das Gleichgewicht wiederfand, wich er zu den ruhigeren Ausläufern zurück, und er schob mit den Schultern andere von sich, bis er ausreichend Spielraum gewonnen hatte, um leichter voranzukommen. Nach wie vor trafen jedoch neue Menschen ein.
»He, Sklave, wohin des Weges?«
Sobald sich David umgedreht hatte, wusste er, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er hätte weitergehen sollen; vielleicht hätte sein Herausforderer dann das Interesse verloren, aber was geschehen war, das war nun mal geschehen.