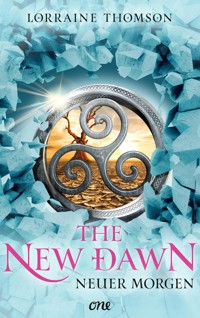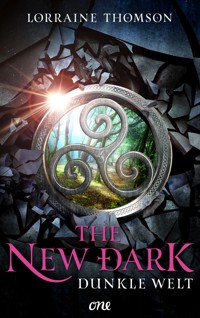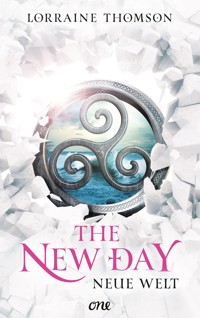
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark-Times-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Mithilfe des Mutanten Einstein findet Sorrel nach langer Suche endlich ihren kleinen Bruder Eli wieder. Doch das Wiedersehen verläuft anders, als sie dachte, und als dann auch noch ihre große Liebe David verschwindet, ist Sorrel am Boden zerstört. Im packenden dritten Teil der Trilogie muss das junge Mädchen für alles kämpfen, an das sie glaubt - um zu retten, wofür es sich zu leben lohnt.
In einer dunklen Welt ist Liebe die einzige Rettung - die spannende Dark-Times-Trilogie von Lorraine Thomson:
Band 1: The New Dark - Dunkle Welt
Band 2: The New Dawn - Neuer Morgen
Band 3: The New Day - Neue Welt
ONE. Wir lieben Young Adult. Auch im eBook.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Titel
Teil Fünf – VERLOREN
Prolog
1. Die Menschenfresser
2. Verloren
3. Der Geist
4. Da ist jemand im Anmarsch
5. Die Schlacht an Neumond
6. Das Gefäß
7. Dazwischen
8. Erdwürmer
9. Sühne
10. Fortgehen kommt nicht infrage
Teil Sechs – HOFFNUNG
11. Die Ablenkung
12. Frieden
13. Der große Graben
14. Unser aller Zukunft
15. Gnade
16. Die Mauer
17. Krieg
18. Belagert
19. Alles oder nichts
20. Norden
Epilog
Über die Autorin
Alle Titel der Autorin bei ONE
Impressum
Über dieses Buch
Mithilfe des Mutanten Einstein findet Sorrel nach langer Suche endlich ihren kleinen Bruder Eli wieder. Doch das Wiedersehen verläuft anders, als sie dachte, und als dann auch noch ihre große Liebe David verschwindet, ist Sorrel am Boden zerstört. Im packenden dritten Teil der Trilogie muss das junge Mädchen für alles kämpfen, an das sie glaubt – um zu retten, wofür es sich zu leben lohnt.
Lorraine Thomson
The New Day
Neue Welt
Aus dem Englischen von Thomas Schichtel
Teil Fünf
VERLOREN
Prolog
Sechzehn Jahre zuvor
Der Stamm versammelte sich am Eingang der Geburtshöhle. Eine erfolgreiche Niederkunft stellte ein seltenes Ereignis dar, und die letzte lag mindestens drei Sommer zurück.
Die Mutter lag auf einem Altar aus festgedrückter Erde, während zwei Frauen des Stammes sie niederdrückten. Sie war mit einem Lumpen geknebelt, denn es brächte dem Stamm Unglück, wenn die Mutter in den Wehen schrie.
Die Hebamme stand zwischen den Beinen der Mutter und hielt das Messer bereit, um das Gesicht des Neugeborenen zu zeichnen. Dasselbe Messer diente auch dazu, die Nabelschnur zu durchschneiden. Die Nachgeburt würde gebraten und verzehrt werden, eine Gabe des Neugeborenen an alle und ein Symbol für die Kraft, die die Geburt dem Stamm eintrug.
Die Hebamme bleckte die spitz zugeschliffenen Zähne, als der Kopf des Neugeborenen sichtbar wurde. Das kam einem Lächeln so nahe, wie man es von Menschen ihrer Art erwarten konnte, aber als das gesichtslose Kind aus der Mutter zum Vorschein kam, riss die Hebamme den Mund auf. Sie ließ das Messer fallen, aber der Schrei, der sich ihr aus tiefer Kehle entrang, übertönte das Klirren des Messers auf dem Fußboden.
Die Frauen des Stammes wichen von der Mutter zurück, während dieser ohrenbetäubende Schrei auf sie eindrang. Die Stammesältesten stürmten in die Höhle, und ihre Augen füllten sich mit Angst, als sie das gesichtslose Geschöpf anstarrten. Sie blickten die Hebamme an. Sie hob das Messer auf und schnitt die Eihaut vom Gesicht des Neugeborenen, aber sie zeichnete es nicht.
Es hätte Unglück und leere Bäuche gebracht, jemanden zu verletzen, der ohne Gesicht zur Welt kam. Sie konnten das Mädchen noch nicht mal auf die traditionelle Art und Weise zeichnen. Vielmehr würde es unter ihnen leben, aber nicht zu ihnen gehören. Sie würde für immer ein Schatten innerhalb des eigenen Volkes bleiben.
Als die Nachgeburt austrat, trug die Hebamme sie aus der Höhle und brachte sie zu einer unmarkierten abgelegenen Stelle, wo sie sie in der Erde vergrub.
1.Die Menschenfresser
David marschierte in der Grube auf und ab. Sie wäre dreieckig, wenn sich nicht die Wand an der einen Seite wölbte und den Raum in der Mitte verengte. Die Grube maß zudem in der Länge bis zu vier Schritte und bis zu drei in der Breite.
Er könnte sich die Finger bis auf die Knochen abwetzen, um sich einen Weg hinaus zu graben, aber Wände und Boden bestanden aus massivem Gestein ohne Risse oder Spalten, an denen er sich hätte festhalten können. Der einzige Weg hinein war durch die Falltür über ihm.
Er sah sich in der schlecht beleuchteten Grube um und fragte sich, ob diese Leute die schon fertige Grube entdeckt oder sie selbst aus Erde und Kies gegraben hatten.
Sie. Das waren Menschen eines Schlages, dem David noch nie begegnet war. Er hatte genug Wörter herausgehört, um zu bestimmen, dass sie reden konnten, aber überwiegend tauschten sie sich durch grobe Grunzlaute und Gesten aus. Wenn sie abends um das Lager tanzten, spielten sie Todesszenen, und ihre Lieder waren schrill und kündeten von künftigem Leid. Ein Übel war tief in ihnen verankert.
David lief immer wieder in der Grube auf und ab: vier Schritte, umdrehen, vier Schritte, umdrehen, bis ihm schwindelig wurde. Die dritte Ecke ließ er aus. Dort erleichterte er sich.
Der Gestank, der schon davon ausging, als sie ihn in die Grube geworfen hatten, war schal, aber stark gewesen. Er verriet ihm, dass er nicht der Erste war, den sie hier festhielten. Diese Vorstellung brachte ihm keinen Trost.
Soweit er es hatte verfolgen können, war heute sein dritter Tag in der Grube. Obwohl er in Schüben an Erschöpfung litt und ihm die Augen vor Müdigkeit brannten, stellte sich der Schlaf nicht leicht ein. Wenn es ihm mal gelang, in Sitzhaltung einzudösen, wurde er wieder wach, weil ihm die Kälte der Steinwand in den Rücken wanderte. Der Kopf hing ihm dann schlaff von den Schultern, und er spürte einen fürchterlichen Krampf im Nacken. Nach dem Schlafen war er nicht weniger müde als vorher, aber wenigstens genoss er dabei Erholung von der Furcht, die ihn von innen heraus auffraß.
Er hob den Blick zur Falltür. Sehr oft, wenn er das tat, starrten eine Reihe hervorquellender Augen zurück, aber diesmal war keiner von ihnen zu sehen, und so sprang er auf, packte eine der Holzstreben und zog sich hoch, um einen Blick durch die Lücken zu werfen.
Zwei Frauen saßen am Lagerfeuer, und die Muskeln an den langen knochigen Armen spannten sich, während sie mit Stößeln in steinerne Reibschalen hämmerten.
Als sie ihm zum ersten Mal mit einem Netz eine primitive Schale herabgelassen hatten, war er argwöhnisch gewesen. Die Schale enthielt einen kräftigen Klacks Brei. Sie hatten ihn angegrunzt und angeschrien und ihm zu verstehen gegeben, er solle die Schüssel nehmen, und als er das tat, gaben sie ihm durch Gebärden zu verstehen, dass er den Inhalt essen sollte. Als er sich weigerte, stocherten sie mit langen Speeren nach ihm. Er ignorierte die Peinigung. Als schließlich Blut floss, gab er nach und schaufelte etwas Brei mit dem Finger auf. Sie hörten auf, ihn zu stechen, sobald er zu essen begann. Der Brei war faserig, schmeckte vage nach Erde und war leicht gesüßt, wies aber im Großen und Ganzen kaum einen Geschmack auf. Angesichts einer solch faden Ernährung nahm es nicht wunder, dass sie bei Davids Anblick sabberten.
Eine der Frauen blickte jetzt herüber. Als sie ihn sah, versetzte sie der anderen Frau einen Stoß, und diese drehte sich ebenfalls um und starrte. Beide grinsten und bleckten dabei Schneidezähne, die spitz zugefeilt waren. Als sie sich die Lippen leckten, lief ein Zittern durch David, das seinen Griff schwächte. Er ließ sich zurück in die Grube fallen und zitterte noch im Nachklang dessen, was er gerade eben erblickt hatte.
Das Feuer hatte nur schwach gebrannt, weshalb keine Flammen den Blick versperrten, und David konnte durch die Hitzeschleier der glühenden Asche etwas dahinter entdecken. Auf der anderen Seite des Lagerfeuers lag ordentlich auf einer Felskante eine Pyramide aus Menschenschädeln aufgestapelt.
Der Anblick der weißen glänzenden Knochen rief ihm die eigene Sterblichkeit in Erinnerung, und der Gedanke, der eigene Schädel könnte auf dem Scheitelpunkt des Stapels hocken, erfüllte ihn mit Furcht und Entrüstung.
Erneut schritt er in der Grube auf und ab. Das diente nicht nur der Ablenkung, sondern hielt auch den Körper in Gang und die Muskeln stark. Komme, was da wolle, er würde bis zum Letzten kämpfen, und wenn er den Tod fand, gedachte er dafür zu sorgen, dass er einige dieser Leute mitnahm. Hätte er doch nur einen Weg hinausgefunden!
Er blieb stehen und starrte aufs Neue zur Falltür hinauf. Die Knoten an den Holzstreben sahen fest aus – zu robust für ihn, um sie mit einer Hand zu lockern, während er an der anderen baumelte, aber wenn es ihm irgendwie gelang, hinaufzuklettern, hätte er beide Hände frei und er könnte es gewiss schaffen.
David betrachtete die steinernen Grubenwände und erneut die Falltür. Nur zwei der Fremden hielten sich im Moment dort oben auf – wenn er also überhaupt etwas versuchen wollte, dann war jetzt der richtige Zeitpunkt.
Er drückte sich mit dem Rücken an eine Wand und setzte einen Fuß kräftig an die Wand gegenüber, ehe er den zweiten Fuß anhob. Mit dem Rücken an einer Wand und beiden Füßen an der anderen arbeitete er sich langsam nach oben; er tat winzige Schritte und schob sich mit dem Rücken an der rauen Oberfläche entlang, und diese kleinen, konzentrierten Bewegungen trieben ihm Schweißperlen auf die Stirn.
Es war nur eine kurze Distanz, aber die Beine schmerzten bei der Anstrengung, den Körper zwischen den beiden Wänden gespannt zu halten, und das Gestein grub ihm Furchen in den Rücken. Trotzdem mühte er sich weiter und ruckte zentimeterweise höher, bis die Falltür in Reichweite seiner Fingerspitzen kam. Noch etwas höher, und er konnte die Stricke lockern. Er musste vorsichtig sein und sichergehen, dass die knochigen Hexen nicht herüberblickten.
Sobald er hoch genug war, konnte er die Beine fest in die abschließende Position stemmen, und dann brauchte er nicht mehr lange, um die Stricke an der Klapptür zu lockern, und anschließend konnte er sich aus der Grube ziehen und verschwinden.
In seiner Vorstellung war er schon frei; seine Füße trommelten beim Laufen auf den Erdboden und er spürte den kühlen Wind im Gesicht und den Geschmack der Freiheit auf den Lippen.
»Runter! Runter! Runter!«
Das plötzlich aufgetretene Stimmengejammer wurde von Speeren begleitet, die durch die Latten der Klapptür gestoßen wurden.
David schrie auf, als sich ihm die Spitzen in Schultern und Beine bohrten. Er packte einen der Speere und lieferte sich einen Wettkampf im Ziehen mit dem Besitzer, aber die anderen stocherten weiter nach ihm. Er ließ los, plumpste schwer auf den Boden der Grube, und die Landung auf dem Steißbein erschütterte ihm den ganzen Körper.
Die Wilden öffneten die Falltür und steckten ihre Köpfe hinein. Sie zankten untereinander um die beste Aussichtsposition. Die heiseren Stimmen hallten vom Gestein wider, sodass die entsetzlichen Laute durch die ganze Grube vibrierten und Davids Kopf füllten, bis er schon glaubte, dieser würde bersten.
Worte in der Farbe von Albträumen flogen in die Grube und umsummten David wie Schmeißfliegen. Schmaus. Fleisch. Schlachtung. Töten.
Sie senkten eine Strickleiter in die Grube, und drei von ihnen stiegen herab, schnell und gewandt wie die Affen im Wilden Wald. Anders als die Affen hingegen waren diese Narbengesichtigen mit Speeren und Messern bewaffnet. Sie füllten die Grube aus und ließen David so keinen Freiraum mehr, um nach ihnen auszuholen.
Sie zerrten David auf die Beine, fuhren mit den Fingern über ihn, zwickten seine Muskeln, zupften am Fleisch. Ihre wie die Zähne spitz zugefeilten Fingernägel bohrten sich ihm in die Haut. Von oben drang Gelächter herab, während die Wilden mit Gesten andeuteten, ihn zu verspeisen. Dann wurde er zur Leiter geschubst und gezwungen, hinaufzuklettern.
Er hatte das Gefühl, dass die Muskeln in Armen und Beinen wie Schnee im Frühling geschmolzen waren, und er konnte sich kaum an der Strickleiter festhalten. Die Füße wollten sich gar nicht bewegen, bis die Wilden ihn stießen und schubsten, sodass er es schließlich doch tat.
Zuvor hatte er versucht, aus der Grube zu fliehen, aber jetzt, da er sie unter Zwang verließ, lastete die Angst schwer auf ihm und hatte ihn jeder Kampfgeist verlassen. Er hätte sich am liebsten in einer Ecke zusammengerollt und wie ein kleines Kind geheult, aber diese Möglichkeit stand ihm nicht offen.
Langsam kletterte er die Leiter hinauf, und mit jeder geschafften Sprosse verging ein Zeitalter. Die gierigen Stimmen ergossen sich auf ihn herab, dass ihm der Magen sauer und die Hände glitschig wurden. Und schließlich gelangte er unausweichlich an den Rand der Grube.
Die Wilden, die dort auf ihn warteten, bildeten einen weiten Kreis, während er herauskletterte. Als er endlich auf den Beinen stand, schnatterten sie nicht mehr, sondern starrten ihn lautlos an. Die drei, die ihn gezwungen hatten, aus der Grube zu steigen, folgten ihm heraus und bauten sich hinter ihm auf. David sah sie einen nach dem anderen in dem Kreis an.
Alle erwiderten seinen Blick. Obwohl die narbigen Gesichter so erschreckend wie eh und je wirkten, drückten die vorquellenden Augen keinerlei Feindseligkeit aus. Vielmehr zeigten sie eher einen Ausdruck tiefer Zufriedenheit.
Das Summen begann ganz leise, so leise gar, dass sich David zunächst nicht sicher war, ob er wirklich etwas hörte, aber allmählich stieg die Intensität, bis die Luft im Kreis vom grausigen Geleier vibrierte. Mehr als alles andere war es dieser Laut, der David die Angst in Wellen durch die Glieder jagte. Hände griffen nach ihm, als seine Knie nachgaben.
Sie führten oder trugen ihn – die Angst hatte Davids Sinne übernommen, sodass er es nicht genau wusste – und setzten ihn auf einen steinernen Thron. Der Stamm summte nach wie vor; der Laut pulsierte und stieg und fiel, sodass er manchmal kaum feststellbar war und sich manchmal zu einem schmerzhaften Crescendo erhob, ehe er wieder verklang.
Davids Blick fiel auf die Pyramide aus glänzenden Schädeln, und er versuchte sich zu befreien, aber zahlreiche Hände hielten ihn an Ort und Stelle. Knochige Finger schlossen sich stark wie Handschellen um seine Arme und Beine. Es war hoffnungslos; es waren so viele, und er war allein.
David wusste im eigenen Herzen, dass ihm der Tod bevorstand. Er konnte nur hoffen, dass er barmherzig schnell eintreten würde.
Die beiden Frauen, die er zuvor am Feuer sitzen gesehen hatte, näherten sich ihm. Eine von ihnen trug eine Steinschüssel. Diese enthielt einen Brei, aber im Gegensatz zu dem grauen faserigen Matsch, mit dem sie ihn zuvor gefüttert hatten, war diese Substanz erdfarben.
Die zweite Frau grub den Finger in die Mischung und hielt ihn David hin. Dieser presste die Lippen zusammen und wandte sich ab. Sein Kopf wurde so fest gepackt, dass er fürchtete, der Schädel würde unter dem Druck implodieren, aber die Wilden zwangen ihn, das Gesicht wieder geradeaus zu drehen.
Man zwickte ihm beharrlich die Nase, damit er den Mund öffnen musste, um Luft zu holen. Sobald er nach Luft schnappte, zwängten sie ihm die Kiefer weit auseinander. Die Frau grinste und legte damit die schartigen Kanten ihrer geschärften Schneidezähne frei. Sie schob David den mit Brei vollgekleisterten Finger in den Mund und verteilte die Substanz auf Zahnfleisch und innerhalb der Wangen, ehe sie einen weiteren Finger Brei aufschaufelte und ihm auf die Zunge strich. Als er zu würgen begann, gaben sie seinen Kopf frei.
David spuckte so viel aus, wie er konnte, aber der größte Teil der Erdpaste blieb im Mund kleben, und er konnte nicht umhin, ihn letztlich zu schlucken. Als die Angehörigen des Stammes sahen, dass er den Brei heruntergeschluckt hatte, gingen sie dazu über, im Takt eines leisen Summens hin und her zu schwanken.
Der Erdbrei zerfiel in Stränge und trocknete ihm den Mund aus. Die Fasern schlangen sich um die Zunge und blieben ihm zwischen den Zähnen stecken. David versuchte sie auszuspucken, brachte dafür aber nicht genug Speichel auf.
Als ob die Stammesleute seinen plötzlichen kräftigen Durst spürten, zog ihm einer den Kopf in den Nacken und goss ihm Wasser in den Mund. Es schwappte über die Lippen hinweg und lief in Rinnsalen über Wangen und Kinn. Er spürte, wie ihm Tropfen unter die Kleidung und über die Brust sickerten. Sobald sie seinen Kopf wieder losließen, waren die Faserstränge verschwunden, entweder heruntergeschluckt oder weggespült. Hatte er sie geschluckt? Er wusste es nicht mehr. Seine Gedanken wurden unscharf.
Zwei Frauen näherten sich ihm. Zuerst dachte er, es wären dieselben zwei wie zuvor, aber als sie sich aus dem Dunstschleier abzeichneten, sah er, dass sie jünger waren, wenngleich nicht weniger knochig als die breirührenden Hexen. Die beiden jüngeren Frauen lächelten mit geschlossenen Lippen und nickten ihm zu. David spürte, wie seinem Gesicht etwas Seltsames widerfuhr; seine Muskeln schienen sich wie eine zähe Flüssigkeit zu bewegen, und dann wurde ihm klar, dass er seinerseits lächelte.
Sie stellten eine Schüssel mit Wasser vor ihm ab. Blumen schwammen darauf. Kräuter, die er wiedererkannte, aber nicht benennen konnte. Sorrel würde wissen, um welche es sich handelte. Sorrel. Süße Sorrel. Wo steckte sie? Wo steckte seine Sorrel?
Eine der Frauen kniete sich vor die Schale und holte ein Tuch daraus hervor. Sie wrang es aus und blickte zu David auf. Es war Sorrel, diese Frau dort vor ihm.
Er schämte sich, dass er sie nicht gleich erkannt hatte. Um es wiedergutzumachen, ihr zu zeigen, wie viel er sich aus ihr machte und wie leid ihm alles tat, wollte er die Hand nach ihr ausstrecken. Als er feststellte, dass er den Arm inzwischen bewegen konnte, blickte er an sich herab. Die Hände, die ihn so fest gepackt gehalten hatten, bannten ihn nicht mehr an Ort und Stelle. Es stand ihm frei, sich zu bewegen, aufzustehen, zu fliehen. Er wollte jedoch nicht fliehen, jetzt nicht mehr, wo Sorrel bei ihm war.
Er blickte sie erneut an. Sie hatte sich verändert. Ihr Gesicht war länger geworden, schmaler, und die Augen viel größer als zuvor. Sie hatte Narben auf den Wangen – woher stammten sie? Sie lächelte, und als sich diesmal ihre Lippen öffneten, legten sie die zugefeilten Spitzen der Zähne frei. David hob die Hand, um das Gesicht der Frau zu streicheln. Sie packte die Hand und hielt sie fest. Ihre Nägel waren so zugespitzt wie die Zähne.
Sorrel hatte keine spitzen Nägel oder spitz gefeilten Zähne. Sie hatte allerdings eine scharfe Zunge. Er kicherte, als er daran dachte. Die Frau wischte ihm das Gesicht mit dem Lappen ab. Letztlich zeigte sich, dass sie gar nicht Sorrel war. Das war gut so, denn es bedeutete, dass Sorrel keine Narben auf den Wangen hatte. Er roch die Kräuter in dem Lappen, und der Geruch wurde von ihren Bezeichnungen begleitet: Rosmarin, Salbei und Thymian. Die Kräuter, die man in Amat benutzt hatte, um Dachsfleisch schmackhafter zu machen.
Während Nichtsorrel ihm das Gesicht wusch, zerschnitt ihm die andere Frau mit einem schmalen Messer die Kleider. Der summende Singsang des Stammes wurde lauter, als sie ihm die Kleiderfetzen herunterzog und seine nackte Haut freilegte. David betrachtete diese Leute, während sie ihn anschauten. Er konnte die Laute, die sie ausstießen, in violetten und orangefarbenen Strudeln durch die Luft auf sich zufliegen sehen.
Das Lagerfeuer war inzwischen kräftiger entfacht, und Funken kreiselten zum dunklen Samt des Himmels empor. Es war bereits Nacht geworden. Wann war das geschehen? Die Frau wusch ihm jetzt die Brust mit dem Lappen. Rosmarin, Salbei und Thymian.
Er war das Fleisch. Er war der Dachs. Er lächelte bei der Vorstellung, dass sie ihn verspeisten, und mit seinen Augen brachte er die Kreise ihrer Stimmen zum Wirbeln. Jeder aß etwas anderes. Dachs, Waldkrabbe, Ratte. Was bedeutete das schon? Die Kreise barsten knackend, wenn sie jeweils über das Feuer schwebten.
David widersetzte sich nicht, als sie ihm zu verstehen gaben, er solle aufstehen. Das Summen stieg weiter an und vibrierte in seinem Körper. Das Ende stand kurz bevor, aber er war seltsam entspannt.
Die violetten und orangefarbenen Kreise schrumpften, als ein Schrei von der Farbe vergossenen Blutes durch die Luft peitschte. Zunächst dachte David, dass er selbst es war, der geschrien hatte, weil sie ihn aufschnitten und ein Teil von ihm die Schmerzen registrierte, aber als er an sich herabblickte, war sein Körper intakt.
David blieb reglos, während im Umkreis das Chaos ausbrach. Noch mehr blutige Schreie fegten über den Lagerplatz. Heisere Schreie und knappe Befehle ersetzten das Summen. Dunkle Wolken tauchten auf und zerstreuten die knochigen Gestalten der Wilden. Die Wilden heulten, während die dunklen Gestalten durch ihre Reihen wirbelten. Als sie näher kamen, erkannte David, dass es keine Wolken waren, sondern verhüllte Gestalten mit funkelnden Klingen und schweren Knüppeln.
Er verfolgte das Geschehen von außerhalb seiner selbst und fragte sich dabei, wie nur möglich war, an zwei Stellen zugleich zu sein. Zwei der verhüllten Gestalten brachen Kiefer und vergossen Blut, während sie auf ihn zustürmten. So also sollte der Todbringer für ihn aussehen, nicht mit vorstehenden Augen und spitzen Zähnen, sondern umhüllt von dunklen Wolken und mit Knüppeln bewaffnet. Die Gestalten prügelten ihn allerdings nicht nieder, eine von ihnen packte ihn am Arm. Der grobe Körperkontakt saugte ihn in sich selbst zurück.
»Wir haben nicht viel Zeit. Komm mit.«
David starrte die kapuzenverhüllte Gestalt an. Bislang hatte er sich gut gefühlt. Im Frieden mit sich selbst. Jetzt erteilte ihm dieser dunkle Wirbel aus Gewalt Anweisungen, denen Folge zu leisten er nicht geneigt war. Er befreite seinen Arm.
Die Kapuze rief ihrem Begleiter zu: »Mason, er ist total breit. Hilf mir mal, ihn von hier wegzuschaffen.«
Breit? Das Wort entwich dem Mund der Kapuze als ein Wirbel in Löwenzahngelb. David hatte keine Ahnung, was das Wort bedeutete, aber als Mason ihn am Arm packte, gefiel ihm das nicht.
Er versuchte, ihnen zu erklären, dass sie ihn in Ruhe lassen sollten, aber er bekam die Zunge einfach nicht bewegt und konnte auch den Griff nicht abschütteln. Große Hände hatte er, dieser Mason. Wie ein Mutant.
David versuchte, einen forschenden Blick unter Masons Kapuze zu werfen, aber die andere Kapuze hatte ihn auch wieder fest gepackt, und sie rannten. Alle drei rannten sie. David kapierte es nicht. Er wollte gar nicht rennen, aber die eigenen Beine gehorchten ihm nicht. Sie gehorchten den Kapuzen.
David begriff nicht, was hier geschah. Eben noch beim Knochenstamm, war er im nächsten Augenblick jedoch schon von dort verschwunden. Ein Schrei in der Nacht, bei dem er nicht sicher war, ob er ihn gehört oder geträumt hatte. Er sah das Lagerfeuer nicht mehr, hatte es zurückgelassen. Vielleicht war es in die Grube gefallen.
Unter ihm liefen die eigenen Beine, und die eigenen Füße trommelten auf die Erde. Er hatte sich einen solchen Augenblick vorgestellt, als er aus der Grube zu fliehen trachtete. Er leckte sich die Lippen, um mal zu sehen, ob sie nach Freiheit schmeckten, aber er biss sich dabei auf die Zunge. Der Mund füllte sich mit dem Metallgeschmack des Blutes, was ihn zu der Vorstellung lenkte, sich selbst zu verspeisen, woraufhin ihm übel wurde.
Die Beine hörten auf zu laufen. Die beiden Kapuzen – Mason und der andere – bedrängten ihn, fragten ihn, ob er okay wäre und ob er aus eigener Kraft weitergehen könne. Sie sprachen von Menschenfressern. David verfolgte mit dem Blick, wie ihnen die Worte als gelbe Luftblasen über die Lippen kamen, und hatte nicht die geringste Ahnung, was irgendetwas von dem bedeutete.
»Er ist völlig weggetreten«, sagte der andere zu Mason.
Sie machten sich so viel Sorgen um ihn, dass es komisch war. David lachte und lachte dann noch heftiger, und er lachte so lange, bis er schließlich weinte. Er sah nur noch messerscharfe Zähne und glänzende Schädel und eine narbengesichtige Frau, die nicht Sorrel war.
Er wachte in einem Holzschuppen auf. Staubkörner wirbelten in dünnen Lichtstrahlen, die durch Astlöcher und Lücken in den Wänden hereinfielen. Er wusste nicht, wo er war oder wie er hierhin gelangt war.
Er schob die raue Decke von sich, unter der er lag. Er fand sich von der Hüfte aufwärts nackt vor. Arme und Rumpf waren mit Schnitten und blauen Flecken übersät – ein Erinnerungsbild von vorstehenden Augen und scharf gefeilten Zähnen wurde von einem Schauer der Furcht begleitet.
Die Stiefel standen ordentlich neben dem Bett. Er setzte sich auf und zog sie an. Er spürte ein Schaudern in sich, das nichts mit der Temperatur zu tun hatte, also wickelte er sich die Decke um die Schultern und ging zur Tür. Er hatte keine Ahnung, in was für einer Zwangslage er sich vielleicht befand, und stellte überrascht fest, dass die Tür nicht abgeschlossen war. Sie öffnete sich zu einer gänzlich neuen Welt.
2.Verloren
Sorrel und Einstein wanderten schweigsam durch das Tal, und ihre Schatten fielen vor sie. Sorrel hegte eine Menge Gedanken, aber sie blieben ihr im Hals stecken, blieben unausgesprochen, erstickt von einer drückenden Mischung aus Aufregung und Grauen. Aufregung darüber, endlich mit ihrem kleinen Bruder wiedervereint zu werden, Grauen über die Verfassung, in der sie ihn vielleicht vorfand.
In ihrer Vorstellung war Eli noch immer dasselbe Kind, das sie zuletzt in Amat gesehen hatte, stets zum Lachen aufgelegt und eifrig bedacht zu gefallen, aber an jenem verheerenden Tag hatte er die Mutter verloren, die Schwester, das Zuhause. Er hatte alles verloren, was er hatte. Es erging ihnen allen so. Die Ereignisse von damals konnten nicht ohne Spuren an Eli vorübergegangen sein, und Sorrel brachte es einfach nicht über sich, sich auszumalen, was ihm vielleicht in der Zwischenzeit widerfahren war und in welcher Weise es ihn verändert hatte, aber verändert musste er sich haben.
Sie selbst hatte sich verändert, das wusste sie, und David hatte es auch. An dem einst so unbeschwerten David hatte Zorn gefressen, und sein Urteilsvermögen war getrübt. Er war eifersüchtig und unvernünftig geworden. Er hätte sie nicht vor die Wahl zwischen ihm und Einstein stellen dürfen. Waren ihre Gefühle über die Wiedervereinigung mit Eli durch eine Kombination aus Aufregung und Grauen geprägt, so bestimmten Zorn und Verlust ihre Gefühle für David. Sie wollte doch nur, dass sie alle wieder zusammen waren. Das schien ihr nicht so viel verlangt.
Als sie das eindrucksvolle Bauwerk aus der Zeit Davor erreichten, das Brig als sein Heim beanspruchte, war das letzte Licht des Tages nur noch eine schwindende Erinnerung.
»Bist du bereit?«, fragte Einstein.
Selbst dieser hatte sich in der Zeitspanne gewandelt, die sie ihn kannte. Sich angekettet in der Mine wiederzufinden, das hatte ihm etwas geraubt; und es hatte sie erschreckt, ihn geschrumpft zu erleben.
»Eigentlich nicht.«
»Du kriegst das hin.«
Sorrel holte tief Luft und stieg die breiten, flachen Stufen zur Tür hinauf. Diese öffnete sich, ehe sie anklopfen konnte.
Ein Mutant mit kurz geschorenen schwarzen Haaren und ohne erkennbaren Hals tauchte auf. Das Licht der Lampe, die er trug, warf tiefe Schatten auf die andere Hälfte seines Gesichts. »Wir haben euch schon erwartet.«
Diese Worte beunruhigten Sorrel. Was meinte er mit erwarten? Wussten sie schon die ganze Zeit, dass Sorrel nach Eli suchte? Sie warf einen kurzen Blick auf Einstein.
»Ich denke, Olaf möchte uns damit sagen, dass sie uns im Auge behalten haben, seit wir im Tal eingetroffen sind.«
Olaf kicherte. »Lange nicht gesehen, Einstein.«
Er führte sie in eine Empfangshalle, die vom Licht weniger Kerzen erhellt wurde. Gemälde hingen an den Wänden, und obwohl die Beleuchtung zu schwach war, konnte Sorrel immerhin erkennen, dass auf den Leinwänden seltsame Tiere und wilde Landschaften abgebildet waren.
»Wer ist deine Freundin?« Olafs Frage war an Einstein gerichtet, aber es war Sorrel, die er anblickte.
»Ich heiße Sorrel.«
»Sauerampfer.« Olaf kicherte erneut.
Sorrel wurde wütend, als sie dieses Wort hörte. Es war im Gefängnis von Dinawl gewesen, als man sie zuletzt damit angesprochen hatte.
»Legt eure Waffen hier ab.« Er deutete mit dem Kopf auf eine Anrichte.
Einstein legte den Speer ab. Sorrels Hand zögerte auf dem Weg zu ihrem Messer.
»Zwing mich bloß nicht, es dir wegzunehmen, Ampfer«, mahnte Olaf.
»Leg es dorthin«, sagte Einstein.
Sorrel zögerte einen Augenblick und legte dann ihr Messer ab.
»Muss ich euch nach weiteren Waffen abtasten?«, fragte Olaf.
»Mehr haben wir nicht«, antwortete Einstein.
Olaf schmunzelte angesichts von Speer und Messer. »Erstaunlich, dass ihr es so weit geschafft habt. Folgt mir. Brig erwartet euch.«
Sorrels Herz klopfte heftig, während Olaf sie zu einem Zimmer führte, in dem mehrere Lampen leuchteten und ein lebhaftes Feuer auf dem Kaminrost loderte. Sorrel hatte die ganze Zeit nur an Eli gedacht, aber letztlich dämmerte ihr, dass sie im Begriff stand, dem Monster gegenüberzustehen, das nicht nur ihren Bruder entführt hatte, sondern auch für die Ermordung ihrer Mutter und Schwester verantwortlich war.
Sie sah sich um, aber Brig war nicht hier.
»Er kommt bald.« Olaf neigte den Kopf und verließ das Zimmer.
Vorleger bedeckten den Boden, und auf den gepolsterten Sofas lagen Kissen. Blumen standen in einer Vase auf einem Tisch, und das Feuer brannte hell und warm. Mit Sorgfalt hatte man diesen Raum gestaltet. Einstein betrachtete Sorrel, während sie herumspazierte, die Dinge mit Augen und Fingern inspizierte.
»Nicht das, was du erwartet hast?«
Sie schüttelte den Kopf und wusste nicht recht, wie sie das alles einordnen sollte.
»Er ist ein vielschichtiger Charakter.«
»Das verstehe ich mal als Kompliment.«
Sorrel fuhr zusammen, als sie Brigs knurrende Stimme vernahm. Sie drehte sich um und sah sich unmittelbar dem Mutanten mit dem rasierten Schädel gegenüber, dem Mann, der ihre Mutter und Schwester ermordet hatte.
Mutanten waren im Allgemeinen wuchtig gebaut, aber selbst nach diesen Standards war Brig ein Kraftprotz. Seine durchdringenden blauen Augen bannten Sorrel an Ort und Stelle, und ihr gefror das Blut in den Adern.
»Ich kenne ihn, aber wer bist du?«
Sorrel hätte beinahe gelacht; allerdings hätte dieses Lachen bitter geschmeckt und wäre ihr auf den Lippen geronnen. Brig war der Herold allen Unheils in ihrem Leben, und er wusste noch nicht mal, dass es sie gab. Schamgefühl, heiß und voller Trauer, sickerte durch sie, während sie daran zurückdachte, wie sie in die Schatten Amats gekrochen war, um sich vor ihm zu verstecken. Sie war jedoch nicht bereit, es ihm zu verraten, und so straffte sie die Schultern, hob das Kinn und erwiderte offen seinen Blick, als sie antwortete.
»Ich bin Sorrel, Elis Schwester, und ich bin gekommen, um Anspruch auf ihn zu erheben.«
Falls Brig bemerkt hatte, dass ihre Stimme zitterte, sagte er jedenfalls nichts dazu. Vielmehr machte er schmale Augen und drehte sich zu Einstein um.
»Und warum bist du hier? Was gedenkst du zu beanspruchen?« Sein Tonfall war spöttisch, aber Einstein ließ sich nicht provozieren.
»Ich bin als Sorrels Freund hier.«
»Freund?« Brig blickte erneut Sorrel an. »Von der Bedeutung dieses Wortes versteht er kaum etwas. Du wärst gut beraten, ihm nicht zu trauen.«
Die Anspannung, die Brig ins Zimmer gebracht hatte, verstärkt sich um das Zehnfache. Sorrel spürte, dass eine Eruption unmittelbar bevorstand, aber aus welcher Richtung, das konnte sie nicht erkennen.
»Du hast mich verkauft, Brig. Du hast mich an die Freien verkauft!« Diese so lange zurückgehaltenen Worte brachen aus Einstein hervor.
»Du hattest mich verraten!«, brüllte Brig zurück.
»Dich verraten? Wir waren Freunde. Du hast dich völlig ohne Grund gegen mich gewandt.«
Sorrels Blick wanderte von einem der beiden zum anderen, während sich Einstein und Brig gegenseitig Worte an die Köpfe schleuderten. Sie rückte auf die Tür zu, während die beiden Mutanten aufeinander zutraten. Wenn es zum Schlimmsten kam, wollte sie in die Halle hinaustreten, sich ihr Messer holen und es Brig in den Hals stoßen, und dann konnten sie Eli finden und von diesem seltsamen Ort fliehen.
Als hätte er ihre Gedanken gelesen, fuhr Brig sie an: »Du da! Komm herüber, wo ich dich im Auge behalten kann!«
Sorrel blickte Einstein an. Er nickte, und sie ging zu ihm. In just diesem Augenblick ging die Tür auf und es erschien Olaf. Er blickte erst Sorrel und Einstein an und schließlich Brig, eine Frage im Gesicht.
»Lass uns allein«, sagte Brig.
»Wie du möchtest.« Olaf nickte und warf noch einen listigen Blick auf Sorrel und Einstein, ehe er sich zurückzog.
»Keinem von euch kann man trauen«, knurrte Brig. »Was dich angeht, Einstein, ich wusste, dass du überleben würdest. Mein Gewissen ist rein.«
»Du hast kein Gewissen.«
Brig warf ihm einen verächtlichen Blick zu. »Du bist so clever, aber du weißt gar nichts. Ich fühle so viel wie nur irgendwer, Einstein. Ich bin verletzbar, ich blute. Als du mich verraten hast, war es für mich wie ein Stich ins Herz.«
»Ich war dir von Anfang an loyal, nachdem du mich aufgenommen hattest. Also erzähle mir, wie ich dich verraten habe, Brig.«
»Versuche nicht, mich zu verunsichern, Einstein. Du weißt sehr gut, was ihr getan habt, du und Clovis.«
»Clovis? Darum geht es? Das war ...«
»Das war was, Einstein?«
Eine Unterbrechung trat ein, ehe Einstein antwortete, und Sorrel ergriff die Gelegenheit beim Schopf.
»Könnt ihr bitte aufhören? Ich bin hergekommen, um meinen Bruder zu finden. Brig, du behauptest, du würdest empfinden und leiden wie alle anderen, aber du bist in mein Dorf gekommen und hast es zerstört. Du hast meine kleine Schwester ermordet, und ich habe miterlebt, wie du meine Mutter umgebracht hast. Ich habe gesehen, wie du es getan hast. Dann hast du Eli entführt, und seitdem bin ich auf der Suche nach ihm. Wenn du – wie du behauptest – ein Gewissen hast, wirst du ihn mir zurückgeben.«
Diesmal bebte ihre Stimme nicht, aber als Brig sie anblickte, zuckten die Muskeln in seinem Gesicht, und sie dachte schon, er würde ihr den Kopf abbeißen. Ein Zittern lief so tief durch Sorrel, dass ihre Knochen beinahe zerflossen.
Obwohl sie schon fürchtete, sie würde unter dem harten Blick seiner Augen zusammenbrechen, blieb Sorrel aufrecht. Nach einigen langen Augenblicken beruhigte sich Brigs Miene, und nachdem das geschehen war, schien er sie mit frischem Interesse zu betrachten.
»Du warst dort?«
Sorrel nickte.
»Versteckt?«
Sie nickte erneut, diesmal mit finsterem Blick und puterrotem Gesicht.
»Dann solltest du etwas erfahren. Ich habe deine Mutter getötet, um sie von ihrem Leid zu befreien.«
Unvermittelt blitzte heftiger Zorn in Sorrels Gesicht auf, aber ehe sie etwas sagen konnte, hob Brig die Hand und gab ihr zu verstehen, dass sie zuhören sollte.
»Ich habe das Baby nicht umgebracht, Sorrel.«
Ein Schauer lief durch sie, als sie den eigenen Namen von seinen Lippen hörte. »Jemand aus meiner Truppe hat das getan, und als deine Mutter das Kind zu beschützen versuchte, hat er ihren Bauch durchstoßen.«
Sorrel dachte an jenen fürchterlichen Tag in Amat zurück. An ihre Mutter, die aus der Hütte stolperte und Bella an sich drückte. Rot war zu sehen gewesen, viel Rot. Sorrel hatte gedacht, dass es von Bella stammte, aber es hätte auch von ihrer Mutter oder von beiden stammen können.
»Sie wäre langsam und qualvoll gestorben und voller Schmerz wegen des Kindes. Ich habe ihr ein rasches Ende bereitet.«
»Wenn das stimmt, was ist dann aus dem geworden, der sie niedergestochen hat?« Die Frage kam von Einstein.
»Er wurde verwundet.« Brig blickte Sorrel an. »Von einem Mädchen. Wir haben ihm Nahrung und Wasser gegeben und ihn zurückgelassen.«
»Ich habe seine Nahrung ins Feuer geworfen und das Wasser verschüttet.« Sorrel fühlte sich leer nach dem, was sie gehört hatte, und ihr Ton war ausdruckslos, obwohl ihr beim Gedanken an den maulwurfsäugigen Mutanten schlecht wurde. »Ich hoffe, dass er langsam und qualvoll gestorben ist.«
Brig zuckte die Achseln. »Keine lebende Seele wird eine Träne über Turk vergießen.«
»Ich möchte meinen Bruder sehen.«
Einen Augenblick später nickte Brig. »Folge mir.« Er ging zu einer Tür in der Ecke des Zimmers. Sorrels Herz klopfte heftig, als sie ihm hinterherging. Sie warf einen Blick auf Einstein. Er nickte. Endlich würde sie mit Eli wiedervereint werden!
Die Tür führte auf einen kurzen Flur, an dessen Ende eine weitere Tür folgte. Brig öffnete diese. Dahinter saß in einem von hellem Lampenlicht beleuchteten Zimmer ein Kind auf einem Vorleger und spielte mit einem Satz hölzerner Stapelbecher.
Sorrel sprang fast das Herz aus der Brust, als sie ihn sah. Eli! Nach all dieser Zeit! Und er sah gut aus. Er war größer geworden, hatte sich aber ansonsten nicht sehr verändert. Nach Monaten, in denen sein Gesicht in ihrer Erinnerung schon blass geworden war, stellte sie erleichtert fest, dass sie ihn überall wiedererkannt hätte.
Eli blickte auf, als sie eintraten, und ein Lächeln erstrahlte in seinem Gesicht. Man sah keinerlei Hinweis darauf, dass er verletzt wäre oder leiden würde. Er schien glücklich. Zunächst glaubte Sorrel, dass er sie erkannte, aber als er sich aufgerappelt hatte, war es Brig, zu dem er lief.
»Hoch, Dada, hoch!«
Brig lachte und warf Eli in die Luft, ehe er ihn wieder auffing und drückte, während Sorrel fassungslos zusah. Dada?
Eli starrte Sorrel aus Brigs Umarmung heraus an, aber als sie seinen Namen flüsterte, vergrub er das Gesicht an Brigs Hals.
»Eli, kennst du mich nicht mehr?«
Eli linste sie an, aber sie fand keinen Hinweis in seinen Augen, dass er sie erkannt hätte. War es möglich, dass er sie schon vergessen hatte? »Ich bin Sorrel, deine Schwester.«
»Bitte«, wandte sie sich an Brig, »ich möchte ihn mal halten.«
Brig hielt Eli noch einige Augenblicke lang in den Armen, während er über diese Bitte nachdachte, dann küsste er das Kind auf den Kopf und reichte es an sie weiter.
Tränen stiegen Sorrel in die Augen, während sie die Arme ausstreckte, um ihren Bruder an sich zu drücken. »Eli, ich bin es, Sorrel.«
Obwohl sie die Worte leise sprach, legte Eli das Gesicht in Falten und fing an zu weinen. Innerhalb von Sekunden heulte er laut und zappelte, um ihrem Griff zu entrinnen.
»Nein, Eli, ich bin es doch! Ich tu dir nichts.«
Das Kind wollte sich aber nicht beruhigen, und sie konnte es kaum festhalten. Gerade als es ihr entglitt, packte Brig es. Während er Sorrel den Jungen aus den Armen nahm, krallte Eli nach ihrem Hals. Sie schnappte nach Luft, als die winzigen Nägel über ihre Kehle harkten. Als er die Hand zurücknahm, war sie zur Faust geballt, und die Silberkette ihres Anhängers hing heraus.
Sorrels Hand flog automatisch an ihren Hals. Die leere Stelle dort verriet ihr, was sie schon wusste: Eli hatte ihr die Halskette der Großmutter entrissen.
»Kennst du sie noch, Eli? Erinnerst du dich an die Halskette?« Sie hörte den flehenden Unterton der eigenen verzweifelten Stimme, aber sie konnte nicht anders, sie war verzweifelt. Sehnte sich verzweifelt danach, von ihrem Bruder erkannt – und geliebt zu werden.
Eli wandte sich von ihr ab und vergrub das Gesicht an Brigs Hals.
»Bitte ...«
»Du machst ihm Angst, Sorrel«, sagte Brig.
»Aber ich bin seine Schwester!«
»Dann verhalte dich auch so und geh auf Distanz.«
»Auf Distanz? Gib ihn mir zurück, du Monster!«
Brig wandte sich ab und schirmte Eli ab, während Sorrel diesen zu packen versuchte. Eli hob den Kopf von Brigs Hals und heulte laut, als er sie näher kommen sah.
»Was hast du mit meinem Bruder gemacht?«, kreischte Sorrel.
Einstein packte sie am Arm und hinderte sie so daran, sich erneut auf Eli zu stürzen. »Sorrel, hör auf!«
Sorrel kämpfte darum, sich von Einstein zu befreien, aber er hielt sie fest und drängte sie mit leiser Stimme, sich zu beruhigen. Sie wehrte sich gegen seinen Griff und sah dabei zu, wie Brig Eli über den Hinterkopf streichelte und ihn hätschelte.
Jedes Zeichen seiner Liebe zu ihrem Bruder war ein weiterer Splitter, der sich ihr ins Herz bohrte. Obwohl sie diesen Schmerz spürte, wusste sie, dass es so besser war, als sie gefürchtet hatte. Brig hatte den Jungen nicht schlecht behandelt – aber es tat trotzdem weh. Gib es zu, Sorrel. Was wirklich wehtut, ist der Umstand, dass Eli diese Liebe erwidert.
Als ihr dieser Gedanke durch den Kopf ging, wehrte sie sich nicht mehr gegen Einstein, sondern weinte nur. Einstein legte die Arme um sie und drückte sie fest, tröstete sie auf die gleiche Art, wie es Brig mit Eli tat, aber egal wie oft er ihr sagte, dass er für sie da war, es war nicht genug. Er konnte nichts tun, um zu verhindern, dass ihr Herz in eine Million winzige Scherben zerbrach.
Als Brig sie anwies, in das andere Zimmer zurückzukehren und dort zu warten, leistete Sorrel keinen Widerstand, während Einstein sie hinüberführte. So oft schon hatte sie sich leer gefühlt, aber jetzt war sie vollkommen trostlos.
Sie blickte zu Einstein auf, als er sie auf einen Stuhl am Kaminfeuer drückte.
»Er mag mich nicht. Mein Bruder mag mich nicht. Die ganze Zeit lang, diese ganzen Träume davon, ihn wiederzufinden ... Ich dachte nie – nicht ein einziges Mal -, dass er mich zurückweisen würde. Dass er mich hassen würde.«
Einstein drückte ihr die Schulter. »Ich bin sicher, dass er dich nicht hasst, Sorrel, aber dich zu sehen, musste ein Schock für ihn sein. Vielleicht hat es Erinnerungen an den Tag damals wachgerufen.«
»Du meinst den Tag, an dem Brig unsere Mutter ermordet hat?«
»Ich habe dir schon erklärt«, sagte Brig, der gerade das Zimmer betrat, »dass deine Mutter im Sterben lag. Ich habe ihren Schmerzen ein Ende gemacht.«
»Du hättest sie sowieso ermordet.« Sorrel wischte sich die Tränen ab und war wütend, weil Brig sie in ihrer verwundbarsten Verfassung erlebte. Wütend auf alles, was er getan hatte.
»Keinesfalls. Sie war jung genug und stark. Ich hätte sie mit den anderen zusammen gefangen genommen.«
»Um sie auf dem Sklavenmarkt zu verkaufen«, höhnte Einstein. »Wie nett von dir.«
Brig holte tief Luft, ehe er darauf reagierte. »Ich habe vieles getan und später wieder bedauert, einschließlich der Tatsache, dass ich den Bewahrern gegen bare Münze meine Seele verkauft habe. Jetzt jedoch habe ich die alten Wege hinter mich gelassen. Eli hat mir die Richtung gewiesen. Ihr glaubt mir vielleicht nicht, aber ich bin inzwischen anders. Ich strebe nur noch nach einem friedvollen Leben. Seit ich mit Eli hier eingetroffen bin, habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Sieh dich um, wenn du mir nicht glaubst, Einstein. Ich habe die alte Truppe aufgelöst. Jetzt sind nur noch eine Handvoll hier.«
»Du hast mein Zuhause zerstört, du hast meine Mutter umgebracht und meinen Bruder verschleppt und erwartest jetzt von uns zu glauben, du hättest dich verändert?«
Sorrel war so voller Zorn, dass sie Brig am liebsten angeschrien hätte. Sie wollte ihn mit Worten verletzen, ihm wehtun, sein Herz auf die Art und Weise zertrümmern, wie er es mit ihrem getan hatte. Stattdessen presste sie jedoch die erstickten Worte zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch.
»Es ist wahr, ob du es nun glaubst oder nicht. Ich habe der Gewalt abgeschworen. Es steht euch frei, über Nacht hier zu bleiben. Ihr erhaltet zu essen und dürft Betten für die Nacht beziehen, und morgen früh erhaltet ihr Vorräte für den Weg. Ich habe nur eine Bedingung.«
»Und die lautet?«, fragte Einstein mit unverhohlenem Zynismus im Ton.
»Geht in Frieden, aber kehrt nie zurück. Ein zweites Mal nehme ich euer Eindringen nicht mehr einfach hin.«
»Was wird aus Eli?« Da Sorrel die Antwort fürchtete, flüsterte sie die Frage nur, aber Brig verstand sie trotzdem.
»Du kennst die Antwort schon. Das Kind hat seine Wahl getroffen.«
Nach diesen Worten verließ Brig das Zimmer durch die Tür in der Ecke. Als er sie hinter sich schloss, hob Sorrel das tränennasse Gesicht zu Einstein. »Alles war vergebens.«
»Nein, Sorrel.« Einstein kniete sich vor sie und fasste sie an den Händen. »Es war nicht vergebens. Du hast Eli gefunden – und hast ihn in Sicherheit und wohlauf vorgefunden. Wir werden ihn mitnehmen. Er ist schließlich dein Bruder, und Brig hat kein Recht, ihn dir vorzuenthalten.«
Sorrel schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht machen. Eli ist kein Gegenstand, um den man sich zankt. Es bringt mich schier um, das zu sagen, aber Brig hat recht. Eli ist hier in Sicherheit, und das ist mehr, als wir ihm bieten können.«
Ihr versagte die Stimme, als noch mehr Tränen flossen. Sie hätte einen Ozean damit füllen können, und es hätte immer noch nicht gereicht, um ihre Trauer auszudrücken, aber sie musste die für Eli richtige Entscheidung treffen.
»Wir können für seine Sicherheit sorgen, Sorrel.«
»Wirklich? Können wir das wirklich? Was wäre geschehen, während du in den Minen warst und ich im Gefängnis? Was wäre zu dem Zeitpunkt geschehen, als mich die Schlinge am Henkersbaum erwartete? Wie hätten wir damals für Eli sorgen können?«
»Es ist jetzt anders.«
»Inwiefern? Wir können ihm nichts bieten, und außerdem – macht Brig ihn glücklich.« Dicke Tränen rollten ihr übers Gesicht, während sie redete. »Du hast doch gesehen, wie Eli ihn angelächelt hat. Er nennt ihn sogar Dada! Er hat geschrien, als er mich sah, Einstein. Er hat geschrien.«
»Das war nicht deine Schuld. Es lag an dem, was Brig in Amat getan hat.«
»Vielleicht hast du recht, aber egal, wie die Wahrheit aussieht: Wenn Eli mich ansieht, leidet er. Brig bringt ihn zum Lächeln. Ich muss tun, was für Eli das Richtige ist, nicht für mich. Ich habe nichts, ich kann ihm nichts bieten. Kein Glück und ganz gewiss keine Sicherheit.«
»Sorrel, du bist die tapferste Seele, der ich je begegnet bin.«
»Ich bin nicht tapfer. Ich habe Angst. Ich kenne überhaupt nur Furcht. Ich möchte nicht, dass das Elis Erbe wird.« Sorrel wischte sich die Tränen ab. »Bitte, geh Brig für mich holen.«
»Bist du sicher?«
»Ich bin sicher.«