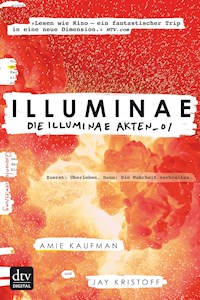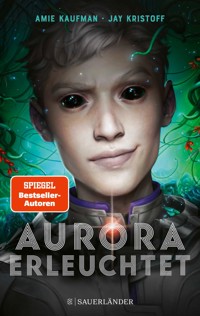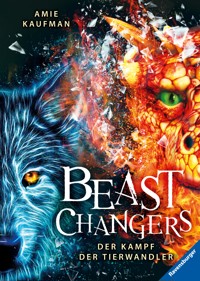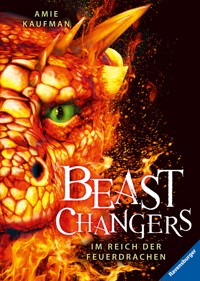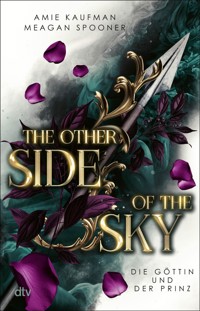
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Göttin und der Prinz Reihe
- Sprache: Deutsch
Nimh und North – Zwei Welten, ein Schicksal Prinz Norths Heimat liegt jenseits der Wolken, in einer glänzenden Stadt, die von erstaunlicher Technik im Himmel gehalten wird. Nimh ist die lebende Göttin ihres Volkes in dem Reich darunter, das nichts kennt außer Glaube und Magie. Ohne zu ahnen, dass die Welt des jeweils anderen existiert, sind ihre Schicksale miteinander verbunden, doch ihre Herzen dürfen es niemals sein. - Für alle Fans von Götter-Fantasy – in zwei Bänden - Ein Roman, zwei Welten, zwei Perspektiven - Mit den beliebten Tropes Forbidden Love, Slow Burn, Enemies to Lovers, First Love, Starke Heldin, Good vs. Evil Dies ist eine Neuauflage von ›Die Göttin und der Prinz - The Other Side of the Sky‹. Alle Bände der Reihe: Band 1: Die Göttin und der Prinz – The Other Side of the Sky Band 2: Die Göttin und der Prinz – Beyond the End of the World Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Nimh und North – zwei Welten, ein Schicksal
Über den Wolken von Alciel schweben glänzende Himmelsstädte. In den Schatten darunter aber existiert unerkannt eine dunklere Welt mit uralten Tempeln und dem Glauben an Magie. Als Nimh beobachtet, wie ein Flugzeug in ihre Welt abstürzt, ist das für sie die Bestätigung einer Prophezeiung. North hingegen, der Prinz aus dem Reich über den Wolken, glaubt nicht an die Zauber und Vorhersagen dieser Welt, aber er muss einen Weg zurück finden zu seiner Seite des Himmels. Zögernd gehen die beiden ein Bündnis ein und kommen sich langsam näher. Aber Nimh ist die lebende Göttin ihres Volkes und darf von keinem Menschen berührt werden …
Von Amie Kaufman (zusammen mit Jay Kristoff) ist außerdem bei dtv lieferbar:
Illuminae. Die Illuminae Akten_01
Gemina. Die Illuminae Akten_02
Obsidio. Die Illuminae Akten_03
Von Amie Kaufman und Meagan Spooner ist außerdem bei dtv lieferbar:
Die Göttin und der Prinz 2. Beyond the End of the World
Amie Kaufman / Meagan Spooner
Die Göttin und der Prinz
The Other Side of the Sky
Band 1
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Katja Hald
Für Kristen, die mit uns an Magie geglaubt hat
1Nimh
Ganz langsam nimmt der schwimmende Markt im zuckenden Schein der Fackeln und Zauberfeuer Gestalt an, während ein jedes der ankommenden Boote einen Schweif aus sich im Fluss spiegelnden Lichtern hinter sich herzieht. Noch verbirgt sich die Sonne hinter dem Horizont, aber ein Hauch von Pfirsichrot und Kupfergold streift bereits die Wolkendecke, die schwer über dem Gedränge des Marktes hängt und die eine drückende Grenze bildet, zu einem hier unten gänzlich unbekannten Reich. Monströse Schatten kriechen aus der morgendlichen Dämmerung und treiben stromabwärts in Richtung der sich ausdehnenden Wasserstadt, wo sie sich im heller werdenden Licht des Tages als Häuser, Werkstätten, Essensstände und Verkaufsbuden entpuppen.
Früher habe ich die Ankunft des schwimmenden Marktes, der hier jeden Monat abgehalten wird, regelmäßig beobachtet. Flussvolk aus weit entfernten Regionen sammelt sich in den Flussniederungen unterhalb des Tempels, steuert seine Häuser mit Segeln, Rudern oder Stangen über den breiten, trägen Strom, bis das Treiben ihn über die Ufer treten und ins Waldmeer schwappen lässt. Innerhalb weniger Stunden verschmelzen unzählige Schilfbarken zu einem vor Leben strotzenden Ganzen und machen aus der beschaulichen Flussbiegung eine wimmelnde Stadt. Diese Verwandlung meiner Welt hat mich von jeher fasziniert – aber mit jedem Mal verblasst die Begeisterung neben der Qual, den Markt nicht mit dem Rest meines Volkes genießen zu dürfen, ein klein wenig mehr.
Es ist das erste Mal seit Jahren, dass ich während des Ankerns wieder auf dem Fluss bin. Vom Heiligtum des Tempels aus betrachtet, wirkt alles weit entfernt, gedämpft. Dort rieche ich weder die Holzkohle und Torffeuer der Köche und Bäcker, die ihre Öfen anheizen, noch höre ich das helle Lachen der Kinder, die zu jung sind, um ihren Eltern mit den Tauen zu helfen. Und auch die pulsierende Synkope aus Schritten und Strömung, welche die schwimmenden Marktstraßen unter meinen Füßen in steter Bewegung hält, spüre ich dort nicht.
Ich erinnere mich nur vage an die Zeit vor dem Tempel, aber einst war auch ich eines dieser Kinder. Damals versprach der verführerische Geruch nach gegrilltem Fleisch und Gewürzbrot eine Belohnung, wenn ich brav war, und das Lachen kam von meinen Freunden, die mich zum Spielen riefen. Einst waren es meine Füße, die auf und ab rannten und die Straßen aus dicken Schilfmatten zum Schwanken brachten.
Vor ein paar Jahren habe ich es einmal gewagt, mich im geliehenen Kleid einer Dienerin auf den Markt zu schleichen, aber die Leichtigkeit und Sicherheit, mit der ich mich als kleines Kind dort bewegte, gehörte bereits der Vergangenheit an. Noch bevor ich die erste Straße bis ans Ende gegangen war, wurde das Gedränge so dicht, dass ich mich in den Schutz der Wachen flüchtete, die bereits panisch nach mir suchten. Nun bin ich allein hier.
Dieser Tage bin ich nicht mehr so töricht, mich zu verkleiden. Viel zu leicht könnte mich jemand streifen oder mich am Arm packen, um mir irgendwelchen Nippes zu verkaufen. Jedes Kind weiß, was mein dunkelrotes Gewand und die mit Kohle umrandeten Augen bedeuten – sie lernen es, noch bevor sie laufen können.
Aber auch nach all der Zeit, die ich das geschäftige Hin und Her des Flussvolkes bereits aus der Ferne beobachte, löst das Gedränge noch immer ein tiefes Unbehagen in mir aus, das schmerzt wie eine alte Wunde. Denn trotz des roten Gewandes und des goldenen Stirnreifs, der traditionellen Kleidung einer Gottheit, die jeden davor warnt, mir zu nahe zu kommen, könnte mich jemand aus Versehen berühren. Es war riskant, fast schon fahrlässig, hierherzukommen – aber die Staatenlenker und Priester, die über mein Leben bestimmen, lassen mir keine Wahl.
Wie so oft wandert mein Blick nach oben zu der dunklen Wolkenmasse über unseren Köpfen. Seit die Götter vor tausend Jahren nach oben geflohen sind und nur eine Gottheit – die erste meiner Linie – zurückgeblieben ist, um ihr verlassenes Volk zu führen, hat man nichts mehr von ihnen gehört. Leben sie noch dort oben? Kümmert es sie, dass ihre Vertreterin in diesem Land gezwungen ist, zu verzweifelten Mitteln zu greifen, um ihrem Volk zu helfen?
Meinen Wachen zu entwischen, war nicht schwer, ganz einfach deshalb, weil ich es nie versuche – jedenfalls nicht mehr. Ich bin keine Gefangene, und auch wenn meine Wachen dazu ausgebildet wurden, bis auf den Tod für mich zu kämpfen, sind sie äußerst zurückhaltend. Würde ich jedoch flankiert von einem Dutzend Männern und Frauen im düsteren Schwarz und Gold der göttlichen Wachen den Markt besuchen, hätte ich gleich den Tempel und die gesamte Stadt über mein Vorhaben informieren können. Die Nachricht wird sich zweifellos auch so schnell bis in den Tempel herumsprechen und das Ohr von Hohepriester Daoman erreichen. Bis dahin werde ich aber längst eine sichere Bootsfahrt für meine Reise vereinbart haben und kann behaupten, ich hätte lediglich dem Ankern beiwohnen wollen.
Das Hausboot, nach dem ich suche, sticht mit seinem zusammengeschusterten Dach, dessen Streben wie dürre Arme in den Himmel ragen, zwischen den anderen hervor. Es ist Quentis Boot. Auf den Flüssen des Waldmeeres ist es eines der schnellsten, aber sobald Quenti ankert, ersetzt er die Segel durch Tierhäute, Schlingpflanzen und Schilf, um diese dann hoch über der Feuchtigkeit des Flusses in der Sonne zu trocknen. Ich umklammere den Schaft meines Speeres, dessen Spitze meine magischen Amulette zieren, und halte Ausschau nach dem Ankerplatz des Händlers.
Über einer eingeschossigen Viehhütte flackert ein Zauberfeuer auf, in dessen blaugrünem Licht ich erspähe, wonach ich suche, doch es führt kein direkter Weg zu Quenti und mich verlässt der Mut. Ich werde mich wohl oder übel in das Gedränge begeben müssen.
Etwas Warmes stößt kräftig gegen meinen Knöchel und diese eine Berührung genügt, dass ich mir ein Herz fasse. Ich muss nicht nach unten sehen, um zu wissen, dass es der Findelkater ist. Sein vertrautes Maunzen dringt an mein Ohr, und als ich ihm antworte, hebt er das breite haarige Gesicht und sieht zu mir auf. Mit einem Schnurren, laut wie das Grollen einer Sturmwolke, stößt er ein zweites Mal den Kopf gegen mein Bein und ich mache mich auf den Weg.
Um das dichteste Gedränge zu umgehen, halte ich mich am Rand des Marktes. Dennoch begegne ich zahlreichen Flussleuten, die noch immer damit beschäftigt sind, ihre Häuser mit anderen zu vertäuen. Ich bleibe gerade lange genug stehen, um eine Prise Feuersamenpulver aus einem der Beutel an meiner Chatelaine zu nehmen.
Ich schließe die Finger und flüstere eine Beschwörungsformel in meine Hand. Ein paar der winzigen Körnchen entweichen mit meiner Atemluft und sinken als funkelnder Sternenregen zu Boden. Mit dem übrigen Pulver reibe ich die Spitze meines Speeres ein, bis sie ein sanftes Licht auf die Wasserlache unter meinen Füßen wirft. Nun, da von mir ein Leuchten ausgeht, strebt mein Volk auseinander und macht mir Platz. Die Menschen, an denen ich vorübergehe, fallen auf die Knie und berühren mit der Stirn das Schilf, sodass ich vor mir nur noch geneigte Köpfe und die farbenfrohen Rücken der Marktkleider sehe.
Göttliche, flüstern sie respektvoll. Schöne Göttin. Heilige Gottheit.
Wann immer sich ein Gesicht hebt, um mich anzusehen, murmele ich meinen Segen und wünsche mir, nur einmal durch die Menge gehen zu können, ohne dass die Menschen mir mit ihren hungrigen Augen folgen, sehnsüchtig auf ein Zeichen der Rettung wartend, welches mein Volk so sehr benötigt. Manchmal meine ich, hinter der Verehrung Zweifel zu sehen – manchmal weiß ich, dass da Zweifel sind.
Alle lebenden Gottheiten der Geschichte, alle meine Vorgänger, verkörperten eine besondere Eigenschaft des Göttlichen, die eine Antwort bildete auf die jeweiligen Nöte und Bedürfnisse unseres Volkes. Es gab Gottheiten der Dichtung, des Krieges, der himmlischen Gestirne und des Wachstums. Die Gottheit, die vor mir in den Tempel berufen worden war, war eine Göttin der Heilung.
In allen lebenden Gottheiten hat sich diese Eigenschaft ein oder zwei Jahre, nachdem sie berufen worden waren, manifestiert. Es heißt, bei Satheon, der unser Volk zu Zeiten meiner Großeltern führte und der mit sechzehn in den Tempel berufen worden war, habe sich seine göttliche Eigenschaft, der Ackerbau, bereits nach einer Woche gezeigt.
Ich selbst bin nun schon seit zehn Jahren eine Göttin, und mein Volk wartet noch immer sehnsüchtig darauf, zu erfahren, welchen Trost ich ihm einst bringen werde. Wenn es denn jemals so weit sein wird.
Der Findelkater, der meine quälenden Gedanken zu erahnen scheint, neigt den Kopf und beißt mich sanft in den Knöchel. Ich ziehe die Luft ein und konzentriere mich auf den kurzen, stechenden Schmerz, froh um seine Begleitung.
Ich habe den Kater eines Nachmittags in einem fest verknoteten Bündel am Flussufer gefunden, ein paar Monate, nachdem man mich in den Tempel gebracht hatte. Er war ganz klein, patschnass und halb ertrunken. Aber so erbärmlich dürr er als Kätzchen war, so massig und muskulös ist er heute. Ein kräftiges Tier mit einem feuerroten Fell.
Mit erhobenem Schwanz und wachsamen Augen trottet er neben mir her und maunzt ebenfalls seinen Segen – wenngleich es bei ihm eher wie ein Fluch klingt. Im Gegensatz zu allen anderen Bewohnern meiner Welt, denen nur allzu deutlich bewusst ist, dass sich meine Eigenschaft schon vor Jahren hätte zeigen müssen, und die trotzdem all ihre Hoffnungen in mich setzen, hat der Findelkater keinerlei Erwartungen an mich – einmal abgesehen von einem vollen Fressnapf. Er ist einfach nur ein Kater. Weshalb er mich, anders als meine Bediensteten und Wachen, auch berühren darf – und ich ihn. Etwas Handfestes und Warmes zum Streicheln und Kuscheln zu haben, wenn ich einsam bin, macht alles andere ein bisschen erträglicher.
Vor mir zieht eine Prozession von Lebensmittelhändlern die Schilfstraße hinunter. Ich bleibe stehen, um sie nicht zu stören. Sie sind umringt von einer Horde lärmender Kinder, die auf einen unachtsamen Moment hoffen, in dem ein eiliger Verkäufer ein klebriges Brötchen oder einen Beutel Süßigkeiten fallen lässt. Direkt hinter ihnen balanciert ein Händler ein Tablett mit Glücksbringern vor sich her, die Krankheiten und Unglück abwenden sollen. Diese Art von Amuletten wird oft erworben und weiterverkauft, ohne je mit einem Funken echter Magie in Berührung gekommen zu sein. Das schwache Vibrieren, das von diesen hier ausgeht, verrät mir jedoch, dass sie echt sind, hergestellt von einem einheimischen Kräuterhexer, vielleicht sogar dem Händler selbst, dessen kleine Zauberfeuerlaterne einen Schwarm neugieriger, lichthungriger Insekten hinter sich herzieht.
Der Findelkater, der zu meinen Füßen sitzt, betrachtet das Treiben mit zunehmendem Missfallen.
Während ich darauf warte, dass die Händler weiterziehen, werfe ich einen Blick zurück auf die Gebäude, welche die engen, gewundenen Gassen um den Tempel oberhalb des Flusslaufes säumen. Auf vielen Dächern flattern Wimpel in Rot und Gold, die im Dämmerlicht leuchten. Doch je heller der Morgen wird, umso besser sind auch die Umrisse der übrigen Wimpel zu erkennen, und mir läuft ein Schauder über den Rücken.
Diese Wimpel sind grau, als wollten sie sich vor dem trüben Himmel tarnen, und es sind viele, sehr viele. Mehr, als mir bewusst war.
Von meinen Gemächern im Tempel aus, dem Audienzsaal oder der Terrasse, von der ich zu meinem Volk spreche, kann ich nur zwei graue Banner sehen. Alle übrigen werden von kunstvoll drapierten Stoffen und Hängepflanzen oder den verwinkelten Mauern des Tempels verdeckt. Es sind so viele, die meinem täglichen Blick verborgen bleiben, dass ich nicht länger an einen Zufall glauben kann. Hat einer meiner Priester, oder gar der Hohepriester selbst, diese Dekorationen angeordnet, um die wachsende Bedrohung vor mir zu verbergen?
Oder waren es die gesichts- und führerlosen Graumäntel, die das Erstarken ihrer Bewegung so lange wie möglich vor mir geheim halten wollten?
Wer auch immer dafür verantwortlich war, die Entscheidung wurde getroffen, ohne mich davon in Kenntnis zu setzen.
»Aus dem Weg!«, knurrt eine Stimme in meinem Rücken. Erschrocken drehe ich mich um.
Anstatt entsetzt über die eigene Dreistigkeit vor meiner Krone und dem roten Gewand zurückzuweichen, verzieht der alte Mann hinter mir das wettergegerbte Gesicht zu einer wütenden Grimasse. Er trägt die zerlumpte, ungefärbte Wollkleidung eines Dorfbewohners aus dem Westgebirge, seine Halskette aus Perlen und Vogelknochen kennzeichnet ihn jedoch als Mitglied eines Flussläuferclans.
Der Findelkater macht einen Buckel, presst sich an meinen Knöchel und faucht den Mann bedrohlich an, während ich den Speer zwischen uns halte und einen Schritt zurückweiche. Ich öffne den Mund, aber die Frage: Wisst Ihr denn nicht, wen Ihr vor Euch habt?, bleibt mir im Halse stecken. Noch nie musste ich jemandem erklären, wer ich bin.
Der Mann hebt die Augenbrauen, seine Pupillen weiten sich. »Du da!« Anstatt sich wie erwartet zu schämen und für sein schroffes Benehmen hastig zu entschuldigen, fängt der Mann an zu singen: »Fischlein, Fischlein, wohin bist du geschwommen …?«
Ich starre in das vor Zorn bebende Gesicht des Alten und langsam begreife ich. Meine Schultern zittern. Seine verschleierten Augen im aufgedunsenen Gesicht sehen mich nicht an wie die normaler Leute – sein trüber Blick geht an mir vorbei. Durch mich hindurch. Er ist vernebelt.
Wahrscheinlich ist er harmlos, sonst würde man ihn nicht auf den Markt lassen. Dennoch packt mich die Angst. Er mag nichts Böses im Sinn haben, könnte aber trotzdem vorwärtsstolpern oder sich auf mich stürzen …
Die verheerenden Auswirkungen der Nebelstürme sind unberechenbar. Sie ruinieren Ernten, verformen Felsen und reißen Bäume aus, die schon in dieser Erde wurzelten, als nicht nur eine Gottheit auf ihr wandelte. Noch schlimmer ist jedoch, was ein Nebelsturm dem ungeschützten Verstand eines Menschen antut.
Der Mann kichert noch immer leise vor sich hin, starrt durch mich hindurch und singt mit seiner krächzenden Stimme: »Sag mir die Wahrheit, kleiner Fisch, bist du der Einzige?«
»Lasst Euch von mir helfen, Großvater.« Die freundlichen Worte, wenngleich sie von einer Fremden kommen, scheinen ihn milder zu stimmen und aus dem Nebel zurückzuholen.
Ich überwinde meine Angst und krame mit der freien Hand in meinem Beuteln nach magischen Reagenzien. »Lasst mich Euch segnen und zurück zu Eurem Clan bringen.«
Die Flussläufer sind bekannt dafür, Vernebelte bei sich aufzunehmen, auch jene, die man aus ihren eigenen Dörfern verstoßen hat, weil es zu schwierig geworden ist, sich um sie zu kümmern. Für die Wunden, die der Nebel schlägt, sei das Leben auf dem Wasser wie Balsam, sagen sie.
»Das allerletzte und allereinsamste und allerkleinste Fischlein …« Er hört auf zu singen und sieht mich mit zusammengekniffenen Augen an.
Aber als ich die Hand hebe, um die Zauberformel zu sprechen, von der ich hoffe, dass sie seinen entzündeten Verstand beruhigen wird, bricht er plötzlich in lautes Lachen aus. »Und so sehr daran gewöhnt, mit den hungrigen Flussschlangen zu schwimmen, dass es nicht merkt, wie allein es ist.« Glucksend reibt er sich die Augen, dann sieht er mich ernst an. »Es ist mir stets eine große Ehre, Göttliche, der Letzten einer Art zu begegnen.«
Ein angstvolles Kribbeln warnt mich vor seiner Nähe. Der Nebel ist nicht bösartig – er ist eine Naturgewalt, Magie, die bei der Entstehung der Welt zurückgeblieben ist. Nur wenn er sich zu einem Sturm zusammenzieht, wird er gefährlich, und selbst dann ist seine Wirkung stets eine andere. Manchmal, wenn auch nur sehr selten, bringt er mit dem Wahnsinn auch Hellsichtigkeit …
Sollten die Graumäntel sich durchsetzen und mich meiner Macht entheben, könnte ich sehr wohl die Letzte meiner Art sein. Die letzte lebende Gottheit, welche auf dieser Erde wandelt.
Ich beuge mich hinunter, um den Findelkater zu streicheln, und spüre seine Anspannung, bereit zum Sprung. Als ich wieder aufsehe, ist der vernebelte Alte verschwunden. Der Markt hat sich mittlerweile so belebt, dass ich durch den immer dichter werdenden Ring aus Menschen, die bemüht sind, mir auszuweichen, nicht mehr viel erkennen kann. Suchend sehe ich mich um, wobei der Kreis sich in Einklang mit meiner Bewegung ausbeult, als würde er von einer unsichtbaren Welle erfasst.
Niemand kann sagen, ob es sich bei den Worten eines Vernebelten um wirres Zeug oder eine Prophezeiung handelt, bis sie tatsächlich eintritt. Aber auch wenn ich den Mann wiederfinden würde, könnte er sich an das, was er gesagt hat, wahrscheinlich nicht mehr erinnern.
Ich straffe die Schultern, damit die Menschen, von denen ich umringt werde, nicht bemerken, wie unsicher ich bin. Obwohl das Marktvolk größtenteils aus Flussläufern, meinen ergebensten und aufrichtigsten Untertanen, besteht, sehe ich immer wieder auch Grau aufblitzen. Was vor ein paar Jahren als Flüstern hinter vorgehaltener Hand tief im Untergrund begann, ist zu einer offenen Bewegung geworden. Die Graumäntel.
Aber ich werde sie meine Angst nicht spüren lassen. Mit ausholenden Schritten gehe ich weiter, während der Kreis aus Gaffern sich immer weiter ausdehnt, bis er schließlich aufbricht und Kinder wie Erwachsene vor mir zurückweichen.
Quentis zusammengeschustertes Hausboot sieht aus, als hätte man eine einfache Hütte auf einer Barke nach Bedarf um immer mehr Räume und Stockwerke erweitert, und wer Quenti kennt, weiß, dass es wahrscheinlich auch so ist.
Ich stoße die Tür einen Spaltbreit auf und räuspere mich. »Gesegnet sei dieses Haus«, rufe ich zögernd. Wie alle Flussläufer nimmt Quenti es mit der Höflichkeit nicht ganz so genau, aber da er oft sehr viele Flusskinder beherbergt, erscheint es mir sicherer, meine Anwesenheit anzukündigen.
Wildes Getrampel, dann aufgeregtes Wispern. Ich sehe nach oben und schaue in drei runde Gesichter, die mich vom Treppenabsatz im zweiten Stock aus beobachten. Als sie den goldenen Kronreif auf meinem Kopf bemerken, zucken zwei der Gesichter zurück und verschwinden. Das dritte Gesicht – ein Mädchen, wie ich im schummrigen Licht zu erkennen glaube – starrt mich mit unverhohlener Neugier an.
»Beim Weltenende, dann ist es wahr!« Das ist nicht Quentis freundlich kratzige Stimme. Ich kneife die Augen zusammen und erkenne im schwachen Licht eine junge Frau, die einem der kleinen Flussläufer zur Treppe folgt. Sie beugt sich vor, um dem Kind etwas ins Ohr zu flüstern. Dann schickt sie es weg und kommt die Stufen herunter. »Seid willkommen, Göttliche. Unser Dank für das Licht, welches Ihr diesem Tag verleiht.«
Ihre Worte klingen angespannt, verhalten. Quentis Gruß wäre wärmer gewesen. In ihrer Nervosität schwingt eine Frage mit, die sie offenbar nicht auszusprechen wagt.
»Ich möchte zu Quenti«, erkläre ich schnell, als sie am unteren Ende der wackeligen Treppe angelangt ist. »Ich muss mit ihm sprechen, unter vier Augen.«
Sie zögert und ich habe Zeit, sie etwas genauer zu betrachten. Sie ist ein paar Jahre älter als ich und trägt die Zöpfe einer verheirateten Flussläuferin. In ihr schwarzes Haar sind die blaukupfernen Federn eines Feuerhaubentauchers eingeflochten, zusammen mit den bunten Reifen, die ihre Handgelenke und Knöchel zieren, ein eindeutiges Zeichen, dass sie demselben Clan angehört wie Quenti. Die olivfarbene Haut über dem Halsausschnitt ihrer Tunika wird an den Schultern dunkler, was von langen Stunden auf dem Wasser unter sengender Sonne zeugt. Und auch ihr muskulöser Arm auf dem Treppengeländer verrät, dass sie mehr an die Arbeit auf dem Fluss als an das Marktgeschäft gewöhnt ist.
Das Schweigen zieht sich in die Länge. Erst als ich das Zucken in ihrem Arm bemerke, begreife ich. Sie weiß nicht, wie sie sich mir gegenüber verhalten soll. Sie ist wie gelähmt von dem Bedürfnis, meine Frage zu beantworten, und der gleichzeitigen Angst, mich zu enttäuschen.
Ich hole einmal tief Luft und versuche, die innere Stimme zu verdrängen, die mir in einem Anflug von Ungeduld zuflüstert: Was hast du erwartet? Dass sie vor dir strammsteht? Du warst einfach viel zu lange in der Obhut von Wachen und Priestern …
»Wie ist Euer Name?«, frage ich sie, wobei ich den Befehlston, den ich mir mit den Jahren angeeignet habe, bewusst vermeide.
»Hiret, Göttliche.« Sie schluckt. »Ich bin Quentis Nichte. Und das ist meine Schwester Didyet.« Ohne richtig hinzuschauen, dreht sie den Kopf zur Treppe in Richtung des Kindes, das geblieben war, um uns zu beobachten, und sich seither nicht vom Fleck gerührt hat. Nun, da ich mir das Mädchen etwas genauer ansehe, fällt mir auf, dass es gar nicht so jung ist, wie ich zunächst geglaubt hatte. Jünger als ich, aber nicht viel.
»Hiret?« Ich muss die Freude nicht heucheln. »Als ich noch beim Flussvolk lebte, kannte ich Eure Mutter. Ich erinnere mich, dass – Tantchen eine Zeit lang mit Quenti unterwegs war. Sie hat Pirakkas gemacht.«
Mein Bild von der Frau ist verschwommen – wie die meisten Erinnerungen an die Zeit vor dem Tempel –, aber an den Duft des frittierten Teiges und den wie Lava hervorquellenden heißen Honig erinnere ich mich noch kristallklar.
Hirets Augen weiten sich. Ein scheues Lächeln lässt eine Ansammlung von Schönheitsflecken auf der Wange unter ihrem rechten Auge tanzen. »Das muss Jahre her sein. Als sie das letzte Mal hier auf dem Markt war, hatte ich noch nicht gelernt, den Fluss zu befahren. Das muss gewesen sein, bevor …« Sie verstummt. Das Lächeln verschwindet und die Unsicherheit kehrt zurück.
»Bevor man mich zur Gottheit berufen hat«, beende ich den Satz für sie. Ich bin es gewohnt, über die dunklen Jahre zwischen meiner Zeit und denen der Trägerin des Göttlichen vor mir zu sprechen. »Euer Onkel war schon damals, als ich noch ein Niemand war, sehr gut zu mir – ist es immer gewesen. Es tut mir leid, wenn ich Euch erschreckt habe, Hiret, aber ich muss ihn dringend sprechen. Ich will ihn um ein Boot bitten, und um ein paar Eurer Leute. Ich habe eine wichtige Mission zu erfüllen und muss mich schon sehr bald auf den Weg machen.«
Hiret sieht an mir vorbei. Sie spürt die Dringlichkeit hinter meinen Worten und bemerkt gleichzeitig, dass ich nicht in Begleitung der sechs Wachen hier bin, die mir normalerweise überallhin folgen. Eine schwache Erinnerung flackert auf, an das kleine Mädchen, das sie einst war, und an das Mädchen, das ich unter der Krone und den roten Gewändern verberge.
»Mein Onkel ist krank«, flüstert sie.
»Krank?« Meine Brust krampft sich zusammen, denn ihre gesenkte Stimme lässt erahnen, dass sie nicht von einem vorübergehenden Husten spricht. »Was …«
»Nebel.« Hirets Blick wandert zur Treppe und vorbei an ihrer schweigenden Schwester, als könne sie durch den engen Flur bis ins Zimmer ihres Onkels sehen. Doch ihr abgewandtes Gesicht kann den Schmerz in ihren scharfen, ausdrucksstarken Zügen nicht verbergen. »Seine Knöchel waren dieser Tage oft geschwollen. Er suchte Linderung im Flussschlamm, als sich über dem Waldmeer ganz plötzlich ein Sturm zusammenbraute.«
»Ist er …?« Ich sehe wieder das Gesicht des vernebelten Mannes vor mir, wie er Lieder von Fischlein singt, und stelle mir meinen alten Freund vor.
»Sein Verstand ist scharf wie eh und je. Aber … Kommt mit mir.«
Hiret geht mir voraus die wackeligen Stufen hinauf. Oben angekommen, verscheucht sie gereizt Didyet, in der ich auch ohne dass sie mir vorgestellt worden wäre, ihre Schwester erkannt hätte. Ihr Gesicht ist eine etwas rundlichere Ausgabe Hirets, nur die Schönheitsflecken unter dem Auge fehlen. Dafür ist es von einem ungebändigten Haarschopf eingerahmt, der ihr vom Kopf absteht wie ein widerborstiger Heiligenschein.
Das Mädchen erwidert meinen Blick mit einem trotzigen Starren, das es ebenfalls von ihrer Schwester unterscheidet – die Lippen fest aufeinandergepresst, sieht es mich finster an. Wütend.
»Was soll die schon machen können?«, murmelt Didyet an ihre Schwester gewandt, jedoch laut genug, dass ich es hören kann. Sie rührt sich nicht von der Stelle, wodurch sie mir, da ich sie nicht streifen darf, den Weg versperrt. »Sie kann die Nebelstürme nicht aufhalten. Sie kann die Vernebelten nicht heilen. Sie ist nicht einmal die …«
»Didyet!«, fährt ihre ältere Schwester ihr mit einer solchen Vehemenz über den Mund, dass das jüngere Mädchen mitten im Satz innehält und hinter seiner Aufmüpfigkeit sogar ein Fünkchen Angst aufblitzt.
Hiret steht da wie erstarrt. Stumm vor Entsetzen über den blasphemischen Gedanken, den ihre Schwester um ein Haar ausgesprochen hätte, ringt sie um Fassung. »Solange die Göttliche im Haus ist, will ich dich nicht sehen. Hast du mich verstanden?« In ihrer ruhigen, leisen Stimme schwingen so viel Autorität und unausgesprochene Drohungen mit, dass ich mich am liebsten ebenfalls in eine der kleinen Schlafkojen verkrochen hätte. »Geh und sag den anderen Kindern, sie sollen still in ihren Zimmern bleiben, sonst ist der Besuch auf dem Markt heute Nachmittag gestrichen.«
Didyet zieht ein trotziges Gesicht. An der Schwelle zum Erwachsenenalter und voller Ungeduld, endlich unabhängig zu sein, hat sie die Spitze, die bei der Betonung auf den anderen Kindern lag, nicht überhört. Dennoch vermag der Tonfall ihrer Schwester sie offenbar mehr einzuschüchtern als das Gewand und der Speer mit den magischen Amuletten einer Gottheit – noch ein kurzer Blick von Hiret zu mir und wieder zu Hiret, dann dreht sie sich um und flieht über eine klapprige Leiter nach oben. Erst als sie die Sprossen hinaufklettert, bemerke ich, dass ihre Knöchel nicht die bunten Perlen und Reife ihres Clans zieren. Stattdessen trägt sie einen einfachen Stoffstreifen, der fest zu einem grauen Fußband verknotet ist.
Mir schwirrt der Kopf: Sie ist noch so jung. Wie ist es möglich, dass sie bereits ein Graumantel ist?
Hiret stößt hörbar die Luft aus und wendet sich mir zu. Auf ihren Wangen glüht noch ein Hauch von Zorn – oder Schamesröte? –, der trotz der Sonnenbräune nicht zu übersehen ist. »Göttliche, ich …«
»Ist schon in Ordnung«, murmele ich. Der Anblick des grauen Fußbandes beschäftigt mich so sehr, dass ich für einen Moment alles, was man mir über eine angemessene Ausdrucksweise beigebracht hat, vergesse.
»Wie lange ist es her, seit eure Mutter in den Fluss heimgekehrt ist, Hiret?«
»Sie …« Ihre Bestürzung weicht Erstaunen. »Zum Fest der Sterbenden sind es zehn Jahre.«
»Möge sie leichten Herzens sein«, wünsche ich leise, den kurzen Anfang meines Segens heraufbeschwörend. Trauer, denke ich abwesend. Didyet hat ihre Mutter verloren, deshalb hat sie sich den Graumänteln angeschlossen. Sie braucht jemanden, dem sie die Schuld geben kann.
»Woher wisst Ihr …?« Mit gerunzelter Stirn schaut Hiret von mir zu meinem Speer, als glaubte sie, die Magie befähige mich, ihre Gedanken zu lesen – auch wenn so etwas unmöglich ist.
»Ihr sorgt schon seit geraumer Zeit für Eure Schwester«, erkläre ich ihr, ein Lächeln in der Stimme, das mein Gesicht nicht zeigen darf. »Nur Mütter haben diesen ganz besonderen Tonfall.«
Und Hohepriester, denke ich mit Unbehagen und male mir Daomans Reaktion aus, wenn er feststellt, dass ich mich von den Wachen unbemerkt davongeschlichen habe.
Der Anflug eines Lächelns huscht über Hirets Lippen und verschwindet wieder. »Kommt. Er ist hier drin.«
Sie zieht den Vorhang in einem der Türrahmen beiseite und tritt mit gebeugtem Kopf so weit zurück, dass mir genügend Platz bleibt, um hineinzuschlüpfen, ohne sie zu berühren. Ich danke ihr mit einem Nicken – und dann sehe ich ihn vor mir in seiner Koje liegen. Mir stockt der Atem.
Vom Rand der Bettdecke bis hinauf zum Schädel ist seine Haut von hässlichen Geschwüren überzogen und sein ohnehin schon dünnes Haar zeigt große kahle Stellen. Selbst im Schlaf sind seine Züge schmerzverzerrt. Sein Atem geht flach und unregelmäßig. Vor mir taucht das runde, von Lachfalten zerfurchte Gesicht unserer letzten Begegnung auf und mir kommt die Galle hoch. Ich muss schlucken, um wieder klar denken zu können.
Obwohl ich sehr weit gereist bin, bis in die westlichsten Regionen des Westgebirges, um für die Vernebelten dort zu tun, was in meiner Macht steht, sind mir derartige Geschwüre noch nie begegnet. Diese Beulen kommen nicht von innen, sie sind keine krankhaft entzündeten Auswüchse seines Körpers. Vielmehr scheint ein wahnsinniger Bildhauer Quentis Fleisch geschmolzen, neu geformt und ihm dann wieder um den Schädel gelegt zu haben.
Er kann mir nicht helfen. Der Gedanke weckt Schuldgefühle in mir. Wie kann ich angesichts des zerstörten Körpers eines alten Freundes, der sich um mich sorgte wie eine Familie – eine Familie, wie sie mir nach meiner Berufung verwehrt war –, an meine göttliche Mission denken.
Aber ich habe keine Wahl. Ich muss meine Bestimmung über meine Gefühle stellen, sonst wird der Nebel bald alles sein, was von meinem Volk noch übrig bleibt. Die Götter haben uns schon vor Hunderten von Jahren verlassen, um sorgenfrei im Wolkenland zu leben – es gibt nur noch mich.
Ich muss meinem Schmerz hörbar Ausdruck verliehen haben, denn hinter mir ertönt Hirets sanfte Stimme, voller Mitgefühl und geteiltem Kummer. »Ich glaube, manchmal wünscht er sich, der Nebel hätte auch seinen Verstand verformt.«
Als ich mich zu ihr umdrehe, hat sich der Anblick von Quentis verunstaltetem Gesicht so tief in meine Netzhaut gebrannt, dass sich seine Wunden für einen kurzen Moment auf Hirets Gesicht abzeichnen, ausgespart nur die Schönheitsflecken auf ihrer Wange. Schaudernd kehre ich in die Realität zurück.
»Ich werde tun, was ich kann«, presse ich hervor, meine Stimme ein heißeres Krächzen.
Hiret nickt, ein dankbares Lächeln auf den Lippen, aber in ihren Augen lese ich etwas anderes. Ich muss an die Worte ihrer Schwester denken.
Was sie gesagt hat, ist wahr. Ich kann die Vernebelten nicht heilen. Die Gottheit vor mir konnte es. In ihr manifestierte sich die Eigenschaft des Heilens, kurz nachdem sie berufen worden war. Sie verbrachte viel Zeit außerhalb des Tempels, reiste zu den entlegensten Dörfern, um die Schutzsteine, die den Nebel abhalten, zu warten und sich um die Unglücklichen zu kümmern, die ungeschützt in einen Sturm geraten waren.
Wohingegen ich … ich kann ihnen nur zeitweilige Linderung verschaffen, nicht viel mehr, als jede ehrbare Kräuterhexe mit einem heilenden Zauberspruch es vermag.
Ich lehne den Speer an die Wand, erkläre dem Findelkater, der sich an meine Beine schmiegt, dass ich Platz brauche, und breite die nötigen Reagenzien für meinen Zauber aus. Hätte das Göttliche mich nicht als Trägerin auserkoren, wäre ich eine mächtige Zauberin – all jenen, die auf ein Wunder hoffen, müssen meine magischen Kräfte jedoch erbärmlich erscheinen.
Hiret schweigt, während ich arbeite. Als ich kurz zu ihr hinübersehe, streichelt sie dem Kater den Rücken, den Blick ins Leere gerichtet. Der Kater blinzelt und legt die Ohren an, um sein Missfallen darüber zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem holt er einmal tief Luft und fängt widerwillig an zu schnurren.
Hiret weiß, dass ihre Schwester die Wahrheit gesagt hat. Ich kann weder die Vernebelten heilen noch die Stürme verhindern. Ob die Gottheiten vor mir dazu in der Lage gewesen waren, kann ich nicht sagen. Alles, was ich weiß, ist, dass keine von ihnen diese Fähigkeit dringender gebraucht hätte als ich. Die Stürme brechen immer schneller, immer heftiger über uns herein und auch ihre Häufigkeit nimmt mit jedem Jahr zu. Wenngleich ich noch sehr jung bin, erinnere ich mich an eine Zeit, in der die Zauberer einen Sturm spüren konnten, lange bevor er sich zusammenbraute, eine Zeit, in der es noch sicher war, sich weitab der Flussufer zu bewegen, weitab der Schutzsteine.
»Ihr sagtet, Ihr seid auf der Suche nach einem Boot.« Hirets Stimme klingt abwesend. Mechanisch fahren ihre Finger weiter durch das weiche Fell des Katers.
»Da wusste ich noch nicht, dass er …« Ich halte den Blick auf meine Hände gerichtet. Meine Kehle ist so trocken, dass ich kaum sprechen kann. »Ich habe es erst hier erfahren.«
»Quenti würde Euch alle Barken geben, die Ihr braucht, und ebenso viele Clanleute. Dazu bin ich nicht ermächtigt. Aber ich kann Euch dennoch Hilfe anbieten. Ich selbst kann meinen Onkel nicht allein lassen, aber mein Mann ist ein ebenso geschickter Flussläufer wie ich, und sein Bruder auch.«
In mir keimt ein winziger Hoffnungsschimmer und bringt ein klein wenig Licht in die Finsternis, die sich über uns gelegt hat.
»Und sie sind entbehrlich? Sie werden hier nicht gebraucht?«
Hiret hält kurz inne, dann sagt sie ruhig: »Ihr seid ohne Eure Wachen gekommen.« Sie weiß um die tiefere Bedeutung dieses Umstands.
Der Zauber aus zerriebenen Knochen und Holunderkraut, den ich gewirkt habe, fällt als flimmernder Staub von meinen Fingerspitzen auf die Bettdecke. Ich sehe hinüber zu Hiret, die mich jetzt mit ihren klugen haselnussbraunen Augen herausfordernd anblickt.
»Ihr kommt hierher – allein«, wiederholt sie noch einmal, »und bittet um etwas, das Euch Eure Priester und Euer Ältestenrat dutzendfach hätten gewähren können, jedes Boot noch dazu bis an den Rand beladen mit jeder beliebigen Fracht. Doch anstatt sie darum zu bitten, sucht Ihr Euren alten Freund auf in der Hoffnung, dass er eines seiner Boote entbehren kann?«
»Hiret, ich … ich würde Euch den Grund, weshalb ich …«
Sie schüttelt den Kopf. Ihr Blick ist klar. »Ich brauche keine Erklärung. Die Hälfte Eures Ältestenrates hat graue Herzen, auch wenn die Farbe ihrer Mäntel etwas anderes vortäuscht. Wenn jene, deren Dummheit und Angst unsere einzige Hoffnung erstickt, Euch von Eurem geheimen Vorhaben abhalten wollen – dann will ich, dass Ihr tut, wozu Ihr berufen seid.«
Ihre Entschlossenheit rührt mich so sehr, dass ich nicht sprechen kann. Mit offenem Mund stehe ich vor ihr wie ein hungriges Kind vor einem Pirakkastand.
»Diese Leute sind Narren«, sagt Hiret. In ihren Augen blitzt wieder diese Vertrautheit auf, als sehe sie hinter der Göttin das Mädchen, das der Hohepriester vor vielen Jahren von der Seite seiner Mutter gerissen und in ein dunkelrotes Gewand gesteckt hat. »Ihr seid das einzige Licht, das uns in dieser in Finsternis versinkenden Welt noch geblieben ist, Göttliche. Diese Leute erinnern sich nicht an ein Leben ohne Schutzsteine. Doch das Gedächtnis der Flussläufer reicht weit zurück. Wir wissen noch, weshalb unsere Vorfahren sich auf dem Fluss niedergelassen haben. Sie haben es im Vertrauen auf den Schutz der Wasser getan, die von Eurem Tempel ins Meer fließen.« Sie kniet nieder und legt die Handflächen auf die Augen, eine alte, nicht mehr gebräuchliche Geste der Gottesfurcht und Ergebenheit. »Das Flussvolk ist mit Euch, Nimhara. Auf ewig.«
»Danke«, flüstere ich benommen.
Sie erhebt sich mit dem Versprechen, mir ein Mitglied ihres Clans zu schicken, das mich durch das Marktgedränge nach Hause begleiten wird. Dann geht sie, um ihren Mann und ihren Bruder zu suchen.
Abgesehen von dem gequälten Atmen des Mannes neben mir herrscht absolute Stille. Vorsichtig streiche ich die Reagenzien des Heilzaubers von der Bettdecke zurück in meine Hand, um von vorne zu beginnen. Dieses Mal aber spüre ich die Zauberformel und die Kräfte, die diese bündelt, kaum. Das Flussvolk ist mit dir … Auf ewig.
Und doch kann ich den Zorn, die Angst und den Trotz im Gesicht von Hirets Schwester, das dem ihren so sehr ähnelt, nicht vergessen. Didyet stellt Hirets Glauben infrage und ich weiß nur zu gut, was ihre Worte gewesen wären, wenn ihre Schwester ihr nicht den Mund verboten hätte. Sie ist nicht einmal die wahre Göttliche.
2North
Die Senatssitzung geht bereits in die zweite Stunde und ich verspüre andauernd diesen grässlichen Drang, mich zu räuspern und zu testen, ob meine Stimme noch funktioniert. Ich nehme einen ausgiebigen Schluck aus meiner Wasserflasche. Dann schließe ich für einen Moment die Augen, um mich zu entspannen, aber nun lässt mir die Frage, ob ich mitten in meiner Rede pinkeln muss, keine Ruhe mehr.
Ich überlege – nicht zum ersten Mal –, meinen Vorstoß noch um einen Monat zu verschieben. Aber das Timing ist perfekt. In wenigen Stunden beginnt in Alciels Hauptstadt die große Flugschau, ich werde ihnen also direkt im Anschluss demonstrieren können, was ich draufhabe – wozu ich in der Lage bin –, und dann müssen sie mir nur noch ihre Unterstützung zusichern.
Wolkensturz nochmal, es muss einfach klappen. Sie müssen erkennen, was ich erkannt habe.
Draußen fliegt die Welt als verschwommener Silberstreifen an uns vorüber, während der Zug den geschwungenen Rand der Insel entlang Richtung Heimat rast. Den Zwischenstopp in Port Camo mitgerechnet, sind wir noch ungefähr eine Stunde unterwegs. Wenn wir am Palast ankommen, wird mein Schicksal bereits besiegelt sein.
Beatrin, meine leibliche Mutter, mein Großvater und die acht Senatoren sitzen um den Konferenztisch und verfolgen interessiert die 3-D-Projektion, die über der glänzenden Tischplatte schwebt, während sie Senator Poprin lauschen, der über die Rückgewinnung von Wasser schwadroniert. Ich lehne etwas entfernt an der Wand und warte, bis ich an der Reihe bin. Auf der anderen Seite des Abteils sitzt meine Herzmutter Anasta. Wahrscheinlich ist sie zu meiner moralischen Unterstützung hier. Wenn sie wüsste, was ich gleich sagen werde, würde ihr das ermutigende Lächeln sicher schnell vergehen. Im Gegensatz zu meiner Blutmutter denkt Anasta immer nur das Beste von mir. Sie war bestimmt hocherfreut, als sie hörte, dass ich darum gebeten hatte, in eigener Sache vor dem Senat sprechen zu dürfen, anstatt wie sonst zum Zwecke meiner Ausbildung ein von Beatrin vorgegebenes Thema vorzustellen.
Ich senke den Blick und drehe unauffällig am Band meines Chronometers, das auf meiner Haut vibriert, bis die Anzeige auf der Innenseite des Handgelenks liegt und ich einen heimlichen Blick auf die eingegangenen Nachrichten werfen kann.
MIRI: wie läuft das meeting, prinzenjunge?
MIRI: gleich kommt dein großer moment!
MIRI: bist du nervös?
MIRI: wäre schrecklich, wenn du nervös wärst
MIRI: macht es dich nervös, dauernd nervös zu lesen?
MIRI: (spaß! du musst nicht nervös sein, du wirst abheben)
SAELIS: Du schaffst das, North. Deine Präsentation ist super.
SAELIS: Sie müssen dir nur zuhören, dann hast du sie in der Tasche.
MIRI: … sie müssen dir ZUHÖREN????
MIRI: ich nehme alles zurück, du bist geliefert
MIRI: ich wollte natürlich sagen: du schaffst das, NORTH!! \o/
SAELIS: Was soll das denn sein?
MIRI: das bin ich, ich jubele ihm zu
SAELIS: Soll der Kreis dein Kopf sein?
MIRI: genau
SAELIS: Muss es dann nicht so aussehen: \O/? Bei deinem Dickschädel …
MIRI: hmm, du hast recht. aber eher wegen meiner umwerfenden Haarpracht
Ich unterdrücke ein Grinsen. Aber Miri hat recht. Ich hatte schon immer Probleme, den Senat dazu zu kriegen, dass er mir zuhört. Und seine Mitglieder mit dieser Idee zu begeistern, wird eine ganz besondere Herausforderung sein. Aber ich habe meinen Vortrag bis zum Umfallen einstudiert und es ist schließlich nicht das erste Mal, dass ich eine Rede halte – seit ich zwölf bin, spreche ich zweimal jährlich vor dem Senat –, aber so wichtig wie jetzt war es mir noch nie. Noch nie war ich von einer Sache so überzeugt oder habe etwas so leidenschaftlich gewollt.
»Vielen Dank, Poprin, für Ihren aufschlussreichen Bericht.« Die angenehme Stimme meiner Mutter gleitet in die lebhafte Diskussion wie eine Schwalbe in einen Schwarm Spatzen. Will heißen, während alle aufgeregt durcheinanderflattern, wild entschlossen, Aufmerksamkeit zu erregen, beherrscht meine Mutter die Szene sofort mit souveräner Eleganz. Beatrin spricht nie laut, aber jedes einzelne Wort von ihr klingt, als wäre es bewusst gewählt worden, und ist präzise artikuliert. Ihre Art zu sprechen ist ebenso perfekt wie das makellos auf ihren Wangen aufgetragene Gold, das ihren königlichen Stand anzeigt, und ihr sorgfältig frisiertes, seidig glänzendes schwarzes Haar.
Mein königliches Make-up wäre normalerweise längst verschmiert, weil ich meine Wangen vor Langeweile in »einem Prinzen ungebührlicher Manier«, wie meine Herzmutter es formulieren würde, auf die Fäuste gestützt hätte. Aber heute bin ich ordentlich geschminkt und habe auch sonst alles Nötige getan, um sie von meiner Sache zu überzeugen.
»Eure Hoheit«, fordert mein Großvater mich auf. Sein Gesicht ist ernst, aber um seine Augen spielt ein Lächeln.
»Eure Majestät«, entgegne ich und stoße mich dabei von der Wand ab. Ich begebe mich auf den freien Platz am Kopfende des Tisches und habe schon wieder das Bedürfnis, mich zu räuspern. Verdammt.
Aber egal. Ich werde sie davon überzeugen, dass ich nicht nur irgendwelchen unrealistischen Träumen hinterherjage.
»Eure Majestät, Eure Hoheiten, verehrte Senatsmitglieder«, beginne ich.
Meine Mütter, mein Großvater und ungefähr die Hälfte der Senatoren blicken mich an, während die andere Hälfte bereits durch ihre Unterlagen blättert, um nachzusehen, was als Nächstes auf der Tagesordnung steht. Aber Talamars dunkle Augen, die meinen so ähnlich sind, sind auf mich gerichtet und er nickt mir aufmunternd zu.
Ich atme einmal tief durch und beginne vorzutragen, was ich bereits zigmal vor dem Spiegel wiederholt habe: »Der große Saal im Palast hat schon unzählige Debatten über das Problem eines eventuellen Höhenverlusts erlebt, und ich bin mir durchaus bewusst, dass im Senat bis heute keine Einigkeit darüber herrscht, ob die Inseln nun tatsächlich absinken oder nicht. Bis wir aber in diesem Punkt Klarheit gewinnen, könnte es noch Jahre dauern, und diese Unsicherheit hat einen ganz einfachen Grund: Wir wissen nicht genug über dieses Problem. Denn zumindest in einer Sache dürften wir uns wohl alle einig sein: Unsere einstigen Kenntnisse über die Triebwerke sind in den Jahrhunderten seit dem Aufstieg verloren gegangen. Wir wissen, dass sie das Archipel in der Luft halten, aber nicht, wie sie das tun. Wir wissen auch, dass sie sich selbst warten, aber nicht, wie. Das wirklich Entscheidende ist jedoch, dass wir keine Vorstellung davon haben, wie lange die Motoren diese Leistung noch erbringen werden. Sie könnten jetzt, in diesem Moment, versagen und die Inseln könnten abstürzen. Dieser Tag liegt vielleicht noch in ferner Zukunft, aber wir wissen es nicht. Daher sollten wir uns in einer Sache, denke ich, in jedem Fall schon heute einig werden: Wir dürfen nicht abwarten, bis dieses Problem zu einer Bedrohung wird. Wir müssen uns jetzt damit befassen. Wir müssen unser Wissen über die Himmelsmotoren wiedererlangen, denn wenn sie eines Tages ausfallen und wir nicht in der Lage sind, sie zu reparieren, ist es zu spät.«
Inzwischen habe ich die Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Die Frage, ob die Städte absinken oder nicht, hat an diesem Konferenztisch schon für mehr hitzige Diskussionen gesorgt als jede andere Angelegenheit, und nun sind alle gespannt zu erfahren, wie ich zu diesem Thema stehe.
Der gesamte Tisch schweigt. Nur Talamar nimmt einen zischenden Zug aus seinem Inhalator, während meine Mutter mir einen ihrer Du-weißt-hoffentlich-was-du-da-tust-Blicke zuwirft. Ihr wäre es sicher lieber gewesen, wenn ich mit ihr über meine Pläne gesprochen hätte, bevor ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Aber dann hätte sie mich in jedem Fall davon abgehalten.
Ich nutze das gespannte Schweigen, um fortzufahren, bevor mir in ein paar Minuten wahrscheinlich niemand mehr zuhört. »Vor zwei Jahren, kurz nach seiner Wahl, hat Senator Talamar eine Expedition nach Unten vorgeschlagen.«
Rund um den Tisch wandern Augenbrauen nach oben und einige der Senatoren beugen sich interessiert vor. Anasta schließt die Augen. Sie war noch nie glücklich darüber, wenn ich mich von Talamar für seine verrückten Ideen habe begeistern lassen.
»Er sagte, der einzige Weg, das verlorene Wissen wiederzuerlangen, bestehe darin, an den Ort zurückzukehren, an dem wir es einst gewonnen haben«, fahre ich fort. »Unsere Vorfahren haben Alciel im Unten errichtet und sind dann damit in den Himmel aufgestiegen. Daher wäre es durchaus denkbar, dass die Königliche Akademie der Wissenschaft in den Ruinen auf Hinweise stößt, wie sie das gemacht haben.«
Selbst jetzt, mitten in meiner Rede, beginnt mein Herz bei dem Gedanken schneller zu schlagen. Eine Reise nach Unten, um mit eigenen Augen den Ort zu sehen, an dem unsere Geschichte begann, den Fuß auf dieselbe Erde zu setzen, auf der einst unsere Vorfahren wandelten … ein Besuch in einem Geisterland, menschenleer, aber dafür voll von vergessenen Geschichten.
»Eine faszinierende Idee.« Die Stimme meiner Mutter schneidet in meine Rede wie ein frisch geschliffenes Messer. »Unglücklicherweise wären die Forscher der Akademie sofort tot. Im Unten ist alles, angefangen bei den kleinsten Insekten, lebensgefährlich. Und selbst in dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es den Wissenschaftlern gelänge, im Unten zu überleben, hätten sie keine Möglichkeit, zurückzukommen. Ihre zweifellos wertvollen Erkenntnisse wären für immer verloren, North.«
Mein Einsatz.
»Das ist richtig, Eure Hoheit«, entgegne ich so respektvoll wie möglich. »Und ich weiß, wie gefährlich es unten ist. Dennoch sehe ich eine Chance, das Unten zu erforschen, da ich einen Weg gefunden habe, wie wir von dort wieder zurück in den Himmel gelangen können.«
Der Raum explodiert. Alle reden durcheinander und übertönen sich gegenseitig. Die Einzigen, die schweigen, sind meine Mutter, mein Großvater, Talamar und ich. Anasta, die ohnehin nicht befugt ist, bei Senatssitzungen zu sprechen, kaut auf ihrer Unterlippe. Sie wird später noch ein Wörtchen mit mir zu reden haben.
Ihre Majestät lehnt sich im Sessel zurück und betrachtet mich nachdenklich, als müsste er sich erst noch darüber klar werden, was er von dem, was ich eben gesagt habe, halten soll. Meinen Großvater anzusehen, ist, als würde ich eine ältere Ausgabe von mir selbst betrachten – das schwarze Haar ergraut, aber noch genauso widerspenstig wie vor den Jahrzehnten, die zwischen uns liegen. Dieselbe adelige Nase, kräftige Augenbrauen, leicht gebräunte Haut. Sein Gesicht, das schon damals anders war als das der meisten Leute hier, hat mich schon als kleiner Junge fasziniert. Es ist nur eine Sache von ein, zwei Stunden, sich die Falten glätten oder die Haut am Kinn straffen zu lassen, aber im Gegensatz zu den meisten Bewohnern Alciels hat mein Großvater Meditechniker nie an sich herangelassen. Seine Lebenserfahrung steht ihm ins Gesicht geschrieben, jede Linie erzählt eine Geschichte, und das gefällt mir.
Talamar hingegen hat so ziemlich alles in Anspruch genommen, was die Meditechnik zu bieten hat. Eine Kinderkrankheit hat seine Lungen dauerhaft geschädigt, was ihm bis heute große Schmerzen bereitet. Er spricht nur ungern darüber, aber es scheint seine Energie kaum zu bremsen. Andererseits kämpft er auch erst seit ein paar Jahren gegen den Senat und es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis dieser ihn kleinkriegt.
Im Moment grinst er unverhohlen in die Runde und genießt ganz offensichtlich den Tumult. Er wusste, was ich sagen würde. Meine Mütter haben mich großgezogen, aber er ist mein biologischer Vater – mein Biospender. Obwohl ich diesen Mann eigentlich gar nicht kennen dürfte, ist er der Einzige, der mich wirklich versteht. Zumindest in dieser Sache. Ich wusste jahrelang nicht, wer er ist. Es war ihm gestattet, mir Geburtstagsgeschenke zu schicken, aber er durfte sich mir nicht zu erkennen geben.
Als ich fünf Jahre alt war, weckte ein Modellgleiter meine verbotene Leidenschaft für die Fliegerei. Mit zehn habe ich dann einen Science-Fiction-Film über ein fantastisches Wolkenschiff gesehen, das im Unten, also auf der eigentlichen Oberfläche der Welt, landet. Obwohl die animierten Bestien, die die havarierten Forscher dort entdeckten, mir wochenlang Albträume beschert haben, hat mich der Film so in seinen Bann gezogen, dass mich die Idee bis heute fasziniert. Als man mir Talamar dann mit fünfzehn endlich als meinen biologischen Vater vorstellte, hatte ich das Gefühl, wir würden uns schon ewig kennen.
Jetzt nickt er mir zu und greift mit einem Lächeln nach seinem Inhalator. Mach weiter, North, sagen seine zusammengekniffenen Augen. Sie werden sehen, was du siehst.
Also hole ich noch einmal tief Luft, um die angeregte Diskussion zu unterbrechen und mit meiner Rede fortzufahren. »Verehrte Senatoren, verehrte Senatorinnen«, rufe ich laut und finde zumindest bei einigen Gehör. »Eure Majestät, Eure Hoheiten.«
Endlich verstummt auch der letzte der Senatoren – Damerio, ein unverbesserlicher Skeptiker – und richtet seine kleinen Knopfaugen auf mich. Offensichtlich lauert er nur darauf, den Streit über sein Lieblingsthema fortzusetzen, und ich spreche schnell weiter, um ihm bloß keine Gelegenheit zu bieten.
»Sie alle besuchen doch regelmäßig das Aeronautik-Festival in Freysna, verfolgen die Stunts und die Rennen und wissen, dass der beste Gleiter der Skysinger ist. Er ist schneller und wendiger als die anderen, sein Pilot talentierter, das Design ungeschlagen. Die Hälfte der Ingenieure an der Akademie würden ihren gesamten Besitz dafür geben, den Piloten zu treffen und sich seine Maschine nur eine Stunde lang genauer ansehen zu dürfen. Nun, ich kenne diesen Piloten. Und ich weiß auch, weshalb der Skysinger so viel besser ist als alles, was sonst so durch die Luft schwirrt. Es liegt an seinem besonderen Getriebe, in das Teile der Himmelsmotoren verbaut wurden.«
»Das wäre illegal«, bemerkt Beatrin. Ihre Stimme klingt ruhig, hat aber einen drohenden Unterton. »Die Motoren dürfen nicht angerührt werden.«
»Es ist nicht illegal, lediglich eine praktische Konsequenz«, entgegne ich. »Bei der Hälfte der Motorenteile wissen wir nicht einmal, wozu sie dienen und ob sie überhaupt notwendig sind. Dieser Pilot hat einen ganz neuen Motorentyp entwickelt und könnte mit der Technologie des Skysingers ein Wolkenschiff bauen, mit dem er in der Lage wäre, im Unten zu landen, aber auch sicher wieder nach Alciel zurückzufliegen. Mit den nötigen finanziellen Mitteln und der Unterstützung der Akademie könnte er das Schiff schon nächstes Jahr um diese Zeit fertiggestellt haben.«
»Das ist unsäglich!«, brüllt Senator Damerio, dem nun endgültig der Kragen platzt. Er bläst sich auf wie ein goldschwänziger Pfau, der ein Weibchen beeindrucken will. Sein wild vom Kopf abstehender Haarschopf hat mich schon immer an die Federkrone dieses selbstherrlichen Vogels erinnert und die gespitzten Lippen zwischen den Hängebacken verstärken dieses Bild noch. »Bei allem Respekt, Hoheit, allein der Gedanke, das Funktionieren der Himmelsmotoren wegen eines völlig natürlichen Höhenverlusts infrage zu stellen und einem rebellischen Piloten zu erlauben, daran herumzupfuschen …«
»In der Tat.« Endlich hat auch mein Großvater etwas in der Sache zu sagen und die Stimme des Königs lässt Damerio umgehend verstummen. »Würdest du mir erklären, North«, zieht er seinen Satz in die Länge, »wie du diesen Piloten kennengelernt hast?«
Sein bohrender Blick sagt mir, dass er die Antwort bereits kennt. Vertrau mir, bettele ich im Stillen, während ich ihn ansehe. Hör mir zu. Ich kann das schaffen. Wenn das hier nicht klappt, muss ich aufgeben, was mir im Leben am meisten bedeutet.
Aber es wird klappen. Es muss klappen.
Ich hole tief Luft. »Ich weiß, dass es machbar ist«, erkläre ich, »weil ich der Pilot und Konstrukteur des Skysingers bin. Ich kann dieses Wolkenschiff bauen und bin auch bereit, es zu fliegen.«
Im Raum bricht Chaos aus. Einzelne Senatoren springen von ihren Stühlen auf, die Stimmen werden laut, Hände schnellen in die Luft und die Displays von einem halben Dutzend Chronos kämpfen um einen Platz im Projektionsfeld in der Mitte des Tisches.
»Es gab schon früher Jahre wie dieses«, schreit Damerio und gestikuliert dabei wild vor seinem Schaubild. »Wir sinken nicht!«
Talamar steht Schulter an Schulter neben Senatorin Gabriala, die wie er von einer der kleineren Inseln stammt. Ihre Stimmen überschlagen sich. »Aber die kleinen Inseln sinken schneller …«
»Man kann uns nicht jedes Mal einfach überstimmen, wenn …«
Mit offenem Mund stehe ich inmitten dieses Chaos, als wäre ich aus meinem Körper herausgetreten und würde das alles von außen beobachten. Es ist genau dieselbe Diskussion wie schon seit Jahren. Mit exakt denselben Argumenten. Nichts von dem, was ich gesagt habe, hat auch nur das kleinste bisschen Wirkung gezeigt – selbst jene unter ihnen, die an den Höhenverlust glauben, sprechen weder von meinem Wolkenschiff noch von den Möglichkeiten einer derartigen genialen Erfindung oder gar der sich daraus ergebenen Chance neuer Entdeckungen. Dem immer gleichen Drehbuch folgend schreien sie sich einfach nur gegenseitig an. Ich bringe ihnen den Skysinger und eine Sekunde später haben sie mich schon wieder vergessen.
Jemand packt mich am Handgelenk und ich fahre herum. Vor mir steht mit weit aufgerissenen Augen und bebenden Lippen Anasta. Bisher konnte meine Herzmutter allem, was ich tat, auch immer irgendetwas Gutes abgewinnen, doch jetzt sieht sie aus, als würde sie jede Sekunde in Ohnmacht fallen. Ohne ein Wort zieht sie mich zu der Tür, die in die königlichen Abteile führt. Ich leiste keinen Widerstand – auch dann nicht, als Beatrin uns wutentbrannt hinterherstampft. Außer meinem Großvater bemerkt niemand, dass wir den Raum verlassen.
Anasta versucht gar nicht erst, mich in ihr Abteil zu zerren, das sie sich mit Beatrin teilt. Sobald wir auf dem Gang sind, bleibt sie einfach stehen, lässt mein Handgelenk los und sinkt mit dem Rücken gegen ein Fenster, als bräuchte sie dessen stützenden Halt. Hinter ihr dehnt sich die unendliche Weite des leuchtend blauen Himmels aus, nur unterbrochen von einer sich bedrohlich auftürmenden Wolkenbank, die aussieht, als könnte sie jeden Moment einstürzen und alles unter sich begraben wie die Berge in unseren Märchen.
»North!«, faucht Beatrin hinter mir. Ich drehe mich zur Seite, damit ich sie beide im Blick habe. »Das alles kann unmöglich dein Ernst sein. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll – damit, dass du uns hintergangen hast, dass du unverantwortliche Risiken eingegangen bist, oder damit, dass du uns vor dem versammelten Senat bloßgestellt hast. In meinem ganzen Leben bin ich noch nicht derart enttäuscht worden.«
Anasta, die noch immer um Fassung ringt, hat das Gesicht in den Händen vergraben. »Wann hast du das alles bloß getan?«, fragt sie mit zitternder Stimme durch ihre Finger hindurch. »Als du angeblich mit deinem Studium beschäftigt warst? Waren das deine Forschungsarbeiten? Du weißt doch, wie wertvoll dein Leben ist, nicht nur für uns, sondern für ganz Alciel.« Als sie die Hände endlich sinken lässt, schwimmen ihre Augen in Tränen. »Wenn dir irgendetwas zustößt, North … Ich darf gar nicht daran denken. Du, dort oben am Himmel, wie du, ohne dass jemand davon weiß, ohne Schutz, durch dieses gewaltige Nichts gleitest …«
»Ich war nie in Gefahr«, protestiere ich und versuche, nicht ungehalten zu klingen, was mir gründlich misslingt. »Ich bin gut in dem, was ich tue, Anasta – ich bin der Beste. All die Jahre habt ihr mir eingebläut, ich müsste herausfinden, womit ich meinem Königreich am besten dienen kann, und nun …«
»Du kannst deinem Königreich nicht dienen, wenn du tot bist!«, fährt Beatrin mich an. »Es hat eine ganze Armee von Meditechnikern gebraucht, bis du geboren wurdest. Was, glaubst du, wird passieren, wenn der Erbprinz stirbt und die Blutlinie endet? Du bist der Prinz der Sieben Inseln, Zweiter in der Erbfolge des Thrones von Alciel und ein Hüter des Lichtes. Deine erste Pflicht ist es, die Linie fortzuführen. Sobald dieser Zug im Palast angekommen ist, wirst du dem Sicherheitsdienst erklären, wo sich dieser Gleiter befindet, und er wird in die Akademie zurückgebracht. Du wirst dieses Ding nie wieder fliegen, unter gar keinen Umständen.«
Ich bin wie vom Blitz getroffen. »Das kannst du nicht machen«, zische ich und schlage alle Zurückhaltung – die mir ohnehin nichts gebracht hat – in den Wind. »Ich bin kein Kind, dem du einfach die Spielsachen wegnehmen kannst, Beatrin. Du kannst mir nicht vorschreiben, was ich tun darf und was nicht. Der Skysinger gehört mir, und wenn du glaubst, ich würde ihn hergeben …«
»Du bist mein Kind!«, schreit sie. Von ihrer viel gepriesenen Gelassenheit ist nicht mehr viel übrig. »Und ich kann dir, genau wie jedem anderen in Alciel, vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Dein Großvater ist der König und du bist sein Untergebener, North, Thronfolger hin oder her. Du wirst tun, was man dir sagt.«
Für einen Moment herrscht Stille und ich versuche, das alles irgendwie zu verarbeiten. Mein Herz pocht wie wild. Ich wusste, dass sie eventuell nicht auf mich hören würden. Ich wusste, dass es schiefgehen könnte. Aber nun, da mein Traum direkt vor meinen Augen zerplatzt, weiß ich nicht, was ich sagen soll.
Mitten hinein in die Stille ertönt das leise Summen meines Chronos, das eine eingehende Nachricht meldet. Anasta senkt den Blick und starrt auf das Display.
»Oh«, sagt sie leise, »jetzt verstehe ich. Du warst das nicht allein, habe ich recht? Deine Freunde haben dir geholfen.«
»Welche Freunde?«, fragt Beatrin.
»Der Sohn seines Tutors«, murmelt Anasta. Saelis. »Und die Tochter des Kanzlers.« Miri.
»Haltet die beiden da raus«, sage ich ebenso leise. »Tu das nicht, Anasta.«
»Tut mir leid, North, aber das muss aufhören«, sagt sie. Einfach so. »Dass ihr ständig zusammen seid, geht zu weit. Eines Tages werden wir deinen Großvater in die Wolken streuen und deine Mutter wird Königin – und nach ihr wirst du der König sein. Ein König darf nicht Teil einer Dreiecksbeziehung sein. Und darauf läuft es doch hinaus, habe ich recht? Deshalb waren die beiden bereit, dir bei einer so unglaublichen Dummheit zu helfen. Sie sind der Grund, weshalb du es überhaupt erst getan hast. Du glaubst, sie lieben dich, und willst dich vor ihnen beweisen.«
»Darum geht es doch im Moment gar nicht«, widerspreche ich und ignoriere die Hitze, die mir in die Wangen steigt. Ich werde mein Liebesleben bestimmt nicht mit meinen Müttern diskutieren, schon gar nicht heute. »Und außerdem ist es meine Entscheidung. Ich tue, was ich für richtig halte. Ich schere mich einen Dreck um alte Traditionen und den ganzen konservativen Mist.«
Beatrin klappt den Mund auf, aber als Anasta den Kopf schüttelt, schluckt sie hinunter, was ihr auf der Zunge liegt. Nachrichten zu überbringen, die ich nicht hören will, war schon immer die Aufgabe meiner Herzmutter.
»Hier geht es nicht um uns«, sagt sie, »oder darum, was wir für richtig halten. Der Monarch lebt seit jeher als Paar, weil eine dritte Person die Politik des Archipels fürchterlich kompliziert machen würde, North. Sieh dir nur Talamar an.«
»Was soll mit ihm sein? Er wurde von seiner Insel in den Senat gewählt.«
»Richtig«, räumt sie ein. »Aber erst nachdem die Presse bekannt gemacht hat, dass er dein Biospender ist. Er wurde eigens dafür ausgewählt, weil er politisch unbedeutend war und nicht genügend Einfluss hatte, seine Rolle für oder auch gegen den Thron einzusetzen. Den Sitz im Senat hat er nur, weil seine Insel sich von der Verbindung zu dir Vorteile erhofft. Und das Schlimme daran ist, das sie damit offenbar recht haben.«
»Ich kann mein Privatleben sehr gut von der Politik trennen«, knurre ich und ignoriere dabei die Tatsache, dass ich gerade mitten in einer politischen Auseinandersetzung mit meinen Müttern stecke.
»Du kannst Klatsch und Tratsch nicht kontrollieren«, wirft Beatrin in scharfem Ton ein. »Der Erhalt der königlichen Blutlinie ist unsere wichtigste Aufgabe, North. Und auch wenn Anasta zu nett ist, um es auszusprechen, sobald du in einer Dreiecksbeziehungmit dem Sohn deines Tutors lebst, wird es zwangsläufig Zweifel geben, wer der Vater des nächsten Thronfolgers ist, egal, welche Beweise du erbringst.«
»Warum sollte das für uns so wahnsinnig wichtig sein, wenn es dem Rest des Archipels offensichtlich völlig egal ist?«, frage ich. »Wenn der Besitzer einer großen Technologiefirma in einer Dreiecksbeziehung lebt, fragt doch auch niemand, wer der Vater der Erben ist. Die Kinder werden großgezogen und dann erben sie. Basta.«
»Die königliche Familie ist kein Technologieunternehmen«, faucht Beatrin. »Für uns gelten besondere Regeln, weil wir besonders sind.«
Ich möchte widersprechen, weiß aber nicht, wie. Nach allem, was gerade bei der Senatssitzung passiert ist, droht jeder weitere Schlag mich endgültig in die Knie zu zwingen.
»Die ganze Geschichte ist so unglaublich, dass ich nicht weiß, wo ich beginnen soll«, fährt Beatrin fort. »Allein die Idee, ausgerechnet du könntest nach Unten fliegen … Noch nie ist jemand von dort zurückgekehrt, North. Es wäre dein sicherer Tod. Du wirst diesen Gleiter zurückbringen und deine beiden Freunde nie wiedersehen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
Mir bleibt die Luft weg. Entgeistert starre ich sie an. »Das ist nicht dein Ernst«, protestiere ich schwach. Mir war klar, dass ich mit meinem Vorstoß einiges riskiere, aber Miri und Saelis hatte ich nicht auf der Liste. Sie sind meine besten und engsten Freunde. Und bis heute hatte ich gehofft, dass sie eines Tages vielleicht auch mehr sein könnten. Aber selbst wenn nicht, will ich sie auf gar keinen Fall verlieren.
»Es ist mein voller Ernst«, sagt sie ruhig. »Und jetzt gehen wir zurück an diesen Tisch und versuchen zu retten, was nach diesem Fiasko noch zu retten ist. Hast du mich verstanden?«
»Verstanden«, murmele ich. In meinem Kopf rauscht es und die Gedanken sind abgehackt, als steckte ich in einem Funkloch. »Ich, ähm … muss noch schnell auf die Toilette.«
»North«, fängt Beatrin an, aber Anasta legt ihr beschwichtigend die Hand auf den Arm.
»Wir sehen uns in einer Minute da drin, North«, sagt sie leise, aber nachdrücklich.
Ich nicke und blicke den beiden hinterher. Für einen Moment schwillt der Lärm der Diskussionen an, dann verebbt er wieder und sie sind hinter der Tür verschwunden.
Ich starre auf das Emblem, das auf die Tür gemalt ist – mein Familienwappen. Es zeigt eine stilisierte Himmelsinsel, die von einem Flügelpaar in der Luft gehalten wird. Die Unterseite der Insel ist eben, an der Oberfläche symbolisiert eine gezackte Linie die Skyline der Gebäude.
In diesem Moment sieht die Insel unglaublich klein aus.
Ich nehme Anastas Platz ein und lehne mich an das sonnenwarme Zugfenster, während ich versuche zu begreifen, was gerade geschehen ist. Meine Hände zittern. In einer knappen Viertelstunde habe ich meinen Gleiter, meine besten Freunde und meine Freiheit verloren.

![Beast Changers. Im Bann der Eiswölfe [Band 1 (Ungekürzt)] - Amie Kaufman - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/32cdaf81ad5376bcfc2bbc3d2164cfa2/w200_u90.jpg)

![Beast Changers. Im Reich der Feuerdrachen [Band 2 (Ungekürzt)] - Amie Kaufman - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8b453ba36123aed1dc60f5b024bf9ed8/w200_u90.jpg)
![Beast Changers. Der Kampf der Tierwandler [Band 3 (Ungekürzt)] - Amie Kaufman - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c6042a3cd95ed9f7945d8b7182aab6fe/w200_u90.jpg)
![The other side of the sky. Die Göttin und der Prinz [Band 1 (Ungekürzt)] - Amie Kaufman - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bf62a7f016e42e923aa9b576bafb5b7/w200_u90.jpg)



![Die Göttin und der Prinz. Beyond the End of the World [Band 2 (Ungekürzt)] - Amie Kaufman - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/202a874cc99d58ccb78024a6bd5919f6/w200_u90.jpg)