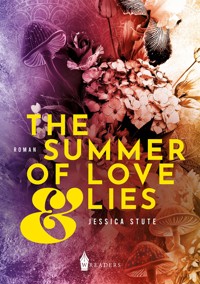
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
San Francisco 1967 Gemeinsam mit dem charismatischen Aktivisten Sam und ihren Freunden erlebt die besonnene Maggie den Summer of Love. Angetrieben von dem ungebändigten Freiheitsgefühl sowie der revolutionären Musik, zwischen Vietnamkrieg und freier Liebe, verbringt Maggie ihre Ferien in Big Sur. An der rauen Küste Kaliforniens begegnet Maggie nicht nur einer Gruppe Aussteiger, denen sie und ihre Freunde sich anschließen, sondern auch Frank, dem Sohn des Leuchtturmwärters. Als sich der Sommer dem Ende neigt, scheint sich die Stimmung in der vermeintlich friedlichen Kommune zu verändern. Und diese eine Nacht soll Maggies Zukunft und das Leben ihrer großen Liebe für immer verändern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1186
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto © Jessica Stute
Über die Autorin
Jessica Stute wurde 1991 geboren und lebt und arbeitet seitdem auf dem Land südlich von Hamburg. Schon im Kindesalter beschäftigte sie sich kreativ mit dem Illustrieren und Verfassen von kleinen Geschichten. Sie hat Kommunikationsdesign studiert und arbeitet heute als Social Media Managerin und Grafik Designerin. Ihr Hippie-Herz ist glücklich, wenn sie im Sommer draußen mit Musik an ihrem Lieblingsplatz entspannen oder Festivals besuchen kann. Die Begeisterung für die USA sowie die Liebe zur Musik inspirieren sie immer wieder zu spannenden, emotionalen Plots und Schauplätzen. Ihre Geschichten befassen sich meist mit Randgruppen und menschlichen Abgründen, gespickt mit einer Prise Popkultur. Besucht Jessica Stute auch auf Instagram unter: frollein_jessy_schreibt
WREADERS E-Book
Band 276
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen
Vollständige E-Book Ausgabe
Copyright © 2025 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena Weinert
Druck: Custom Printing
Bestellung und Vertrieb: Nova MD GmbH, Vachendorf
Umschlaggestaltung: Jessica Stute (unter Verwendung von Grafiken von Shutterstock.com: ©Kateryna Kon, ©irabel8, ©mamita, ©Ivala)
Lektorat: Alina Schunk
Korrektorat: Svea-Magdalena Lehmann
Satz: Antje Weise
www.wreaders.de
Playlist
Scott McKenzie – San Francisco
The Mamas & The Papas – California Dreamin‘
The Who – My Generation
The Kinks – You Really Got Me
The Beach Boys – Surfin‘ U.S.A.
Jimi Hendrix – Purple Haze
The Monkees – I‘m A Believer
Ten Years After – I‘d Love To Change The World
Cream – Sunshine Of Your Love
Jefferson Airplane – Somebody To Love
Janis Joplin – Summertime
Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son
Uriah Heep – Gypsy
Jefferson Airplane – White Rabbit
The Musical Hair – Aquarius
The Box Tops – The Letter
Bill Withers – Ain‘t No Sunshine
Joan Baez – Diamonds And Rust
Dusty Springfield – If You Go Away
The Turtles – Happy Together
The Musical Hair – Let The Sunshine In
The Doors – The End
The Subways – Alright
The Kooks – Seaside
The Mad Caddies – Backyard
Paramore – Misguided Ghosts
Incubus – Wish You Were Here
Lana Del Rey – California
Blues Pills – Little Sun
Magic Castles – Big Sur
Prolog
Maggie
Frühjahr 1967 | San Francisco | Kalifornien
Sie hatten beinahe den gesamten Golden Gate Park eingenommen. Tausende junge Menschen, die sich an einem Januartag dort zusammenfanden – Einheimische und Zugereiste gleichermaßen –, um gemeinsam zu protestieren. Sich lautstark, aber friedlich gegen das System zu erheben. Gegen den ›American Way Of Life‹. Gegen den Vietnamkrieg, der seit mehr als zwölf Jahren andauerte. Gegen den noch immer vorherrschenden Rassismus und die Unterdrückung der Afroamerikaner. Und gegen das neu eingeführte Verbot von LSD.
Im Fernsehen nannten sie es ›Human Be-In‹. Auf den Bildern in den Nachrichten war kaum noch ein Stückchen Rasen des Stadtparks im Herzen San Franciscos zu erahnen. Stattdessen wimmelte es überall nur so vor bunter Kleidung. Barfüßige Frauen in wallenden, gemusterten Stoffen, wohin man auch sah. Blumenkränze, Tücher oder geflochtene Zöpfe zierten so manchen Kopf. Junge Männer mit Gitarren und Joints in der Hand, mit langem oder wild gelocktem, gewollt unfrisiertem Haar.
Die Erwachsenen belächelten diese Zusammenkunft tanzender – in ihren Augen – haariger Freaks. Oder aber sie empörten sich unüberhörbar darüber. Und genau darin lag doch der Sinn dieser Aufmachung: das Establishment zu provozieren und aufzumischen, ohne wirklich etwas dafür tun zu müssen. Und vor allem: Ohne jegliche Form von Gewalt. Nur mit Worten. Eindringlich genug, um hoffentlich gehört zu werden. Von der Politik. Von der Bevölkerung. Von der ganzen Welt. In Form von Parolen, die in großen Buchstaben auf Pappschilder geschrieben und in die Lüfte gehalten wurden.
›Make Love. Not War.‹
Etliche Künstler und Musiker fühlten sich ebenfalls angezogen von diesem ›Happening‹. Hiesige Bands, die sich zur selben Zeit in San Francisco gründeten und im Stadtteil Haight-Ashbury lebten, vereinten sich durch ihre Musik mit den Widerständlern.
All das dauerte mehrere Wochen. Ja, sogar Monate. Haight-Ashbury wurde während dieses Zeitraumes wie zu einer eigenen Stadt. Einer Stadt, in der andere Regeln galten. Geschaffen von Freigeistern für Freigeister. Für Andersdenkende, für Anarchisten. Für Friedenskämpfer. Für alle.
Wohngemeinschaften und Aktionsgruppen wurden gegründet. Es gab künstlerische und musikalische Workshops, Beteiligungen an politischen Gesprächsgruppen. Neben Geschäften – den ›Free Stores‹ – in denen man gratis Lebensmittel erstehen konnte, entstanden darüber hinaus sogar eigene Infrastrukturen, wie etwa soziale Einrichtungen, zum Beispiel die ›Free Clinics‹. Der Grundgedanke dieses Gesundheitskonzeptes war es, nicht nur kostenlose Behandlungen anzubieten, sondern auch unbürokratisch und vor allem vorurteilsfrei ihren Mitmenschen zu begegnen. Ganz nach der Devise: ›Bei uns sind alle gleich.‹
Es sollte für ein paar Monate ein besserer Ort werden, als es die Vereinigten Staaten und der Rest der Welt zu diesem Zeitpunkt waren. Inmitten von zwei Kriegen: dem Kalten Krieg und dem Vietnamkrieg. Ein so mächtiges Land noch immer geprägt von Rassismus und Rassentrennung. Ein Land noch immer erschüttert durch den grausamen Mord an Kennedy, dem Präsidenten der Herzen.
Doch nach diesen paar Monaten war es nicht einfach vorbei. Der ›Summer Of Love‹ im Januar 1967 war erst der Beginn von etwas ganz Großem, dessen Auswirkungen bis heute andauern.
Ich glaube, jeder Generation wohnt der Zauber einer Jugendkultur inne. Junge Menschen, die aufstehen, etwas bewegen, verändern und sich von ihren Eltern – der Generation davor – bewusst abheben wollen. Die rebellieren, um etwas Neues zu kreieren. Doch der Nachhall dieser Zusammenkunft all dieser jungen Leute im besagten Frühjahr war enorm. Es war ein Impuls. Wenn nicht sogar der eine Impuls. Denn so etwas sollte es in dieser Form kein zweites Mal geben.
Wärt ihr damals jung gewesen, wärt ihr vermutlich genauso fasziniert und neugierig gewesen wie meine Freunde und ich. Wenn wir vor den Radios oder Fernsehgeräten unserer Eltern klebten, und man diese Atmosphäre, von der die Nachrichtensprecher sprachen, nicht nur in Schwarzweiß, sondern hautnah miterleben wollte.
Unter den Studenten hieß es, man muss wenigstens einmal dort gewesen sein, um zu verstehen, was es wirklich bedeutet. Wie es sich anfühlt, dabei zu sein. Man konnte diesen Umbruch förmlich spüren. Er lag irgendwie in der Luft. War plötzlich da. Diese lebendige Vibration. Diese innere Unruhe. Das Gefühl, etwas anders machen zu können als die Generation davor. Auszubrechen; bei einer ganz neuen Lebensart mitwirken zu können, die dort direkt vor unserer Haustür entstand. Und dieses Gefühl existierte nicht nur dort, in den Köpfen der Menschen im Golden Gate Park. Nein, dieses Gefühl keimte in diesem Jahr wohl ebenso in uns allen auf. Und dieses Gefühl begann genau hier: Im ersten Semester meines Medizin-Studiums an der Universität Berkeley. Das Semester, in dem ich – Maggie Wheeler – mit Samuel Marshall Lewis zusammenkam. Mein ganz persönlicher ›Summer Of Love‹. Der Sommer, der alles verändern sollte.
The Beginning Of Summer
Eliza
Juni 2017 | San Francisco | Kalifornien
Nun sag schon, Elly, was war es dieses Mal?« Meine beste Freundin Philline hievt mit Schwung mein petrolfarbenes Surfbrett von der Halterung ihres Buggy-Jeeps und dreht sich erwartungsvoll und schmunzelnd zu mir um. »War er ein Fuckboy? Wohnt er noch bei seiner Mama? Oder war es der Klassiker: Es liegt nicht an dir, sondern an mir?«
Ich senke den Blick und lächele in mich hinein. »Weder noch«, antworte ich nur knapp und nehme ihr mein Board aus der Hand.»Nick hat ehrlicherweise gesagt, dass es ein schlechter Zeitpunkt für eine Beziehung sei, weil er ab dem Herbst an die Ostküste ans College geht.«
Philline verdreht die Augen. »Ach komm, El, das kaufst du ihm ab? Würde man sich wirklich davon abhalten lassen, wenn man sich echt was bedeutet? Wenn du mich fragst, war das ’ne faule Ausrede. Er will sich bloß nicht festlegen, damit er am College freie Bahn für Abenteuer hat. So sieht es aus. Ich kann einfach nicht glauben, wie viel Pech du immer bei Typen hast.«
»Und wenn schon, Phi, ich glaube, es hätte sowieso nicht gepasst. Ich habe da schließlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und eine Fernbeziehung kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Er war einfach nicht der Richtige.« Gekonnt schlüpfe ich in meinen kurzärmeligen Neoprenanzug und knote mir meine langen Haare zu einem Dutt zusammen. Pip, meine Mom, sagt immer, sie haben die Farbe von Sand. Blonde, von der Sonne gebleichte Strähnen vermischen sich mit dunkelblonden darunterliegenden. Für so einen Effekt würden so manche mit Sicherheit viel Geld beim Friseur lassen.
»Ja, ja, Online-Dating, der Fluch unserer Generation. Ich sag’s dir, unsere Spezies wird irgendwann aussterben, weil niemand mehr vor die Tür geht. Und weil keiner sich mehr festlegen und sich lieber alle Optionen offenhalten will. Wenn der Richtige kommt, dann ist er es auch über eine gewisse Entfernung,« behauptet Philline und greift ebenfalls nach ihrem eigenen Board. Sie wachst es mehr schlecht als recht und klemmt es sich anschließend unter den Arm. »Na, los. Bist du soweit?«
Ich nicke und folge ihr den schmalen Trampelpfad zwischen den Dünen hinunter, vom Parkplatz bis zum Ocean Beach.
»Kann ja nicht jeder seine große Liebe bereits in der achten Klasse treffen, so wie du und Hunter.« Ich gebe ihr einen liebevollen Klaps auf die Schulter und sie grinst nur, erwidert aber nichts darauf.
Heute ist der perfekte Tag zum Surfen. Das dachten sich offensichtlich viele andere auch, denn bereits der Parkplatz ist brechend voll mit bekannten Gesichtern aus der Surfszene, und auch am Strand tummeln sich Gruppen klassischer Surfer oder Kitesurfer zwischen einigen neugierigen Zuschauern und Touristen.
Der Himmel ist ziemlich trüb für Ende Juni und der Wind fegt über den Sand hinweg, sodass meine Augen zu tränen beginnen. Es sieht so aus, als könne es später am Abend noch Regen geben.
Ich liebe dieses Rauschen. Das des Windes um meine Ohren, zusammen mit dem der brechenden Wellen. Das Meer mit seinen Gezeiten ist für mich eine der wahrhaftigsten Formen einer Naturgewalt. Wenn man weiß, wie, kann man sie jedoch bezwingen und sie für den eigenen Vorteil nutzen. So wie ich, wenn ich mich gleich in die Fluten stürze.
Ich bekomme eine Gänsehaut und meine hellen Härchen auf meinen Unterarmen stellen sich auf, als ich entschlossen neben Philline kurz vor der Gischt stehenbleibe und auf den Pazifik schaue.
Von den zwanzig Grad, die heute in den Straßen San Franciscos herrschen, ist hier draußen nichts mehr zu spüren. Der Wind trägt entfernte Rufe anderer Surfer im offenen Meer zu uns herüber. Die Möwen kreischen über uns und weiter rechts sitzt eine Gruppe Jugendlicher, die lachen und dabei über ihr Handy blecherne Electro-Beats hören.
»Ich hoffe, du bist in Form.« Philline zwinkert mir zu. »Ich werde dich nämlich vernichten.«
»Heute vielleicht. Aber ganz bestimmt nicht beim Surf Cup.«
»Träum weiter.« Sie grinst mir provozierend zu und rennt los. Wenn es um die Wassertemperatur geht, ist sie echt hart im Nehmen. Sie stürzt sich immer sofort hinein, während andere noch zitternd bis zu den Knien im Wasser stehen.
Ich hole einmal tief Luft, umklammere mein Board und laufe ihr wild entschlossen hinterher. »He, warte auf mich.«
Bäuchlings auf meinem Brett liegend und die Leash, die mich und mein Surfbrett verbindet, um mein Fußgelenk gebunden, paddele ich so weit raus, bis ich meine beste Freundin endlich wieder eingeholt habe. Sobald sich meine Haut an die Wassertemperatur gewöhnt hat, die fast identisch mit der Außentemperatur ist, fühlt es sich beinahe warm an meinem Körper an.
Einige Meter trennen mich mittlerweile vom Festland. Die weicheren Wellen schwappen behäbig unter meinem Körper entlang und lassen mich auf meinem Board auf und ab wippen.
Schaut man von hier nach links, sieht man dort nichts weiter als den kilometerlangen Ocean Beach. Blickt man nach rechts, beginnen dort unmittelbar die leichten Hügel vom Lincoln Park, die den Blick auf die dahinterliegende Golden Gate Bridge verwehren. In noch weiterer Entfernung liegt im trüben Nebel das angrenzende klüftige Festland rund um Sausalito. In meinem Rücken wacht der schicke Sunset District sowie der Golden Gate Park, San Franciscos grüne Lunge. Ich kenne diese Stadt in- und auswendig, weil ich hier lebe, seit ich drei Jahre alt bin. Und beinahe genauso lange stehe ich leidenschaftlich gern auf einem Surfbrett.
Philline ruft mir etwas zu, aber ich kann sie nicht richtig verstehen. Ich bin bereits viel zu sehr darauf fokussiert, jede vermeintliche Welle, die sich vor uns aufbäumt, zu inspizieren und abzuchecken, wann der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, um sie zu meiner Welle zu machen.
Durch den weißgrauen Himmel werde ich geblendet und ich halte mir eine Hand über meine Augen. Die da hinten könnte was werden.
Philline hat sie auch entdeckt. Aber meine Position ist die bessere, daher überlässt sie mir diese erste Chance. Außerdem gilt: Pro Welle immer nur ein Surfer. Aus Sicherheitsgründen. Aber auch ein unausgesprochener Ehrenkodex unter den Sportlern.
Vor jedem angehenden Ritt greife ich einmal fest um meine Muschelkette, die ich vor Jahren geschenkt bekommen habe, als ich meinen allerersten Contest gewonnen habe, und denke dabei kurz an Dad. Du bist die Welle, sage ich stumm vor mich hin und höre dabei seine Stimme, wie er mir das immer motivierend zugerufen hat, als er es mir damals auf Hawaii beibrachte.
Ich fokussiere mich auf die immer näherkommende Wasserflut und konzentriere mich nur noch auf den weiß schäumenden Kamm. Immer näher taste ich mich heran und bringe mich in Position. Jeden Moment bereit, mich aufzurichten.
Jetzt, denke ich. Mit meinen Händen greife ich links und rechts an den Rand meines Boards, winkele meine Beine an, gehe in die Hocke und dann ... löse ich meine Hände, stelle mich leicht gebeugt auf und halte gekonnt die Balance, während die Welle mich mitreißt. Ich fliege. Gleite fließend mit dieser gigantischen Wassermasse unter mir meterweit dem Ufer entgegen. Die Arme nach links und rechts ausgebreitet, federe ich jede Gegenbewegung ab und stemme meine Füße fest auf den frisch gewachsten Kunststoff. Wasser spritzt mir auf meine Wangen.
Das ist der Moment, in dem ich einfach weiß: Ich liebe das, was ich tue. Für den Moment bin ich mir selbst genug. Und ich brauche keinen Typen, der sich nicht sicher ist, ob er mich will. Und noch eine Sache weiß ich ganz genau: Verdammt, ich werde den Surf Cup in San Diego im September gewinnen.
Erschöpft fahre ich mir durch mein Gesicht und lasse das Süßwasser der Stranddusche neben dem Parkplatz das Salz auf meiner Haut wegspülen.
»Und du willst wirklich nicht mit auf diese Semesterparty?« Philline befestigt währenddessen unsere beiden Surfbretter wieder behutsam auf der Dachreling ihres Jeeps. »Ich könnte dich um acht Uhr abholen. Da werden ganz bestimmt auch ein paar Jungs aus dem Abschlussjahrgang kommen.« Sie zwickt mir liebevoll in die Seite und ich verdrehe die Augen.
»Ich glaube, ich habe erst mal die Nase voll von Dating-Material«, murmele ich erschöpft, meinen Neo bis auf die Hüften heruntergezogen, und kämme meine strohigen Haare notdürftig mit meinen Fingern durch. Das schreit nach einem Conditioner. Dieses ständige Salzwasser ist Gift für meine Locken.
»Ich lasse bestimmt nicht zu, dass du dich wegen einem Typen die ganzen Sommerferien über einigelst und dich nur aufs Training versteifst.« Sie runzelt die Stirn und lässt sich auf dem Fahrersitz nieder. »Wir sind immerhin im zweiten Semester an der USF. Eine bessere Zeit kriegen wir nicht mehr, El. Also entspann dich mal für einen Abend.« Sie gibt mir einen liebevollen Klaps auf die Schulter.
»Ich igel mich nicht wegen Nick ein. Und du willst mich doch nur gleich wieder verkuppeln und mich so vom Training ablenken, damit du am Ende des Sommers besser bist als ich.« Ich lache und strecke ihr im Scherz die Zunge raus. Unsere Rivalität ist immer bloß gespielt. Wir würden uns beiden den Sieg von Herzen gönnen. Obwohl, bei Philline bin ich mir da manchmal nicht ganz sicher ...
»Ich überlege es mir«, sage ich dann, um meine Freundin zu besänftigen. »Ich schreibe dir nachher noch mal, okay?«
Philline lässt den röhrenden Motor an und fährt schwungvoll vom Parkplatz. »Ich verlass mich drauf, El.« Danach säuselt sie noch überdreht in mein Ohr: »Partayyy«, was aber durch den Motorenlärm und den dröhnenden Dance-Beat, den sie aufdreht, beinahe untergeht. Rasant schert sie auf die Fulton Street ein, um mich nach Hause zu fahren.
Vor meinem Apartment in Fillmore, in dem ich mit meiner Mom Pip zusammenwohne, lässt Philline mich raus. Es ist ein schlichtes, weißes Mehrfamilienhaus im spanischen Stil, mit roten Schindeln, runden Bögen und Säulen, bestehend aus zwölf Wohneinheiten. Das Viertel ist seit Jahren sehr multikulturell geprägt, was Mom bei der Wohnungssuche damals sehr begrüßt hat, und ich liebe es ebenfalls mitten im Geschehen zu sein. All die fußläufigen Geschäfte und Cafés. Das emsige Treiben vor unserer Haustür, laute Gespräche Alteingesessener, oder spontane Reggae-Musik mit Trommeln aus dem Innenhof nebenan. Ich bin hier aufgewachsen und kann mir die Großstadt einfach nicht mehr wegdenken.
Zügig hieve ich mit einem Ruck mein Board vom Wagendach von Phillines Jeep, weil sie mitten im Halteverbot hält, und winke ihr zu. Ich entdecke unseren alleinstehenden Nachbarn Jamaal, der mit seinen langen Dreads und einem Turban in den jamaikanischen Farben auf dem Kopf am Geländer steht, eine Zigarette raucht und mich dabei beobachtet, wie ich barfuß über den Hof laufe.
»Guten Abend, meine Wassernixe. Hast du wieder die Weltmeere bezwungen?«, scherzt er und ich muss lachen.
»Übertreib’s nicht, Jamaal. Ich wünsch dir einen schönen Abend.«
Ich schließe das Board wie immer in unserem Kellerraum ein. Dann hüpfe ich die wenigen Stufen hinauf in den Laubengang des ersten Stockwerks und schließe die Tür auf.
»Grüß deine Mom von mir«, ruft er mir zu.
»Mach ich.« Ich grinse Jamaal an und meine Finger formen ein schnelles Peace-Zeichen zum Abschied.
Sobald ich die Tür öffne, strömt mir ein seltsamer Essensduft in die Nase. Oje, Mom hat mal wieder herumexperimentiert und indisch gekocht. Zumindest soweit ich die Gewürzpalette zwischen dem beißenden Geruch von Verbranntem und ihrer Armee aus Duftkerzen identifizieren kann. Ich kann hören, wie sie nebenan mit jemandem spricht. Haben wir Besuch?
»Bin wieder da, Pip«, rufe ich in die Wohnung hinein. Mom heißt eigentlich Piper. Aber weil ich es damals als kleines Kind nicht richtig aussprechen konnte, wurde daraus lediglich Pip. Und bis heute nenne ich sie häufiger so, als dass ich Mom zu ihr sage. Mom sage ich eigentlich nur, wenn ich sauer auf sie bin. Dann weiß sie sofort, dass es ernst ist und irgendetwas nicht stimmt.
Das Gesicht meiner Mom huscht einmal um die Ecke und sie gibt mir ein Zeichen, dass sie telefoniert. Ich nicke ihr zu.
»Mir gefällt es nicht, dass du dort ganz allein bist«, sagt sie zu der Person am anderen Ende der Leitung. »Kommt regelmäßig jemand vorbei, um nach dir zu sehen?«Ich lausche und merke, wie danach ein Moment Stille herrscht.
Pip verdreht die Augen, als sie dann wieder dran ist mit Reden. »Erzähl keinen Unsinn. Ich kenne dich. Und ich kenne Big Sur. Da wohnen doch gerade mal eine Handvoll Leute in deiner Nähe und ...« Sie verschwindet wieder in der Küche, sodass ich nicht mehr jedes Wort verstehen kann, das sie sagt, sondern nur wildes Geschirr-Geklapper das Gespräch übertönt. Big Sur? Sie spricht doch wohl nicht mit Gramps?
Abwartend packe ich meinen Rucksack aus und hänge den feuchten Neoprenanzug sowie das Handtuch zum Trocknen ins Bad auf den Wannenrand. Danach lasse ich mich müde auf die Couch plumpsen, lege die Füße hoch und greife mir eine Banane, die in der Obstschale vor mir liegt. Eindeutig die bessere Wahl, um meinen Hunger zu stillen, wenn ich an Pips Kochkünste denke. Trotz allem liebe ich unsere antiautoritäre Power-Frauen-WG. Ich könnte zwar auch mit Philline zusammenziehen, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich es mit Pip besser erwischt habe. Philline würde mindestens jeden zweiten Abend eine Party veranstalten. Also habe ich nichts dagegen einzuwenden, bis zum College-Abschluss zu Hause wohnen zu bleiben.
Neben mir im Sessel liegt ein aufgeschlagenes Sachbuch über den Buddhismus und ein mittlerweile kalt gewordener Chai Tee.
Das, was für mich das Surfen ist, sind für Pip eindeutig ferne Länder und Kulturen. Sie liebt das Reisen und ist früher als junge Frau von einem Land zum nächsten gejettet. Sie hatte genug von der abgeschiedenen Gegend, in der sie groß geworden ist. Sie wollte alles von der Welt sehen und noch viel mehr. Von Italien über Südafrika bis nach Indien und Thailand. Sie spricht fließend Spanisch und Französisch und ein paar vereinzelte Fetzen von einem der vielen indischen Dialekte, die man in Goa spricht, wo sie einige Zeit gelebt hat. Vermutlich ist das auch ein Grund, weshalb sie heute als erfolgreiche Dolmetscherin und Übersetzerin arbeitet.
Manchmal wundert es mich, dass Pip es schon so lange mit mir hier an ein und demselben Ort aushält, wo sie doch früher so eine Weltenbummlerin war und es sie nie lange an einem Ort gehalten hat. Sogar in dem gleichen Apartment, in das sie mit mir vor rund fünfzehn Jahren gezogen ist, wohnen wir noch immer.
Sie wollte immer noch mehr sehen und ständig mit dem Kopf durch die Wand. Ihr Ding machen, egal, was andere ihr rieten. Sie wusste immer, was sie wollte. Und das war vieles und wechselte manchmal schneller als das Wetter. Sie hat schon etliche Jobs gehabt, seit ich auf der Welt bin. Aber vor allem in den unterschiedlichen Ländern, die sie vor meiner Zeit bereist hat. Erntehelferin auf Ko Samui und Barkeeperin in London, zum Beispiel. Und sie hat freie Stadtführungen durch diverse Städte angeboten. Einmal hat sie sogar Nachtschichten in einem Sexkino in Paris geschoben.
Bis sie dann Mitte der Neunziger Jahre meinen Dad kennenlernte. Logan Fuller, einer der erfolgreichsten Profisurfer seiner Zeit. Alle nannten ihn Snap, weil er damals diesen Surfmove von allen am besten beherrschte. Irrwitzigerweise lief er Mom nicht auf einem anderen Kontinent über den Weg, sondern bei sich zu Hause vor der Tür. Na ja, fast. Nämlich in Los Angeles am Strand, als sie kurz über Weihnachten auf der Durchreise in Kalifornien war. Sie hat Dad beim Surfen entdeckt und sich auf Anhieb in ihn verknallt. Sie gingen ein paar Mal miteinander aus und führten eine On-Off-Beziehung, weil sie eigentlich wie Pech und Schwefel waren. Oder nein, besser gesagt, sie waren sich viel zu ähnlich, wodurch es zu ständigen Reibereien kam. Beide hatten einen fürchterlichen Sturkopf, wollten sich nichts sagen lassen und waren viel zu oft und lange berufsbedingt in der Weltgeschichte unterwegs. Das hat auf Dauer einfach nicht funktioniert und das ahnten sie auch. Aber es dauerte ein paar Monate und einen Ausrutscher (mich), bis sie es allmählich begriffen.
Dad war damals in seinen Zwanzigern, hatte gerade zum zweiten Mal den Worldcup gewonnen und Pip ging sogar für die ersten Jahre, nachdem ich geboren wurde, mit ihm nach Hawaii.
Seltsamerweise konnte mein Kopf das Bild von Pip und Hawaii nie gänzlich zusammensetzen. Es ist, als seien das zwei völlig unterschiedliche Puzzleteile. Denke ich an Hawaii und an meine ersten Erinnerungen zurück, sehe ich immer nur Dads Gesicht vor meinem inneren Auge. Dad mit mir am Strand in seinem roten Strandbuggy. Dad im Wasser, wie er meinen kleinen Körper durch die Wellen gleiten lässt und mir von Beginn an die Angst vor dem Ozean nimmt, aber mir gleichzeitig seinen Respekt davor lehrt. Dad, wie er mir mein erstes Surfbrett zu Weihnachten schenkt.
Aber wo war Pip in all diesen Erinnerungen? Offensichtlich unglücklich in ihrer Beziehung zu Dad, und dieser so abgelegenen Inselgruppe schnell überdrüssig. Als ich etwa dreieinhalb war, verließ sie Dad – Hals über Kopf, wie es nicht anders zu erwarten war – und zog mit mir zurück aufs Festland nach San Francisco. Dad und das Leben auf Hawaii waren ihr wieder mal zu langweilig geworden.
Irgendwas hatte sich zu diesem Zeitpunkt in ihr gewandelt. Vielleicht war es die Tatsache, dass sie sich von jetzt an allein um mich – dieses winzige Geschöpf namens Elly – kümmern musste. Aber das hatte sie sich schließlich genauso ausgesucht, also würde sie das auch schaffen. So in etwa stellte ich mir Pips Einstellung damals vor. Nichts konnte sie wirklich erschüttern. Immer fand sich irgendwo ein neues Schlupfloch. Etwas Positives, das man aus einem Niederschlag oder einer Herausforderung ziehen konnte.
Seit wir diese Wohnung in Fillmore bezogen hatten und Mom jahrelang einem langweiligen Job in einem Callcenter nachging, war sie nach und nach zu einer neuen, bodenständigeren Pip geworden, die sogar zur Abendschule ging, um sich fortzubilden. Wenn auch nicht weniger chaotisch und spontan. Mom hat mich oft genug mit ihren fixen Ideen und nächtlichen kreativen Findungsphasen in den Wahnsinn getrieben. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich sei die Reifere von uns beiden und in ihr steckte immer noch eine hibbelige Teenagerin fest, die alles ausprobieren musste, weil sie Angst hatte, irgendetwas zu verpassen.
Hin und wieder kommt so was noch immer vor, aber auch Pip ist im Alter – mit nun fast fünfzig – gelassener geworden. Eine typische Mom war sie trotzdem nie. Vielleicht auch ein Grund, warum ich sie eher selten so genannt habe.
Gedankenverloren blättere ich in ihrem Sachbuch herum, ohne wirklich darin zu lesen und da fällt mir wieder diese dämliche Hausarbeit ein, die wir vor Semesterende aufgebrummt bekommen haben.
»Was? Hausarbeit?! Ich dachte, ihr habt Ferien«, hat Pip vor ein paar Tagen empört gesagt, als ich ihr davon erzählte.
»Schön wär’s«, habe ich geantwortet und demonstrativ meine dezente Ausbeute aus der Bibliothek, für Recherche-Zwecke, vor ihr auf dem Wohnzimmertisch ausgebreitet. »Semesterferien bedeuten nur vorlesungsfreie Zeit, aber nicht, dass wir uns auf die faule Haut legen dürfen, hat unser Dozent gesagt. Aber das kannst du ja nicht wissen. Du warst schließlich nie auf dem College.«
»Na, ein Glück«, raunte sie und schob dann hastig hinterher: »Nichts für ungut, Honey. Für dich ist das genau das Richtige. Nur für mich wars das damals eben nicht. Und dazu hast du einen Vater, der dir die Collegegebühren bezahlen kann.«
Ich ging nicht weiter darauf ein, sondern wand mich weiter in meinem Unmut. »Die wollen allen Ernstes im September eine dreißigseitige Abhandlung über einflussreiche Frauen des einundzwanzigsten Jahrhunderts von uns haben.«
Pip machte ein Geräusch, als würde sie schnarchen. »Mann, das hört sich ja schon langweilig an, wenn du nur davon sprichst.« Sie lachte und ich gab ihr einen Klaps auf die Schulter.
»Okay, also über dich werde ich schon mal nicht schreiben.«
Sie grunzte und fasste sich theatralisch an ihr Herz. »Oh, jetzt hast du mich aber tief getroffen.«
Ja, so war Pip.
Als ich bemerke, dass sie aufgehört hat zu telefonieren, nehme ich schnell meine nackten Füße vom Tisch. Pip ist zwar nicht spießig, aber sie findet es unappetitlich, wenn ich meine schmutzigen Straßenfüße immerzu so in Szene setze und jedes Mal mindestens eine Handvoll Sand in der Wohnung oder in ihrem Fiat verteile. Ich hingegen liebe es nun mal, so oft es geht barfuß zu laufen. Also habe ich eben vom Strand bis in Phillines Jeep sowie den Weg vom Hof bis in unsere Wohnung darauf verzichtet, in meine Flipflops zu schlüpfen. Irgendwie fühle ich mich einfach wohler, wenn ich barfuß bin. Freier.
Pip kommt mit einer knallbunten Haremshose und einem schwarzen T-Shirt aus der Küche und reibt sich müde das Gesicht.
»Was ist los?«, will ich wissen. »Mit wem hast du gesprochen?«
Pip seufzt, lässt sich in den Sessel fallen, auf dem noch in der Decke der Abdruck ihres Hinterns zu sehen ist, und nimmt einen Schluck von ihrem Chai. Als sie merkt, dass er lauwarm ist, verzieht sie angewidert das Gesicht und lässt ihn resigniert stehen.
»Das war Gramps«, murmelt sie.
»Grumpy Gramps?« Also doch, denke ich. Meine Stimme klingt überrascht und ich hebe den Blick. Es kommt nicht oft vor, dass Pip mit ihrem Vater spricht. Höchstens an Weihnachten und Geburtstagen.
Pip nickt in Gedanken versunken. »Es geht ihm nicht besonders gut«, sagt sie und pustet sich eine Locke von der Stirn.
Ich beuge mich vor und schaue Pip an. »Wieso? Was ist mit ihm?«
Ich habe zwar keine wirkliche Bindung zu meinem Großvater, aber ich sehe, dass es Pip beschäftigt, also geht’s mich auch was an.
»Er wirkt zerstreut. Ist ein paar Monate her, dass ich zuletzt mit ihm gesprochen habe, da ist es mir noch nicht wirklich aufgefallen. Aber ich fürchte, er wird langsam vergesslicher.« Mom runzelt die Stirn, als würde sie ein bestimmtes Bild vor ihrem inneren Auge sehen, das ihr nicht gefällt. »Und er ist gestürzt.«
»Oje, ist ihm was passiert?«
Pip zuckt mit den Schultern. »Soweit ist wohl alles in Ordnung. Zum Glück nichts gebrochen. Er sagt, es gehe ihm bestens. Nur ein paar blaue Flecken hier und da. Aber ich habe irgendwie kein gutes Gefühl.« Pip steht auf und geht zum Fenster. Am Himmel vor unserem Balkon hat sich die tiefstehende Sonne einen Weg durch die Wolkendecke gebahnt und grinst uns nun orangerot an.
»Gramps war doch immer zäh«, versuche ich sie aufzumuntern. Das sage ich zwar so leichthin, aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Ich kenne Gramps doch kaum. Zuletzt habe ich ihn vor gut einem Jahr auf seinem siebzigsten Geburtstag gesehen, als Mom ihn für ein paar Tage aus seinem einsamen Haus zu uns in die Stadt geholt hat. Aber man hat ihm sofort angemerkt, dass er sich hier in diesem Umfeld, in Pips Gästezimmer mit diesen riesigen Batiktüchern und psychedelischen Bildern von irgendwelchen indischen Gottheiten über dem Bett, absolut nicht wohl gefühlt hat. Es war so ganz anders als bei ihm zu Hause.
Davor gab es lediglich ein paar Pflichtbesuche von Pip, damit Gramps auch hin und wieder mal seine Enkelin aufwachsen sehen konnte. Ich weiß nicht wieso, aber Pip und ihr Dad haben nicht wirklich viel gemeinsam. Und Pip selbst spricht nicht oft von ihrer Kindheit. Immer nur von den Geschichten danach, als sie mit achtzehn in die Welt aufgebrochen ist. Daher weiß ich bis heute nicht, welche unausgesprochenen Konflikte zwischen den beiden stehen. Vielleicht liegt es daran, dass Pip ohne ihre Mutter aufgewachsen ist, weil sie gestorben ist, als Pip noch ein Baby war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Gramps ein schlechter Vater gewesen sein soll. Was auch immer es ist, das ihre Beziehung zueinander zerrüttet hatte, ich bin der Meinung, Pip würde schon ihre Gründe haben. Daher hielt ich bereits von klein auf selbst genauso wenig von Gramps wie Pip es mir immer vorgelebt hatte.
Ob das fair ihm gegenüber war, weiß ich nicht. Aber ich war eben ein leicht zu beeinflussendes Kind und Mom sehr überzeugend in ihrer Darbietung in der Rolle als unverstandene Tochter.
»Er hat ständig Orte und Namen vertauscht«, sagt Pip jetzt.
»Wahrscheinlich ist er noch durcheinander von dem Sturz.«
Pip schüttelt den Kopf. »Das liegt nicht an dem Sturz, Elly. Aber er weigert sich partout, zum Arzt zu gehen.« Sie schnaubt. »So ein Sturkopf, kannst du dir das vorstellen?«
Ich verziehe den Mund zu einem Grinsen. »Hm, daher hast du das also ...«
»Ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht wie mein Dad«, beharrt Pip. Und ich frage mich, wieso sie immer vehement diese unsichtbare Grenze zwischen ihm und sich ziehen muss.
Mein Dad und ich haben auch nicht viel gemeinsam und unsere Vater-Tochter-Beziehung könnte weitaus besser sein. Aber wir machen das Beste aus den Umständen. Ich habe ihn lieb und ich weiß, dass er mich auch lieb hat. Auch wenn er mit seiner neuen Frau noch zwei kleine Jungs bekommen hat. Zwillinge. Und auch, wenn ich mir manchmal gewünscht hätte, dass alles anders gekommen und meine Eltern noch zusammen wären, steht da nichts Böses zwischen uns. Außer vielleicht fünf völlig überteuerte Flugstunden bis nach Honolulu.
Pip macht ein komisches Gesicht, sieht mich an, dann wieder weg.
»Was ist?«
Pip schüttelt den Kopf. »Er … er ... eben am Telefon, da hat er mich mit Mom verwechselt.«
»Mit deiner Mom?«, wiederhole ich belegt, weil Pips Mom – also meine Gran – ein Thema ist, das Pip immer abgeblockt hat und für mich tabu war. »Aber sie ist –«
Pip nickt bestätigend und senkt den Blick. »Ich weiß, das ist –« Sie beendet den Satz ebenfalls nicht und murmelt: »Ach, egal.«
Ich stehe auf und lege ihr eine Hand auf die Schulter. »Hey, ich sage doch, Gramps ist durcheinander. Wahrscheinlich hat er irgendwelche Schmerztabletten genommen, die ihn etwas benebeln.«
Und dann sagt Pip etwas, was mich sehr überrascht, nämlich: »Ich sollte zu ihm fahren und nach ihm sehen.«
»Klar, wenn dich das beruhigt.«
»Er ist schließlich nicht mehr der Jüngste«, betont Pip. »Was, wenn er noch mal stürzt und niemand da ist, der ihm helfen kann? Mir ist einfach nicht wohl dabei. Du weißt, wie weit Gramps in der Pampa lebt.«
»O ja, und wie.« Ich räume Pips Chaibecher in die Küche und schmeiße meine Bananenschale weg. Pip folgt mir und wirft mit ihrer Lesebrille auf der Nasenspitze einen Blick in ihren Kalender.
»Mist«, flucht sie.
»Was ist nun schon wieder?«, will ich etwas genervt wissen. Weil bei Pip immer alles schnell zum Drama wird.
»Ich muss übermorgen nach Phoenix zu dieser Konferenz. Das habe ich ja total verschwitzt. Unpassender geht es nicht.« Pip stöhnt genervt auf und reibt sich die Schläfen.
»Kannst du das nicht absagen oder verschieben?«
»Flug und Hotel sind schon seit Wochen von meiner Agentin gebucht. So kurzfristig zu stornieren wäre nur mit hohen Kosten verbunden. Außerdem ist es wichtig für mein Business. Ich brauche das Netzwerk der Leute dort.«
Ich zucke mit den Schultern und werfe skeptisch einen Blick in die Pfanne mit dem vermeintlich indischen Essen.
»Kannst du nicht danach zu Gramps fahren?«
»Und ihn über mehrere Tage mit seiner geprellten Hüfte im Bett herumliegen lassen? Nein, auf gar keinen Fall.«
»Dann weiß ich auch nicht, Mom«, sage ich nachdrücklich, weil dieses Gespräch doch zu nichts führt. Ich nehme mein Handy und schaue, ob Philline mich bereits mit Nachrichten bombardiert, dass ich mich endlich für diese Semesterparty fertig machen soll.
»Wem schreibst du? Wieder diesem Jungen? Wie hieß er noch gleich?« Sie schnippt mit den Fingern, als würde es ihr so wieder einfallen, und ich schüttele lächelnd den Kopf.
»Niemandem. Und, nein, das mit Nick ist vorbei. Aber ich wollte mich vielleicht später noch mit Philline auf einen Drink treffen. Semesterferien einläuten und so.«
»Oh, oh, das schreit nach Liebeskummer.«Pip runzelt besorgt die Stirn. »Soll ich uns ein Salted-Caramel-Eis holen?«
»Quatsch«, tue ich es ab. »Wir hatten doch nur ein paar Dates.«
Ich hatte gehofft, meine Stimme so klingen zu lassen, als würde mir die Sache mit Nick nicht allzu nahe gehen. Aber da habe ich natürlich die Rechnung ohne Pip gemacht. Denn die macht auf einmal große Augen und klatscht in die Hände.
»Ich hab’s«, ruft sie. »Wer Liebeskummer hat, braucht dringend einen Tapetenwechsel. Miss ›Ich-Habe-Semesterferien‹, DU fährst zu Gramps. Natürlich!«
»Was? Nein, ich –«, protestiere ich, aber mir will auf Anhieb einfach kein Grund einfallen, warum das absolut nicht infrage kommt.
Vielleicht weil ich diesen Mann kaum kenne? Weil ich mich auf meine Hausarbeit konzentrieren muss? Weil ich als Altenpflegerin absolut ungeeignet bin? Weil ich für den Surf Cup trainieren muss?
Ja, das ist gut, denke ich. Damit kriege ich Pip. Sie weiß, wie wichtig mir der Wettkampf ist.
»Das geht nicht. Ich muss mit Philline zum Training. Und ich habe keinen Liebeskummer.«
Auf meine letzte Äußerung geht sie gar nicht erst ein. »Du und Training? Du bist doch jetzt schon besser als alle anderen.«
»Mom!«
»Ist doch so. Es wäre doch nur für ein paar Tage. Mehr nicht. Nur, um mein Gewissen zu beruhigen, dass er klarkommt. Versprochen. Und damit du den Kopf frei bekommst. Bitte Ellylein, tu es für mich.«
Ich weiche Pips Blick aus. Frustriert laufe ich wieder ins Wohnzimmer zur Couch und versuche ihrer Bettelei zu widerstehen. Pip folgt mir, wie so ein anhänglicher Dackel. Sie wird mich so lange bequatschen, bis ich einknicke. Also wozu noch diskutieren?
Ruckartig drehe ich mich zu ihr um, sodass sie beinahe in mich hineinläuft.
»Zwei Tage!«, verhandele ich mit erhobenem Zeigefinger. »Höchstens Drei. Dann muss ich wieder zurück.«
Pip lächelt mich dankbar an und zerdrückt mich fast in ihrer Umarmung. »Du bist ein Schatz, Ellylein.«
»Und du bist nervig, Pip.« Ich winde mich lachend aus ihren Armen und wage mich nun doch noch an ihr mysteriöses, veganes Curry-Huhn. Ich werde eine Grundlage brauchen, wenn Philline später wieder mal versucht, mich abzufüllen.
Gedanklich bin ich jedoch absolut nicht bei der Semesterparty, sondern schon längst in Big Sur. Drei Tage, hat Pip gesagt.
The Summer Of Awakening
Maggie
Juni 1967 | Berkeley | Kalifornien
Um mich herum tummelten sich die Leute dicht an dicht gedrängt. Ich war überrascht, wie viele tatsächlich erschienen waren, obwohl sich die Zusammenkunft in den vergangenen Tagen nur durch Mundpropaganda verbreiten konnte. Manche der um mich herumstehenden Studenten kannte ich aus meiner Semesterstufe oder sogar aus ein paar Vorlesungen, die wir gemeinsam hatten, und von denen ich niemals geglaubt hätte, dass sie sich an etwas halbwegs Illegalem beteiligten. Aber das hätte man von mir selbst vermutlich auch nicht erwartet. Doch hier in der Menge, umgeben von hunderten Gleichgesinnten, verlieh einem der Gedanke des Zusammenhalts und der Anonymität offenbar Schutz. Und Mut. Denn öffentliche Demonstrationen waren seit dem Redeverbot, ausgelöst durch den Bürgerrechtler Malcolm X vor ein paar Jahren, auf dem Campusgelände untersagt.
Schräg hinter mir stand meine beste Freundin Valerie Collins und strich sich ihr dichtes, haselnussbraunes Haar hinter die Ohren. Wir befanden uns ziemlich weit vorne, aber etwas abseits, direkt zwischen den weißen, altertümlichen Gebäuden des Universitätsgeländes von Berkeley. Rechts von uns thronte die alte Bibliothek. Auf der anderen Seite der Wissenschaftstrakt. Die abfallende große Wiese bis runter zum Memorial Glade, wo wir manchmal zwischen zwei Vorlesungen auf dem Rasen in der Sonne saßen, sowie die ordentlich angelegten Sandwege, waren voll von Menschen. Und alle waren gekommen, um zu hören, was er zu sagen hatte: Samuel Marshall Lewis.
Sein aufgebrachter, entschlossener Blick war in die Weite gerichtet und er fuhr sich einmal energisch durch sein dichtes, dunkelblondes Haar.
Der Himmel über uns leuchtete cyanblau. Die Nachmittagssonne stand zwar nicht mehr im Zenit, aber sorgte um diese Jahreszeit für enorme Strahlkraft. Ich entdeckte ein paar Schweißperlen auf Samuels Stirn, während er sprach. Zusammen mit zwei anderen älteren Jungen aus höheren Semestern stand er vor dem hohen, weißen Sather Tower auf einem provisorischen Podest und verkündete seinen Unmut lauthals durch ein Megafon.
»Begreift ihr es denn nicht? Wir sind denen doch vollkommen egal. Alles, was die da oben sehen, ist Macht und Geld. Sie denken, sie können alles mit uns machen, aber da kennen sie uns schlecht. Wir werden keinen blinden Gehorsam leisten. Nicht mehr. Nicht wie die Generationen vor uns. Sie wollen uns weismachen, Widerstand sei nicht gesetzestreu. Aber wir kennen unsere Rechte und die werden wir einfordern. Wir werden nicht schweigen. Wir werden aufstehen und uns wehren. Wir sind keine Nummer!«
Samuel stand dort oben, so selbstsicher und erhaben über all seine Mitstudenten, die gebannt an seinen Lippen hingen. Er genoss seinen Auftritt, weil er so sehr für diese Sache brannte. Das konnte heute wohl jeder hier spüren. All jene, die gekommen waren, teilten die gleiche Meinung wie die Aktivisten rund um Samuel, und das spornte ihn noch zusätzlich an. Seine Stimme erbebte geradezu vor Erbostheit und erfüllte den ganzen Platz, hallte an den Gebäuden wider und blieb tief in meiner Brust hängen, wo mein Herz plötzlich ein wenig schneller schlug, als sein Blick für eine Sekunde an mir haften blieb. Ich konnte sogar von hier aus das Leuchten in seinen Augen erkennen. So wie jetzt hatte ich ihn noch nie erlebt. Aber ich konnte nicht abstreiten, dass ihn diese Vitalität, die ihn durchströmte, noch attraktiver machte.
Ich hörte lautes Lachen und Gemurmel. Eine Gruppe unmittelbar neben mir stehender junger Männer reckten ihre Hälse empor und sie riefen lauthals, indem sie ihre Hände als Sprachrohr benutzten: »Wir sind keine Nummer! Wir sind keine Nummer!«
Sam fuhr bestimmend fort, angetrieben von all den Zustimmenden: »Genau! Wir sind Menschen. Jung und wissenshungrig. Wir sind die Zukunft dieses Landes und ausgerechnet uns wollen sie zwingen, in einen Krieg zu ziehen, der dem Untergang geweiht ist? Das klingt für mich nicht mehr nach einem klugen Schachzug, nein, ich nenne so etwas grenzdebil.« Wieder lautstarker Jubel.
»Das bringt doch eh nichts«, murmelte Valerie neben mir leise und etwas missmutig und ich gab ihr einen Stoß in die Seite.
»Mit dieser negativen Einstellung ganz sicher nicht«, erwiderte ich bissig. »Siehst du nicht, wie viele wir sind? Wenn so etwas wie hier an jedem College in den Vereinigten Staaten passiert, dann müssen die Politiker ihre Meinung ändern und uns anhören.«
Valerie schnaubte ungläubig. Ein bisschen konnte ich sie verstehen. Die Politiker machten immer, was sie wollten, und bekamen meistens Recht. Was konnten wir schon bewirken? Was konnten wir gegen das Leid, das auf dieser Welt herrschte, schon ausrichten? Aber ich musste einfach daran glauben. Genauso, wie Sam es tat.
Es hieß, mit dem anhaltenden, zermürbenden Krieg in Vietnam bekäme die Army auf Dauer massenhaft Probleme bei der Rekrutierung neuer Soldaten. Nur wenige der Zivilisten waren überhaupt noch bereit, in einen Krieg zu ziehen, dessen Grund sie nicht begriffen und deren Einmischung der US-Army sie nicht länger unterstützen wollten.
Ich persönlich fand es ungeheuerlich, dass unser Land ernsthaft über einen Einberufungszwang junger Männer nachdachte. Sogar von einer Art Lotterie, wie sie bereits im Ersten und Zweiten Weltkrieg stattgefunden hatte, war die Rede.
Noch waren Studierende von der Wehrpflicht ausgeschlossen, aber das sollte sich offenbar bald ändern. Die Regierung befürchtete, es käme dadurch zu einer Horde Dauerstudierenden, die sich lediglich durch den Vorwand ihres Studiums vor ihrer Bereitschaft, ihrem Land zu dienen, drücken wollten.
Den ganzen jungen Leuten nach zu urteilen, die sich hier auf dem Vorplatz der Universität eingefunden hatten, war Sam bei Weitem nicht der Einzige, der diese Willkür nicht dulden und ohne Weiteres hinnehmen würde.
»Erst wollen sie uns die Redefreiheit und Proteste verbieten? Und jetzt wollen sie uns auch noch unsere Bildung nehmen und uns stattdessen in einen sicheren Tod schicken? Das werden wir zu verhindern wissen. Denn sie unterschätzen unsere Stimme. Unseren Willen. Und wie viele wir sind, wenn wir uns gemeinsam gegen diese Anzugträger da oben erheben.«
Sein Publikum applaudierte. Mit so einem großen Ansturm hatte selbst Sam nicht gerechnet. Umso adrenalingeladener war er nun, während er sich mit seiner Forderung an mehrere hundert Gleichgesinnte und Betroffene wandte.
Zustimmende Rufe und Pfiffe ertönten aus der Menge. Mich überkam das ungute Gefühl, dass dieser nicht zu übersehende und unüberhörbare, verbotene Protest nicht mehr lange von der Campusverwaltung geduldet werden würde. Immer öfter wurden wir neuerdings verscheucht. Sie behandelten uns wie den letzten Pöbel. Dabei taten wir doch gar nichts Schlimmes. War es lediglich, weil wir eine andere Einstellung besaßen?
Wenn Sam von diesen ›Leuten da oben‹ sprach, dann war ich eine der wenigen, die wusste, dass er seinen Vater hier ganz klar mit einbezog. Marshall Lewis Senior saß im Senat des San Francisco County unter den Republikanern und hätte seinen Sohn mit Sicherheit auf der Stelle enterbt, wenn er gewusst hätte, dass Samuel sich an solchen linksorientierten Demonstrationen beteiligte. Ja, sogar die Speerspitze dessen bildete.
Auf einem der Hügel der Observatory Hills inmitten des Campusgeländes hatte ich mich zurückgezogen, mit meinen Gedanken vollkommen in die Seiten einer meiner liebsten Geschichten von Emily Brontë vertieft, als mir auf einmal von hinten jemand das Buch aus der Hand riss.
»Hier steckst du also. Das hätte ich mir denken können.« Augenblicklich schreckte ich zusammen und drehte mich um, während ich auf der grünen Holzbank sitzen blieb. »Wie war ich?«
»Sam«, stieß ich erleichtert aus und lächelte leicht. Auch noch nach Wochen wurde ich nervös, wenn ich in seine bernsteinfarbenen Augen blickte. »Ich schätze, du hast auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck bei den anderen hinterlassen. Aber bitte erschreck mich nächstes Mal nicht so.«
Noch immer hinter der Lehne stehend, beugte Samuel sich zu mir herunter und gab mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Die Stelle, wo sein Mund auf meine Haut traf, prickelte und mein Herz machte einen kleinen Satz.
»Entschuldige, meine Sonne«, nuschelte er in mein Haar. »Kommt nicht wieder vor. Ich vergesse immer wieder, dass du in einer anderen Welt lebst, sobald du liest.«
Schwungvoll kam er um die Bank herumgelaufen und platzierte sich zielsicher direkt neben mir. Ausgiebig studierte er den abgegriffenen Einband meines Buches, mit den vielen Falten und den zahlreichen zerknickten Eselsohren, dort, wo ich meine Lieblingspassagen markiert hatte.
»›Sturmhöhe‹«, stellte er amüsiert fest. »Wie oft hast du das eigentlich schon gelesen, Maggie?«
Ich spitzte die Lippen und schnappte ihm das Buch gekonnt aus seinen Fingern.
Ich grinste keck. »Sagt ausgerechnet der, der ständig aus Kerouacs Romanen zitiert.«
»Du hast mich entlarvt, meine Sonne.« Mit einer schnellen Geste schüttelte er sich seine in die Stirn gefallenen dunkelblonden Haarsträhnen aus dem Gesicht. Die Schatten der Bäume legten sich auf sein ebenmäßiges Gesicht. Sein Profil wirkte stolz und wie gemeißelt, aber im Gegensatz zu sonst sah er ein wenig zerzaust aus.
Kein Wunder, dachte ich. Nachdem die Protestaktion vor rund einer Stunde unsanft beendet wurde, als die Polizei eintraf, und alle Teilnehmenden in sämtliche Ecken des Campus untergetaucht waren, hatten Sam und seine zwei Partner ebenfalls das Weite gesucht, bevor sie von der Universitätsleitung und den Gesetzeshütern zur Rechenschaft gezogen werden konnten.
Gegen hunderte einzelne Studenten hatten sie nichts in der Hand, sofern sie nicht die Drahtzieher selbst in die Finger bekamen. Und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als einen weiteren Protest wieder mal folgenlos zu unterbinden.
Ich war davon ausgegangen, dass die anderen längst nach Hause gegangen waren. Immerhin war es Freitagnachmittag und bis auf die Aktion hielt es keinen Studenten länger als nötig auf dem Gelände. Außer mir. Ich liebte es, wenn allmählich Ruhe in dem parkähnlichen Areal einkehrte und ich mir zwischen all den gepflegten Grünanlagen ein gemütliches Plätzchen zum Lesen suchen konnte. Die knorrigen, alten Bäume, die mich umgaben, erzählten mir manchmal ihre ganz eigene Geschichte aus vergangenen Tagen, wenn alles ganz still und menschenleer um mich herum wurde.
Hier oben auf dem Hügel mit Blick auf die Northside war mein geheimer Lieblingsplatz. Gut, so geheim war er nun auch wieder nicht, denn immerhin hatte Samuel mich hier aufgespürt. Es war der Platz, an dem wir uns im Frühjahr kennengelernt hatten. Als er und ich feststellen mussten, dass wir nicht die Einzigen waren, die zum Lesen hierherkamen, und wir uns gegenseitig von den Geschichten in unseren Büchern erzählten. Ich schilderte Samuel die tragische Dreiecks-Beziehung zwischen Catherine, Heathcliff und Edgar, die er natürlich längst aus dem Englischunterricht kannte. Und Samuel schwärmte von dem abenteuerlustigen Sal Paradise aus ›On The Road‹. Er nannte mich daraufhin neckend eine hoffnungslose Romantikerin und ich ihn einen Träumer.
Als ich ihm damals von unten aus meinem Schneidersitz in die Augen geblickt hatte, wie er mit einer Zigarette in der einen und einem zerfledderten Buch in der anderen Hand vor mir gestanden hatte, war es eigentlich sofort um mich geschehen. Gutaussehend und gebildet.
Ich kannte Samuel Marshall Lewis bereits vom Sehen, seit dem ersten Tag meines Medizinstudiums vergangenen Herbst. Jeder am Campus kannte ihn und mindestens jedes zweite Mädchen sah ihm hinterher, wenn er die Gänge der Fakultät passierte. Selbstsicher und mit dieser Leichtigkeit, ohne dabei arrogant zu wirken. Mit der Kombination aus Jeans und Lederjacke sowie dem lässig nach hinten gekämmten Haar und den dichten Augenbrauen erinnerte er mich ein wenig an James Dean. Bis heute fragte ich mich manchmal, was er damals in mir gesehen hatte, das ihn dazu veranlasste, ausgerechnet mich wenige Tage nach unserem ersten Aufeinandertreffen um ein Date zu bitten. Und alle für ihn schwärmenden Mädchen fragten sich offenbar dasselbe. Denn seitdem wir miteinander gingen, heimste ich nicht selten ein paar missgünstige Blicke ein.
»Hast du heute noch was vor?« Samuel legte einen Arm um mich und den Kopf schief, als er mich von der Seite betrachtete.
»Ich weiß nicht. Ich wollte noch etwas lesen und dann nach Hause. Dad erwartet mich bestimmt zum Abendessen.«
»Begleitest du mich, wenn ich dir verspreche, dass ich dich pünktlich nach Hause bringe?« Er verzog den Mund zu einem charmanten Lächeln und strich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Wohin soll ich dich denn begleiten?« Ich schlug die Seiten des Klassikers auf meinem Schoß zu und hinterließ das Lesezeichen an der Stelle, wo Sam mich eben unterbrochen hatte.
»Ich will wieder zum Golden Gate Park. Kommst du mit?«
Ganz euphorisch hüpfte ich auf und blickte mit geweiteten Augen zu Sam auf. »Ich dachte schon, du fragst nie. Schon letzte Woche wäre ich so gern mitgekommen. Ich dachte, du willst lieber mit Stanley allein fahren.« Ich machte einen Schmollmund.
Sam nahm meine Hand und lächelte mich an. »Natürlich hätte ich dich mitgenommen, wenn ich gewusst hätte, wie viel dir daran liegt, meine Sonne. Du bist doch jetzt meine Freundin. Na los, komm schon.« Er gab mir einen Kuss auf mein rotblondes Haar, das mir in leichten Wellen über meine Schultern fiel. Ich mochte meine Haare schon immer lieber, wenn ich sie offen trug. Verlegen sah ich auf meine Hände, ehe ich mein Buch zurück in meine Tasche steckte und seine Hand wieder nahm.
»Aber Valerie und Stanley müssen auch mitkommen.«
»Klar doch, sie warten bereits am Auto.«
Lachend ließ ich mich von ihm mitreißen. Während wir hastig zum Ausgang Richtung Parkplatz liefen, sprach Sam ganz außer Atem weiter: »Glaub mir, Maggie. Ein Besuch wird nicht ausreichen. Wenn du einmal dort warst, willst du wieder hin. Das ist wie ein Prozess, der vollzogen werden will, wie eine Metamorphose. Wenn du es siehst, wirst du verstehen, was ich meine.« Ich hörte ihm jedoch gar nicht mehr richtig zu, so eilig hatte ich es und rannte voraus.
Etwa eine halbe Stunde später parkte Sam seinen Wagen am Straßenrand im Stadtteil Haight-Ashbury, und nachdem die Jungs ausgestiegen waren, klappte Sam seinen Sitz nach vorne und ließ Val und mich ebenfalls hinaushüpfen.
»Ladies«, sagte er aufrichtig und hielt uns die Tür auf.
»Und du bist sicher, dass wir mit diesem Schlitten hier aufkreuzen sollten?« Stanley lief um Sams roten Alfa Spider Cabriolet herum und fuhr einmal mit der Hand über den Lack, als wären es die Rundungen einer Frau. »Sie werden uns für verdammte Bonzen halten.«
»Sicher«, beteuerte Samuel mit einem süffisanten Grinsen im Gesicht und sein Blick verdunkelte sich augenblicklich. Er zückte seinen Autoschlüssel, und während er an der Beifahrerseite des Alfas entlang schritt, zog er einen langen, genüsslichen Strich vom vorderen Kotflügel bis zum Heck.
»Oh, Vater«, scherzte er mit verstellter, theatralischer Stimme. »Ich hätte es besser wissen müssen und mit meinem Wagen nicht in diese Gegend fahren dürfen.«
Val und ich kicherten etwas verunsichert. Was tat er denn da bloß? Die aufeinandertreffenden Metalle verursachten ein unerträgliches Geräusch und eine Gänsehaut in mir, sodass ich und Valerie gleichzeitig das Gesicht verzogen. Ebenso bei dem Anblick des beschädigten Lackes.
»Ja, Mann.« Stan klopfte ihm zustimmend auf die Schulter und sorgte mit seinen Fingern für einen großen Riss im Stoff des Verdecks.
»Aber, Sam –«, setzte ich an, doch Stanley unterbrach mich lachend.
»Was hast du denn, Mag? Zahlt doch alles Senator Lewis.« Er zwinkerte mir zu.»Daddy Lewis wird denken, das waren diese ›verdammten Hippies‹, die er so sehr hasst.«
Sam nickte bestätigend. »Genau. Und dann werde ich ihm sagen: Nein, Vater. Das war ich. Der größte Gegner deiner widerlichen Dekadenz. Und das hier ist meine Botschaft an dich, um dir ein für alle Mal deutlich zu machen, auf welcher Seite ich stehe.«
Stanley und Sam lachten, während sie sich gegenseitig hochschaukelten, sich für ihre grandiose Tat beweihräucherten und zügig ein paar Schritte vorausgingen. Val und ich folgten ihnen wortlos.
Ich wusste, wie sehr Samuel tagtäglich im Konflikt mit seinem erzkonservativen Vater stand. Wie sehr er das weiß getünchte Anwesen in Claremont Hills verabscheute und wie sehr er es hasste, dass seine Eltern ihren Wohlstand auslebten, mit allem, was dazugehörte. Teure Autos und edle Empfänge. Besuche in Countryclubs. Und zu allem Überfluss war Senator Lewis ein konservativer Politiker. Um sich all jenem zu widersetzen, wählte Sam schon vor Jahren statt einem Studium der Politik oder Rechtswissenschaften die geistige Lehre und schrieb sich für Philosophie und Literatur ein. Brotlose Kunst und Geschwätz, hatte sein Vater dies abschätzig genannt, wie Sam mir vor Kurzem erzählte.
Zu viert setzten wir uns die restlichen Meter bis zum Eingang des Stadtparks in Bewegung und Samuel verschenkte seine teure Markensonnenbrille kurzerhand an einen Obdachlosen. Noch so ein Statement seines neuartigen Anti-Materialismus.
Kaum waren wir um die nächste Ecke gebogen, schien es, als hätten wir eine andere Welt betreten. Und wir waren plötzlich mittendrin. Etliche Gruppierungen von Menschen drängten sich aneinander, wie vorhin bei dem Protest auf dem Campus. Nur dass die jungen Menschen hier ganz anders aussahen als die Beatniks der Studentenbewegung, mit denen Sam sich bis vor Kurzem noch umgeben hatte. Als ich ihn vor ein paar Monaten kennengelernt hatte, hatte er seinen Vater noch mit modernem Jazz in den Wahnsinn getrieben und mit seinen Kommilitonen die Freitagabende in verrauchten Kneipen verbracht, um über Kunst, Literatur und Politik zu schwadronieren. Aber spätestens seit seinem ersten Besuch im Golden Gate Park vor ein paar Wochen mit Stanley hatte das irgendwas mit ihm gemacht. Plötzlich war er der Popularität der Hipster vom College überdrüssig, weil sie seiner Meinung nach längst nicht mehr dem Bild der bewussten Abgrenzung und Individualität entsprachen und viel zu wenig echten Aktivismus zeigten. Alle sahen beinahe gleich aus mit ihren Hornbrillen, den schicken Hemden und wie sie schwafelnd und Zigarette rauchend ständig ihren Intellekt zur Schau stellten. In seinen Augen war das nur noch heiße Luft. In den Leuten, die sich im Golden Gate Park tummelten, sah nicht nur Sam etwas gänzlich Neues, was noch formbar war, und was noch niemand wirklich einordnen konnte, geschweige denn, so schon einmal zuvor gesehen hatte. Aber eines war klar: Man wollte unbedingt dabei sein und es hautnah erleben, um es begreifen zu können.
»Ich hab’s doch gesagt, Stan, es verändert sich ständig. Und es werden von Tag zu Tag mehr«, stellte Sam beeindruckt von dieser einmaligen Kulisse fest und steckte sich eine Zigarette an.
Da waren diese Frauen, die nur mit transparenten Tüchern bekleidet über die Wiese tanzten, durch die man ihre nackten Brüste sehen konnte. Vereinzelt waren dort Zelte oder Planen aufgespannt, wo manche zu kampieren schienen. Davor saß eine Gruppe Männer mit Haaren bis über den Rücken, die Gitarre oder Bongos spielten. Zwei weitere Männer am Wegesrand küssten sich innig. In der Luft hing eine Mischung aus Räucherstäbchen und dem beißenden, süßlichen Geruch von Marihuana. Als wir eine Gruppe passierten, ließ ein Typ Stan im Vorbeigehen an seinem Joint ziehen, lachte seltsam und zog dann einfach weiter, ohne etwas zu sagen.
Seine Begleiter wiederholten johlend ihr Mantra: »Freies LSD, befreit LSD! Freies LSD, befreit LSD!«
Als wir uns weiter einen Weg durch die Menschenmassen bahnten, erkannte ich drei Mädchen aus der Uni, die ein Schild hochhielten mit der provokanten Aufschrift: ›Bombing For Peace Is Like Fucking For Virginity‹. Die eine war ebenfalls oben ohne und hatte sich ein riesiges Peace-Zeichen über ihren Bauch und ihre Brust gemalt.
Meine Freunde und ich ließen uns ganz in ihrer Nähe auf dem Rasen nieder und Val und ich entschieden uns kurzerhand, uns von den Kommilitoninnen mit Fingerfarben dasselbe Friedenssymbol sowie eine Blume auf die Wangen malen zu lassen.
»Im Namen des Friedens. Und im Namen der Natur«, murmelte die eine, während sie so tat, als würde sie mich und Val segnen, indem sie ihre Hand fest auf unseren Scheitel legte, dabei die Augen schloss und für eine Weile innehielt.
Neben uns tanzte ein Typ mit Turban, einem Blumenkleid und ohne Schuhe zu seiner offenbar ganz eigenen Musik in seinem Kopf, denn es waren keine Klänge in der unmittelbaren Umgebung zu hören. Er wankte hin und her, als könne er keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Sein Blick war ganz woanders.
»Der hat seine Seele durch LSD offenbar bereits befreit«, stellte Stanley grinsend fest und schnorrte sich eine Zigarette von Sam.
»Du hattest Recht, Sam, es ist das verdammte Paradies.«
»Ja, echt abgefahren«, murmelte Valerie ehrfürchtig und stieß mich an. »Hast du das auch gesehen?« Ich nickte nur, dabei wusste ich gar nicht, was sie eigentlich genau meinte. Vermutlich einfach alle Eindrücke auf einmal. Aber ich versuchte, lässig zu bleiben, um mir nicht anmerken zu lassen, wie perplex ich in Wahrheit war. Samuel wirkte in dieser ganzen Umgebung so abgeklärt, als wäre all das hier für ihn völlig normal. Als gehöre er bereits hierher. Aber er war ja schließlich nicht zum ersten Mal hier.
»Echt subversiv«, korrigierte er trocken. Stan begann wieder mal mit Val herumzualbern, indem er so tat, als hätte er ebenfalls den besten Trip seines Lebens und Val gluckste auf. Meine Gedanken schweiften ab, ich ließ mir die letzten Sonnenstrahlen des Tages auf meine bemalten Wangen scheinen und fragte mich, wie ich das Zeug wieder abbekommen sollte, damit Vater es nicht sah.
Eine Gruppe unscheinbar aussehender Männer gesellte sich zu dem Turban-Typen und sie sprachen ihn an, ob er einen Trip für sie hätte. Gerade als dieser, noch immer in seinen Rausch gehüllt, in einen Leinensack griff, den er um den Hals trug, packte einer der Männer den Kerl und zerrte ihm die Arme auf den Rücken.
Val und ich sahen uns erschrocken an, weil diese Szene so gar nicht zu dem friedlichen Bild passte, das sich ansonsten um uns herum bot.
Ein paar andere Jungen und Mädchen, die bis eben noch in eine hitzige Debatte vertieft waren, sprangen abrupt auf und schrien: »RAZZIA! Alle Mann verschwinden!« Augenblicklich setzten sie und noch viele weitere sich in Bewegung. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, da hatte Sam mich auch schon auf die Beine gezogen und schleifte mich am Arm hinter sich her.
»SAM?«, rief ich aufgelöst, aber er antwortete mir nicht. Wir liefen und liefen, quer über die grünen Wiesen und Wege, Richtung Nordausgang. Manche kletterten bereits über Zäune und versteckten sich im Gebüsch. Oder sie blieben zurück, um sich der gegnerischen Front in den Weg zu stellen. Wir hatten doch nichts getan, dachte ich. Nicht mal Drogen besaßen wir. All die Menschen hier verhielten sich friedlich. Sie tanzten und unterhielten sich. Okay, hin und wieder protestierten sie auch gegen das System. Aber gänzlich ohne Gewalt und Verletzte. Genau solche Aktionen der Polizei oder des Militärs führten doch erst dazu, dass Leuten in dieser Massenpanik etwas zustieß und es außer Kontrolle geriet. Und wenn das geschah, würde die Presse das wieder gegen die Aktivisten verwenden und es falsch auslegen, sodass Leute wie mein Vater dachten, die farbenfrohen jungen Menschen seien ein gefährlicher Mob, den es im Keim zu ersticken galt.
Zwischen hunderten Fremden liefen wir noch immer, und meine Lunge schmerzte. Laute Schreie und Protestrufe, an die Polizei gewandt, drangen zu uns herüber. Stanley und Valerie hatten wir in dem Chaos längst verloren. Aber wir würden die zwei sicherlich am Auto wiedertreffen. Jetzt geriet ich schon zweimal an einem Tag in eine illegale Protestaktion. Wie verrückt. Wenn Vater das wüsste. Er würde mir sofort den Umgang mit Samuel verbieten, wenn er rausbekäme, dass er dahintersteckt. Ich lächelte verschmitzt und mein Herz schlug mir bis zum Hals. Aber mit Sam an meiner Seite verspürte ich keine Angst.
Ich konnte das Tor zum Ausgang des Parks bereits von Weitem sehen, da zog Samuel mich plötzlich nach links hinter eine Vielzahl von Bäumen und Rhododendron-Büschen.
»Komm mit«, befahl er flüsternd, was in dem vorherrschenden Lärm im Park beinahe unterging. Auf seiner Stirn funkelten ein paar Schweißperlen und sein Brustkorb hob und senkte sich.
Nachdem er mich ein paar Sekunden lang aus seinen bernsteinfarbenen Augen ansah, kam er auf mich zu, presste mich an einen der Baumstämme und küsste mich so leidenschaftlich wie noch nie zuvor. Ich stellte mich auf Zehenspitzen, um ihm noch näherzukommen, und ließ ihn seine Hände tief in meinem Haar vergraben. Dabei wanderte seine Hand unter meine Bluse und entfachte eine Gänsehaut in mir. Solch einen impulsiven Kuss hatte ich noch nie gespürt. Das konnte nur von dem Adrenalin kommen, das durch unsere Körper rauschte. Jederzeit könnte man uns hier entdecken. Aber für einen Wimpernschlag existierten nur wir zwei. Keine aufgeschreckte Meute, keine gewaltbereite Polizei. Keine Klassengesellschaften. Keine Ungerechtigkeit auf der Welt. Nur Sam und ich. Seit er in meinem Leben war und mir diese neue Welt gezeigt hatte, war alles viel aufregender geworden. Ich fühlte mich so viel lebendiger. Er hatte mich gelehrt, dass man nicht immer alles so hinnehmen müsse, wie es war. Dass man es selbst in der Hand hatte.





























