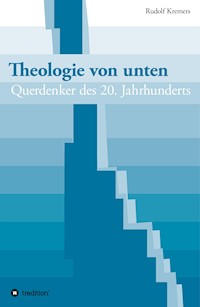
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Viktor v. Weizsäcker, Paul Schütz, Joseph Wittig, Eugen Rosenstock-Huessy, Walter J. Hollenweger: Diese fünf in diesem Buch vorgestellten Denker verbindet die Wahrnehmung einer grundlegenden Zäsur der abendländischen Geistesgeschichte, äußerlich angezeigt durch die beiden Weltkriege, und die Überzeugung, dass ein Neuanfang »von unten« ausgehen müsse, vom Profanen, vom Menschen in seiner Leiblichkeit her. Alle diese fünf Denker waren »Outsider«. Sie wurden und werden darum in ihren Fachgebieten weithin überhört. Sie lagen nicht im »Trend«. Was ist bzw. war das für ein Trend? Er wird am deutlichsten durch den Namen »Sören Kierkegaard« charakterisiert. Dieser war der geistige Vater der theologischen und philosophischen Aufbrüche nach den Weltkriegen. Mit den Waffen, die der große Däne fast ein Jahrhundert vorher geschmiedet hatte, wurde da gekämpft und der Kulturprotestantismus des 19. Jahrhunderts zerschlagen. Und auf seiner dialektischen Interpretation der menschlichen Existenz glaubte man auch Philosophie und Theologie neu begründen zu können. Das gilt auf theologischem Gebiet sowohl für die »dialektische Theologie« als auch für die »existentiale Interpretation« der biblischen Zeugnisse, die beiden sich befehdenden Hauptströmungen der Nachkriegszeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Rudolf Kremers: Theologie von unten, Querdenker des 20. Jahrhunderts
Rudolf Kremers
Theologie von unten
Querdenker des 20. Jahrhunderts
Impressum
© 2017 Rudolf Kremers
Lektorat, Korrektorat: Dipl.-Theol. Christiane Lober, Halle Gestaltung: Peter Stalder, Lörrach
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
978-3-7439-6374-0 (Paperback)978-3-7439-6375-7 (Hardcover)978-3-7439-6376-4 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einführung
I. Viktor von Weizsäcker
Lebensdaten
Hauptwerke
1. Die Krise des abendländischen Geistes
2. Die medizinische Anthropologie
3. Die »pathische« Existenz
4. Medizin und Seelsorge
Literaturverzeichnis
II. Paul Schütz
Lebensdaten
Hauptwerke
1. Die Suche nach der Wirklichkeit
2. Der Trost der Kreatur
3. Die Neuentdeckung der Bibel
4. Die Wiedererkennung der Prophetie
Literaturverzeichnis
III. Joseph Wittig
Lebensdaten
Hauptwerke
1. Der Fall Joseph Wittig(s)
2. Die drei Zeugen
3. Das Leben Jesu in Palästina und Schlesien
4. Die neue Kirche
Literaturverzeichnis
IV. Eugen Rosenstock-Huessy
Lebensdaten
Hauptwerke
1. Die »Wortverkörperung«
2. Volksbildung und Universität
3. Das Geheimnis der Sprache
4. Der Herr der Äonen
Literaturverzeichnis
V. Walter J. Hollenweger
Lebensdaten
Hauptwerke
1. Historisch-kritische Exegese als Befreiung
2. Erfahrungen der Leibhaftigkeit
3. Die mündliche Kirche
4. Die narrative Theologie
Literaturverzeichnis
Weiterführung
Literaturverzeichnis
Einführung
»Es ist nicht so, dass die Menschen den Raum der Kirche verlassen haben, sondern das Mysterium hat ihn verlassen, um sich an anderen Orten niederzulassen – Inkarnation und Transsubstantiation muss man jetzt dort suchen gehen, wo man vorher nur profane Dinge sah.«Viktor v. Weizsäcker
»Aus der Tiefe, ›von unten herauf‹ ganz auf das Mittel der Menschensprache gestellt, das Mysterium der Trinität andenken im endlichen Geist! Genauer Gegensatz zur Deduktion der Offenbarung aus dem ›Wort Gottes‹ in einer rationalen Theologie.«Paul Schütz
»Es ist eine Uhr abgelaufen, es ist die Walze einer Leier abgespielt. Die großartigsten Werke des Geistes stehen vor dem Verfall. Die Staaten wanken; durch die Risse ihrer Mauern wachsen andere Gestalten … Die Kirche des römischen Geistes ist selbst ein Staat geworden und teilt das Schicksal des Staates; aus allen von ihr getrennten und doch gleich ihr dem Geist verfallenen Kirchen recken sich Hände, die den Siegelring des Glaubens tragen, und greifen nacheinander.«Joseph Wittig
»Alles muss noch einmal gesagt werden, jetzt vom Menschen her.«Eugen Rosenstock-Huessy
»Die Theologie muss körperlich und dialogisch werden. – Nur was wir gespielt, getanzt und gesungen haben, haben wir verstanden.«Walter J. Hollenweger
An diesen Zitaten wird deutlich, was die fünf im Folgenden vorgestellten Denker miteinander verbindet. Es ist die Wahrnehmung einer grundlegenden Zäsur der abendländischen Geistesgeschichte, äußerlich angezeigt durch die beiden Weltkriege, und die Überzeugung, dass ein Neuanfang »von unten« ausgehen müsse, vom Profanen, vom Menschen in seiner Leiblichkeit her. Im Übrigen sind es sehr verschiedene Denker:
– Ein Arzt, der zugleich Naturphilosoph war und dessen neue Sicht in den klinischen Alltag der Medizin bis heute kaum aufgenommen wurde;
– Ein evangelischer Theologe, der seinen Dissensus zur lutherischen Lehre erklärt hat und daraufhin von seiner Kirche in den vorzeitigen Ruhestand abgeschoben wurde;
– Ein katholischer Theologe, der zugleich Volksschriftsteller war und der von seiner Kirche exkommuniziert wurde;
– Ein Jurist und Sprachforscher jüdischer Herkunft, der sich zwar aus Überzeugung evangelisch taufen ließ, der aber in keiner der herrschenden Konfessionen ganz unterzubringen ist;
– Ein aus der Pfingstkirche erwachsener und von ihrer Erfahrung bestimmter evangelischer Theologe.
Sie alle gehören aber (außer dem zuletzt Genannten) derselben Generation an, der Generation nämlich, die beide Weltkriege im erwachsenen Alter miterlebt und durchlitten hat. Und ihnen allen ist aufgegangen, dass diese Weltkriege, von denen der zweite nur die Fortsetzung des ersten war, eine grundlegende Krise des abendländischen Geistes offenbart haben. Alle haben darum auch nach einem grundlegenden Neuanfang gesucht, und ihrer aller Grundfrage war dabei: Wie kann die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, nach dem Zusammenbruch Europas in den beiden Weltkriegen wieder glaubwürdig werden? Wie kann sie in den Trümmern der Nachkriegslandschaft neu Gestalt gewinnen?
Alle diese fünf Denker waren »Outsider«. Sie wurden und werden darum in ihren Fachgebieten weithin überhört. Sie lagen nicht im »Trend«. Was ist bzw. war das für ein Trend? Er wird am deutlichsten durch den Namen »Sören Kierkegaard« charakterisiert. Dieser war der geistige Vater der theologischen und philosophischen Aufbrüche nach den Weltkriegen. Mit den Waffen, die der große Däne fast ein Jahrhundert vorher geschmiedet hatte, wurde da gekämpft und der Kulturprotestantismus des 19. Jahrhunderts zerschlagen. Und auf seiner dialektischen Interpretation der menschlichen Existenz glaubte man auch Philosophie und Theologie neu begründen zu können. Das gilt auf theologischem Gebiet sowohl für die »dialektische Theologie« als auch für die »existentiale Interpretation« der biblischen Zeugnisse, die beiden sich befehdenden Hauptströmungen der Nachkriegszeit.
Zu diesem Trend also lagen die im Folgenden dargestellten Denker quer. Das hat am deutlichsten Paul Schütz erkannt und ausgesprochen. »Unsere Theologie hat es nicht vermocht, das ›Quäntchen Zimt‹, das ihr Kierkegaard gereicht hat, als ›Gewürz‹ in den Teig zu verrühren. Sie hat sich daran vergiftet«1, schreibt er in seiner drastischen Sprache. Diese Querlage zu Kierkegaard steht aber auch hinter den anderen hier beschriebenen Entwürfen, besonders hinter der Auseinandersetzung zwischen Eugen Rosenstock-Huessy und Karl Barth – obwohl der Name Kierkegaard da gar nicht auftaucht. Alle diese Denker haben die kritische Funktion Kierkegaards voll bejaht, ja, sie waren selbst davon stark bestimmt, aber dass seine Existenzdialektik eine hilfreiche Grundlage für die notwendige Neuformulierung und vor allem Neugestaltung von Glaube, Kirche und Theologie nach dem Krieg sein könnte, erschien ihnen als Ausflucht ins Gedankliche, als Rechtfertigung der Abwesenheit Gottes statt ihrer Überwindung. Sie selbst gingen dagegen von der Erfahrung der Gegenwart Gottes aus, seiner Gegenwart im Diesseits, in menschlicher Wissenschaft, Kunst und Kultur. Von daher versuchten sie die leibhafte Gestalt von Kirche und Glaube neu in den Blick zu bekommen.
Das Folgende ist der Versuch, ihre verschiedenen Denkwege nebeneinanderzustellen. Dabei kann es natürlich nicht um eine Würdigung ihres Gesamtwerkes gehen. Das ist in einer einzigen Schrift unmöglich darzustellen. Es geht vielmehr streng um die verschiedenen Antworten auf die Frage: Wie können christlicher Glaube, Kirche und Theologie nach dem großen Zusammenbruch der abendländischen Kultur in den beiden Weltkriegen neu Gestalt gewinnen? – Für den Verfasser waren diese Denker wichtige Wegbegleiter auf seinem theologischen Werdegang als Seelsorger in der Gemeinde, im Krankenhaus und im Gefängnis. Darum möchte er mit dieser Schrift auch eine Dankesschuld abtragen; und es geht, wie jeder Leser leicht feststellen kann, weniger um eine objektiv-wissenschaftliche als um eine sehr persönliche Stellungnahme zu diesen fünf Denkern.
I. Viktor von Weizsäcker
Lebensdaten
1886
Geboren am 21. April in Stuttgart als Sohn des späteren württembergischen Ministerpräsidenten Karl Weizsäcker (1916 in den erblichen Freiherrenstand erhoben) und seiner Frau Paula, geb. von Meibom
1904–09
Medizinstudium, danach Assistent an der Medizinischen Klinik in Heidelberg bei Ludolf von Krehl
Medizinstudium, danach Assistent an der Medizinischen Klinik in Heidelberg bei Ludolf von Krehl
1914–18
Truppenarzt in Frankreich und Polen
1919
Naturphilosophische Vorlesung in Heidelberg, Thema: »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde«
1922
Außerordentlicher – ab 1930 ordentlicher – Professor für Neurologie in Heidelberg
1941
Berufung auf das Ordinariat für Neurologie in Breslau
1945
Rückkehr nach Heidelberg
1946–52
Ordinarius für Allgemeine Klinische Medizin in Heidelberg
1957
Verstorben am 8. Januar in Heidelberg
Hauptwerke
Neben einer Vielzahl von medizinischen und philosophischen Aufsätzen sind zu nennen:
–Körpergeschehen und Neurose. 1933/1986
–Der Gestaltkreis. 1940/1996
–Arzt und Kranker. 1941/1949
–Begegnungen und Entscheidungen. 1949
–Diesseits und jenseits der Medizin. 1950
–Natur und Geist. 1954
–Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1956
–Pathosophie. 1950/1956
1. Die Krise des abendländischen Geistes
Es mag erstaunen, dass als erster theologischer Querdenker hier nicht ein Theologe, sondern ein Mediziner bzw. Arzt genannt wird. Aber das Denken dieses Arztes ist von enormer theologischer Bedeutung. Das wurde nur von der Fachtheologie bisher zu wenig wahrgenommen. Dagegen waren alle drei folgenden Denker stark durch Weizsäcker beeinflusst. Paul Schütz hat sich mit ihm und seinem Schüler Wilhelm Kütemeyer in seinem Hauptwerk »Parusia« intensiv auseinandergesetzt. »Wie dieser Arzt den Kern des Evangeliums wieder heraufholt und zum Maßstab macht«, schreibt er dort, »das eben lässt uns die Gesundheit unserer Orthodoxie fragwürdig werden ... Die scharfäugige Diagnose dieses Arztes trifft uns dort, wo wir als Theologen krank sind.«2 – Und Joseph Wittig schrieb – nach der Begegnung mit Weizsäcker – einmal: »Vielleicht wird die Medizin auch die erste unter den Fakultäten der Menschheit sein, die in die wunderbare Ursprungsschicht allen Geschehens eindringt. Wie sie als erste den Mut hatte, dem Geist zu entsagen, um sich ganz und gar der körperlichen Erfahrung anzuvertrauen, wird sie vielleicht auch als erste den Mut haben, zu Gott und seinem Leben, dem Glauben. Die Theologie, vermute ich, wird die letzte sein.«3 Mit »Geist« meint Wittig in diesem Zusammenhang den Geist der Wissenschaft, die Methoden und Systeme, d. h. das Gedachte, auf das sich diese Wissenschaft gründet. Dem wird die unmittelbare körperliche Wahrnehmung gegenübergestellt. Beide Zitate machen deutlich, dass diese Theologen nicht bei der biblischen Überlieferung allein ansetzen, sondern Bibel und kreatürliche Erfahrung zusammenzubringen suchen. Franz Rosenzweig, der auf jüdischer Seite zu diesen Querdenkern gehört, hat das einmal so formuliert: »Die theologischen Probleme wollen ins Menschliche übersetzt werden und die menschlichen bis ins Theologische vorangetrieben ... Die Offenbarung zerstört ja das echte Heidentum, das Heidentum der Schöpfung, mitnichten, sie lässt ihm nur das Wunder der Umkehr und Erneuerung geschehen.«4 Das ist ganz im Sinne des obigen Zitates von Eugen Rosenstock-Huessy, der sich in seinen Schriften des Öfteren auf Viktor Weizsäcker bezieht. Dieser Arzt war also für jene theologischen Querdenker ein wichtiger Gewährsmann und Gesprächspartner im Blick auf die kreatürliche (Selbst-)Erfahrung des Menschen, bei der sie neu anzusetzen versuchten.
Schon in seiner Studienzeit und den ersten praktischen medizinischen Betätigungen vor dem Ersten Weltkrieg ging Weizsäcker auf, wie sehr die herrschende Medizin die Wirklichkeit des Menschen verfehlt. Weil diese Medizin ganz vom naturwissenschaftlichen, d. h. kausal-mechanistischen Denken und der darauf basierenden Technik geprägt war, wurden entscheidende Bereiche des Menschen, die biografischen, geistigen, religiösen usw., einfach ausgeblendet. Das brachte ihn, wie viele andere, in ein inneres Dilemma. Die medizinischen Forscher, so spricht er es einmal aus, sähen sich genötigt, vor dem Gang ins Laboratorium »mit Hut und Stock auch ihren Gott an den Nagel zu hängen«5. Das aber führt zu »einer Art von Bewusstseinsspaltung, und je gründlicher sie erfolgt, desto deutlicher entsteht das Bild der beginnenden oder vollendeten Schizophrenie«6. Dieser Eindruck einer kranken und krank machenden Wissenschaft findet für ihn dann seine schreckliche Bestätigung in der Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Was auch die äußeren politischen Gründe für den Ausbruch des Krieges waren – es zeigte sich für ihn darin eine tiefe Krise des abendländischen Geistes, die letztlich in der von der herrschenden Wissenschaft erzeugten Bewusstseinsspaltung ihre Ursache hatte. So schrieb er später in seinen Lebenserinnerungen, dass er im Ersten Weltkrieg »zu der Überzeugung gekommen« sei, »dass das geschichtliche Geschehen die volle Qualität des Wahnsinns« habe.7
Das Ungenügen an der herrschenden Medizin und die Suche nach neuen Wegen wurden durch diese Kriegserfahrungen natürlich aufs Stärkste intensiviert. 1919 hielt Weizsäcker in Heidelberg eine naturphilosophische Vorlesung, von der später Bruchstücke unter dem Titel »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde« veröffentlicht wurden. Darin versuchte er die naturwissenschaftliche Medizin mit Religion und Philosophie ins Gespräch zu bringen. Durch die mathematische Naturwissenschaft wird, so zeigte er, die Natur nacheinander »entgottet, entgeistigt, entdinglicht, entseelt«. Das geschieht, indem sie in Zahlenverhältnisse aufgelöst wird. Die Qualitäten werden auf Quantitäten reduziert. Damit aber wird nicht die Wirklichkeit erkannt, sondern nur ein Aspekt der Wirklichkeit, der dann erscheint, wenn man alles ausblendet, was zahlenmäßig nicht fassbar ist. Das zeigt sich sofort, wenn der Forscher sich dem Leben zuwendet, d. h. der Biologie oder Medizin. »So vollendet die Logik der Mathematik und Physik heute ist, so kläglich sind ihre Erfolge bei der Biologie. Hier enthüllt sich irgendein Schaden, ein Mangel, der ganz tiefe Gründe hat«8, schreibt Weizsäcker. Es zeigt sich nämlich, dass auf diesem Erkenntnisweg die Wirklichkeit des Lebendigen nicht erfasst werden kann. Damit wird diese Denkform aber ein indirekter Hinweis auf das Geheimnis der Schöpfung. Weizsäcker bezeichnet die Naturwissenschaft deshalb als »negative Theologie«. Sie zeigt nur das, was Gott bzw. geschöpfliches Leben nicht ist.
2. Die medizinische Anthropologie
Wie kann die Lebenswissenschaft sich aber dem Geheimnis der Schöpfung, die Medizin insbesondere dem Geheimnis des Menschen annähern? Dieser Frage geht Weizsäcker nun in seiner medizinischen Praxis, in der konkreten Begegnung mit dem kranken Menschen, nach. Und die Ergebnisse seiner Suche hat er erstmals in drei Aufsätzen der Zeitschrift »Die Kreatur« veröffentlicht. Diese Zeitschrift wurde 1927 durch Martin Buber gegründet. Ihr heimlicher Spiritus Rector war aber wohl Franz Rosenzweig. »Diese Zeitschrift will«, so schrieb dieser im Vorwort des ersten Heftes, »von der Welt so reden, dass ihre Geschöpflichkeit erkennbar wird. Sie will nicht Theologie treiben, eher, in geistiger Demut, Kosmologie ... Die Geschöpflichkeit verbindet die Getrennten und verbürgt die ›Kosmologie der Hoffnung‹ auf das Reich hin.« Die Getrennten – damit waren die drei großen biblischen Konfessionen gemeint: Katholiken, Protestanten und Juden. Von jeder dieser drei Glaubensweisen suchte Rosenzweig Mitherausgeber zu gewinnen. Und es ist bezeichnend, dass neben Martin Buber, einem vom orthodoxen Judentum eher misstrauisch betrachteten Religionsphilosophen, als Vertreter des Protestantismus der Arzt Viktor Weizsäcker und als Vertreter des Katholizismus der in der Katholischen Kirche verfemte Theologe und Volksschriftsteller Joseph Wittig angefragt und gewonnen wurden. Alle drei waren Denker, die nicht in den von jenen drei Glaubensweisen entwickelten spezifischen Denk- und Lehrsystemen gefangen, sondern auf der Suche nach realen Gotteserfahrungen auf ihren jeweiligen Wissensgebieten waren. Rosenzweig suchte also solche Grenzgänger, die auf dem Boden des Kreatürlichen ein Gespräch über die bestehenden Grenzzäune hinweg zu führen befähigt waren.
Der Beitrag Weizsäckers zu dieser Zeitschrift bestand nun in drei Aufsätzen mit den Titeln »Der Arzt und der Kranke«, »Die Schmerzen« und »Die Krankengeschichte«. Alle diese Aufsätze sind aus der unmittelbaren Begegnung mit dem kranken Menschen erwachsen. Sie bilden die Grundlage der neuen – medizinischen – Anthropologie, um die Weizsäcker sein Leben lang gerungen hat. Grundsätzlich ging es ihm in seiner Begegnung mit dem Kranken darum, alle mitgebrachten wissenschaftlichen Vorstellungen von der Krankheit und ihren Ursachen zu vergessen und sich ganz dem Geschehen zu öffnen, das sich in dieser Begegnung abspielt. »Die Natur erklärt sich selbst, wenn man es ihr nur erlaubt. Man muss nicht sie belehren, sondern sich von ihr belehren lassen«9, schreibt er später dazu lapidar. Wenn der Arzt den bei ihm Hilfe suchenden Menschen wahrnehmen will, muss er mit ihm ins Gespräch eintreten. »Ich bin krank«, sagt der Patient. Und der schlechte Arzt untersucht darauf sofort Herz, Lunge, Blutdruck, Urin usw. und kommt aufgrund dieser objektiven Tatbestände zur Diagnose der Erkrankung. Aber der Kranke hat ja nicht gesagt: »Mein Herz, meine Lunge, meine Blase usw. ist krank«, sondern »Ich bin krank«. Das ist etwas anderes und stürzt den guten Arzt zunächst in ein Dilemma. Denn mit allem medizinischen Wissen von den objektiven Tatbeständen des Körpers und seiner Krankheiten, die nichts Wirkliches sind, sondern etwas Gedachtes, soll er einen Menschen behandeln, dessen Wirklichkeit er nicht kennt. »Es ist eine erstaunliche aber nicht zu leugnende Tatsache, dass die gegenwärtige Medizin eine eigene Lehre vom kranken Menschen nicht kennt«10, schreibt Weizsäcker. Im Gespräch mit dem kranken Menschen erfährt der Arzt, dass dieses »Ich« eine Geschichte hat, dass es in der Gegenwart Empfindungen und Ängste hat, von vergangenen Erfahrungen belastet und im Blick auf die Zukunft von Hoffnungen und Erwartungen umgetrieben ist. Dies alles spielt in der Aussage »Ich bin krank« mit und muss darum auch bei der Diagnose und Therapie mitbedacht werden. Es ist bezeichnend für Weizsäcker, der sich einmal einen »grübelnden Jünger der ärztlichen Kunst« genannt hat, dass er diese Einsichten, die uns heute fast selbstverständlich erscheinen, bis in die letzte Tiefe verfolgt und umstürzende Konsequenzen für die ärztliche Praxis daraus gezogen hat, die bis heute nur in Ansätzen verwirklicht sind.
Es geht um die Einführung des Subjekts in die Medizin, nicht nur des Subjekts des Kranken, sondern auch des Arztes. Denn um den Kranken in seiner Situation zu verstehen, muss der Arzt sich in das Gespräch selbst einbringen. Leben kann nämlich nur von dem verstanden werden, der sich am Leben beteiligt, also nicht von einem objektiven und darum distanzierten Betrachter. Weizsäcker vergleicht das ärztliche Gespräch mit dem Kranken bzw. dessen Behandlung einmal mit einem Schachspiel. Die Regeln des Spiels sind vorgegeben, nicht aber Zug und Gegenzug, die das Spiel voranbringen. Die neutralen, »wissenschaftlichen« Beobachter sind dann die »Kiebitze«, die danebenstehen und ihre klugen Bemerkungen machen, aber das Spiel nicht voranbringen können. Der Arzt, der sich selbst einbringt dagegen, der mitspielt, treibt das Spiel voran. Er stellt nicht nur einen Befund fest, sondern schafft mit dem Kranken zusammen erst den Befund, und der ist nie etwas schon Vorhandenes, sondern neu geschaffen. Und das ist im Grunde in jeder menschlichen Begegnung so. Im wirklichen Gespräch werden nicht nur Feststellungen getroffen oder bestritten, sondern die beiden Gesprächspartner schaffen miteinander etwas Neues, so wie eben zwei Schachspieler durch ihre unvorhersehbaren Züge das Spiel verändern und vorantreiben.
Was ist das für ein Spiel? Wer setzt die Regeln fest, und was ist sein Ziel? »Hier erscheint«, schreibt Weizsäcker, »das, was in religiöser Sprache ›Schöpfung‹ heißt. Ein emanzipiertes Jahrhundert hat ... in einer Art von Angst vor der Schöpfung diese als eine unbegreifliche oder auch zu spekulative und wissenschaftlich zu unbeweisbare, ja ihrer Pflichterfüllung gefährliche, Idee aus der Naturwissenschaft ausgeschlossen. Dieser Irrtum kann fallen, wenn sich zeigt, dass es umgekehrt steht und dass diese Idee alleine es ist, unter deren Herrschaft irgendetwas als wahr und wirklich hervorzubringen ist.«11 »Schöpfung« im biblischen Sinn ist ja nicht ein Ursprungsgeschehen, das dann weiterliefe nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung bzw. von Zufall und Notwendigkeit, sondern ein fortlaufender Prozess, der einem Ziel entgegenläuft. Im Ursprung werden nur Möglichkeiten geschaffen, die dann verwirklicht werden können oder auch nicht – wie eben bei einem Schachspiel. Der Mensch wird dabei zum Mitspieler des Schöpfers, indem er solche Möglichkeiten aufgreift und gestaltet oder verwirft. Das ist nicht nur eine Glaubensaussage, sondern eine Erkenntnis des forschenden Verstandes. Nur indem der Mensch mitspielt auf dem Schachbrett der Welt, kann etwas »als wahr und wirklich hervorgebracht« werden. Wer da der Schöpfer und was das Ziel seiner Schöpfung ist, bleibt dabei noch verborgen. Aber für den, der sich am »Schachspiel« des Lebens beteiligt, erscheint doch schon das Ziel dieses Lebensspiels. Es geht darin darum, dass der Mensch seine Bestimmung in der Welt wahrnimmt und erfüllt. Was ist diese Bestimmung? Weizsäcker spricht hier vom »Mysterium Incarnationis«, auf das er in der Begegnung mit dem kranken Menschen immer wieder gestoßen wird. Damit ist nicht – wie in der kirchlichen Lehre – das Geheimnis der Person Jesu gemeint, sondern das Geheimnis des Menschen überhaupt. Der Mensch ist das Geschöpf, in dem Geistiges sich verleiblichen will und soll.12 Diese Zielgerichtetheit der menschlichen Existenz wird ganz körperlich erfahrbar; denn jede Fehlentwicklung zeigt sich an als körperlicher Schmerz.
In den Erfahrungen, die der Arzt im Gespräch mit dem Kranken sammelt, wird deutlich, dass der Mensch »Kreatur« ist, d. h., der Mensch »hat nicht nur die kalte Existenz, sondern sein Dasein ist immer ein So-sein-Sollen«13. Über der menschlichen Existenz steht also ein »Creator«, dessen Herrschaft in bestimmten Ordnungen sichtbar wird, die der Mensch nicht ungestraft übertreten kann. Das ist der Hintergrund jeder Schmerzerfahrung. »Am Ariadnefaden des Schmerzes«, schreibt Weizsäcker dazu, »ist ein Gefüge der Lebensordnungen aufzuspüren, derer nämlich, welche eine fleischgewordene Wahrheit, die Fleischwerdung einer Wahrheit anzeigen, nämlich eine Lebenswirklichkeit ... Es ist ein Gefüge da, eine Ordnung, die nicht schmerzlos gestört werden kann.«14 Das menschliche Dasein ist also stets »ein in-Geboten-Stehen«, und »es bedarf keiner besonderen Hingabe, Unterwerfung, Gläubigkeit, um dies einzusehen, sondern nur eines Hörens.«15 Dass der Mensch »Creatur« ist, d. h. ein Geschöpf, das sein Leben vor dem Schöpfer verantworten muss, das erfährt der Arzt, der sich auf das Gespräch mit dem Kranken einlässt. Und so wird deutlich, dass der Mensch »wie alle Geschöpfe einen Vater hat« und dass also »das letzte Ziel der Gehorsam gegen den Vater« ist16 – das letzte Ziel des Menschenlebens und darum auch jedes therapeutischen Gesprächs. Das hat natürlich weitgehende Konsequenzen für das »seelsorgerliche« Gespräch. Der Seelsorger, der seinem »Beichtkind« seine im biblischen Glaubenszeugnis verkündigte Kreatürlichkeit und damit seine Verantwortung vor dem Schöpfer nahebringen will, kann nun anknüpfen bei ganz körperlichen Erfahrungen – und muss da anknüpfen.
3. Die »pathische« Existenz
Diese Sicht der kreatürlichen Existenz des Menschen hat von Weizsäcker in seinem unvollendeten Alterswerk »Pathosophie« zu entfalten versucht. Diese »Pathosophie« stellt er der »Philosophie« gegenüber. Die Grundelemente des menschlichen Daseins sind nicht Gedanken und Ideen, nicht der »Geist« wie in der Philosophie, sondern leibhaftige Widerfahrnisse, »Passionen«, die der Mensch erst hinterher, im Nachhinein, gedanklich zu bewältigen sucht. – Diese Sicht des Lebens wäre aber völlig falsch verstanden, wenn man sie pessimistisch nennen würde. Denn zum »Pathischen« gehört nicht nur das Leid, sondern auch die Freude, nicht nur der Schmerz, sondern auch die Lust. Alles sind Widerfahrnisse, an denen und in denen der Mensch zu seiner Bestimmung heranreifen soll, »erlitten und empfangen werden die einen wie die andern und beides können wir nicht machen. Das ist der springende Punkt.«17
Von Natur, von seinem Anfang her, ist der Mensch »unzulänglich, ergänzungsbedürftig, veränderungssüchtig, undeterminiert, defekt oder ohnmächtig«. Aber das Ziel, das ihm gesetzt ist, dem er durch die guten und bösen Widerfahrnisse seines Lebens entgegengeführt werden soll, ist die Erfahrung seiner Kreatürlichkeit und darin der Aufruf zum Gehorsam gegen den Vater. – Diese »pathische Existenz« des Menschen tritt in verschiedenen Kategorien in Erscheinung, die Weizsäcker als Pentagramm beschreibt: in den Kategorien »Dürfen, Müssen, Wollen, Sollen, Können«. Erhellend und tröstlich ist dabei, dass er mit der Beschreibung des »Dürfens« beginnt. »Das Dürfen ist der Ostermorgen menschlichen Daseins. Dies laut werden zu lassen ist nur der Hymnus fähig und befugt, so heißt es da.«18





























