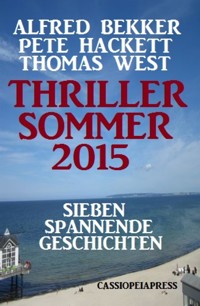
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Siebenmal Hochspannung für Urlaub und Strand von Alfred Bekker & Thomas West & Pete Hackett!
Mal actionreich, mal rätselhaft; mal romanlang und mal kurz und knackig - so sind die Geschichten in diesem Band. Die deutsch-französische Botschaft in einem osteuropäischen Land wird überfallen und der Botschafter entführt.
Ein Team von Spezialisten muss eingreifen. Ein junger Mann schließt sich Terroristen an - und ein Privatdetektiv muss ihn finden.
Um diese und viele andere Themen geht es in dem vorliegenden Buch.
Der Umfang dieses Buchs entspricht 600 Taschenbuchseiten.
Dieses Buch enthält folgende sieben Geschichten:
Alfred Bekker: Mord an Bord
Alfred Bekker: Codename Revolution
Thomas West: Alte Leichen
Pete Hackett: Operation Mubato
Alfred Bekker: Der Kopf-Abhacker
Alfred Bekker: Verschwörung der Killer
Pete Hackett: Abgezockt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Thriller Sommer 2015: Sieben spannende Geschichten
Cassiopeiapress Spannung
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenThriller Sommer 2015
von Alfred Bekker & Thomas West & Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 600 Taschenbuchseiten.
Dieses Buch enthält folgende sieben Geschichten:
Alfred Bekker: Mord an Bord
Alfred Bekker: Codename Revolution
Thomas West: Alte Leichen
Pete Hackett: Operation Mubato
Alfred Bekker: Der Kopf-Abhacker
Alfred Bekker: Verschwörung der Killer
Pete Hackett: Abgezockt
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch
© by Authors
© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
MORD AN BORD
von Alfred Bekker
1
"Sieh mal, dahinten ist Onkel Jules mit seiner Yacht!" Catherine Laffont deutete mit dem ausgestreckten Arm hinaus auf das glitzernde Mittelmeer. Pierre, ihr Mann, nickte und hielt sich die Hand wie einen Schirm über die Augen.
"Ja", murmelte er zwischen den Zähnen hindurch. "Und das Schönste ist, dass das alles bald uns gehören wird, Catherine! Die Yacht, die Firma, das Aktienvermögen... Alles!"
"Noch ist es nicht so weit, Pierre!"
Pierre zuckte die Schultern. "Das kann schneller kommen, als man denkt. Onkel Jules ist nicht mehr der Jüngste. Eine Bypass-Operation hat er schon hinter sich und letztes Jahr, das mit den Nierensteinen war auch nicht ohne." Pierre lachte hässlich und fuhr fort: "Alles in allem hat er wohl immer schon mehr auf sein Geld geachtet, als auf seine Gesundheit!"
"Da hast du wohl recht! Allerdings könnte er auch auf die Idee kommen, alles an Monique fallen zu lassen... Dann sieht es übel für uns aus."
Pierre seufzte.
Monique, Onkel Jules blutjunge Geliebte war drauf und dran, zu einem Problem zu werden. Wenn sie ihn noch lange bearbeitete, würden die beiden vielleicht sogar heiraten.
Die Yacht kam näher, fuhr geradewegs auf den Strand zu.
"Er kommt dem Strand recht nahe", murmelte Catherine verwundert. Bei einer so großen Yacht war das nicht ungefährlich. Man konnte leicht auflaufen.
Inzwischen waren auch andere Strandgäste auf die Yacht aufmerksam geworden und sahen zu, wie das große Boot immer näher an den Strand herankam. Dann gab es einen scharfen Ruck und ein unangenehmes, knarrendes Geräusch. Die Yacht war auf Grund gelaufen und legte sich schräg zur Seite. Der Wind blies noch immer mit unverminderter Kraft ins Segel und drückte auf einer Seite die Reling ins Wasser.
"Da stimmt was nicht!", meinte Pierre. Denselben Gedanken schien offenbar auch der für diesen Strandabschnitt zuständige Bademeister zu haben. Er stand in seinen dunklen Shorts auf dem Beobachtungsstand und rief wild gestikulierend etwas zu seinen Helfern herunter. Wenig später trug er zusammen mit ein paar anderen Männern ein Schlauchboot zum Wasser.
"Ich muss wissen, was da passiert ist", sagte Pierre und lief hinter den Männern mit dem Boot her. Er stand bereits bis zu den Knöcheln im Wasser, als er sie einholte.
"Lassen Sie mich mitfahren! Da auf dem Boot, das ist mein Onkel!"
Der Bademeister blickte Pierre kurz an, dann nickte er. Der Motor wurde angeworfen und anschließend brauste das Schlauchboot auf die gestrandete Segelyacht zu. Der blonde Bademeister war der erste, der an Bord kam. Seine gewaltigen Muskeln spannten sich, als er sich an der Reling hochzog. Die anderen Insassen hatten etwas mehr Mühe, an Bord zu kommen. Als Pierre es schließlich geschafft hatte, fand er Onkel Jules in der großzügigen Kajüte. Er lag auf dem Boden, so als wäre er gestürzt. Der Bademeister hatte sich über ihn gebeugt und machte Wiederbelebungsversuche. Aber schon nach kurzem gab er auf.
"Es hat keinen Sinn", sagte er. "Dieser Mann ist tot!"
"Sollen wir nicht die Polizei rufen?", fragte der Gehilfe des Bademeisters, ein schmächtiger Junge, der höchstens gerade achtzehn war.
"Nach einem Verbrechen sieht das hier ja nun wohl nicht aus", beeilte sich Pierre, die Sache abzubiegen. Der Junge zuckte die Achseln.
Und der Bademeister schien auch nicht gerade wild entschlossen zu sein, die Angelegenheit von einem Kriminalkommissar untersuchen zu lassen.
"Auf jeden Fall müssen wir jemanden kommen lassen, der die Yacht birgt. Die Leiche können wir mit dem Boot an Land bringen."
2
Alles schien so zu laufen, wie Pierre und Catherine es sich gewünscht hatten. Es gab kein Testament und daher war Pierre, als einziger lebender Verwandter von Onkel Jules auch sein Erbe.
"Wir sind reich", sagte er zu ihr und sie mahnte ihn, seine Freude nicht allzu deutlich zu zeigen. Vor allem nicht in der Öffentlichkeit..."
"Sonst nimmt am Ende doch noch jemand Onkel Jules' Tod genauer unter die Lupe."
Als sie Onkel Jules 12-Zimmer-Villa aufsuchten, trafen sie dort Monique an.
Die junge Frau trug schwarz und war wohl der einziger Mensch weit und breit, der wenigstens so tat, als würde er über Onkel Jules trauern. Denn beliebt war er nicht gerade gewesen.
"Für ein paar Tage kannst du natürlich noch hierbleiben, Monique", meinte Pierre mit großzügiger Geste. "Schließlich stehst du ja jetzt gewissermaßen vor dem Nichts..."
"Keine Sorge", sagte Monique. "Ich habe meine Sachen bereits gepackt und ziehe zu meiner Schwester. Ach übrigens... Ich habe eine Obduktion von Jules Leiche beantragt."
Pierres Augen wurden schmal und Catherine runzelte die Stirn.
"Warum hast du das getan?", fragte Pierre.
"Weil ich wissen möchte, ob Jules einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Meint ihr, ich wüsste nicht, wie lange ihr schon auf seinen Tod gewartet habt? Und wie leicht wäre es gewesen, ihm ein Gift zu verabreichen, das erst dann wirkt, wenn er bereits mit seiner Yacht weit draußen auf dem Meer ist."
"Das ist doch absurd!", rief Pierre.
Monique zuckte die Achseln. "Wirklich? Du warst fast jeden Tag mit ihm zusammen Pierre, und hast Jules bei der Leitung der Firma geholfen. Du kanntest seine Lebensgewohnheiten haargenau und wusstest, dass er bei gutem Wetter immer etwa um dieselbe Zeit hinaussegelte. Und zwar allein, um seine Gedanken zu sammeln."
3
Monique zog noch am selben Tag aus und man hörte nichts mehr von ihr. Inzwischen machten es sich Pierre und Catherine in der großen Villa gemütlich.
Nach etwa einer Woche bekamen sie Besuch von einem Kriminalkommissar.
"Mein Name ist Amery", sagte er. "Und ich untersuche den Tod von Jules Laffont."
"Was gibt es da zu untersuchen?", fragte Pierre nicht gerade freundlich.
"Bei der Obduktion wurde eine Überdosis Schlafmittel festgestellt. Seine Lebensgefährtin sagte uns aber, dass Monsieur Laffont solche Mittel nie genommen hat, was auch plausibel ist, denn er war herzkrank und das betreffende Medikament ist für solche Leute das reinste Gift!"
"Sie meinen, Onkel Jules wurde ermordet?", fragte Catherine.
Kommissar Amery nickte. "Ja. Ich muss Sie bitten mir zu sagen, wer Ihr Hausarzt ist..."
4
"Er wird alles herausfinden!", zeterte Catherine. "Dass ich mir die Schlafmittel von Dr. Dupont habe verschreiben lassen und sie dann angespart habe, anstatt sie einzunehmen..."
"Aber es gibt keinen Zeugen dafür, dass ich Onkel Jules kurz bevor er mit der Yacht ablegte noch einen Drink gemacht habe," verteidigte sich Pierre.
"Das hat alles Monique eingefädelt, diese Schlange!", zischte Catherine.
"Sie weiß nichts!"
"Aber sie wird nicht lockerlassen!"
Pierre rief Dr. Dupont an, aber der sagte nur, dass er sich in die Sache nicht hineinziehen lassen wollte. "Wenn dieser Kommissar Amery hier auftaucht, werde ich ihm die Wahrheit sagen müssen."
Pierre fluchte lauthals, als er den Hörer auf die Gabel knallte. Noch am Abend kam Kommissar Amery mit zwei Kollegen, um Pierre und Catherine Laffont festzunehmen. Allerdings nur wegen Mordversuch.
Pierre runzelte erstaunt die Stirn und Amery sagte: "Ja, Sie haben richtig gehört. Zwar haben Sie beide versucht, Ihren Onkel zu vergiften, aber die Dosis war zu gering. Das gerichtsmedizinische Gutachten sagt eindeutig, dass Jules Laffont nicht an dem Schlafmittel gestorben ist, sondern an den sogenannten Wiederbelebungsversuchen von Laroche, dem Bademeister. Er war der Ex-Freund von dieser Monique. Vielleicht hoffte er, dass sie zu ihm zurückkehren würde, wenn Ihr Onkel nicht mehr am Leben wäre..."
ENDE
Codename Revolution
von Alfred Bekker
1
Mehrere Wurfhaken fanden Halt zwischen den gusseisernen Gitterstäben auf der zweieinhalb Meter hohen Mauer. Sie umgab das nächtliche Palais Ragowski wie eine Festungsmauer. Die ersten von zwei Dutzend Bewaffneten zogen sich an den Wurfseilen empor. Die Männer trugen Sturmhauben, Splitterwesten und kurzläufige Maschinenpistolen vom Typ Uzi. In den um das Bein geschnallten Holstern steckten außerdem pro Mann eine Automatik mit aufgeschraubtem Schalldämpfer und eine Injektionspistole, die Nadeln mit einem schnell wirkenden Nervengift verschossen.
Die ersten der maskierten Angreifer seilten sich bereits auf der anderen Seite ab.
Security Guards patrouillierten dort mit mannscharfen Schäferhunden auf und ab. Im Schein der Gartenbeleuchtung waren sie gut zu erkennen.
Die Maskierten schwärmten aus, hielten sich dabei im Schatten der Büsche.
Einer der Hunde knurrte.
Der dazugehörige Security Guard wurde misstrauisch.
Er ging in die Hocke, nahm dem Tier den Maulkorb ab und ließ es von der Leine. Hechelnd schnellte der Schäferhund über die große Rasenfläche, direkt auf die Schatten werfenden Sträucher zu, zwischen denen sich ein Teil der Angreifer verborgen hielt.
Einer der Maskierten griff zur Injektionspistole, zielte.
Lautlos traf die Nadel den Hund, der mitten im Lauf zu Boden ging.
Der Security Guard wollte zu der Heckler & Koch-MPi greifen, die ihm an einem Riemen über der Schulter hing.
Aber er kam nicht mehr dazu.
Ein Nadelprojektil traf ihn am Hals.
Ohne einen Schrei sank er zu Boden.
2
Palais Ragowski, Sitz der gemeinsamen Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik in Barasnij, Hauptstadt der Freien Republik Rahmanien Donnerstag 2345 Osteuropäische Sommerzeit
Damien Duvalier blickte mit versteinertem Gesicht auf den Fernsehbildschirm. Der gemeinsame Botschafter Frankreichs und Deutschlands bei der Regierung des osteuropäischen GUS-Nachfolgestaates Rahmanien atmete schwer.
„Na, was gibt es Neues?“, fragte sein Abteilungsleiter Jürgen Dankwart. Er wirkte übernächtigt. Dunkle Ringe hatten sich unter seinen Augen gebildet. Die Krawatte saß wie ein Strick um seinen Hals.
„Das nationale Fernsehen sendet noch immer nichts außer der Ansprache des neuen Machthabers“, berichtete Duvalier. „Die wird dafür alle Stunde wiederholt.“ Er zuckte die Achseln. „Bleibt nur CNN über Satellit!“
Die beiden Männer sprachen Englisch miteinander.
Eigentlich eine Schande, wie Duvalier fand. Zwar sprach er etwas Deutsch und Dankwart leidlich Französisch, aber in der täglichen Verständigung hatte sich Englisch einfach als die praktischste Lösung herauskristallisiert - dem sprachlichen Selbstbewusstsein des Franzosen zum Trotz.
Im Moment gab es jedoch dringendere Probleme als die Frage, in welcher Sprache eine gemeinsame deutsch- französische Botschaft ihre Dienstgeschäfte regelte.
Dankwart hörte den Worten des CNN-Sprechers zu.
„Das Regime des Generals Zirakov, das sich vor nunmehr zwei Wochen in dem osteuropäischen Land Rahmanien an die Macht putschte, scheint sich zu stabilisieren. Die Schießereien, die in den vergangenen Tagen aus den Straßen der Hauptstadt Barasnij gemeldet wurden, scheinen inzwischen abgeebbt zu sein. Panzerverbände sind im Regierungsviertel aufgefahren und eine Eliteeinheit der Militärpolizei riegelt diesen Teil von Barasnij hermetisch ab. Inzwischen meldete sich der ehemalige Kanzler Viktor Narajan aus dem Untergrund zu Wort. Er ließ in einer Radiobotschaft über Kurzwelle verbreiten, dass er sich nicht in der Gewalt der neuen Machthaber befinde und den Widerstand gegen die Putschisten anführen wolle. Narajan war demokratisch zum Kanzler gewählt worden, später aber auf Grund von Korruptionsvorwürfen stark in die Kritik geraten...“
Duvalier horchte auf.
Mit der Fernbedienung in seiner Linken stellte er die Lautstärke leiser.
In der Ferne war eine Detonation zu hören.
In den vergangenen zwei Wochen war das nichts Ungewöhnliches in den Straßen von Barasnij gewesen. Die Botschaft arbeitete nur mit einer Notbesetzung, die aus dem Botschafter selbst, seinem Stellvertreter und einigen wichtigen Mitarbeitern sowie einer Spezialtruppe von Sicherheitsbeamten bestand.
Sämtliche Familienangehörigen sowie alle eben verzichtbaren Botschaftsmitarbeiters waren in den ersten Tagen nach der Machtübernahme von General Zirakov nach Hause geschickt worden.
Der Flucht war in den ersten Tagen über den Landweg noch möglich gewesen, während die Flughäfen sofort geschlossen worden waren.
Inzwischen waren beinahe sämtliche Kommunikationskanäle der Botschaft abgeschnitten.
Die Lage wurde prekär, aber Duvalier war ein Kenner des Landes.
Er hatte Slawistik studiert und war vermutlich einer der wenigen EU-Diplomaten, die überhaupt der rahmanischen Sprache mächtig waren.
„Wir hätten es wie die Amerikaner machen sollen“, meinte Jürgen Dankwart mit Blick auf die CNN-Bilder. Es waren immer wieder dieselben, wackeligen Amateurvideo-Sequenzen, die der amerikanische Nachrichtensender brachte. Bilder aus Barasnij, wahrscheinlich nur wenige Kilometer vom Palais Ragowski entfernt aufgenommen. Sie zeigten aufmarschierende Militärpolizisten und Fallschirmjäger der rahmanischen Armee, die Straßen und Plätze besetzten. Im Hintergrund hörte man Explosionen.
Duvalier hob die Augenbrauen.
Er sah Dankwart etwas irritiert an.
Die Amerikaner hatten Barasnij schon bei Ausbruch der Krise verlassen. Seitdem gab es keinerlei diplomatischen Kontakt zur neuen Führung des osteuropäischen Landes.
„General Zirakov mag alles andere als der Wunschkandidat des Westens für das Amt des rahmanischen Regierungschefs sein, aber ich denke, es ist immer gut, den Gesprächsfaden niemals abreißen zu lassen“, gab Duvalier zu bedenken. „Gerade wenn sich ein Land einer so tief greifenden Krise befindet.“
Dankwart hob die Augenbrauen. „Gesprächsfaden?“, echote er.
„Bislang gibt es keinerlei offizielle Gespräche mit Zirakov oder seinen Leuten. Wir wissen noch nicht einmal, ob er wirklich selbst die Macht in den Händen hält oder ganz andere Gruppierungen ihn nur vorschicken.“
Ein platschendes Geräusch ließ Duvalier aufhorchen.
Etwas oder jemand musste in den Pool gefallen sein.
Duvalier drehte am Fernseher den Ton ab und trat ans Fenster.
Einer der Sicherheitsbeamten schwamm in dem auf der Rückseite des Botschaftsgebäudes befindlichen Swimming Pool. Die Heckler & Koch-MPi war bis auf den Grund gesunken.
„Merde!“, murmelte der Botschafter ganz undiplomatisch.
Dankwart trat neben ihn und begriff sofort.
Aber keiner der beiden Männer konnte noch reagieren.
Die Tür flog zur Seite.
Zwei Maskierte stürmten herein.
„Hände hoch! Keine Bewegung!“, erscholl es in akzentschwerem Englisch.
Duvalier und Dankwart gehorchten.
Innerhalb von Augenblicken befand sich ein halbes Dutzend weiterer Angreifer im Raum. Sie traten die Tür zu einem Nachbarzimmer auf. Aber dort war niemand.
Nach Ausrüstung und Vorgehensweise handelt sich um eine reguläre Einheit der Armee oder des Geheimdienstes!, ging es Duvalier durch den Kopf.
Der Franzose konnte das beurteilen.
Vor seiner diplomatischen Karriere hatte er als Oberstleutnant einer Fallschirmjägereinheit gedient.
„Ich möchte darauf hinweisen, dass wir diplomatische Immunität genießen“, sagte Duvalier auf Rahmanisch. „Was Sie hier tun ist vollkommen gesetzwidrig.“
Der Anführer der Maskierten sah Duvalier direkt ins Gesicht.
Der Botschafter konnte von seinem Gegenüber nichts weiter als ein paar eisgrauer Augen sehen.
Die Augenbrauen waren hell.
Das legte den Schluss nahe, dass er blond war.
„Sie befinden sich hier in Rahmanien“, erklärte er. „Hier können wir alles. Vergessen Sie das nicht!“
„Irrtum! Sie befinden sich auf exterritorialem Gelände!“, protestierte Duvalier. Gedanken rasten durch sein Hirn. Was ging hier vor sich?
Warum ließ General Zirakov das zu? Möglicherweise hatte er diese Aktion sogar persönlich veranlasst.
Wollte Zirakov die Europäer mit einer Geiselnahme von Botschaftsangehörigen erpressen?
Der General mochte alles andere als ein Freund des Westens oder ein feinsinniger Diplomat sein, aber ein derart plumpes Vorgehen traute Duvalier selbst ihm kaum zu.
Dieser verrückte Hund schadet sich doch selbst am meisten damit!, durchzuckte es den Botschafter.
„Führt sie ab und sperrt sie zu den anderen!“, befahl der Anführer der Maskierten.
3
Hauptquartier der Vereinten Nationen, New York Büro des militärischen Attachés
Freitag 1446 OZ
Der militärische Attaché war ein asketisch wirkender Mann namens Heinrich von Schröder. Sein Gesicht war zur Maske erstarrt. Der hagere Mann war für die Verbindung zwischen dem Generalsekretariat der UNO und Security Force Omega zuständig.
Die Knöchel seiner linken Hand, mit der er den Telefonhörer hielt, traten weiß hervor.
Am anderen Ende der Leitung war der Generalsekretär.
„Ja, Sir, natürlich habe ich davon gehört. Ich habe vor einer halben Stunde mit dem deutschen und dem französischen UNO-Botschafter gesprochen. Inzwischen sind erste Meldungen über das Entführungsdrama in Barasnij schon über die Medien gegangen.“ Von Schröder machte eine Pause. Was der Generalsekretär ihm zu sagen hatte, schien ihm nicht zu gefallen. Mitten auf seiner Stirn bildete sich eine tiefe Furche. „Ich kenne natürlich die Medienberichte, Sir. Demnach erklären die Täter nur, dass sie das Botschaftspersonal in ihrer Gewalt haben. Angeblich gibt es bislang keine Forderungen.“ Eine weitere Pause folgte. „Nein, Sir, ich habe keine Ahnung, woher die zusätzlichen Informationen in den Medien stammen. Die UNO-Botschafter Deutschlands und Frankreichs sind ebenso überrascht.“ Der Attaché schluckte, während er den weiteren Ausführungen seines Gesprächspartners lauschte. „Ich verstehe, Sir“, sagte er schließlich. „So, wie Sie mir die Lage schildern, bleibt uns nur noch eine Option: Der Einsatz des Delta-Teams der Security Force Omega unter Colonel Breckinridge!“
4
Stabsgebäude der Security Force Omega Fort Ellroy, North Carolina
2 Stunden später
General Uwatani, seines Zeichens Oberbefehlshaber der Security Force Omega, ließ den Blick zufrieden durch den spartanisch eingerichteten Briefing-Raum kreisen. Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Sämtliche Mitglieder des SFO-Teams saßen in voller Kampfmontur da. Auf dem Boden lagen Erdklumpen, die sich aus den Profilsohlen der Stiefel herausgelöst hatten.
Colonel John Breckinridge legte seine MPi auf seine Knie.
Nahkampfspezialist Mark Furrer klopfte sich etwas von dem inzwischen getrockneten Lehm von der dreckstarrenden Hose seines Kampfanzugs. Er hielt inne, als er sah, wie Breckinridges strenger Blick ihn zu durchbohren schien.
„Das ist 'ne Schweinerei, Sergeant!“
„Entschuldigung, Sir“, murmelte Mark Furrer.
General Uwatani war bekannt dafür, weitaus weniger auf Förmlichkeiten zu achten. Für ihn zählten andere Qualitäten. „Ist schon in Ordnung“, griff er in das Gespräch ein. „Schließlich sind Sie alle direkt aus einer laufenden Gefechtsübung hier her geholt worden. Da kann ich nicht erwarten, dass Sie in geschniegelter Galauniform erscheinen. Glauben Sie mir, dass bisschen Dreck, das Sie hier machen ist das Geringste der Probleme, mit denen wir derzeit konfrontiert sind!“
„Na jedenfalls sind wir auf jeden Fall sofort einsatzbereit“, warf Sergeant Carlo Tarvisio ein. Der Italiener und zweite Nahkampfspezialist des Teams war für sein vorlautes Mundwerk berüchtigt, mit dem er sich schon so manches Mal in Teufelsküche gebracht hatte. Furrer und Tarvisio hatten zunächst um denselben Posten bei der SFO konkurriert, ehe man schließlich zu der Lösung gekommen war, zwei Nahkampfspezialisten zu integrieren.
Neben ihm hatte die Argentinierin Marisa „Mara“ Henriquez Platz genommen. Sie war zur SFO versetzt worden, weil zu Hause in Buenos Aires einige Leute ihre Karriere als erste Frau bei der Spezialeinheit UOE vorerst beenden wollten. Sie setzte ihren Kampfhelm ab. Das dunkle Haar trug sie kurz.
„Angeber!“, zischte sie Tarvisio zu, mit dem sie sich aus unerfindlichen Gründen in eine Art Dauerwettstreit befand.
Hinter ihr saß die niederländische Militärärztin Dr. Ina Vanderlantjes. Auch sie trug volle Kampfmontur. Das Gesicht war mit Tarnfarbe angemalt und kaum zu erkennen. Pierre Leclerque, der Kommunikationsoffizier des Trupps, tickte etwas nervös auf dem Gehäuse seines tragbaren High-Tech-Computers herum, den er so gut wie immer bei sich trug. Chèrie nannte er das Gerät. Der zweite Techniker des Teams war der Russe Miroslav „Miro“ Karapok. Er hatte den Platz rechts neben Leclerque eingenommen.
Inzwischen war diese Truppe zu einer schlagkräftigen Einheit zusammengeschweißt worden, die bereis in diversen Kriseneinsätzen unter Beweis gestellt hatte, wozu sie fähig war.
Eine Art Feuerwehr der Weltpolitik.
Das war es, was dem südafrikanischen General Uwatani bei der Gründung von Security Force Omega vorgeschwebt hatte.
Und die SFO war auf dem besten Weg, sich genau in diese Richtung zu entwickeln.
Uwatani aktivierte über eine Fernbedienung einen Beamer.
Ein Kartenausschnitt zeigte die geographischen Umrisse Rahmaniens und die wichtigsten Städte des Landes. „Ich weiß nicht, in wie fern Sie von der aktuellen Krisenentwicklung in Rahmanien gehört haben“, begann Uwatani etwas gedehnt.
„Wir haben die letzten Tage in einem Biwak kampiert und versucht, ein von Terroristen besetztes Kernkraftwerk zurückzuerobern, ohne dass es zum Super-GAU kommt!“, meldete sich Tarvisio ungefragt zu Wort.
„So oder so ähnlich lautete jedenfalls unsere Manöveraufgabe. Da hat man leider wenig Zeit, das Weltgeschehen zu verfolgen, wenn man gerade dabei ist, eine Atomhölle zu verhindern!“
Kurzes Gelächter kam auf.
Breckinridge verdrehte die Augen.
„Du kannst es wohl einfach nicht lassen, was?“, murmelte Marisa Henriquez giftig.
„Scusi, so bin ich nun einmal!“, grinste Carlo Tarvisio über das ganze Gesicht.
Uwatani nahm den Einwurf des Italieners gelassen hin.
Breckinridge war es sichtlich peinlich. Schließlich war Carlo ihm unterstellt und somit fühlte sich Breckinridge auch für dessen Auftreten mitverantwortlich.
„Ich gehe also davon aus, dass Sie nichts weiter über die Krise um die deutsch-französische Botschaft in Barasnij wissen. Kurz gesagt: Vor etwa einem halben Tag ist dort das noch verbliebene Botschaftspersonal entführt worden. Darunter Botschafter Duvalier und sein Stellvertreter Dankwart. Insgesamt etwa ein Dutzend Personen. Das Wachpersonal wurde bis auf den letzten Mann getötet. Unsere Informationen stammen in erster Linie aus Geheimdienstquellen, die uns vor Ort zugänglich sind.“
„Wer steckt hinter dieser Entführung?“, hakte Colonel John Breckinridge nach. Der Amerikaner verschränkte die Arme vor der Brust.
„Eine gute Frage, Commander“, sagte General Uwatani. „Wir wissen es einfach nicht. Seit etwa zwei Wochen hat General Zirakov im Land die Macht übernommen, aber es ist durchaus ungewiss, wie fest er im Sattel sitzt.“ An der Wand erschien ein Bild des Generals. Der buschige Schnauzbart erinnerte an Stalin. „Zirakov stürzte vor kurzem den demokratisch gewählten Kanzler des Landes.“ Ein weiteres Bild erschien, das einen geschäftsmäßig lächelnden Mann in den Fünfzigern zeigte, der einer jubelnden Menge zuwinkte. „Kanzler Viktor Narajan errang vor drei Jahren einen überwältigenden Wahlsieg, nachdem sein Amtsvorgänger Basil Jiklajev unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Im Laufe von Narajans Amtszeit häuften sich Korruptionsvorwürfe und Vorwürfe in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen. Aber es ist kaum anzunehmen, dass General Zirakov ihn aus humanistischen Motiven heraus abgesetzt hat. Narajan ist in den Untergrund gegangen und ruft von dort aus zum Widerstand auf.“
„Verfügt er denn über eine Machtbasis?“, hakte Breckinridge nach.
Uwatani nickte.
„Durchaus. Narajan war lange Zeit Chef des Geheimdienstes, der einzigen Institution des Landes, die den Wechsel vom Kommunismus zu einer Art Demokratie westlicher Prägung nahezu unverändert überstand.
Mit Hilfe dieser Kontakte gelang es ihm vermutlich seinerzeit Jiklajev auszuschalten und die Wahlen in seinem Sinn zu manipulieren. Auch wenn momentan andere in Barasnij Panzer aufmarschieren lassen, sollte man Narajan noch nicht abschreiben. Er soll eine Art Privatarmee unter seinem Befehl haben, bestehend aus Männern, die er aus dem Geheimdienst rekrutiert hat. In Barasnij wird auch zwei Wochen nach dem Putsch immer noch geschossen. Ob Zirakov wirklich sicher im Sattel sitzt, ist zweifelhaft.“
An der Wand erschien jetzt das Bild des Palais Ragowski, dem Sitz der deutsch-französischen Botschaft.
„Die Täter haben die Botschaft besetzt und sich dort vermutlich verschanzt“, berichtete Uwatani. „Das Botschaftspersonal wird irgendwo im Gebäude gefangen gehalten. Es wurde eine dürre Erklärung an die westlichen Medien lanciert, die aber keine Forderungen enthielt.“
„Was tut die rahmanische Regierung in der Sache?“, fragte Breckinridge.
Uwatani verzog das Gesicht.
„Nichts.“
„Dann sollen sie uns das erledigen lassen“, forderte Breckinridge.
„Es gibt eine offizielle Stellungnahme der neuen Regierung“, erklärte der General. „Sie lehnt jede Hilfe von außen ab.“
„Irgendeine Vermutung, was dahinter stecken könnte?“, fragte der Colonel.
Uwatani nickte. Sein Gesicht wirkte sehr ernst. „Wir nehmen an, dass Zirakovs Leute versuchen, diese Geiselnahme zu benutzen, um vom Westen die politische Anerkennung zu erzwingen.
„Eine sehr plumpe Methode!“, kommentierte Breckinridge.
„Eigentlich müssten sie wissen, dass sie damit nicht durchkommen!“
„Wer sagt Ihnen das?“, erwiderte der General. „Wenn Zirakov in einer heldenhaften Aktion für die Freilassung der Geiseln sorgt, wird man ihm das in Berlin und Paris nicht vergessen. Es wäre nicht der erste Deal dieser Art.“
Uwatani betätigte erneut die Fernbedienung des Beamers.
Ein Kartenausschnitt zeigte die russisch-rahmanische Grenze.
„Ihr Auftrag wäre, von der russischen Grenze aus einzeln oder paarweise einzusickern. Sie treffen sich erst in Barasnij, klären die Lage um die Botschaft und befreien die Geiseln.“
„Und wie kommen wir wieder heraus?“, fragte Breckinridge.
„Das ist immer die wichtigste Frage bei einer militärischen Operation, habe ich mal gelernt“, meinte Carlo Tarvisio. Er hatte sich diese Bemerkung einfach nicht verkneifen können.
Uwatani deutete auf die Karte. „Sie werden mit einer Hubschrauberstaffel ausgeflogen.“
„Spielt die russische Seite da wirklich mit?“, vergewisserte sich Breckinridge.
Uwatani nickte. „Moskau kooperiert in dieser Sache. Das ist sicher.
Sie brauchen nur ein codiertes Funksignal abzugeben und unsere Hubschrauberstaffel setzt sich in Marsch.“
„Unsere Helis?“, wunderte sich Mark Furrer.
Uwatani bestätigte dies.
„Im Rahmen der so genannten Sicherheitspartnerschaft für den Frieden befindet sich eine Spezialeinheit der US Army zu Übungswecken im russisch-rahmanischen Grenzgebiet“, erklärte er.
„Zumindest ist das die offizielle Version... Der Codename dieser Operation lautet übrigens FREE WILLY.“
Wer hat sich das denn ausgedacht?, schoss es Carlo Tarvisio durch den Kopf. „Hoffentlich heißt auch wenigstens einer in der Botschaft Willy“, hatte er noch sagen wollen, aber ehe er dazu kam, stieß Mara Henriquez ihm ihren Ellbogen in die Seite.
„Lass es“, sagte sie.
5
Russisch-rahmanische Grenze Grenzübergang Saschnaja Montag 1230 OZ
Es regnete Bindfäden. Die Straße war aufgeweicht. Der alte Magirus Deutz-Lastwagen rumpelte die von wassergefüllten Schlaglöchern übersäte Piste entlang, die geradewegs auf die russisch-rahmanische Grenze zuführte.
Mark Furrer saß am Steuer des Lastwagens, dessen Laderaum mit Decken, Verbandszeug und Medikamenten gefüllt war, die für eine in der Hauptstadt Barasnij tätige Hilfsorganisation bestimmt waren.
Auf dem Beifahrersitz hatte Ina Vanderlantjes Platz genommen.
„Die Schüttelei geht mir ziemlich auf die Nerven“, meinte die Niederländerin.
Mark grinste.
„Ich schätze, bis wir in Barasnij sind, wird es nicht besser werden.“
„Also ehrlich! Dagegen ist ja eine Fahrt im Schützenpanzer im Manövergelände gar nichts!“
„Hauptsache unsere Legende ist überzeugend genug und wir kommen ohne Probleme ans Ziel“, meinte Mark.
„Wir werden es gleich wissen“, erwiderte sie und deutete voraus.
Aus dem Dunst, der aus den Wiesen und Wäldern aufstieg, tauchte ein Grenzposten auf. Auf russischer Seite hatten sie nichts zu befürchten.
Die Regierung in Moskau unterstützte das geheime Kommandounternehmen zur Geiselbefreiung tatkräftig.
Auf der anderen Seite des Schlagbaums begann das Risiko.
Mark und Ina waren die Vorhut des Teams.
Sie sollten in Barasnij zunächst einmal die Lage sondieren.
Breckinridge und die anderen würden dann an unterschiedlichen Grenzübergängen ebenfalls einsickern.
Der Lastwagen erreichte den Checkpoint.
Die russischen Kontrolleure ließen sich kurz die Papiere zeigen.
Es waren echte deutsche Pässe, allerdings mit falschen Personendaten versehen.
Pro Forma untersuchten die Russen auch die Ladung des Lkw.
Schließlich beobachteten ihre rahmanischen Kollegen genau, was sie taten und es war unerlässlich, dass sie keinen Verdacht schöpften.
Schließlich wurde der Lastwagen durchgewunken.
Mark ließ den Motor wieder an.
Der Lastwagen rumpelte durch mehrere Schlaglöcher durch die etwa hundert Meter Niemandsland und hielt schließlich vor der rahmanischen Schranke.
„Aussteigen!“, bellte ein ziemlich unfreundlicher, grauhaariger Grenzoffizier abwechselnd auf rahmanisch, russisch und deutsch.
Soldaten waren überall postiert. Sie hielten Sturmgewehre und Maschinenpistolen im Anschlag und wirkten nervös. Einer drückte eine Zigarette aus und warf den Stummel zu Boden.
„Machen wir besser, was er sagt!“, meinte Ina.
Mark nickte.
Vorsichtig, jede allzu schnelle Bewegung vermeidend, kletterten sie aus der Fahrerkabine des Lastwagens.
Grenzbeamte durchsuchten sie kurz nach Waffen.
Einer der Grenzer wurde bei Ina ziemlich zudringlich, berührte sie deutlich länger als notwendig.
Der Vorgesetzte stand daneben und grinste.
Offenbar waren Ordnung und Disziplin bei den Grenzern momentan zusammengebrochen. Jeder machte, was er wollte. Vorschriften zählten nicht mehr. Eine brenzlige Situation.
Ina Vanderlantjes ließ die Prozedur über sich ergehen.
Mark konnte den Impuls gerade noch unterdrücken, handgreiflich zu werden.
Der Vorgesetzte war ein Mann mit einem ähnlich buschigen Schnauzbart, wie die SFO-Soldaten ihn bei General Zirakov gesehen hatten.
Er ließ sich die Pässe zeigen und betrachtete sie eingehend, während sich einige seiner Leute daran machten, die Ladung zu kontrollieren.
„Dr. Martina Derendorf?“, fragte er.
„Das bin ich!“, sagte Ina Vanderlantjes.
„Sie sind Ärztin für Kinderheilkunde?“
„Ja. Ich arbeite für die Organisation Hilfe ohne Grenzen. Wir betreiben mehrere Kinderheime und Krankenhäuser in Rahmanien, darunter auch die Kinderklinik von Barasnij, für die diese Lieferung bestimmt ist!“
„Ich hoffe für Sie, dass das stimmt“, knurrte der Grenzoffizier.
Er wandte sich Mark zu.
„Und Sie?“
„Das ist mein Fahrer“, erklärte Ina.
Der Grenzoffizier blickte auf die Papiere.
Dann brüllte er ein paar Befehle auf Rahmanisch an seine Männer.
Ein zynisches Grinsen spielte um seine Lippen.
Er ging auf und ab.
Ina und Mark stand da und konnten nichts tun, außer den rahmanischen Grenzbeamten bei der Durchsuchung des Lastwagens zuzuschauen.
Der Regen nahm zu.
Den beiden SFO-Soldaten klebte das Haar am Kopf.
Sie trugen natürlich unauffälliges Zivil. Jeans, Turnschuhe, Sweatshirt.
„Die Uhren gehen hier etwas anders als bei euch“, sagte der Grenzoffizier. „Es ist nicht viel Verkehr an diesem Checkpoint. Wir haben also alle Zeit der Welt, um uns ihren LKW genau anzusehen.“
„Unsere Medikamentenlieferung wird dringend erwartet“, gab Ina zu bedenken.
Der Grenzoffizier blieb vollkommen ungerührt.
„Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Sie müssen verstehen, dass wir auch unsere Vorschriften haben und uns peinlich genau daran halten müssen, Doktor...“ Er sah noch einmal in den Pass. „Dr. Derendorf“, vollendete er dann.
Inzwischen begann einer der Grenzer, unter das Fahrzeug zu kriechen. Mit einer Taschenlampe leuchtete er alles ab.
Dort unten befanden sich gut getarnte geheime Behälter, die für die Ausrüstung der beiden SFO-Soldaten bestimmt waren. Wenn einer der Grenzbeamten die Ausrüstung fand, war das Unternehmen FREE
WILLY gescheitert, noch bevor es wirklich begonnen hatte.
Das durfte unter keinen Umständen geschehen.
„Kann man diese Prozedur nicht irgendwie... beschleunigen?“, fragte Mark an den Kommandanten des Checkpoints gewandt.
„Nun, gegen eine gewisse Gebühr ist vieles möglich“, knurrte er.
„Wir haben es wirklich sehr eilig. Vielleicht können wir da ja ins Geschäft kommen!“
Der Grenzoffizier blickte Mark an, als würde dieser von einem anderen Stern kommen.
„Was Sie da sagen, klingt sehr nach dem Versuch, einen Offizier der Grenztruppen bestechen zu wollen!“
„Nein, nein. Davon kann doch keine Rede sein“, beeilte sich Mark, diesen Eindruck zu korrigieren. „Wir sind einfach nur an guter und schneller Zusammenarbeit interessiert.“
Mark bückte sich.
Er tat dies sehr langsam, sodass keiner der Bewaffneten irgendeinen Angriff vermuten musste.
Anschließend holte er ein Bündel mit Geldscheinen aus dem Strumpf und reichte es dem Grenzoffizier.
„Nur Euro“, murmelte der anerkennend. „Sehr gut.“ Er rief ein paar Anweisungen auf Rahmanisch. Die Kontrolle des Lastwagens war augenblicklich beendet. „Steigen Sie ein und fahren Sie weiter!“, wandte sich der Offizier an Mark.
Er nickte Ina zu.
Das lassen wir uns besser nicht zweimal sagen! , schien ihr Blick zu sagen.
Augenblicke später saßen sie wieder in der Fahrerkabine des Magirus. Der Motor kam stotternd in seinen Takt. Der Lastwagen fuhr an. Mark beobachtete die Grenzbeamten noch einige Augenblicke über den Rückspiegel.
„Puh, ich dachte, wir hätten es mit Grenzbeamten zu tun --- nicht mit einer Räuberbande!“, stieß Ina hervor.
„Wie liegt da die genaue Unterscheidung?“, grinste Mark.
Äußerlich wirkte er ruhig und gelassen.
In Wahrheit fiel allerdings auch ihm ein Stein vom Herzen.
Schließlich war im Lastwagen auch die Ausrüstung der beiden SFO-Kämpfer versteckt. Gut getarnt in den Radkästen und in speziellen Behältern, die in das Chassis des Magirus eingepasst waren.
„Ich hatte schon Angst, dass sie unsere Waffen finden“, meinte Ina.
„Einer der Kerle war nahe dran!“
„Ich weiß“, nickte Mark.
„Aber du hast ja gerade noch rechtzeitig die Euros aus dem Strumpf gezogen!“
„Wir haben einfach Glück gehabt. Die hätten uns auch festnehmen und wegen Bestechung anklagen können.“
Ina nahm die Karte hervor, die im Seitenfach an der Innenseite der Tür steckte.
„So etwas wie eine Autobahn werden wir wohl kaum vorfinden“, meinte Mark.
„Hundert Kilometer Schlaglochpiste bis Barasnij liegen vor uns“, stellte Ina fest. „Aber das Ding hat wenigstens einen schönen Namen.“
„Ach, ja?“
„Nationalstraße A.“
6
Es war ein stockdunkler Kellerraum. Insgesamt vier Angehörige der deutsch-französischen Botschaft von Barasnij waren hier eingesperrt.
Neben Damien Duvalier und seinem Stellvertreter Jürgen Dankwart noch die Abteilungsleiterin Petra Heim und die Sachbearbeiterin und Juristin Francoise Poincheval.
Zwei Personen aus der Notbesetzung der Botschaft fehlten.
Es handelte sich um die Diplomaten Helmut Michelsen und Pierre Joscan.
Keiner aus der Gruppe, die in diesem dunklen Kellerloch festgehalten wurde, hatte Michelsen und Joscan seit ihrer Gefangennahme gesehen. Vielleicht waren sie ebenso umgebracht worden, wie das Sicherheitspersonal. Immerhin wusste Duvalier, dass zumindest Michelsen eine Waffe bei sich getragen hatte.
Seit Stunden war die Gruppe in dieser Dunkelheit eingepfercht.
Es war kalt und feucht.
„Ich werde noch wahnsinnig!“, meinte Francoise Poincheval. „Was sind das für Leute, die uns hier festhalten?“
„Wir hatten bisher keinerlei Erkenntnisse über Aktivitäten irgendwelcher terroristischen Organisationen in Rahmanien“, meinte Dankwart. Seine Stimme klang niedergeschlagen.
Der Zustand der meisten Gruppenmitglieder war inzwischen ziemlich instabil. Duvalier registrierte das mit Besorgnis.
Die beste Lebensversicherung in einer derartigen Situation war immer noch ein kühler Kopf.
„Ich bin mir sicher, dass es sich um irgendeine reguläre Einheit handeln muss. Die haben sich gegenseitig mit militärischen Rängen angesprochen, wenn sie rahmanisch sprachen.“
„Es hat wohl keiner von denen damit gerechnet, dass jemand von uns sie verstehen kann!“, meinte Francoise Poincheval. „Aber das macht doch keinen Sinn? Was hat General Zirakov davon, dass er uns hier festhält?“
„Das können Sie ja unsere Kerkermeister fragen, wenn sie das nächste Mal auftauchen“, meinte Jürgen Dankwart zynisch. „Bis jetzt waren die ja alles andere als gesprächig.“
Duvalier ging in der Dunkelheit auf und ab.
Das half ihm, seine Gedanken zu sammeln. Er musste nur aufpassen, mit keinem der anderen Gefangenen zusammen zu stoßen.
Auf jeden Fall ist die Chance, dass uns jemand hier raushaut denkbar schlecht, war dem ehemaligen Fallschirmjäger klar.
Aber er hielt diese Erkenntnis für sich.
Die psychische Verfassung war schon labil genug.
„Petra?“, fragte er.
Keine Antwort.
Die Gruppe hatte die ganze Zeit über geredet, so als müssten sie sich alle gegenseitig der Tatsache versichern, dass sie noch anwesend waren.
Schließlich konnte keiner von ihnen den anderen sehen. Da waren nur Stimmen in der Dunkelheit.
Und eine Stimme fehlte.
Petra Heim.
Die Abteilungsleiterin hatte sich schon seit geraumer Zeit nicht zu Wort gemeldet.
„Petra?“, fragte Duvalier noch einmal.
Ein leises Schluchzen kam ihm aus der Dunkelheit entgegen.
Seelischer Zusammenbruch!, dachte Duvalier. Das hat uns gerade noch gefehlt!
7
National Straße A 2 km vor der rahmanischen Hauptstadt Barasnij
Montag 1820 0Z
„Fahr mal rechts ran“, forderte Mark Furrer.
Ina Vanderlantjes hatte Mark inzwischen längst hinter dem Steuer des Magirus abgelöst. Die Fahrt über die Schlaglochpiste, die sich hochtrabend Nationalstraße A nannte und direkt nach Barasnij führte, war alles andere ein Zuckerschlecken. Die beiden SFO-Kämpfer waren regelrecht durchgeschüttelt worden. Erst auf den letzten dreißig Kilometern vor der Hauptstadt war die Straße deutlich besser ausgebaut worden und wurde abschnittweise sogar vierspurig geführt.
„Wieso sollen wir anhalten? Wir sind doch gleich da“, erwiderte Ina.
„Wir hatten zwar nicht besonders viel Zeit, um uns auf die kulturellen Besonderheiten Rahmaniens einzustellen, aber ich schätze, dass hier eine Lastwagen fahrende Frau auffälliger ist, als ein Lastwagen fahrender Mann!“
Ina lachte.
„Das ist doch nicht dein Ernst!“
„Doch.“
„Ich dachte, dies ist ein Land, in dem der Kommunismus herrschte und früher ein Teil der Sowjetunion war.“
„Sicher!“
„Ich habe gehört, dass es bei den Sowjets sogar weibliche Stahlarbeiter gegeben hat! Die dürften in dieser Hinsicht an alles gewöhnt sein, Mark!“
„Na, wenn du meinst...“
„Ich würde vorschlagen, du aktivierst unser GPS, damit wir uns in den Straßen von Barasnij einigermaßen zurechtfinden. Meinetwegen können wir dann auch für einen Fahrerwechsel anhalten. Ich sitze jetzt schließlich auch schon eine ganze Weile auf dem Bock.“
Zunächst mussten Vanderlantjes und Furrer eine Kinderklinik in Barasnij anfahren, um dort die Ladung an Medikamenten abzuliefern.
Danach erst konnten sie mit ihrem eigentlichen Job beginnen.
Mark Furrer betrachtete Ina Vanderlantjes von der Seite.
Eine attraktive Frau, dachte er. In Kampfanzug und Splitterweste konnte man davon wenig sehen. Aber in Jeans und T-Shirt zeichneten sich die aufregenden Körperformen der jungen Niederländerin deutlich ab.
Mark hatte sich von Anfang an von ihr angezogen gefühlt und sie waren sich nach anfänglichen Schwierigkeiten und Missverständnissen inzwischen näher gekommen.
Aber ihm war auch klar, dass der Dienst in der SFO für derartige Gefühle wenig Raum ließ.
Rechts und links der auf dem letzten Stück bis zum Stadtzentrum sogar sechsspurigen Nationalstraße befanden sich fünf- bis zehnstöckige Plattenbauten, wie sie typisch für viele Stadtrandgebiete des ehemaligen Ostblocks waren.
Es waren kaum Fahrzeuge unterwegs.
Dafür kreuzten um so mehr Militärfahrzeuge den Weg der beiden SFO-Soldaten.
Etwa ein Dutzend Schützenpanzer kam ihnen entgegen.
Außerdem mehrere Lastwagen mit Soldaten in voller Kampfmontur, die offenbar zu einem Einsatz fuhren.
Privatfahrzeuge waren sehr selten. Nur einige schwer beladene Lastwagen und Kleintransporter fuhren ins Stadtinnere.
Barasnij war eine Stadt, die in den Wirren des zweiten Weltkriegs vollkommen zerstört worden war. Von der alten, historischen Bausubstanz war nichts geblieben. Plattenbauten im Sowjetstil aus den fünfziger und sechziger Jahren dominierten das Stadtbild.
Die heutige Stadt glich in ihrem Grundriss einem Gittermuster.
Der Lastwagen erreichte eine Straßensperre.
Die Soldaten gehörten einem Fallschirmjäger-Bataillon der rahmanischen Armee an. Mit einem Bündel-Euro-Scheine waren die Männer nicht zu bestechen. Schon in kommunistischer Zeit hatten die Angehörigen dieser Truppe alle denkbaren Privilegien genossen. Daran hatte sich auch danach nichts geändert.
Sie galten als eine Truppe von General Zirakov zu hundertfünfzig Prozent ergebenen Elitekämpfern.
Ina zeigte den Fallschirmjägern die Papiere. Darunter auch die Einfuhrerlaubnis für die Medikamente, die der Kinderklinik von Barasnij geliefert werden sollten.
Eine kurze Durchsuchung des Laderaums nach Waffen folgte.
Eine Detonation ließ alle Beteiligten zusammenzucken.
Eine Rauchsäule stieg zwischen den quaderförmigen Plattenbauten empor.
Die Aufmerksamkeit der Soldaten war abgelenkt. Sie winkten den Lastwagen weiter.
„Nun mach schon, Mark!“, murmelte Ina.
Sie wirkte sichtlich angespannt.
Mark ließ den Motor an.
„Was schätzt du, wie weit ist die Detonation entfernt?“, fragte der Deutsche.
„Maximal 200 Meter!“, vermutete Ina.
„Wahrscheinlich ein Geschoss aus einem Granatwerfer.“
„General Zirakovs Leute scheinen noch nicht einmal hier in Barasnij fest im Sattel zu sitzen.“
Mark Furrer lenke den Magirus weiter in die Stadt hinein.
Die reißbrettartige Anlage der Stadt erleichterte die Orientierung.
Weitere Detonationen waren zwischen den Gebäuden zu hören. Sie wechselten sich mit Maschinengewehrfeuer ab.
Da wurde anscheinend in einigen Vierteln der rahmanischen Hauptstadt heftig gekämpft.
Der Weg zur Kinderklinik war mit Hilfe des GPS leicht zu finden.
Aber Furrer und Vanderlantjes mussten einen Umweg fahren, um das offenbar umkämpfte Gebiet großräumig zu umfahren.
Die Straßen wirken wie ausgestorben. Die Cafés und Restaurants der Innenstadt waren geschlossen. Nur wenige Passanten waren unterwegs. Dafür um so mehr Patrouillen jener Fallschirmjägereinheit, der General Zirakov vertraute.
Auch die meisten Geschäfte waren geschlossen.
„Nicht mehr lange und die Versorgungslage wird hier zur Katastrophe“, war Ina überzeugt.
„Wenn dieser Zirakov auch nur eine Funken Verstand hat, wird er das zu verhindern versuchen“, antwortete Mark.
Er lenkte den Magirus in eine Nebenstraße.
„Wieder rechts!“, wiesen Ina und das GPS-Navigationssystem den Nahkampfspezialisten beinahe gleichzeitig an.
Ein Lächeln huschte über Inas Gesicht, das für wenige Augenblicke etwas entspannter wirkte.
Die Straßen wurden enger.
Mark folgte der Anweisung und bog nach rechts. Ein paar ausgebrannte Pkw-Wracks am Straßenrand verengten die Fahrbahn zusätzlich.
Aus einer Einfahrt schnellte plötzlich ein verbeulter, mit kyrillischen Buchstaben bemalter Van hervor.
Mark musste in die Bremsen treten.
Quietschend kam der Magirus zum stehen.
Der Fahrer des Van stieg aus. Er hielt eine Automatik in der Hand.
Drei weitere Männer in Zivil tauchten aus Türnischen hervor.
Manche von ihnen trugen Uniformteile, aber sie wirkten eher wie Kriminelle.
Einer der Angreifer riss die Fahrertür auf.
Mark Furrer wurde grob hervorgezerrt, bekam einen Schlag mit dem Magazin einer Kalaschnikow und landete hart auf dem Boden.
Ina bekam den Lauf einer Beretta unter die Nase gehalten.
„Keine Bewegung!“
8
Russisch-rahmanisches Grenzgebiet am Oberlauf der Djarena Montag 1830 0Z
Der russische Truppentransporter stoppte. Colonel John Breckinridge und Mara Henriquez stiegen von dem Wagen herunter.
Carlo Tarvisio reichte den beiden nacheinander die in wasserdichte Behälter verpackte Ausrüstung und sprang dann zu Boden.
Mit den Kampfstiefeln landete er im aufgeweichten Boden.
Fahrer und Beifahrer des Truppentransporters stiegen aus. Die Türen klappten. Die beiden Männer trugen Uniformen der russischen Armee.
Der größere der beiden Russen wandte sich an Colonel Breckinridge. „Von hier an sind Sie auf sich allein gestellt“, erklärte er in akzentbeladenem Englisch.
Breckinridge nickte.
„Danke für Ihre Unterstützung.“
Der Russe deutete in Richtung Westen. Ein Fluss mäanderte dort durch die Landschaft. „Das ist die Djarena“, erklärte der Russe. „Von hier an fließt sie noch etwa einen Kilometer nur auf russischem Gebiet, ehe sie für drei bis vier Kilometer die Grenze markiert. Danach fließt sie ins Landesinnere.“
„Genau dorthin wo wir hin wollen“, kommentierte Tarvisio.
„Spar dir deine Energie für das Schwimmen“, versetzte Mara Henriquez. „Ich schätze, so ein Maulheld könnte leicht aus der Puste kommen!“
Weder Breckinridge noch der Russe nahmen das kleine Wortgefecht zwischen den beiden SFO-Soldaten weiter zur Kenntnis.
„Ich nehme an, Sie kennen sich im Grenzgebiet aus“, vermutete Breckinridge.
Der Russe nickte.
„An der Grenze müssen Sie höllisch aufpassen, Colonel. Die Rahmanier wollen um jeden Preis verhindern, dass irgendjemand ohne ihre Kontrolle die grüne Grenze überschreitet.“
„Es heißt, dass General Zirakovs Regime auf sehr wackeligen Beinen steht!“
Der Russe nickte.
„Die neue Regierung fürchtet nichts so sehr, als dass die Rebellen unter dem alten Kanzler sich über die Grenze zurückziehen und dann auf russischem Boden für die rahmanischen Streitkräfte unerreichbar sind.“
John Breckinridge hob die Augenbrauen.
„Ihre Grenztruppen würden das nicht verhindern?“
Der Russe zuckte die Achseln. „Die Grenze ist lang, Colonel. Und wir können nicht überall sein. Die Rahmanier allerdings auch nicht ---und deshalb haben Sie meines Erachtens eine reelle Chance!“
Die Russen verabschiedeten sich.
Wenig später rumpelte der geländegängige Truppentransporter davon. Die Reifen pflügten durch das aufgeweichte Erdreich in der Uferregion der Djarena.
Breckinridges Haltung straffte sich.
„Also los! Worauf warten Sie noch?“, fragte er an Mara und Carlo gewandt. „Taucheranzüge anlegen!“
Sie trugen die Ausrüstung an das Flussufer heran.
Es hatte in letzter Zeit starke Niederschläge gegeben. Daher führte die Djarena mehr Wasser als üblich.
Sie legten Taucheranzüge aus spezialgefertigtem Neopren an, die über eine Thermo-Spezialschicht verfügten. Die SFO-Kämpfer hatten vor, sich mit der Strömung der Djarena über die stark bewachte Grenze Richtung Hauptstadt tragen zu lassen.
Tarvisio und Henriquez waren für diese Art des Einsickerns in feindliches Gebiet geradezu prädestiniert.
Bei der italienischen Spezialeineinheit ComSubIn hatte sich Tarvisio bei diversen Einsätzen dieser Art bewährt und konnte seitdem mit Fug und Recht behaupten, Schwimmhäute zwischen den Fingern zu haben.
Auch Mara Henriquez war als erstes weibliches Mitglied der argentinischen Fuerza Anfibia auf Tauch- und Landeoperationen spezialisiert.
Die Ausrüstung einschließlich der Bewaffnung führten die SFO-Kämpfer in speziellen wasserdichten Behältern mit sich. Zu Waffen, Kampfanzug und dem Rest des militärischen Equipments gehörte diesmal auch Zivilkleidung. Schließlich mussten sie zunächst aus dem Untergrund operieren und konnten sich nicht offen als Angehörige einer UN-Spezialeinheit zu erkennen geben.
Das Marschgepäck war dadurch noch etwas umfangreicher als ohnehin schon.
Aber zunächst einmal würden Wasser und Strömung für die drei SFO-Angehörigen die Transportarbeit übernehmen.
Zur Ausrüstung gehörte auch ein wasserdicht in Folie geschweißtes Navigationssystem, mit dessen Hilfe genau bestimmt werden konnte, wo sie an Land zu gehen hatten.
Mara Henriquez bemerkte Tarvisios Blick, während sie den Reißverschluss ihres Neoprenanzugs schloss. Sie registrierte, dass Tarvisio bereits komplett fertig war: Maske, Flossen, Schnorchel und Navigationssystem.
Auf eine Flasche mit Druckluft verzichtete das SFO-Team aus Gewichts- und Platzersparnis.
Schließlich hatte niemand von ihnen vor, tiefer als ein paar Zentimeter zu tauchen.
Die meiste Zeit über würden sie sich einfach an der Oberfläche flussabwärts treiben lassen.
„Jetzt werden wir ja sehen, was deine Schwimmhäute wert sind, Carlo!“, meinte Henriquez angriffslustig. Ihr gefiel es offenbar nicht, dass Tarvisio es schneller geschafft hatte, seine Ausrüstung zu ordnen.
John Breckinridge atmete tief durch.
„Morgen früh sind wir alle so durchgeweicht, als hätten wir eine Woche lang in der Badewanne gelegen!“
Breckinridge war der erste von ihnen, der ins Wasser ging und sich flussabwärts treiben ließ. Die Ausrüstung zog er an einem Seil hinter sich her. Zuvor hatte er sie sorgfältig mit Büschen und Blättern getarnt.
Als nächstes folgte Tarvisio und schließlich Mara Henriquez.
9
Mark Furrer lag am Boden.
Der Kerl mit der Kalaschnikow holte zu einem Tritt aus. Mark fing den Stiefel mit den Händen ab und drehte mit aller Kraft den Fuß herum.
Der Kerl schrie. Die Achillessehne riss. Der Mann knallte zu Boden. Er war halb wahnsinnig vor Schmerz. Mark schnellte hoch, war eine Sekunde später über ihm. Er knockte den Kerl mit einem Fausthieb aus und riss die Kalaschnikow an sich.
Einer der anderen Angreifer riss seine Automatik hoch.
Mark drückte ab.
Die Kalaschnikow wummerte los.
Der Rahmanier taumelte getroffen zurück und fiel der Länge nach auf den Asphalt.
Inzwischen hatte Ina den Kerl, der ihr die Waffe entgegenhielt mit einem schnellen Handkantenschlag ausgeschaltet. Ächzend sank der Mann zu Boden.
Einer der anderen Angreifer feuerte mit einer MPi auf die Fahrerkabine des Magirus. Ina duckte sich. Die Scheiben zersprangen unter dem Dauerbeschuss. Glasscherben regneten auf Ina Vanderlantjes herab.
Mark Furrer rollte sich auf dem Boden herum, schnellte hoch und feuerte erneut die Kalaschnikow ab.
Mit so heftiger Gegenwehr hatten die Angreifer offenbar nicht gerechnet.
Mark erwischte einen.
Er fiel getroffen zu Boden.
Die anderen zogen sich zurück und feuerten mehr oder minder ungezielt in Marks Richtung. Wenige Augenblicke später waren sie in den engen Gassen zwischen den Betonblöcken verschwunden.
Mark erhob sich.
Er kehrte zur offen stehenden Fahrertür zurück.
„Alles in Ordnung, Ina?“, fragte er.
„Mal davon abgesehen, dass ich die Kleidung voller Glassplitter habe --- ja!“
Mark wischte das Glas notdürftig vom Fahrersitz und setzte sich wieder hinter das Steuer.
Die Kalaschnikow reichte er an Ina weiter.
„Nichts wie weg hier“, meinte er.
Mark setzte zurück, bog in eine Einfahrt ein und drehte. Dann fuhr er den Magirus zur Hauptstraße zurück und bog rechts ab.
Offenbar hatten die Angreifer mit leichter Beute gerechnet.
Sie hatten teuer dafür bezahlen müssen.
Eine halbe Stunde quälte sich Mark mit dem zerschossenen Lastwagen durch das Straßenlabyrinth von Barasnij.
Zweimal wurden sie an Checkpoints angehalten.
An der zerschossenen Frontscheibe nahmen diese Posten nicht viel Notiz.
„Terroristen“, so lautete ihr Kommentar.
Als sie den dritten Checkpoint erreichten, bekamen sie sogar eine bewaffnete Eskorte. Ein leichter Schützenpanzer und ein Geländewagen begleiteten sie zur Kinderklinik von Barasnij. Sie hatte in den letzten Jahren den Namen des Kanzlers Narajan getragen, da der rahmanische Regierungschef das Krankenhaus mit einer sehr großzügigen Spende aus seinem Privatvermögen gefördert hatte.
So fern sich General Zirakov an der Macht hielt, würde sich der Name der Klinik sicher bald ändern.
Die bewaffnete rahmanische Eskorte verabschiedete sich schnell.
Das Klinikpersonal begann damit, den Lastwagen zu entladen.
Innerhalb einer halben Stunde war das erledigt.
Dr. Maxwell, ein britischer Arzt, leitete das Krankenhaus. Er bot Furrer und Vanderlantjes an, in dem zur Klinik gehörenden Wohnkomplex zu übernachten. „Sie dürfen zwar keinen Luxus erwarten, aber das tut wohl ohnehin niemand, der sich entschließt, einen Hilfstransport nach Rahmanien zu fahren.“
„Wir danken Ihnen“, sagte Vanderlantjes in perfektem Oxford English. „Allerdings werden wir nicht lange bleiben.“
Dr. Maxwell runzelte die Stirn. Seine grauen, buschigen Augenbrauen zogen sich enger zusammen. „Sie haben doch wohl nicht vor, mit dem zerschossenen Fahrzeug zurückzufahren?“
Ina lächelte verhalten und schüttelte den Kopf.
„Nein, keine Sorge, Dr. Maxwell.“
„Also werden Sie eine Weile hier in Barasnij bleiben müssen, denn erstens wird es schwer werden, jemanden zu finden, der Ihnen eine neue Scheibe einsetzt und zweitens...“
„Ich habe durch frühere Aufenthalte hier in Barasnij noch einige Kontakte“, unterbrach die niederländische Militärärztin den Leiter der Kinderklinik. „Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden schon jemanden finden, der uns den Lastwagen repariert.“
„Sagen Sie das nicht! Es ist verdammt schwer geworden, in dieser Stadt einen Kfz-Mechaniker zu finden, der etwas drauf hat.“
„Wieso das?“, fragte Furrer.
„Weil diejenigen, die etwas auf dem Kasten haben von der Auto-Mafia abgeworben werden, die mit gestohlenen Fahrzeugen aus Westeuropa handelt“, erläuterte Dr. Maxwell.
Ina und Mark wechselten einen kurzen Blick.
Für die beiden SFO-Kämpfer ging es in erster Linie darum, irgendwann unauffällig ihre Ausrüstung aus dem Magirus zu bergen. Ob der Lkw wieder hergestellt werden konnte, war zweitrangig.
„Seien Sie nur vorsichtig“, warnte der britische Arzt. „Das, was Ihnen heue passiert ist, kann sich jederzeit wiederholen. Es sind einfach zu viele Waffen im Umlauf. Bevor die Rote Armee abzog, haben die schlecht verpflegten Soldaten teilweise ihre Ausrüstung verkauft. Ganze Waffendepots sind unter der Hand verschoben worden. Das macht sich natürlich bemerkbar. Auch wenn die Bewaffnung dieser kriminellen Banden nicht mehr auf dem neuesten Stand ist - sie reicht aus, um zu töten.“
10
Grenzübergang Feraschnaja, Südrahmanien
Montag 2300 OZ
Miro Karapok saß am Steuer eines Mercedes, dessen Heck ziemlich tief über dem Boden hing. Der Wagen war völlig überladen. Der Kofferraum vor voller Teppiche. Angeblich wertvolle Handarbeit aus Buchara. In Wahrheit billige Imitate. Auf der Rückbank stapelten sich Jeans-Hosen, Lederjacken und CD-Player.
Auf dem Beifahrersitz der Limousine, deren Karosserie bereits an mehreren Stellen durchgerostet war, saß Pierre Leclerque, der Kommunikationsfachmann des SFO-Teams.
Die Ausrüstung der beiden Männer war in der ziemlich altersschwachen Mercedes-Limousine versteckt. Der Wagen war aufwändig umgebaut worden. Spezialisten der Roten Armee hatten das erledigt. Eine Art Amtshilfe für die UN war das. In Rekordzeit hatten sie spezielle Fächer im Fußboden geschaffen, in der sich vor allem die Waffen verstauen ließen. Was die Kampfanzüge anging, so fielen sie in dem Wust von Sonderposten-Kleidung, die sich im Wagen befand, überhaupt nicht auf.
Schließlich konnte man auf den wilden Märkten Rahmaniens Uniformen und Ausrüstungsteile von mindestens einem Dutzend Armeen erwerben. Von Jacken der deutschen Bundeswehr bis hin zu Helmen der US-Army oder Stiefeln der russischen Streitkräfte.
Kampfanzüge mit den Emblemen der rahmanischen Armee waren natürlich auch darunter.
Karapok und Leclerque führten mehrere Garnituren davon in ihrem Wagen mit sich.
Vorgeblich handelte sich um Marktware.
In Wahrheit war es eine Möglichkeit für die beiden SFO-Kämpfer, sich gegebenenfalls zu tarnen.
Am meisten Sorgen bereitete Karapok jedoch die hoch empfindliche Kommunikationstechnik, die ebenfalls im Wagen verstaut war. Alles andere ließ sich notfalls ersetzen --- nicht aber Leclerques Spezial-Laptop, mit dessen Hilfe er in fremde Datensysteme einzudringen pflegte, wenn der Auftrag das erforderte.
Das Gerät befand sich zusammen mit ein paar anderen unersetzlichen Ausrüstungsgegenständen dort, wo sich normalerweise das Reserverad des Mercedes befunden hätte.
„Was soll ich machen, wenn die Grenzer mich ansprechen?“, fragte Leclerque. „Schließlich spreche ich weder Rahmanisch noch Russisch!“
Drei Stunden lang waren sie über schlaglochübersäte Pisten gefahren, ohne dass Karapok auch nur ein einziges Wort gesagt hatte.
Der wortkarge Russe war ein Einzelgänger, der erst langsam zur Teamarbeit bekehrt werden musste.
„Kein Problem“, behauptete er.
„Wieso kein Problem? Die merken doch gleich, dass ich kein Russe bin! Schließlich sprechen fast alle Rahmanier Russisch so gut wie ihre Muttersprache!“
„Besser!“, korrigierte Karapok. „Viele sprechen Russisch besser als Rahmanisch, weil in der Sowjetzeit nur die Beherrschung der russischen Sprache Karrierechancen eröffnete.“
„Neben einer Parteimitgliedschaft, wie ich annehme“, ergänzte Leclerque, der sich über Karapoks Redefluss nur wundern konnte. Zwei ganze Sätze in drei Stunden!, ging es ihm durch den Kopf. Was ist los mit ihm?
„Hör zu, Pierre“, fuhr Karapok fort. Die beiden Männer unterhielten sich auf Englisch, der in der SFO gängigen Arbeits- und Verkehrssprache. „Du hältst einfach den Mund. Ich garantiere, dass nichts passiert! Ich sage dann einfach, dass du nicht mehr sprichst, seit du ein halbes Jahr von tschetschenischen Rebellen gefangen gehalten wurdest!“
Die Piste mache jetzt eine Biegung. Das letzte Stück bis zur Grenze war sogar asphaltiert. Allerdings waren in der Vergangenheit wohl viele Militärtransporte über diesen Weg gegangen. Die Folgen waren unübersehbar. Die Kettenglieder der Panzer hatten sich regelrecht in den verhältnismäßig weichen Straßenbelag hineingedrückt.
Der Mercedes erreichte den Checkpoint an der Grenze.
Miroslav Karapok wurde aufgefordert auszusteigen. Er unterhielt sich mit den Grenzern auf Russisch und händigte ihnen mehrere Jeans-Hosen und zwei CD-Player aus. Daraufhin kehrte er zum Wagen zurück.
Er zwinkerte Leclerque zu.
Die Grenzer winkten sie durch.
„Man könnte denken, du hättest dein Leben lang nichts anderes getan, als Ware von zweifelhafter Qualität über irgendwelche Grenzen zu bringen“, staunte Leclerque.
Karapok gab keine Antwort.
Den Blick starr geradeaus gerichtet saß er hinter dem Steuer des Mercedes.
240 Kilometer bis Barasnij, stand auf einem Straßenschild.
Na großartig!, dachte Leclerque mit Blick auf den Schweiger neben ihm. Das wird sicher richtig lustig mit Miro!
11
Barasnij, Rahmanien
Dienstag 0215 OZ
Wie Schatten huschten Vanderlantjes und Furrer durch die Nacht.
Es herrschte strenge Ausgangssperre in Barasnij, aber die Truppen des Generals Zirakov waren nicht in der Lage, sie wirklich überall zu kontrollieren. Dazu verfügten sie nicht über die nötige Truppenstärke.
Offenbar glaubte der neue Herr im Regierungspalast nur gewissen Truppenteilen wie den Fallschirmjägern uneingeschränkt trauen zu können.
Die beiden SFO-Kämpfer hatten ihre Kampfausrüstung aus dem Magirus-Lastwagen geborgen und sich von unscheinbaren Zivilisten in Kommandokämpfer verwandelt. Mit der MP7 im Anschlag, Nachtsichtgeräten und einem Interlink-Headset zur Aufrechterhaltung einer permanenten Funkverbindung schlichen sie sich durch die Straßen.
Mit Hilfe von Navigationsgeräten konnten sie sich in der Stadt orientieren. Die Anlage Barasnijs als ehemalige sozialistische Musterstadt im rechtwinkligen Karoraster-Grundriss machte die Orientierung leichter.
Beide SFO-Soldaten trugen pechschwarze Masken, die das Licht absorbierten.
Der Umstand, dass zurzeit in Teilen von Barasnij Strommangel herrschte und die Straßenbeleuchtung recht spärlich war, kam ihnen entgegen.
Sie hielten sich vor allem an Nebenstraßen, um den Checkpoints auszuweichen.
Schon am Tag waren kaum Menschen in den Straßen gewesen. Die Angst vor marodierenden Banden oder der Willkür der Sicherheitskräfte und Elitesoldaten der Regierung war wohl zu groß. In der Nacht waren die Straßen so gut wie ausgestorben.
Wer jetzt noch unterwegs war, musste einen wirklich guten Grund dazu haben und war entweder Regierungssoldat, Angehöriger einer der zahllosen kriminellen Banden oder gehörte den Rebellen des Ex-Kanzlers Narajan an.
Die Übergänge waren letztlich fließend, wie Furrer und Vanderlantjes sehr wohl bewusst war. Selbst in der Zeit, als Narajan noch die Volksmeinung auf seiner Seite wusste, waren ihm immer wieder intensive Kontakte zur kriminellen Szene vorgeworfen worden.
Aber über derartige Kontakte verfügte vermutlich auch General Zirakov.
Block um Block arbeiteten sich die beiden Elitesoldaten vor.
Ihr größter Schutz war dabei die Dunkelheit.
Wenn es wirklich zu einem Gefecht kam, waren sie zwar auf Grund ihrer überlegenen Ausbildung und Bewaffnung in der Lage, sich zu verteidigen und wieder unterzutauchen. Aber wenn nur der geringste Verdacht entstand, dass sich Angehörige einer ausländischen Elitetruppe im Land befanden, die in der Nähe der deutsch-französischen Botschaft operierten, so geriet das gesamte Unternehmen FREE WILLY in Gefahr.
Eine landesweite Fahndung wäre die Folge gewesen. Alle Grenzen wären sofort geschlossen worden und das Augenmerk der Sicherheitskräfte hätte sich auf die vermeintlichen Invasoren gerichtet.
Also war Vorsicht die oberste Devise.
Das Ziel der beiden SFO-Kämpfer war die Botschaft.
Mark und Inas Aufgabe war es, die Lage zu sondieren, bis der Rest von Colonel Breckinridges SFO-Team in Barasnij eingetroffen war.
Wenn alles nach Plan ging, war das spätestens am nächsten oder übernächsten Tag der Fall.
Je näher die beiden dem Viertel kamen, in dem sich das Palais Ragowski befand, desto größer schien die Dichte der Straßensperren und Checkpoints zu werden. Selbst kleinere Nebenstraßen waren abgeriegelt und wurden anscheinend rund um die Uhr bewacht.
Die beiden kauerten im Schatten einer Türnische.
Bis zum nächsten Checkpoint waren es gerade fünfzig Meter. Die Stimmen der Soldaten waren zu hören. Ihre Zigaretten leuchteten wie Glühwürmchen.
„Die Gegend um die Botschaft scheint vollkommen abgeriegelt zu sein“, meinte Mark.
„Aber wir müssen näher heran, wenn wir die Lage sondieren wollen.“ Ina atmete tief durch. „Hast du einen Vorschlag?“
Mark deutete auf den Gullydeckel. „Über das Abwassersystem müssten wir es schaffen.“
„Auch das noch!“
„Hör zu, du bist bei der SFO, nicht bei einer Parade-Truppe, deren Aufgabe es ist, gut auszusehen!“
„Oder gut zu riechen!“, ergänzte Vanderlantjes. „Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn Carlo oder Mara dich auf diesen Einsatz begleitet hätten.“
„Aber nur eine Ärztin konnte unbehelligt und auf direktem Weg nach Barasnij gelangen, ohne Misstrauen zu erregen.“
„Auch wieder wahr.“
Mark deutete in die Richtung, aus der sie gekommen waren.
„Wir müssen ein Stück zurück, dort können wir in aller Ruhe in einen Gully steigen.“
„Das ganze ist ein Glücksspiel“, wandte Ina ein. „Schließlich wissen wir nicht, wo wir herauskommen. Das Navigationssystem dürfte da unten keinen Kontakt zum Satelliten haben.“
„Aber der Kompass funktioniert dort. Wir halten uns einfach in Richtung der Botschaft, steigen aus, wenn wir das Gefühl haben, nahe genug dran zu sein und...“
„Müssen hoffen, nicht dem nächsten Posten vor die MPi zu laufen.“
Mark nickte. „Richtig.“
Sie schlichen in geduckter Haltung zurück. Immer bemüht sich in den Schattenzonen aufzuhalten.
Mark ging voran.
Ina Vanderlantjes sicherte nach hinten und behielt dabei die Soldaten am Checkpoint im Auge. Mit Hilfe des Nachtsichtgeräts konnte sie die Männer klar erkennen. Sie alberten herum.
Gut so, dachte Ina. Das erleichtert uns den Job.
Wenig später hatten die beiden eine Seitengasse erreicht. Sie lösten einen Gullydeckel und stiegen in die Tiefe. Ein bestialischer Gestank schlug ihnen entgegen. Das Abwassersystem von Barasnij war wohl erheblich renovierungsbedürftig. Mark registrierte Risse im Beton.
Sämtliche Hinweise und Schilder waren in kyrillischen Buchstaben geschrieben. Da das Land kurz nach seinem Ausscheiden aus der GUS
auf das lateinische Deltabet umgestellt hatte, bedeutete dies, dass seit über einem Jahrzehnt hier unten alles beim Alten geblieben war.
Furrer und Vanderlantjes marschierten durch einen röhrenartigen Abwassertunnel, wateten teilweise bis zu den Knien durch eine übel riechende Brühe.
In den Tagen vor ihrer Ankunft hatte es in Rahmanien stark geregnet. Dass der Wasserstand in den Abwasserkanälen trotzdem verhältnismäßig niedrig war, musste wohl damit zu tun haben, dass die Kanäle nicht mehr dicht waren. Ein Teil des Wassers ging durch Ritzen und Spalten im Beton verloren, bahnte sich seinen eigenen Weg und untergrub Straßen und Gebäude. Eine Zeitbombe.
Eine halbe Stunde marschierten sie geradeaus, dann verzweigte sich der Kanal. Sie entschieden nach rechts zu gehen.
Nach einer weiteren Dreiviertelstunde wagten sie den Ausstieg.
Sie kamen in einer verwaisten Seitengasse wieder an die Oberfläche.
Beide atmeten tief durch, sogen die frische Nachtluft in sich hinein.
Sie blickten sich um.
Die MP7 immer schussbereit.
Ein Geländewagen russischer Bauart fuhr die Straße entlang. Das Motorengeräusch durchdrang die gespenstische Stille. Vanderlantjes und Furrer schnellten geduckt hinter ein Autowrack am Straßenrand, das komplett ausgeschlachtet worden war und weder Reifen noch Scheiben besaß.
Der Geländewagen hielt mit quietschenden Reifen.
Fünf uniformierte Bewaffnete sprangen herunter. Elitesoldaten des rahmanischen Militärs. Sie trugen Sturmhauben und G-3-Sturmgewehre aus deutscher Produktion, die Rahmanien im Zuge seiner Mitgliedschaft in der so genannten „Partnerschaft für den Frieden“ erhalten hatte.
Die Soldaten schwärmten aus.
Ina und Mark kauerten am Boden.
Fünf Mann --- ein sechster verharrte hinter dem Steuer des Geländewagens. Mark überlegte, wen er zuerst ausschalten musste, falls sie entdeckt wurden.
Sie kauerten im Schatten.
Die Rahmanier verfügen nicht über Nachtsichtgeräte.
Ein Trumpf für die beiden SFO-Kämpfer.
Nur zwei aus der Truppe hatten Taschenlampen dabei, deren Lichtkegel umhertanzten.
Einige Worte wurden auf Rahmanisch gewechselt.
Wenig später stiegen die Männer wieder auf ihren Geländewagen, der daraufhin davonbrauste.
„Noch einmal gut gegangen, was?“, meinte Mark.
Ina blickte auf das Display ihres Navigationssystems.
„Keine hundert Meter mehr bis zur Botschaft“, stellte sie fest.
„Gratulation für deinen räumlichen Instinkt!“
„Anerkennende Worte aus deinem Mund --- das ist ja mehr wert, als eine Belobigung durch den Generalsekretär persönlich!“
„Bild dir nur nichts drauf ein!“
Er lachte. „Keine Sorge!“
12
Vor dem Palais Ragowski --- einem der wenigen älteren Gebäude im Stadtbild von Barasnij --- befand sich der Rohbau eines zwanzigstöckigen Büroturms. Eine Bauruine, an der in den letzten zwei Jahren nichts mehr gemacht worden war. Angesichts der immer instabiler werdenden Lage im Land, hatten die ausländischen Investoren wohl kalte Füße bekommen und sich nach und nach aus dem Projekt zurückgezogen.
Von dort aus konnte man das Botschaftsgelände hervorragend beobachten.
Noch weiter zum Palais vorzudringen wäre auch schwierig gewesen.
Bewaffnete Posten patrouillierten vor der hohen Mauer, die das eigentliche Botschaftsgelände umgab.
Vanderlantjes und Furrer stiegen in das fensterlose Betonskelett.
Ein halb großformatiges Schild in Englisch und Rahmanisch verriet, dass der so genannte Future Tower vor einem Jahr hätte fertig werden sollen, wenn die ursprüngliche Planung eingehalten wäre. Jetzt war es fraglich, ob aus dem Projekt überhaupt noch etwas wurde.
Es gab keinerlei Fenster. Von den Aufzügen existierten nur die Schächte. Ratten huschten zwischen den kahlen Betonwänden herum.
Noch nicht montierte Stahlgitter und Rohre lagen auf dem Boden herum.
Die beiden SFO-Kämpfer gelangten in den siebten Stock.
Marks Berechnung nach, war dort die Aussichtsposition in Bezug auf das Botschaftsgelände ideal.
Sie pirschten sich an die zum Palais Ragowski ausgerichtete Fensterfront heran.
Auf der anderen Seite war alles ruhig.
„Scheint alles abgedunkelt zu sein“, meinte Ina. „Was mich wundert ist das Verhalten der Rahmanier.“
Mark verstand sofort, worauf sie hinauswollte.
„Die scheinen mehr daran interessiert zu sein, niemanden in die Botschaft zu lassen, als dass sie einen Ausbruch der Geiselnehmer verhindern wollen.“
„Was die Theorie stützt, dass es tatsächlich General Zirakovs Leute sind, die dahinter stecken!“
„Jedenfalls wird das ein hartes Stück Arbeit, die Botschaftsangehörigen dort herauszuholen!“
Ein Geräusch ließ beide SFO-Soldaten zusammenzucken.
Mark wirbelte herum, riss die MP7 hoch.
Er spürte, wie etwas in seinen Oberarm eindrang.
Dorthin, wo keine Splitterweste ihn schützte.
Ein Nadelprojektil drang durch den Stoff des Kampfanzugs.
Mark versuchte, die MP7 abzudrücken, aber sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Alles begann sich vor seinen Augen zu drehen. Er sank zu Boden. Ina erging es nicht besser. Nur Sekundenbruchteile nachdem Mark getroffen worden war, wurde sie von einer Nadel am Oberschenkel erwischt. Sie konnte weder schreien noch ihre Waffe abdrücken.
Mit einem dumpfen Geräusch sank sie zu Boden.
Eine sich schattenhaft gegen das durch die offene Fensterfront eindringende Licht abhebende Gestalt ging auf die beiden zu, drehte sie mit dem Fuß herum.
Es folgte ein leiser Fluch in rahmanischer Sprache.
13
In der Nähe von Djarenagrad, 30 Kilometer von Barasnij entfernt
Dienstag 0410 OZ
Mara Henriquez war die erste, die festen Boden unter den Füßen hatte, die Flossen abstreifte und das rutschige Flussufer empor kletterte.
Die Ausrüstung zog sie ein Stück hinter sich her. Dann holte sie ihre MP7 aus dem wasserdichten Behälter, stieg noch etwas höher und sondierte die Lage. In einiger Entfernung befand sich ein Waldgebiet.
Eine Straße zog sich in Richtung der kleinen Ortschaft Djarenagrad.
Als nächster tauchte Breckinridge aus dem dunklen Flusswasser auf und stieg an Land.
Er nahm die Taucherbrille ab und verzog das Gesicht. Auf den letzten Kilometern war die Djarena eine Kloake mit trübem, schlammigem Wasser gewesen. Alles andere als ein attraktives Tauchrevier.
Breckinridge zog seine Tauchermaske vom Kopf.
„Alles klar!“, rief Henriquez ihm zu. „Keinerlei Feindkräfte in der Nähe.“
Breckinridge nickte zufrieden.
Bis Barasnij hatten sie noch einen beträchtlichen Fußmarsch zurückzulegen.
Breckinridge begann sofort damit, den Taucheranzug abzustreifen.
Innerhalb weniger Augenblicke verwandelte er sich in einen voll ausgerüsteten Kommando-Kämpfer. Die Zeit drängte. Nur wenige Stunden Dunkelheit blieben ihnen noch, die sie nutzen mussten, um so weit wie möglich querfeldein Richtung Barasnij zu marschieren. Den Tag über würden sie irgendwo kampieren müssen. Angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse nach General Zirakovs Umsturz war es zu riskant, am Tag weiter zu marschieren.
Breckinridge schloss die Koppel seines Kampfanzugs. „Wo bleibt denn Tarvisio?“, fragte er.
„Wenn man vom Teufel spricht...“, murmelte Henriquez grinsend, als sie den Italiener aus dem trüben Wasser auftauchen sah. Triumph leuchtete in ihren Augen. „Na, was ist mit deinen Schwimmhäuten los, Carlo?“
Tarvisio machte nur eine wegwerfende Handbewegung und fluchte etwas Unverständliches vor sich hin.
„Beeilen Sie sich!“, forderte Breckinridge. „In Barasnij werden wir gebraucht!“
Innerhalb weniger Minuten hatten sich alle drei SFO-Spezialisten in voll ausgerüstete Elitesoldaten verwandelt. Das Interlink war aktiviert.
Mit Hilfe der Nachtsichtgeräte und ihres Navigationssystems würden sie sich problemlos orientieren können. Die Taucherausrüstung wurde an einer geschützten Stelle vergraben. Dasselbe geschah mit den wasserdichten Behältern, in denen sie ihre Ausrüstung transportiert hatten.
Die drei SFO-Kämpfer nahmen ihr Marschgepäck auf und folgten den Anweisungen ihres Navigationssystems.
Tarvisio bemerkte wie Henriquez sich zwischendurch den Oberschenkel rieb.
„Na, Probleme damit, sich wieder an die Schwerkraft zu gewöhnen?“
Mara verzog das Gesicht.
„Du kennst so was natürlich nicht, Mister Super-Kondition!“
Tarvisio grinste.
„Könnte vielleicht daran liegen, dass ich im Gegensatz zu dir meine Kräfte besser eingeteilt habe und nicht versucht habe, um jeden Preis als Erster aus dem Wasser zu steigen!“
Mara machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Du kannst doch nur nicht verlieren!“, meinte sie.
Die drei SFO-Kämpfer näherten sich der Straße.
Die Scheinwerfer eines Wagens leuchteten auf.
Henriquez, Breckinridge und Tarvisio duckten sich augenblicklich ins hohe Gras.
Mehrere Geländewagen des rahmanischen Militärs fuhren auf die Ortschaft Djarenagrad zu, eine Stadt von maximal 5000 Einwohnern.
Die drei SFO-Soldaten warteten, bis die Militärfahrzeuge verschwunden waren.
„Weiter!“, forderte Breckinridge.
Sie kreuzten schließlich die Straße und bewegten sich querfeldein Richtung Westen.
In einer Stunde war Sonnenaufgang.
Danach hatten sie vielleicht noch eine halbe Stunde Morgendämmerung, ehe sie sie sich einen Unterschlupf für den Tag suchen mussten.
Schweigend marschierten sie vorwärts.
Siedlungen gingen sie aus dem Weg, schlugen sich durch kleinere Waldgebiete und Felder.
Im Morgengrauen erreichten sie ein verlassenes Industriegelände mitten in der Landschaft. Mehrere Fabrikhallen eines ehemaligen sowjetischen Chemiekombinates befanden sich neben einem vierstöckigen, quaderförmigen Gebäude, in dem sich wohl früher Labors und Büros befunden hatten.
Ein paar völlig ausgeschlachtete Lastwagen standen noch auf dem Kombinatsgelände.
„Das ist doch ein Ort, der wie geschaffen dafür ist, den Tag zu verbringen!“, meinte Breckinridge.
14
Mark erwachte. Er hatte Kopfschmerzen.
„Ganz ruhig!“, sagte eine Männerstimme.
Mark stellte fest, dass die MP7 nicht mehr in seiner Rechweite war.
Auch hatte man ihm Helm, Nachtsichtgerät und Sturmhaube abgenommen.
Mit Ina war dasselbe geschehen.
Sie lag zwei Meter entfernt und kam ebenfalls gerade wieder zu sich.
Eine Gestalt in dunkler Kleidung stand vor ihnen. Das Gesicht wurde von einer Sturmhaube bedeckt. Er hatte die zwei MP7-Gewehre bei sich, die er offenbar Vanderlantjes und Furrer abgenommen hatte.
Eines hing über der Schulter, das das andere hielt er im Anschlag.
„Ich nehme an, dass Sie die Personen sind, mit denen ich Kontakt aufnehmen soll“, sagte der Mann. Er sprach Englisch. Der Akzent war kaum zu hören. „Zumindest sind die falschen Papiere, die Sie bei sich tragen auf die Namen ausgestellt, die man mir angekündigt hat!“
Mark stutzte.
„Dann sind Sie...“
„Boris“, vollendete der Mann. „Nennen Sie mich Boris. Alles andere tut nichts zur Sache.“
Bei Mark und Ina klingelte es.
Boris war ein ehemaliger CIA-Kontaktmann. Früher hatte er auch für den rahmanischen Geheimdienst gearbeitet, bis er nach der Wahl von Kanzler Narajan in Ungnade gefallen und entlassen worden war.
Für ein gutes Honorar war er bereit, das SFO-Team zu unterstützen und seine alten Verbindungen spielen zu lassen.
„Ich nehme an, Sie haben ein mehr oder weniger ausführliches Dossier über mich gelesen“, vermutete Boris.
„Stimmt“, sagte Mark.
„Vergessen Sie besser alles, was darin steht. Es stimmt fast nichts davon.“
„Für uns ist wichtiger, ob wir Ihnen trauen können“, erwiderte Mark.
„Können Sie!“
Boris warf Mark die MP7 zu. Der Lieutenant fing sie sicher.
Im ersten Moment war Mark überrascht.
„Ich möchte Ihr Gesicht sehen“, verlangte er dann.
„Ach, hat man Ihnen Fotos von mir gezeigt?“, fragte Boris. Mark ging nicht weiter darauf ein.
Boris zögerte noch, zog aber dann seine Sturmhaube vom Kopf.
Durch die offenen Fenster fiel nur spärliches Licht auf Boris' hageres Gesicht. Mark schätzte den Verbindungsmann der CIA auf Mitte fünfzig.
Allerdings wirkte er für sein Alter sehr athletisch. Ina war noch nicht ganz wieder beieinander. „Was ist das für ein Zeug, mit dem Sie uns ausgeschaltet haben?“, fragte sie und betastete den Oberschenkel, wo das Nadelprojektil sie getroffen hatte. Es war nicht mehr dort. Boris musste es entfernt haben.
„Hat sich bei der Betäubung von Tieren hervorragend bewährt“, erklärte Boris. „Sie werden vielleicht noch ein oder zwei Stunden ein leichtes Ziehen spüren, dann ist es vorbei.“ Er griff an das Futteral an seinem Gürtel. „Ich habe mir die dazugehörige Luftdruckpistole so umgebaut, dass sie bis zu fünf Nadeln kurz hintereinander abfeuern kann.“
Er ging auf Ina zu, half ihr auf und reichte ihr ihre Waffe. „Es tut mir leid, ich hatte hier nicht mit Ihnen gerechnet und Sie für rahmanische Sicherheitskräfte gehalten.“
Ina nickte. „Okay, Boris. Eigentlich sollten Sie uns ja erst morgen kontaktieren! Was machen Sie hier?“
„Wir hatten offenbar dieselbe Idee. Dieser Tower ist ein hervorragender Aussichtspunkt, um das Botschaftsgelände im Auge zu behalten. Ich habe die letzten Nächte hier oben verbracht und in Ihnen einige interessante Neuigkeiten mitteilen...“
„Raus damit!“, forderte Mark.
Boris hob die Hände.
„Nicht so schnell!“
„Sie sind für Ihre Dienste gut bezahlt worden, soweit ich informiert bin.“
„Dafür habe ich auch meinen Job erledigt. Fahren Sie zur Nummer 4321 der Straße des 1. Mai. Das liegt in den Außenbezirken von Barasnij. Dort befinden sich die Fabrikhallen eines ehemaligen Spielwarenkombinats. Das ganze Gelände steht heute leer. Neue Investoren wollen diese alten Ruinen aus der Zeit des Kommunismus nicht übernehmen und bauen lieber was Neues auf die grüne Wiese.“
„Verstehe.“
„Sie finden dort alles, was sie brauchen. Ein paar unauffällige Fahrzeuge mit rahmanischen Kennzeichen und was ich sonst noch besorgen sollte. Außerdem können Sie das Gelände als Operationsbasis benutzen. Es wird durch einen Zaun geschützt, der unter normalen Umständen unüberwindbar ist.“ Boris grinste. „Schließlich ist das alles volkseigene Konkursmasse, die geschützt werden muss. Aber ich verfüge eben über gute Beziehungen, die es erlauben...“
„Wie kommen wir auf das Gelände?“, unterbrach Mark sein Gegenüber.
„Tippen Sie die Zahlenkombination 334667111 in das elektronische Schloss. Merken Sie sich das oder schreiben Sie es sich auf, ganz wie Sie wollen.“ Boris machte eine Pause. Er trat näher an die Fensterfront.
Mark blieb in seiner Nähe. Der V-Mann deutete hinüber zur Botschaft.
„Die neuen Informationen, die ich habe sind sicherlich zwanzigtausend Euro extra wert“, sagte er.
„Wir sind nicht mit einem Geldkoffer angereist!“, gab Mark zu bedenken.





























