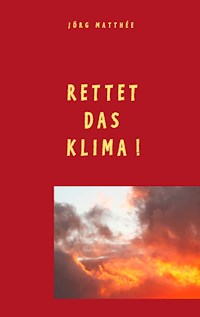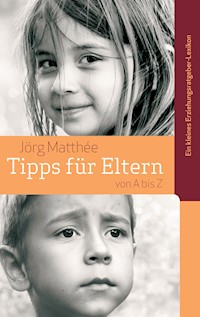
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Tipps für Eltern von A bis Z bringen auf den Punkt, worauf es in der Erziehung von Kindern ankommt. Für Eltern, die nicht mehrere Bücher zu verschiedenen Themen lesen wollen, sondern das Wesentliche zur Erziehung in einem Taschenbuch. Empfehlenswert auch für alle, die mal Eltern werden wollen oder in Ausbildung oder Beruf mit Erziehungsfragen zu tun haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Die Tipps für Eltern von A bis Z bringen auf den Punkt, worauf es in der Erziehung von Kindern ankommt.
Für Eltern, die nicht mehrere Bücher zu verschiedenen Themen lesen wollen, sondern das Wesentliche zur Erziehung in einem Taschenbuch.
Empfehlenswert auch für alle, die mal Eltern werden wollen oder in Ausbildung oder Beruf mit Erziehungsfragen zu tun haben.
Der Autor
Jörg Matthée ist Familienvater, Psychologe, Psychotherapeut, Pädagoge und Soziologe. Er arbeitet seit vielen Jahren in Beratung und Therapie mit Kindern, Jugendlichen und Eltern.
Inhalt
Vorwort
Anfassen, erfassen und begreifen
Ängste und Schutz
Aufräumen
Augenhöhe
Auseinandersetzung: miteinander reden
Autorität
Bewegung und Sport
Beziehungsebene
Ehrlichkeit und Authentizität
Eigene Erfahrungen
Einschlafen
Ekel und Abwehr
Eltern-Rivalität
Ernst nehmen
Feste feiern
Forscher-Geist: Kinder wollen lernen
Freunde
Geschwister
Gesunde Ernährung – ganz von selbst
Gesundes Misstrauen gegenüber Fremden
Getrennte Eltern
Glück
Grenzen und Halt
Größenphantasien und Enttäuschungen
Hilfen für Eltern
Höhen und Tiefen
Humor
Kinder- und Jugendschutz
Konflikte klären
Konsum
Krankheit und Gesundheit
Kränkungen
Kulturelle Anregungen
Kuscheln
Langeweile
Laute Lebensfreude
Lehrer
Licht und Schatten
Liebe und Bindung
Loslassen
Mädchen und Jungen
Medien
Mein Körper
Mobbing
Natur
Neugier
Offene Wunden
Pubertät
Raum und Heim
Resonanz und Rückmeldungen
Respekt vor Kindern und von Kindern
Ringen um den Kontakt
Ruhe bewahren
Sauberkeit
Selbst entscheiden und gestalten: zwei Möglichkeiten
Selbst-bewusst-sein
Sexualität
Singen und musizieren
Sinn-volle Erziehung
Sorge
Spielen
Stärker durch Krisen: Wachstum
Stopp-Regel
Streit und Versöhnung
Taschengeld
Tiere
Träume
Verhandeln statt anordnen
Vertrauen, Zutrauen
Vom Tag erzählen
Vorbilder
Vorlesen und lesen
Welt
Werte
Wertvolle Gefühle
Wiederholungen
Wissen und Glauben
Wünsche
Wut, Ärger und Grenzen
Zeit
Zukunft
Nachwort
Vorwort
Nicht alle Eltern wollen einen dicken Ratgeber lesen. Bei diesem Buch habe ich daher versucht, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Jedes Kapitel enthält einen Tipp, der aus einem oder zwei Sätzen besteht. In der Kürze liegt die Würze. Auf das Wesentliche kommt es an.
Dieses Buch habe ich aus meiner langjährigen beruflichen Praxis heraus geschrieben. Mein Anliegen ist gewesen, ein für die alltägliche Erziehung praktikables Buch zu schreiben. All diese Inhalte sind in meiner Beratungsarbeit viele Male erprobt – und ich möchte dafür den vielen Klientinnen und Klienten, Eltern, Kindern und Jugendlichen danken, die ich in meinem bisherigen Berufsleben betreuen durfte. Dieses Buch streift viele Themen, ohne sie jedes Mal ganz zu vertiefen. Und es ist eine Sammlung von Erziehungstipps von A bis Z, ohne dass diese in eine feste Struktur oder Ordnung gegossen werden. Es unterscheidet sich damit bewusst von einer wissenschaftlichen Abhandlung und orientiert sich eher am manchmal chaotischen Erziehungsalltag. Meine Absicht und Hoffnung ist dabei, dass so der eine oder andere Aspekt in einer leichteren Form bei den Lesern andocken kann als in einer streng strukturierten Form. Auch damit knüpft dieses Buch an meine Beratungsarbeit an, in der sinnvolle Veränderungen der Ratsuchenden jeweils auf deren eigene Erfahrungen aufbauen, nicht nach Plan, sondern in bunter Vielfalt. Neben meiner Beratungsarbeit ist ganz selbstverständlich auch voll und ganz mein eigenes Vater-Dasein mit all seinen Höhen und Tiefen in dieses Buch eingeflossen. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn das nicht der Fall wäre, und wohl auch gar nicht möglich. Ohne diese eigenen Eltern-Erfahrungen (und damit sehr hautnahe Möglichkeiten der Überprüfung des Geschriebenen) hätte ich mich wohl auch gar nicht getraut, solch einen Ratgeber zu schreiben und zu veröffentlichen. Herzlichen Dank an meine Familie für viele Anregungen und Ideen für dieses Buch. Ich hoffe, dass Sie als Leser wirksame Hinweise für Ihren Erziehungsalltag aus diesem Buch mitnehmen können. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie gute Wegbegleiter beim Aufwachsen Ihrer Kinder sein können.
Im Vordergrund dieses Buches stehen allgemeine Überlegungen, worauf es in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus meiner Sicht ankommt. Der Schwerpunkt des Buches zielt somit ab auf grundsätzliche Haltungen, Werte und Sinnverständnis in der Erziehung. Die Beispiele dazu erleben Eltern im Alltag selbst in vielen Variationen. Meine Erfahrung als Erziehungsberater ist, dass es oft für Eltern hilfreicher ist, wenn eine grundsätzliche Haltung zu einer Erziehungsfrage erlangt werden kann. Wer eher einen vorwiegend an Beispielen orientierten Erziehungsratgeber lesen möchte, sei zum Beispiel das Buch von Jan-Uwe Rogge „Erziehung – Die 111 häufigsten Fragen und Antworten“ empfohlen. Dem lexikalischen Charakter meines Buches ist geschuldet, dass manche Gedanken der Vollständigkeit wegen in verschiedenen Kapiteln vorkommen. Auf Querverweise verzichte ich, weil es das Lesen meines Erachtens eher behindert. Dieses Buch ist ein Begleitbuch zur praktischen Erziehungsberatung und kann diese nicht ersetzen. Wer sich für das grundsätzliche Verständnis der Erziehung interessiert, kann jedoch darin viele Anregungen finden. Die Tipps dieses Buches sind oft pur, kurz und knapp, manchmal pragmatisch. Wer das ganze Buch liest, wird dennoch merken, dass die Tipps im Gesamten eine Haltung vermitteln, die von Werten, Bedeutungen und Sinn geprägt ist.
Zwei zentrale Gedanken sollen am Schluss dieses Vorwortes stehen. Erstens: all diese Erziehungstipps haben wenig Wert ohne eine grundlegende liebende Haltung zum Kind, die eine gute Bindung des Kindes zu seinen Eltern ermöglicht. Zwar kann der eine oder andere Tipp auch eine Erleichterung an sich darstellen, seine ganze Kraft entfalten kann ein Tipp jedoch nur im Rahmen von Liebe und sicherer Bindung. Und zweitens: immer glückliche Kinder gibt es nicht. Es gibt nur manchmal glückliche Kinder. So ist das Leben. Aber wir Eltern können viel dafür tun, dass manchmal häufiger ist.
Jörg Matthée
Anfassen, erfassen und begreifen
Kinder lernen die Welt kennen, indem sie die Dinge dieser Welt begreifen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie fassen etwas an und erfassen es so. Mit all ihren Sinnen. Sie ertasten es, fühlen es, riechen es, hören es, manchmal schmecken sie es. Das machen Kinder mit Vergnügen, spielerisch. Sie entdecken so die Welt. Meistens lassen sie sich ganz viel Zeit dabei.
Ein Beispiel: Einen ganzen Tag oder mehr können viele Kinder sich damit beschäftigen, Schnecken zu erkunden. Sie lassen die Schnecken durch die Landschaft, über Gegenstände oder Körperteile kriechen und fühlen, wie klebrig sich das anfühlt. Sie veranstalten Schneckenrennen und entdecken, auf welchen Materialien sich eine Schnecke besser fortbewegen kann. Mit ihren Händen begreifen sie die Schnecke, verstehen sie als Lebewesen. Sie erfassen vielleicht, wovon die Schnecke sich ernährt.
Kinder spüren dabei das Glück, ein Stück der Welt zu begreifen. Die Langsamkeit der Schnecke ist ideal für diese Erfahrung. Das ist nicht Unsinn, sondern Sinn. Wiederum im wahren Sinne des Wortes: eine sinn-liche Erfahrung, bei der ein Stück Welt begriffen werden kann. Diese Erfahrungen für Kinder gibt es im Original nur in der Natur, auf jeden Fall nur im Kontakt mit der Natur. Das kann natürlich auch beispielsweise im Kontakt mit Tieren (nicht nur Haustieren, sondern auch Insekten und anderen Lebewesen), Pflanzen oder Natur-Materialien im Haus oder in der Wohnung sein. Entscheidend ist, dass das Begreifbare anfassbar ist.
Kein Ersatz dafür ist die Welt der Medien. Kein Fernseher oder Computer kann diese beschriebenen Erfahrungen den Kindern vermitteln. Forschungen haben ergeben, dass Kinder, die überwiegend in einer Lebensweise mit Medien aufwachsen, erhebliche Defizite in der motorischen Entwicklung aufweisen. Und da Körper und Geist nicht unabhängig voneinander existieren, sind auch Auswirkungen auf die geistige Entwicklung der Kinder zu befürchten, wenn Kinder aufwachsen, ohne die Welt wortwörtlich zu begreifen.
Manche Eltern halten ihre Kinder von diesen hautnahen Erfahrungen ab, statt diese zu fördern. Sie tun das beispielsweise aus eigenen Gefühlen des Ekels oder der Angst vor Schmutz oder Krankheit. Oder sie tun das, weil sie es selbst so gelernt oder erfahren haben. Oder aus reiner Vorsicht. Zumeist also in bester Absicht. Damit greifen sie jedoch leider in nicht guter Weise in die Welt-Erfahrung ihrer Kinder ein. Kinder wissen manchmal halt besser, was ihnen gut tut.
Tipp: Ein Kind spielt gerne so, dass es die Welt mit den Händen anfassen, erfassen und begreifen und auf diese Weise mit all seinen Sinnen verstehen kann.
Ängste und Schutz
Es mag zu den größten Missverständnissen in der Erziehung gehören, dass die Angst von Kindern etwas ist, das es zu beseitigen gilt. „Hab‘ keine Angst!“ heißt die Aufforderung dann zum Beispiel. Das ist in der Regel gut gemeint. Und tatsächlich hat die Aufforderung „Hab‘ keine Angst!“ auch eine gute Seite, nämlich zu beruhigen und Mut zuzusprechen. Soweit ist das also – zum Teil – auch in Ordnung. Aber häufig wird damit die sinnvolle Funktion der Angst übersehen: Angst schützt. Gerade die kindliche Angst reguliert die Erfahrung, bremst etwas ab und mahnt zur Vorsicht. Das ist durchaus sinnvoll, damit das Kind nicht immerzu auf die Nase fällt. Ein Kind kann die Gefahren des Lebens noch nicht so gut einschätzen. Dabei ist es normal, dass es sich den einen oder anderen Kratzer zufügt. Auch erlittene Kratzer sind Lernerfahrungen. Das regulierende Gefühl jedoch ist die Angst. Sie achtet darauf, dass ein Kind nicht in gefährliche Situationen stürzt, sondern sich an sie herantastet.
Ein Beispiel: Ein Kind, das in einen unbekannten Fluss springt, um zu baden, handelt nicht mutig, sondern leichtsinnig. Schützende Angst würde es dazu bewegen, zunächst die Fluss-Tiefe und die Fluss-Strömungen an der Badestelle vorsichtig zu erkunden.
Kinder und auch Erwachsene, die keine oder kaum Angst spüren, haben ein höheres Unfallrisiko als Kinder und Erwachsene, die ihre Ängste spüren und als regulierend für ihre Lebenserfahrungen nutzen.
Wirklich mutige Kinder wachsen nicht damit auf, dass sie ihre Angst verleugnen, sondern dass sie Gefahren realistisch einschätzen lernen. Wirklicher Mut enthält somit Selbst-Bewusstsein in dem wörtlichen Sinn, dass sich Kinder ihrer selbst mitsamt ihren Gefühlen, auch ihrer Angst, bewusst sind.
Tipp: Ein Kind sollte von den Eltern so begleitet werden, dass es seine Ängste nicht verleugnen muss, sondern als regulierend und schützend für seine eigenen Lebenserfahrungen nutzen kann.
Aufräumen
Über wenig anderes gibt es in Familien so viel Streit und Ärger wie über das Aufräumen. Unordnung im Kinderzimmer, im Flur stehende Schulsachen, im Badezimmer hingeschmissene Kleidungsstücke sind häufig Auslöser für den Ärger der Eltern. Kinder nehmen es von selbst oft nicht so genau mit der Ordnung ihrer Sachen. Auch einfache Appelle nutzen da meistens wenig. Dabei setzen Eltern manchmal zu viel voraus oder sind selbst auch nicht die besten Vorbilder.
Eine Ordnung finden und halten können setzt, das wird leicht übersehen, ein entsprechendes ordentliches, strukturiertes Denken voraus. Und dafür braucht es etwas Übung. Kinder lernen Ordnung und Struktur am besten, wenn sie in nicht übertriebener, aber regelmäßiger Weise darin begleitet werden, eine Ordnung zu finden, zum Beispiel in ihrem Kinderzimmer. Dazu gehört zunächst einmal, gemeinsam mit dem Kind eine Ordnung zu suchen für die Vielfalt von Sachen, die es gibt: für Wäsche, Spielzeug, Bücher, CDs, Schulsachen und vieles mehr. Für all diese Dinge sind natürlich entsprechend passende Plätze in einem Schrank, in Schubladen, Regalen oder Kartons nötig, die möglichst auch noch sinnvoll angeordnet sind. Wichtig ist, diese Schritte bereits gemeinsam mit dem Kind zu entwickeln und nicht über dessen Kopf hinweg. Einmal täglich, am besten abends, braucht ein Kind dann noch jahrelange Begleitung darin, dass es zum Abschluss des Tages all die Dinge, mit denen es am Tag intensiv gespielt oder gearbeitet hat, wieder an die üblichen Plätze zurück räumt. Das sollten Eltern in der Regel nicht für das Kind tun, sondern es einfach dabei begleiten. Eltern können ihr Kind ganz gelassen oder sogar spielerisch dabei unterstützen, die passenden Plätze zu finden. So entspannt kann Aufräumen auch Spaß machen. Es geht nicht darum, Druck auf das Kind auszuüben, sondern Aufräumen als eine Selbstverständlichkeit zu praktizieren so wie das Zähneputzen. Im Lauf der Jahre wird es dann auch für das Kind zur Selbstverständlichkeit, vielleicht sogar zum Bedürfnis. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen von der Regel: zum Beispiel, wenn ein Kind etwas Interessantes gebaut hat, wird sicherlich eine Möglichkeit zu finden sein, dieses Werk für einige Tage stehen zu lassen.
Tipp: Ein Kind braucht insbesondere in den ersten Lebensjahren Begleitung dabei, Ordnung und Struktur in seinen Sachen und damit auch in seinem Denken zu finden.
Augenhöhe
Es kommt nicht so selten in Familien vor, dass Kindern etwas hinterher gerufen wird, vielleicht noch um eine Ecke herum oder über den Flur, vielleicht in gereiztem, ermahnendem Ton. Nicht weniger selten passiert es, dass Kinder während ihres Spielens so nebenbei angesprochen werden. Meistens handelt es sich um irgendwelche unerledigten Aufgaben, die die Kinder schnellstens erfüllen sollen. Und dann wundern sich die Eltern kurze Zeit später, dass die Erledigung auf sich warten lässt, was die Eltern noch mehr ärgert. Manchmal gibt es dann sogar noch mehrere Durchgänge desselben, bei denen zusätzlich dem Kind Vorwürfe gemacht werden, dass es nicht hört, was ihm gesagt wird. Und das ist wohl tatsächlich so. Das liegt aber einfach daran, dass Kinder nicht so leicht aufnehmen, was ihnen gesagt wird, wenn sie in ihr Spiel vertieft sind oder wenn sie irgendwo unterwegs sind. Eltern und andere Erziehungspersonen sollten das beachten, wenn sie ihr Kind wirklich erreichen wollen. Tatsächlich ist es wohl so, dass Eltern häufig wenig Zeit haben und ihrem Kind daher schnell etwas zurufen, eben so nebenbei, zum Beispiel bei der Hausarbeit. Das ist nachvollziehbar und durchaus verständlich. Erst wenn Eltern erkennen, dass damit gar keine reale Zeitersparnis verbunden ist, weil Zeit raubende Wiederholungen nötig sind oder die Wirkung ganz verpufft, sind sie zu einer Verhaltensänderung bereit.
Eltern, die wirklich mit ihren Kindern in Kontakt kommen und sicher gehen wollen, dass ihr Kind auch aufnimmt, was sie sagen, bleibt die folgende Möglichkeit: Eltern können direkt zu ihrem Kind hingehen und sich auf Augenhöhe zum Kind begeben. Sonst sprechen Eltern aufgrund des Größenunterschieds immer von oben herab, was kein so schöner Kontakt ist, da das Kind dann im wahren Sinne des Wortes zu den Eltern aufschauen muss. Eltern können dann im Augenkontakt zu ihrem Kind an den Reaktionen des Kindes ablesen, ob sie sich wirklich im Kontakt befinden. Wenn Eltern dann nachfragen, was das Kind von dem hält, was sie ihm gesagt haben, kommen die Eltern auf diese Weise ins Gespräch mit ihrem Kind und das Gesagte und Gewünschte erzielt eine wesentlich nachhaltigere Wirkung bei dem Kind. Zusätzlich wichtig ist auch, dass Eltern dabei Vorbilder für einen respektvollen Umgang sind, was zum Beispiel bedeutet, dass sie geeignete Zeitpunkte für das Ansprechen finden. Die Eltern sollten abwägen, ob die Angelegenheit so dringend ist, dass sie dafür zum Beispiel ein spannendes Spiel des Kindes unterbrechen müssen. So lernt ein Kind am Vorbild der Eltern gleichzeitig einen respektvollen Umgang mit anderen.
Tipp: Mit einem Kind auf Augenhöhe lässt sich vieles leichter besprechen und klären.
Auseinandersetzung: miteinander reden
Kinder brauchen die Auseinandersetzung mit ihren Eltern und anderen wichtigen Bezugspersonen. Sie benötigen ein Gegenüber, an dem sie sich orientieren, sich reiben, von dem sie sich abgrenzen können, an dem sie wachsen können. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass dafür Zeiten, Orte und Gelegenheiten da sind, um miteinander zu reden: ungestörte Momente. Wenn ein Fernseher oder ein PC-Spiel dabei läuft, ist das in der Regel kein ungestörter Moment – außer genau dieser Schutz ist in dem Moment nötig, um überhaupt erst einmal ein Gespräch zu beginnen. Manchmal ist ein Anfang nur so nebenbei möglich. Auf Dauer ist diese Nebenbei-Gesprächsform nicht ideal. In vielen Familien wird nur noch wenig gesprochen. Da ist das Gegenüber nicht der Vater oder die Mutter, sondern tatsächlich der Fernseher oder das Notebook. Eine lebendige Auseinandersetzung ist damit nicht möglich, allenfalls eine virtuelle. Sicherlich ist im Internet eine sachliche, thematische Auseinandersetzung mit vielen Themen möglich. Das ist hier jedoch nicht gemeint. Gemeint ist, dass in Gesprächen mit dem Kind die Eltern sichtbar, spürbar, erkennbar, begreifbar werden für das Kind als Persönlichkeiten, die etwas tun, etwas denken, etwas fühlen, für etwas stehen. Daran kann sich das Kind entwickeln. Damit kann das Kind in vielen Auseinandersetzungen zu einer eigenen Persönlichkeit heranreifen, eine eigene Sichtweise entwickeln, einen eigenen Geschmack verfeinern, eine eigene Meinung bilden. Es kann sich im Verlauf der Entwicklung von den Eltern abgrenzen und eine eigenständige Lebensweise entwickeln. Das gelingt nicht so gut, wenn diese Auseinandersetzung mit den Eltern nicht oder kaum stattfinden kann. Woran soll sich das Kind halten?
Diese Auseinandersetzung ist auch dann noch wichtig, wenn das Kind schon jugendlich ist und bereits eigene Wege geht. Jugendliche signalisieren oft, dass diese Auseinandersetzung sie nicht interessiert, reagieren vielleicht nicht oder kaum. Auch dann ist die Auseinandersetzung noch nicht überflüssig geworden, im Gegenteil. Stellen Eltern die Auseinandersetzung, das Reden mit Ihrem Kind zu diesem Zeitpunkt ein, könnte ein Kind das so erleben, als sei es nun den Eltern gleichgültig geworden, als sei egal, was es macht. Eine schreckliche Vorstellung, den eigenen Eltern gleichgültig zu sein. Allein dieser Gedanke sollte Eltern weiter motivieren, auch mit jugendlichen Kindern, die sich in einer Abwehrhaltung befinden, beständig und manchmal auch hartnäckig die Auseinandersetzung zu suchen. Das Kind wird es den Eltern allerdings erst viel später danken. Einen Dank zu diesem Zeitpunkt können Eltern von einem jugendlichen Kind tatsächlich nicht erwarten.
Tipp: Eltern sollten mit ihrem Kind reden und sich mit ihm “über Gott und die Welt” auseinandersetzen, wenn es nicht den Eindruck haben soll, dass es den Eltern gleichgültig ist.
Autorität
Autorität ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und das ist gut so. Autorität ist in den letzten Jahrzehnten einem starken Wandel unterworfen. War sie früher in hohem Maße selbstverständlich von den Positionen und Funktionen bestimmt, muss sie heute in viel stärkerem Maße erworben und gefüllt werden. Eltern und Lehrer hatten in früherer Zeit in ihren Rollen zumeist diese selbstverständliche Autorität gegenüber den Kindern. Die Autorität war verbunden mit Macht, Kontrolle, Distanz, Strenge und nicht selten auch mit Gewalt. Auf Seiten der Kinder standen Gehorsam, Disziplin, oft auch Angst. Zumeist gab es einen deutlichen Vorsprung von Eltern und Lehrern gegenüber den Kindern in Wissen, Kompetenz und Erfahrung.
Durch das hohe Tempo des gesellschaftlichen Wandels insbesondere in den letzten Jahrzehnten hat sich der Vorsprung an Wissen und Kompetenz, den Eltern wie Lehrer früher hatten, deutlich verringert. Manchmal wissen Kinder und Jugendliche heute sogar in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Computertechnik mehr als ihre Eltern und Lehrer. Das hat Einfluss auf die Autoritätsbeziehung und verändert sie. Aber auch die antiautoritäre Bewegung und der kulturelle Wandel, mit denen nicht nur für die Erziehung Werte wie Selbständigkeit, Autonomie und Freiheit wichtiger wurden, hatte maßgeblichen Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung und die Lehrer-Schüler-Beziehung.
Auch wenn es immer wieder Bewegungen gibt, alte Autoritätsideale aufzufrischen, so zeigen nicht zuletzt die historischen Erfahrungen des Nationalsozialismus, dass wir eine Erziehung zu mündigen, selbstbewussten und kritischen Persönlichkeiten für eine demokratische Gesellschaft brauchen. Die Suche nach alten Autoritätsidealen entsteht meistens aus Verunsicherung in der Erziehung, wenn noch keine neue Sicherheit im Umgang mit Kindern erreicht wurde. Wie nun schaffen wir das am besten?
Die Konsequenz daraus, dass die Autorität aufgrund von Position, Funktion und Status an Macht verloren hat, ist, dass Autorität mehr denn je erworben und gefüllt werden muss. Das ist logisch, wenn sie nicht per se vorhanden ist. Und wenn Autorität nicht mit Äußerem verbunden sein soll, dann mit dem Inneren, mit den inneren Werten. Das kann neben dem Wissen und der Kompetenz einer Person auch deren überzeugender Charakter sein. Kaum eine Person ist in diesem Kriterium stärker als ein in sich ruhender Mensch mit der natürlichen Autorität einer authentischen Persönlichkeit. Solche wahrhaftigen Eltern sind für das Kind klar erkennbar, ehrlich, spürbar, aber auch deutlich und standhaft. Für ein Kind kann es für den eigenen Halt und die eigene Orientierung wohl kaum bessere Eltern geben, wenn diese ihrem Kind zudem liebevoll zur Seite stehen und sich mit ihm auseinandersetzen.
Tipp: Authentische Eltern sind für die Kinder klar erkennbar, ehrlich, spürbar, aber auch deutlich und standhaft und erhalten damit ihre Autorität dem Kind gegenüber.