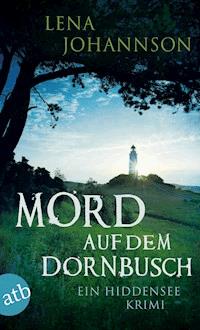9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Hamburg-Saga
- Sprache: Deutsch
Das Erbe der Schokoladenvilla.
Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, Frieda muss schlimme Verluste verkraften. Sie lässt sich nicht unterkriegen und möchte nach und nach ihre Nichte Sarah zur Nachfolgerin in der Schokoladenmanufaktur ausbilden. Doch Friedas Sohn hat andere Pläne. Und dann holt Frieda auch noch die Vergangenheit ein. Wird es ihr zum Verhängnis, dass sie Sarah nie adoptiert hat? Ein Kampf beginnt, der Frieda mehr als die eigene Familie kosten könnte. Kann sie diesen Kampf gewinnen?
Authentisch und berührend: nach dem Vorbild eines Hamburger Kakao-Kontors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Das Erbe der Schokoladenvilla.
Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, Frieda muss schlimme Verluste verkraften. Sie lässt sich nicht unterkriegen und möchte nach und nach ihre Nichte Sarah zur Nachfolgerin in der Schokoladenmanufaktur ausbilden. Doch Friedas Sohn hat andere Pläne. Und dann holt Frieda auch noch die Vergangenheit ein. Wird es ihr zum Verhängnis, dass sie Sarah nie adoptiert hat? Ein Kampf beginnt, der Frieda mehr als die eigene Familie kosten könnte. Kann sie diesen Kampf gewinnen?
Authentisch und berührend: nach dem Vorbild eines Hamburger Kakao-Kontors
Über Lena Johannson
Lena Johannson, 1967 in Reinbek bei Hamburg geboren, war Buchhändlerin, bevor sie freie Autorin wurde. Vor einiger Zeit erfüllte sie sich einen Traum und zog an die Ostsee. Im Aufbau Taschenbuch sind u.a. ihre Bestseller »Die Villa an der Elbchaussee«, »Jahre an der Elbchaussee« und »Die Malerin des Nordlichts« lieferbar.
Mehr Information zur Autorin unter www.lena-johannson.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lena Johannson
Töchter der Elbchaussee
Die Geschichte einer Schokoladen-Dynastie
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil 2
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil 3
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Dankeschön!
Impressum
Teil 1
Kapitel 1
Mai 1945
»Ich hole uns noch ein wenig Limonade.« Rosemarie stemmte sich aus dem Sessel, hielt sich an der Lehne fest und verschnaufte, ehe sie mit schleppenden Schritten in die Küche ging.
»Beeil dich, Röschen, gleich kommen die Nachrichten.« Albert rutschte an den Rand der Sitzfläche, beugte sich vor und stützte erwartungsvoll die Ellenbogen auf die Knie. Dabei spielte noch Musik. Frieda sah zu den Kindern hinüber. Kinder! Henrik wurde im August bereits siebzehn. Mit seiner Freundin Gerlinde war es ihm anscheinend schon ernst. Sarah war eine hübsche junge Frau geworden und sah ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich. Wie immer, wenn Frieda an Selma Blumenstein dachte, überkam sie eine Traurigkeit, die im Lauf der Jahre zwar verblasst war, nur völlig vertreiben ließ sie sich einfach nicht. Warum nur hatte Selma ihre Tochter bei Frieda und Per in Hamburg gelassen, ehe sie fortgegangen war? Wo mochte sie stecken, ob es ihr gut ging? Frieda hätte zu gern mit ihr gesprochen, doch Selma war wie vom Erdboden verschluckt. Was, wenn sie irgendwann wieder auftauchte, um ihre Tochter zu sich zu holen? Unsinn, Sarah war jetzt zwanzig Jahre alt. Sie würde selbst entscheiden, bei wem sie leben wollte. Dass sie in Hamburg bei Frieda und Per bleiben würde, daran gab es keinen Zweifel. Wie konzentriert sie auf dem Sofa saß und Jacken, Blusen und Hosen ausbesserte. Kleider von Käthe und Herbert Braune sowie von Martha und ihren Kindern, die alle seit bald zwei Jahren in der Møllerschen Villa untergebracht waren.
Was war nur los mit dieser Welt? Oft wünschte sich Frieda sehnlichst, mit ihrem Bruder reden zu können. Sicher konnte auch er nicht begreifen, dass die Menschen einen zweiten Krieg innerhalb so kurzer Zeit zugelassen hatten. Jeder erinnerte sich doch nur zu gut an den ersten, mit all seinem Leid und seinen Tragödien. Aber niemand hatte eingegriffen, hatte das erneute Unheil verhindert. Wie auch? Frieda war ja selbst zu sehr damit beschäftigt gewesen, das eigene Leben weiterzuleben, zum Wohle der Kinder, zum Wohle der Firma. Auch sie hatte sich damit begnügt, auf ein Wunder zu hoffen. Hans hatte diese Hoffnung längst verloren, er gab keine Silbe mehr von sich. Nur eine der vielen unseligen Veränderungen, die sie irgendwie verkraften musste. Wenigstens lebte Hans. Und sie hatten in den ersten Jahren des Krieges viel Glück gehabt. Draußen an der Elbchaussee waren sie sicher, wenngleich auch hier nachts die Sirenen heulten.
Friedas und Pers Haus hatte einen halben Keller hinter der Souterrain-Wohnung. Während zu den Wohnräumen, die sie einst Selma und ihrer Tochter Sarah zur Verfügung gestellt hatten, eine Treppe führte, erreichte man den Keller durch eine Luke in einer Kammer des Parterres. Ein ausgewiesener Schutzraum war es nicht, aber besser als lange Wege zum nächsten Bunker auf sich zu nehmen. Die Villa ihrer Eltern an der Elbchaussee besaß keinen Keller. So hatte sich die Routine eingespielt, dass Rosemarie, Albert und Hans mit wichtigen Papieren und einigen wenigen Gegenständen in Alberts Aktentasche zu Frieda, Henrik und Sarah kamen, sobald Fliegeralarm über die Dächer jaulte. Die ersten Male hatten sie sich alle aneinandergeklammert, später wurden sie etwas ruhiger, doch die Angst war immer spürbar. Glücklicherweise waren die feindlichen Flugzeuge meist über die Hansestadt hinweggedonnert, ohne ihren tödlichen Ballast abzuwerfen. Während Mutter dann eine Melodie summte oder ein Gespräch über irgendetwas Belangloses anfing, sorgte Vater sich immer um die Geschäftsräume im Meßberghof. Frieda teilte seine Sorge, weiter zur Innenstadt hin hatte es durchaus Bombeneinschläge gegeben. Gleich 1940 war die Lombardsbrücke in der Innenstadt getroffen worden. Gerade der Hafen, nur Schritte vom Kontorhaus entfernt, war ein bedeutendes Ziel. Ob ihre Conchiermaschinen und Walzen wohl noch ganz waren? Und wie mochte ihre geliebte Speicherstadt aussehen?
Die Angst um Hamburg und vor allem seine Menschen war das eine, Friedas größte Sorge galt jedoch Per. Zwei Jahre war er nun schon fort, nur einmal war er für zwei Wochen nach Hause gekommen. Aber auch das war schon lange her. Nach dem Tod von Pers Vater kümmerte sich sein älterer Bruder um die Reederei, doch auch Per war noch Geschäftsführer. Also hatte er nach Dänemark fahren müssen. Lange Trennungen schienen zu ihrer Ehe zu gehören. Erst war Per mehrmals in China gewesen, dann Friedas Reise nach Venezuela. Immerhin fielen in Dänemark keine Bomben, nur hatte sich die Situation in der letzten Zeit zugespitzt. Am Telefon hatte Per erzählt, dass der dänische Widerstand wuchs.
»Die Deutschen haben uns staatliche Integrität zugesichert. Schließlich sind wir ›Arier‹ und damit Brüder.« Er hatte verächtlich geschnaubt. »Sehr dumm, dass wir partout keine Ausgangssperren, keine Militärgerichte und auch nicht die Todesstrafe akzeptieren wollten. Und unsere Polizei war ja auch viel zu lasch gegenüber den Aufrührern. Kein Wunder, dass sie nun aufgelöst wurde.« Frieda stockte der Atem, als sie das hörte. Sie wusste nur zu gut, dass er fürchten musste, jemand könne sein Gespräch mithören. Jeder fürchtete das ständig und überall. Doch sie wusste auch, wie Per wirklich dachte, wie sehr er darunter litt, dass sein Land von den Deutschen beherrscht und geknebelt wurde, dass seine Landsleute, die sich dagegen wehrten, in Konzentrationslager deportiert wurden. Jetzt konnte kein dänischer Polizist das mehr verhindern.
Bei ihrem letzten Gespräch, ehe das Telefon ausgefallen war, weil irgendwo Leitungen getroffen worden waren, hatte Per gesagt: »Ach Frieda, diese Dänen machen sich das Leben wirklich schwer, weil sie nicht kooperieren. Es ist mehr als bedauerlich.« Dabei war seine Stimme ganz kratzig geworden. »Ich bin froh, dass die Deutschen mich als Landsmann erkannt haben, obwohl mir doch meine Papiere abhandengekommen sind.«
Sie hatten nach Henriks Geburt darüber nachgedacht, ob es günstig wäre, wenn Per die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen würde. Aber wozu? Sie hatten sich dagegen entschieden. Allerdings war es derzeit sicherer, sich als Deutscher auszugeben. Mit seinen brillanten Sprachkenntnissen, einer deutschen Ehefrau, dem Wohnsitz in Hamburg und einem Unternehmen, das weit über die Hansestadt hinaus für seine vorzüglichen Kakaoprodukte bekannt war, gelang Per das vermutlich mit Leichtigkeit.
Seit Ende letzten Jahres hatten sie nun nicht mehr miteinander gesprochen, nur einige Briefe hatte sie noch bekommen und ihm geschrieben. Jeden Tag hoffte Frieda, er würde plötzlich vor der Tür stehen. Gleichzeitig war sie um jeden Tag froh, den er in Sicherheit war. Dass er gerade als vermeintlicher Deutscher in Dänemark immer mehr in Gefahr geraten könnte, wagte sie nicht zu denken.
Während der ersten Nächte in dem provisorischen Schutzraum hatte Frieda Sarah und ihren Sohn Henrik noch beruhigen müssen. Irgendwann gewöhnten die beiden sich daran, bei Alarm den Keller aufzusuchen. Hans gewöhnte sich nie daran, im Schutzraum auszuharren. Selbst als es noch meist Fehlalarme waren, weil die Bomber die Stadt überflogen, bebte er jedes Mal wieder in Todesangst, atmete schnell und sträubte sich, die Leiter hinabzuklettern, als solle er geradewegs in sein Grab hinabsteigen. Anfangs hatten sich am nächsten Morgen nur einzelne Rauchfähnchen irgendwo weiter östlich in die Höhe gekringelt. Wie die dünnen Rauchfäden, die noch eine Weile über dem Dochtstummel schwebten, wenn eine Kerze heruntergebrannt war. Hans betrachtete sie, bis sie nicht mehr zu sehen waren.
Ach Hans, ihr stolzer, spöttischer großer Bruder. Was hätte nicht alles aus ihm werden können? Mutig und voller Energie war er damals mit wehenden Fahnen in den ersten Krieg gezogen, als gebrochener Mann war er zurückgekehrt. 1939 hatte er versucht, sich das Leben zu nehmen. Für Frieda stand fest, dass das seine Absicht gewesen war. Sie wusste nur nicht, ob seine Angst vor einem zweiten Krieg oder Claras Abreise nach Amerika der Auslöser gewesen war. Wahrscheinlich beides. Mutter dagegen weigerte sich, überhaupt daran zu glauben, dass er es ernst gemeint hatte.
»Er wollte seine Panik vor einem erneuten Krieg mit Alkohol betäuben«, erklärte sie, wann immer das Thema zur Sprache kam. »Gewiss, das war ein Fehler. Nach dem, was er schon einmal als Soldat durchgemacht hat, sollte aber jeder Verständnis dafür haben. Niemand darf ihm vorwerfen, dass er zur Flasche gegriffen hat.« Und auch nicht, dass er mit vernebeltem Geist außer Schnaps auch noch Verdünner oder sonstwas getrunken hatte? Frieda glaubte nicht an einen schrecklichen Unfall. Wochen vorher hatte Hans nicht nur viele seiner Bilder verbrannt, sondern auch noch leere Leinwände, weil er nicht wieder malen wollte, solange die Nazis an der Macht waren. Dann hatte er sich schrecklich aufgeführt, bis Clara bereit war, Hamburg ohne ihn zu verlassen, und war hinterher vollkommen verzweifelt gewesen, weil sie genau das getan hatte. Und schließlich war der Tag gekommen, an dem er auf Sarah hatte aufpassen sollen, und sie ihn auf dem Dachboden gefunden hatte. Über ihm ein Seil an einen Balken geknotet, um seinen leblosen Körper herum, der über einem Hocker zusammengesackt war, leere Flaschen. Wann immer Frieda sich an diesen Anblick erinnerte, kroch ihr eisige Kälte den Rücken hinauf. Hans hatte ein Bild gemalt, sein letztes womöglich. Ein Selbstporträt inmitten der Gräuel, die er an der Front gesehen haben mochte. Nicht noch einmal!, hatte er in schwarzen Buchstaben quer darüber geschrieben. Doch die Ärzte hatten ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach einigen Wochen nahm Hans wieder feste Nahrung zu sich und verließ das Krankenbett. Da war der Krieg längst furchtbare Realität. Gesprochen hatte Hans seitdem kein Wort mehr.
»Wir können nicht ausschließen, dass die Stimmbänder in Mitleidenschaft gezogen wurden«, sagte ihnen der zuständige Arzt. »Soweit wir es sehen können, scheint aber alles intakt zu sein.«
Im Juli 1943, Per war gerade erst nach Dänemark gereist, brach die Hölle über Hamburg herein. Ernst hatte es schon länger befürchtet.
»Früher oder später sind wir auch dran, Frieda.« Seine Stirn lag in tiefen Falten, das fröhliche Blitzen in seinen Augen war erloschen. »Der Hafen ist das perfekte Ziel für die alliierten Truppen. Und der Bahnhof natürlich. Die lassen sich nicht täuschen. Nicht von einem Holzgerüst mit so’n paar Planen und auch nicht von den Schachteln, die die Wehrmacht auf die Binnenalster gesetzt hat und die aussehen sollen wie ein Wohngebiet. Die finden unseren schönen Hauptbahnhof trotzdem. Zur Not schmeißen die eben großflächig ihre Bomben ab. Und denn erwischen die auch jede Menge Wohnhäuser und Zivilisten. Kannst mir glauben, Frieda, wir kriegen noch kräftig ’n Arsch voll. Guck bloß, dass du euren Keller zusätzlich sicherst.«
Zu ihrer großen Erleichterung hatte er das gleich selbst in die Hand genommen. Von da ab stützten mächtige Balken die Decke, noch mehr Sandsäcke vor den Fenstern sperrten auch den letzten Lichtschimmer aus. Ernst hatte keinen Tag zu früh Vorkehrungen getroffen. Noch immer schauderte Frieda bei der bloßen Erinnerung. Die Sperrfeuer der Flugabwehrkanonen donnerten unaufhörlich. Und dann das Dröhnen der Motoren von unzähligen Flugzeugen. Engländer! Jeder wusste, dass die Amerikaner am Tag bombardierten, die Engländer kamen in der Nacht.
Frieda versuchte, sich an Jasons Worte zu erinnern, dass man immer eine Wahl habe und dass deutsche und englische Soldaten im Grunde keine Feinde seien, sondern nur Befehle befolgten. Auch Hans hatte ihr nach seiner Rückkehr von der Front erzählt, dass er auf Engländer getroffen war, die ihn hatten gehen lassen, obwohl sie ihn hätten erschießen können. Doch wenn man in einem stockfinsteren Keller kauerte und das Heulen der Bomben immer lauter wurde, dann fiel es schwer, an etwas anderes als an tiefe Feindschaft zu glauben. Einmal hatte ein naher Einschlag das stattliche Haus am Jenischpark erschüttert. Er zerstörte eine steinerne Brücke über die Flottbek und ein nahe gelegenes Gasthaus vollständig. Mehrere Bäume standen schief, mächtige Äste waren gebrochen und hingen nur noch in den Zweigen der Krone. Als endlich das Entwarnungssignal durch die Straßen schrillte, zitterte Frieda am ganzen Körper, und ihr liefen Tränen über das Gesicht, so erleichtert war sie, dass alle noch am Leben waren. So ging es vier Nächte in Folge, in denen Hamburg von Spreng- und Brandbomben geradezu überzogen wurde.
Dann kam der achtundzwanzigste Juli. Frieda erinnerte sich noch ganz genau daran. In der Nacht hatte sie, wie immer, kaum ein Auge zugemacht. Vor lauter Müdigkeit fühlte sie sich wie in einem Nebel, als sie am Morgen Henrik und Sarah versorgte. Von Arbeit im Kontor oder der Manufaktur konnte schon seit Ewigkeiten keine Rede mehr sein. Frieda wäre auch nicht dazu in der Lage gewesen. Sie konnte an nichts anderes denken, als daran, wann sie sich endlich hinlegen und schlafen durfte. Doch daraus wurde nichts. Ein Lastwagen hielt an der Straße. Frieda sah Menschen auf der Ladefläche hocken. Noch nie zuvor hatte sie erbärmlichere Gestalten gesehen. Die Haare waren teilweise bis zur Kopfhaut weggeschmort, ihre Kleidung hing in Fetzen und war verbrannt. Während Frieda noch fassungslos auf das Elend starrte, hämmerte plötzlich jemand an die Tür. Als sie öffnete, stand vor ihr ein Uniformierter.
»Wir verteilen die Ausgebombten. Mit wie vielen Personen wohnen Sie in diesem Haus?«
»Vier, wir sind vier Personen«, stotterte sie überrumpelt. Der Mann verzog eine Miene, die keinen Zweifel daran ließ, was er von Leuten hielt, die sich so viel Platz und eine so elegante Unterkunft leisten konnten. Sie konnte nicht weiter darüber nachdenken, denn er war einfach an ihr vorbei gestürmt und sah sich jeden Raum an. Im Parterre, dann im Souterrain und zuletzt im Obergeschoss.
»Keller?«, fragte er sie streng.
»Nur ein Teilkeller«, gab Frieda leise zurück. Was geschah hier? Er konnte das Haus doch nicht einfach beschlagnahmen?
»Zeigen!«, kommandierte er.
»Kommen Sie.« Frieda ging in die Kammer und öffnete die Luke.
»Sehr gut«, erklärte er, nachdem er den provisorischen Schutzraum inspiziert hatte. »Es sind ein paar Veränderungen nötig, darum kümmern wir uns.« Das war alles, eine weitere Erklärung bekam Frieda nicht. Stattdessen ging er zum Wagen, winkte ein älteres Ehepaar, eine Frau mit zwei Kindern, drei ältere Damen, eine junge Frau und zwei weitere Kinder vom Wagen.
»Was wollen die hier?«, fragte Henrik.
»Sie verteilen die Ausgebombten«, antwortete Frieda, ohne es selbst so recht zu begreifen. »Ich denke, sie werden hier eine Weile wohnen.«
Der Mann in Uniform kam zurück, die kleine Gruppe, die meisten mit weit aufgerissenen Augen oder vollkommen stumpfem Blick, schlich hinter ihm her. Er trat zur Seite und schob, als sie zögerten, einen nach dem anderen ungeduldig ins Haus. Das Souterrain war einer älteren Dame mit ihrer erwachsenen Tochter und deren beiden Kindern zugeteilt. Drei weitere Zimmer gingen an das ältere Ehepaar, eine alleinstehende Frau mit ihren zwei Kindern und ein anderes an zwei ältere Damen, Schwestern, wie sich herausstellte. Das Wohnzimmer gehörte weiterhin Frieda und den Kindern, ebenso Pers und Friedas Schlafzimmer sowie je ein Kinderzimmer. Ausreichend im Grunde, nur dass sich nun neun Erwachsene und fünf Kinder das große Bad im Parterre und ein kleines im Souterrain teilen mussten. Auch die Küche wurde von allen benutzt.
Aus einem unerfindlichen Grund war in der Hannemannschen Villa niemand einquartiert worden.
»Warum ziehen wir nicht zu ihnen?«, schlug Sarah vor. »Dann können die Braunes sich im Wohnzimmer einrichten und haben es bequemer. Und Hilde und Dorothea hätten je eine Kammer für sich.«
Zuerst sträubte sich Frieda gegen die Vorstellung, doch sie musste gestehen, dass Sarah recht hatte. Das kleine Zimmer war für das Ehepaar Braune eine Zumutung, wenn sie auch immer wieder beteuerten, wie dankbar sie waren, nicht auf der Straße oder in einer Massenunterkunft hausen zu müssen. Auch für die Schwestern Hilde und Dorothea war es bestimmt nicht leicht, plötzlich zu zweit in einem Zimmer zu leben, nachdem zuvor jede von ihnen eine eigene großzügige Wohnung in Winterhude besessen hatte.
Also hatte Frieda das Nötigste zusammengepackt und war mit Henrik und Sarah in die Villa an der Elbchaussee gezogen.
»Eine sehr gute Idee«, fand Albert. »Bestimmt müssen bald noch mehr Ausgebombte verteilt werden. Da habe ich doch lieber euch drei hier.« Er zwinkerte fröhlich.
Bei Fliegeralarm mussten nach wie vor alle ins Haus am Jenischpark laufen. Mit all den neuen Bewohnern war es schrecklich eng in dem Teilkeller. Die Luft war innerhalb kürzester Zeit stickig, und die kleinen Kinder weinten ununterbrochen. Auch am Tag ging Frieda hin und wieder rüber und brachte den Menschen ein wenig Kakao oder Schokolade aus ihren eisernen Vorräten. Der Uniformierte hatte nicht zu viel versprochen, und man hatte sich um Umbaumaßnahmen gekümmert. Jedes Zimmer war nun vorsorglich mit einem Bollerofen ausgestattet. Die Rohre verliefen abenteuerlich quer durch das gesamte Haus. Frieda fragte sich, ob das alles wieder abgebaut werden konnte, ohne dass größere Schäden zurückblieben. Vor allem aber, dachte sie beklommen, schien man mit einer langen Aufenthaltsdauer der einquartierten Menschen zu rechnen. Es war Sommer, ein heißer noch dazu. Niemand brauchte jetzt einen Ofen.
Wenn Frieda zurückdachte, konnte sie nur darüber staunen, wie rasch sich die eigene Einstellung in diesen Zeiten doch ändern konnte. Hatte sie sich eben noch Gedanken gemacht, wann sie die fremden Menschen wohl wieder loswerden würde, war sie im nächsten Moment von Herzen froh, dass man sie bei ihr einquartiert hatte. Die meisten kamen aus dem Osten der Stadt. Und der war im Feuersturm vernichtet worden, als habe es sich bei den Gebäuden dort um Pappschachteln gehandelt, die den Flammen nichts entgegenzusetzen hatten. Niemand, weder die freundlichen Braunes noch die Kinder, würden noch leben, hätte man sie nicht zu Frieda gebracht. In der Nacht des achtundzwanzigsten Juli hatte es begonnen. In wenigen Stunden, das kam hinterher nach und nach ans Licht, waren dreißigtausend Menschen im Feuer umgekommen. Erstickt oder verbrannt. Das Vorgehen war perfide, Frieda konnte nicht fassen, dass jemand sich einen derartig grausamen Plan ausdachte. Angefangen hatte es mit sogenannten Christbäumen, Leuchtfeuern, die hinabsegelten und die Stadt erhellten, damit die Piloten die Gebiete sehen konnten, die sie anzugreifen hatten. Was hatte es genützt, dass regelmäßig Luftschutzwarte kontrollierten, ob auch jede Wohnung, jedes Haus gemäß der Anweisung verdunkelt war? Gar nichts! Sprengbomben rissen die Dächer auf, Brandbomben setzten alles in Flammen. Nicht einmal mutige Männer, wie damals beim Großen Brand 1842 ihr Urgroßvater, hätten eine Chance gegen dieses Inferno gehabt. Viel zu gefährlich. Sogar Zeitzünder kamen zum Einsatz, hörte man später, die für Explosionen sorgten, nachdem die Flugzeuge längst fort waren. So kam es, dass die Bewohner der Stadt, die mit dem Leben davongekommen waren, sich verkriechen mussten, anstatt dass sie hätten löschen und wenigstens irgendetwas retten können. Die Engländer schonten in dieser Nacht die Zivilbevölkerung nicht mehr. Im Gegenteil: Ihr Ziel war es, Hamburg mit Mann und Maus zu vernichten. Als Frieda und die anderen am nächsten Morgen ins Freie traten, empfing sie eine Hitze, als hätte jemand einen Glutofen im Garten installiert. Sie sahen keine vereinzelten Rauchfähnchen mehr, sondern ihnen bot sich ein geradezu unglaubliches Bild: Obwohl Sommer war, spannte sich ein schwarzgrauer Himmel über sie. Die Sonne schaffte es nicht durch die Schwaden von Ruß und Qualm, von Tod und Elend. Dazu der scharfe Brandgeruch und ein ständiger leichter Ascheregen, schwarze Fetzen von Büchern, Plakaten, Bildern, vielleicht auch Holz und womöglich … Frieda traute sich kaum, Richtung Innenstadt zu blicken. Dort leuchtete der Horizont blutrot. Und es hörte nicht auf. Zwei Tage nach dem verheerenden Angriff kamen die Engländer zurück. Friedas Gedanken kreisten um die vielen, die weiter östlich lebten. Wie mochte es Ernst und seiner Familie gehen, wie den Arbeitern der Schokoladenmanufaktur? Rudolf hatte schon im ersten großen Krieg ein Bein eingebüßt. Oder Jonas, der damals seinen Vater und den ältesten Bruder verloren hatte, was war mit ihm? Spreckel, Meynecke, Ulli und Marianne. Erst nach fünf weiteren Tagen hatte Frieda Gewissheit, dass sie am Leben waren. Spreckel war verletzt, auch von Ulli hörte sie, dass sie Verbrennungen davongetragen hatte. Ihre Eltern waren beide tot, aber ihre kleine Schwester Marianne war ungeschoren davongekommen. Welch eine Erleichterung, welch eine unbändige Freude, dass die meisten es geschafft hatten. Gleichzeitig wuchs der Schmerz in Frieda so sehr, dass sie glaubte, nicht mehr atmen zu können, so unvorstellbar grauenvoll war, was sie sah und von denen hörte, die von dem Feuersturm erzählen konnten. Die Flammen waren durch die Stadt gewirbelt, hatten einen solchen Sog entfaltet, dass Alte und Schwache einfach von den Füßen und mitten hinein in die Feuersbrunst gerissen worden waren. Fensterscheiben waren geschmolzen, ebenso Kacheln, die gerade noch Küchen und Bäder geziert hatten. Bunker hatten sich bei schweren Detonationen gehoben und wieder gesenkt, als wollten sie sich selbst tiefer in den Boden rammen. Wassertanks waren explodiert und hatten ihren kochenden Inhalt versprüht. Wo einst Straßen gewesen waren, gab es nun Krater, niemand hatte mehr eine Orientierung, wenn er sich in Richtung Innenstadt bewegte. An Mauerstücken, den Resten von dem, was einst Wohnblöcke gewesen waren, hatten Menschen mit Kreide Nachrichten hinterlassen, hörte Frieda. Sie suchten nach Angehörigen oder notierten, dass sie lebten und wohin sie gehen wollten. Hunderttausende verließen Hamburg, zogen Bollerwagen hinter sich her, schoben verbeulte Fahrräder, auf die sie ihr Hab und Gut geschnürt hatten. Autos gab es in der Stadt schon lang nicht mehr.
Die Glücklichen hatten noch immer ein Dach über dem Kopf, wohnten im Westen und Norden der Stadt, wo es in vielen Straßen aussah, als habe gar kein Krieg stattgefunden. So wie Frieda und ihre Familie.
Bald zwei Jahre waren vergangen, seit sie mit Henrik und Sarah in den Anbau der Hannemannschen Villa gezogen war. Sie hatten die schweren Angriffe im Juli und August des Jahres 1943 überlebt und eisige Kälte in den Wintern überstanden. Sie hatten gebangt und mit wenig Verpflegung auskommen müssen. Und sie hatten das Wunder erlebt, dass nach all der Zerstörung wieder Briefe ausgetragen wurden, dass von irgendwoher Strom kam – wenigstens für einige Stunden am Tag.
Im Jahr nach dem Feuersturm wurde Henrik sechzehn. Im August war das gewesen. Nur einen Monat später rief Hitler, der im Juli knapp einem Anschlag entkommen war, alle Männer an die Waffen, von sechzehn bis sechzig Jahre. Frieda hatte sich daran gewöhnt, einmal am Tag zu ihrem Haus zu gehen und nach der Post zu sehen. Immer begleitete sie die Hoffnung auf eine Nachricht von Per. Ab September wünschte sie sich zwar weiterhin, es möge ein Brief von ihrem Mann im Kasten liegen, gleichzeitig hatte sie Angst davor, ein Schreiben von der Wehrmacht zu finden.
An einem sonnigen Tag im November geschah es. Frieda freute sich darüber, dass das Hamburger Schmuddelwetter einem strahlend blauen Himmel gewichen war. Die Luft war eisig, aber herrlich klar, ihr Atem stand vor ihren Lippen. Immer öfter hörte man hinter vorgehaltener Hand Gerüchte, der Krieg könne Weihnachten vorüber sein. Vor allem Ernst hielt Frieda auf dem Laufenden.
»Die BBC sagt, es sieht düster aus für Deutschland. Von wegen Endsieg, wir sind auf ganzer Linie geschlagen.«
»Ernst, um Himmels willen, du darfst nicht länger Feindsender hören.« Weiter kam Frieda nicht.
»Meine Feinde sind die Engländer nicht. Wenn es auch mal ’ne Zeit gab, als ich nicht sehr gut auf die zu sprechen war. Na, auf einen nicht.« Er schmunzelte, wurde aber sofort wieder ernst. »Wie willst du denn sonst wissen, was los ist? Was wirklich los ist, meine ich. Unser Großdeutscher Rundfunk erzählt uns doch nur Unfug«, zischte er. »Wie letztes Jahr über Stalingrad.« Er schnaubte böse und senkte die Stimme. »Gelogen hat der Goebbels. Von wegen, alle seien den Heldentod gestorben.« Ernst schüttelte den Kopf. »Nee, Frieda, wenn du dir eine Meinung bilden willst, brauchst du was anderes als den Großdeutschen Märchenfunk. Jeder hört BBC!« Das war zwar übertrieben, aber er hatte recht, viele taten das. Ihr Vater hatte es auch einmal gewagt, ihre Mutter hatte sich schrecklich darüber aufgeregt. Seitdem hörte Albert nur heimlich fremde Sender, wenn Rosemarie schlief.
»Die können mich jederzeit einziehen, Frieda«, sagte Ernst. »Ich muss bannig aufpassen. Das gilt auch für deinen Sohn. Wie willst du denn Entscheidungen treffen, wenn du gar nicht weißt, was da draußen so passiert?« Was sollte sie darauf schon sagen? »Siehst du! Wenn ich aber hör, dass sich überall die Fronten auflösen, denn weiß ich, dass ich nur noch ’n paar Wochen oder Tage unsichtbar oder verletzt sein muss, um nicht noch in letzter Sekunde verheizt zu werden.«
»Verletzt?«
»Ich hab ’n Hammer bereitliegen«, erklärte er ihr. »Wenn der Einberufungsbefehl kommt, kloppe ich mir damit einmal kräftig auf den Zeh, Walli bringt mich zum Arzt.« Ernst hatte Walli 1942 geheiratet, damit sie versorgt war, falls ihm etwas zustieß, wie er sich ausgedrückt hatte. »Mach das am besten mit Henrik genauso. Denn kann er zu Hause bleiben und braucht nicht noch los. Ist doch sowieso bald alles vorbei«, wiederholte er.
Doch es war nicht vorbei. Es ging womöglich gerade erst los, schoss Frieda durch den Kopf, als sie an diesem Novembertag den Vorbescheid für Henriks Einberufung aus dem Kasten nahm.
»Aber ich will nicht!«, rief er, als sie mit dem Schreiben in die Hannemannsche Villa kam. »Ich will keinen Eid auf den Führer schwören, dass ich ihm mein Leben opfern würde.«
»Beruhige dich doch«, sagte Frieda. Sarah verbarg ihr Gesicht hinter den Händen, Albert schüttelte nur den Kopf und seufzte wieder und wieder.
»Ich will mich nicht beruhigen!«, schrie Henrik. »Der Führer ist ein alter Mann!«
»Du sagst so etwas nie wieder!«, fauchte Rosemarie.
»Aber es ist wahr. Alle sagen das. Ein Greis ist er, der keine weitere Niederlage verkraften kann.«
»Henrik, es reicht.« Frieda wusste, dass er recht hatte, aber sie wusste auch, wie gefährlich es war, das laut auszusprechen.
»Er ist unser Führer, und er wird den Krieg zu einem guten Ende bringen«, beharrte Rosemarie.
»Niemand kann diesem Grauen ein gutes Ende setzen«, wandte Albert müde ein. »Aber Hauptsache, es geht überhaupt bald zu Ende.«
Rosemarie überhörte ihn. »Du solltest stolz darauf sein, endlich auch einen Beitrag für den Sieg deines Vaterlandes leisten zu dürfen.«
Frieda zog sich mit Henrik und Sarah zurück. Sie konnte das Gerede ihrer Mutter nicht ertragen.
»Es ist nur der Vorbescheid«, beruhigte sie ihren Sohn und sich selbst. »Sollte die Einberufung überhaupt noch kommen, können wir uns immer noch etwas überlegen.«
Die Einberufung kam Mitte Dezember. Frieda vertraute Henrik unter vier Augen an, was Ernst ihr geraten hatte. Nur brachten sie es beide nicht über sich, Henrik eine solche Verletzung beizubringen. So kam, wie angekündigt, am dritten Advent morgens um acht ein Wagen der Wehrmacht. Henrik bemühte sich nach Leibeskräften, vor den anderen Soldaten nicht zu weinen, doch er konnte das Zittern nicht verbergen. Und als er sich auf die Bank der Ladefläche setzte, lief ein Tropfen Blut von seiner Unterlippe, so kräftig hatte er darauf gebissen. Frieda riss sich zusammen und verabschiedete ihn lächelnd. Sie wollte ihm Zuversicht geben, wenn sie auch selbst nicht wusste, woher sie die nehmen sollte. Als der Wagen außer Sichtweite war, konnte sie ihre Tränen nicht länger zurückhalten.
Es war das traurigste Weihnachtsfest, das Frieda je erlebt hatte. Ohne ihren Sohn und ohne ihren Mann. Wann immer sie gedacht hatte, schlimmer könne es nicht werden, hatte sie einsehen müssen, dass das ein Irrtum war. Und jedes Mal stellte sie mit Erstaunen fest, dass sie immer noch ein wenig mehr ertragen konnte. Pers und Henriks Briefe halfen ihr. Henrik schrieb viel. Allein das war ein sicheres Zeichen dafür, wie elend er sich fühlen musste. Längst vergessen die Zeit, in der er von Heldentaten geträumt hatte. In der Anfangszeit berichtete er davon, dass er ständig irgendwohin transportiert wurde. Die Einsatzbefehle schienen sich stündlich zu ändern. Vom Bahnverkehr war aufgrund der schweren Beschädigungen kaum etwas übrig, nur auf wenigen Strecken fuhren überhaupt noch Züge, und die hielten sich natürlich an keinen Fahrplan. So verbrachte Henrik viele Stunden mit Warten. Wenn seine Kompanie mal an einem Ort blieb, schrieb er von Kameraden, die in Frankreich gekämpft hatten und auf verschlungenen Wegen zu ihnen gestoßen waren. Die meisten seiner Briefe schloss er mit einem Satz, in dem er seinen unerschütterlichen Glauben an den Sieg betonte, den er aus dem festen Vertrauen auf den Führer nährte. Frieda und Sarah lasen, was zwischen seinen Zeilen stand: Deutsche Soldaten flohen vor der riesigen Überlegenheit feindlicher Truppen. Zerstörung überall, die ein deutliches Bild über den Stand des Krieges malte. Henrik glaubte weder an den Sieg noch an den Führer, doch er wusste von der staatlich verordneten Briefzensur. Die Soldaten hüteten sich darum, das zu beschreiben, was sie wirklich erlebten. Hätte jemand offen geschrieben, dass er den Krieg für verloren hielt, hätte man ihn für Untergrabung der Moral bestraft. In schweren Fällen sogar mit dem Tod. Henrik musste seine Angst, sein Heimweh und seinen Hass auf Hitler zwischen seinen Formulierungen verstecken. Tage und Wochen gingen ins Land, und noch immer herrschte Krieg. Frieda schien er allmählich endlos. Dennoch saß sie im Frühjahr 1945 täglich mit Sarah, Hans und ihren Eltern vor dem Volksempfänger und hörte den Berichten zu, immer in der Hoffnung, endlich würde das Wort Kapitulation fallen.
Kapitel 2
Am ersten Mai kam Ernst zu Besuch.
»Die Engländer sind nicht mehr weit von Harburg weg, habe ich gehört«, erzählte er atemlos. »Denn kann das nu nicht mehr lange dauern, bis die Wehrmacht sich geschlagen gibt.«
»Wenn du nur recht hast!« Frieda traute sich kaum, wieder Hoffnung zu schöpfen. Andererseits redete Ernst nicht als Einziger so und war zudem gut informiert. »Kann ich dir etwas anbieten, einen Kakao vielleicht?«
»Och, da sag ich nicht nein.« Sarah war draußen, Hans lag, wie so oft, mitten am hellen Tag in seinem Bett und grübelte wahrscheinlich. »Kannst du das Radio anmachen?«
»Natürlich. Ist aber nur der Reichssender Hamburg«, entgegnete Frieda mit einem Lächeln.
»Für mich heißt das noch immer Norddeutscher Rundfunk«, erwiderte Ernst leise. »Und hoffentlich heißt das bald wieder so.«
»Sehe ich doch genauso.«
»So denn bereite du man den Kakao zu«, forderte er sie auf. »Kannst ja nix dafür, wenn ich ’n büschen am Empfänger drehe.« Er zwinkerte ihr zu, sie zuckte demonstrativ mit den Schultern und ging. Frieda war noch nicht in der Küche, als er schon nach ihr rief: »Komm schnell, da ist was passiert!« Mit wenigen Schritten war sie bei ihm. Ernst hatte nicht am Gerät gedreht. »Die haben eine Rede vom Dönitz angekündigt.« In gebückter Haltung stand er vor dem Radio, die Finger kurz vor dem Knopf, als würde der Empfang leiden, wenn er sich bewegte. Auch Frieda blieb wie erstarrt stehen und hörte mit angehaltenem Atem, wie ein Sprecher sagte: »Heute Nachmittag ist unser Führer Adolf Hitler in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei gefallen. Bis zum letzten Atemzuge hat er für sein geliebtes Vaterland und gegen den Bolschewismus gekämpft.« Friedas Gedanken überschlugen sich. Ernst und Albert hatten nach dem gescheiterten Attentat im Jahr zuvor gesagt, dass das Scheitern ein schreckliches Unglück sei. Sie hatte ihre Worte noch im Kopf. Hitlers Tod wäre die Chance auf ein schnelles Ende des Krieges gewesen. Dann war es jetzt so weit? Würden die Nazis ohne ihren Anführer endlich aufgeben? Sie hörte kaum zu, was der neue Reichspräsident und Oberbefehlshaber der Wehrmacht Karl Dönitz von Heldentod und unermüdlichem Kampf bis zum letzten Herzschlag redete, sie konnte nur daran denken, dass der Krieg nun enden würde. Henrik würde nach Hause kommen, und Per. Sie hatte nicht einmal bemerkt, dass Ernst sich aufgerichtet hatte. Erst als er seine Brille abnahm und sich über die Augen wischte, löste auch Frieda sich aus ihrer Erstarrung.
»Es ist vorbei, Ernst«, sagte sie leise. »Nicht wahr? Es ist vorbei.«
Ernst liefen die Tränen über die Wangen, tropften ihm von Nase und Kinn. Er konnte nichts sagen, er nickte nur. Frieda trat zu ihm und nahm ihn in die Arme. Sie hielten sich aneinander fest und weinten.
Am Tag drauf saß sie mit ihren Eltern vor dem Volksempfänger. Draußen war schönstes Wetter, es war schon ungewöhnlich warm für die Jahreszeit, allerdings auch ungewöhnlich windig. Bereits in den vergangenen Tagen waren armdicke Äste gebrochen.
»Ich muss sehen, dass ich die irgendwie da runter kriege«, hatte Albert gesagt und in die Baumkronen geblickt. »Ehe womöglich jemand so einen Knüppel abkriegt.«
»Ich hole uns noch ein wenig Limonade.« Rosemarie hievte sich aus dem Sessel, hielt sich an der Lehne fest und verschnaufte. Sie hatte vor dem Krieg ordentlich zugelegt und erstaunlicherweise nur wenig davon verloren, darum fiel ihr jede Bewegung schwer. Trotzdem war sie oft diejenige, die etwas holen ging.
»Bleibt ihr nur sitzen, ihr habt auch mal eine kleine Pause verdient«, pflegte sie zu sagen. Zwar stimmte es, dass Frieda und Sarah diejenigen waren, die mit den Lebensmittelmarken loszogen, um etwas zu essen zu besorgen, die kochten und das Haus sauber hielten, und Albert kümmerte sich ein wenig um den Garten. Der wahre Grund, vermutete Frieda, war jedoch ein anderer. Rosemarie war die Einzige in der Familie, die Hitler von der ersten Stunde an verehrt hatte, und das noch immer tat. Und es hatte sich nichts an ihrer Haltung geändert, trotz all der schrecklichen Dinge, die geschehen waren und über die jeder Bescheid wusste. Sie war in allem anderer Meinung als ihr Mann und ihre Kinder. Darum war es schwierig, wenn die gesamte Familie die Nachrichten verfolgte. Besonders jetzt nach Hitlers Tod. Auch Rosemarie hatte geweint, allerdings nicht vor Freude wie Frieda, sondern vor Kummer. Während alle anderen auf weitere gute Neuigkeiten hofften, selbst Hans saß in angespannter Haltung im Wohnzimmer, wusste Rosemarie nicht, wie es weitergehen sollte.
Nur wenige Augenblicke, nachdem sie zur Küche gegangen war, knisterte es in dem Gerät, dann ertönte die ernste Stimme von Gauleiter Karl Kaufmann, der sich an die Hamburger wandte: »Nach heldenhaftem Kampf, nach unermüdlicher Arbeit für den deutschen Sieg und unter grenzenlosen Opfern ist unser Volk dem an Zahl und Material überlegenen Feind ehrenvoll unterlegen.« Während Kaufmann offenbar um Worte rang, war es in der Hannemannschen Stube mucksmäuschenstill. Nur der Wind pfiff um die Türmchen der Villa. Frieda hielt die Luft an. Sie sah zu ihrem Vater hinüber, dessen Augen immer größer wurden. Hans hatte ein feines Lächeln auf den Lippen, zum ersten Mal, seit Frieda ihn leblos auf dem Dachboden gefunden hatte. »Der Feind schickt sich an, das Reich zu besetzen, und steht vor den Toren unserer Stadt.«
Rosemarie kehrte mit einem Krug Limonade zurück, die vermutlich überwiegend aus Wasser bestand. Ihre Miene zeigte blankes Entsetzen, als Kaufmann ausführte, dass der Feind vorhabe, Hamburg mit übermächtiger Waffengewalt anzugreifen, wodurch noch einmal Tod über Hunderttausende käme.
»Grundgütiger«, murmelte sie.
Auch Sarah sah vollkommen verängstigt aus. Sie setzte sich zu Frieda auf das Sofa und presste sich an sie. Frieda legte ihr den Arm um die Schulter und streichelte sie beruhigend. Sie wagte allerdings nicht, auch nur ein Wort zu sagen, denn sie hatte Angst, das Wichtigste zu verpassen.
»Mir gebietet Herz und Gewissen in klarer Erkenntnis der Verhältnisse und im Bewusstsein meiner Verantwortung, unser Hamburg, seine Frauen und Kinder vor sinn- und verantwortungsloser Vernichtung zu bewahren«, schepperte es aus dem Volksempfänger. Frieda spürte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. Sie musste schlucken.
»O lieber Gott«, flüsterte sie und hielt Sarah noch ein bisschen fester. Wie aus weiter Ferne hörte sie, wie der Gauleiter die Besetzung Hamburgs durch den Feind für den nächsten Tag ankündigte, wie er für diesen Moment Haltung, Würde und Disziplin von den Hamburgern forderte.
Er schloss mit den Worten: »Gott schütze unser Volk und unser Reich!« Danach war es einige Sekunden still in dem Wohnzimmer.
Albert fand seine Sprache zuerst wieder. »Donnerwetter!« Mehr brachte er nicht heraus.
»Ist das nun eine gute Nachricht?«, wollte Sarah wissen. Sie bebte am ganzen Körper.
»Ja, Schätzchen, ich glaube, das ist eine sehr gute Nachricht.« Frieda musste lachen und wischte sich eilig Tränen mit dem Handrücken weg.
»Was soll daran wohl gut sein?«, fragte Rosemarie in einem Ton, der völlige Resignation verriet. »Sie werden uns spüren lassen, dass sie die Sieger sind. Alles wegnehmen werden sie uns.« Plötzlich änderte sich ihr Tonfall, und sie klang sehr entschlossen: »Nein, das werde ich nicht zulassen.« Sie machte kehrt und verließ das Wohnzimmer.
»Was hast du vor, Röschen?« Albert sah ihr verblüfft nach. Frieda wollte ihr nachgehen, doch da stand Hans auf, kam zu ihr und drückte sie wortlos an sich. Sie erwiderte seine Umarmung.
»Was meinst du, haben wir es geschafft, Bruderherz?« Sie hoffte, er würde etwas sagen, doch er presste sie nur fester an sich. Als er sie losließ, nahm sie das Knarzen der Treppe wahr, gleich darauf das Klappen der Haustür. Hans sah Sarah lange an. Frieda dachte schon, er würde ihr in diesem besonderen Moment sagen, dass er ihr Vater war, doch er nahm sie nur in den Arm. Schließlich ging er auch noch zu Albert, der ihm ein wenig hilflos auf den Rücken klopfte.
»Hast schon recht, mein Sohn, zwar ist der Krieg offiziell noch nicht vorbei, aber wir dürfen uns ruhig schon mal freuen, dass wir alle noch da sind.«
In dem Moment krachte es draußen, es gab einen Schlag und einen Schrei, der merkwürdig abgeschnitten klang.
»Das kam aus dem Garten«, sagte Sarah leise.
»Rosemarie?«, fragte Albert alarmiert. Frieda und Hans rannten gleichzeitig los. Sobald sie einen freien Blick auf das parkähnliche Gelände hatten, blieben sie stehen, als wären sie gegen eine unsichtbare Wand geprallt. Eine Sekunde nur, dann liefen sie zu ihrer Mutter, die vor dem Rhododendronstrauch lag, ein mächtiger Ast, der von der großen Kastanie abgebrochen sein musste, der Länge nach über ihr, als hätte sie sich damit zudecken wollen.
Als Frieda später in der Küche ein kleines Abendbrot zurechtmachte, fragte sie sich, ob der Krieg aus ihr schon ein Monster gemacht hatte. Sie erinnerte sich nur an ein einziges Gefühl, das sie gehabt hatte, während sie neben ihrer Mutter kniete: Hoffnung, dass ihr Bruder zumindest in dieser Situation endlich sprechen würde. Er musste doch etwas sagen, so wie Rosemarie da lag, die Augen geschlossen, einen klaffenden Riss von der Stirn bis weit über den Scheitel, Blut lief ihr unaufhörlich aus der Wunde über die Schläfen, in die Ohren.
Doch Hans sprach kein Wort. Stumm hievte er den schweren Ast zur Seite. In das Rascheln der Blätter, die über Rosemaries Körper strichen, mischte sich ein Schrei.
»Nein! Röschen, nein, um Gottes willen!« Alberts Gesicht war verzerrt vor Schmerz.
Frieda sprang auf. »Wir kümmern uns um sie, Papa«, sagte sie sanft, und zu Sarah: »Bring ihn rein, bitte!«
Sarah blickte an Frieda vorbei zu dem reglosen Körper, ihre Augenbrauen zuckten kurz. »Komm, Albert«, sagte sie leise, »wir sind hier nur im Weg. Onkel Hans und Frieda wissen, was zu tun ist.«
»Meine Frau, ich will zu meiner Frau«, jammerte Albert, ließ sich jedoch ohne Widerstand von Sarah ins Haus führen.
Frieda hockte sich wieder hin, legte ihre Finger an den Hals ihrer Mutter. Nichts. Sie neigte ihr Ohr hinab zu den schmalen Lippen. Doch da war nichts.
»Sie ist tot«, flüsterte sie. Hans stand einen Schritt entfernt und rang die Hände. Seine Kieferknochen traten hervor, so sehr biss er die Zähne aufeinander. Kein Wort. »Der Ast hat sie erschlagen. Ausgerechnet heute«, sagte sie. »Was hat sie nur hier draußen gemacht?«
Als ob das noch eine Rolle spielen würde, aber Friedas Verstand hatte sich einfach mit etwas beschäftigen müssen, um zu verhindern, dass ihr Gefühl die Oberhand gewann. Hans hockte sich neben sie und zupfte sie sacht am Ärmel. Sie sah zu ihm auf, er deutete auf eine Stelle neben dem Rhododendron. Im Beet war ein Loch, eher eine flache Mulde, daneben stand ein kleiner Holzkasten mit Intarsien, eins von Rosemaries Schmuckkästchen. Hans griff nach einer Hand seiner Mutter und hielt sie hoch, so dass Frieda die schwarzen Ränder unter den Nägeln und die Erde an den Fingern erkennen konnte.
»Sie wollte ihren Schmuck vor den Engländern in Sicherheit bringen.« Frieda schüttelte langsam den Kopf. »In ihrem ganzen Leben hat sie nie Gartenarbeit gemacht, und jetzt wollte sie mit bloßen Händen ein Loch graben.« Die Fingerspitzen sahen aus, als hätte ihre Mutter eine tiefe Grube ausgehoben, doch weit schien Rosemarie nicht gekommen zu sein.
Sie hatten ihren Körper nach drinnen geschafft. Nie wieder würde Frieda ihr das noch immer lange Haar zu Zöpfen flechten und daraus hübsche Schnecken drehen. Nie wieder würde sie mit ihr reden. Vorbei. Einfach so. Sie hatten sie in einer kleinen Kammer aufgebahrt, Frieda hatte ihr das Blut vom Gesicht gewaschen. Sarah hatte Albert eine Schlaftablette gegeben.
Und jetzt bereitete Frieda also für alle das Abendessen zu, denn sie mussten vernünftig sein und etwas essen, wenn auch niemand Appetit hatte. Es musste ohne Mutter weitergehen. Keiner bekam mehr als wenige Bissen herunter. Niemand sagte etwas, als könne die Ruhe der Verstorbenen noch gestört werden. Nach dem Essen zogen sich Hans und Sarah zurück. Albert war noch ganz benommen, von dem Verlust und der Tablette.
»Habe ich es nicht gesagt?« Albert sprach so leise, dass Frieda, die den Tisch abräumte, ihn beinahe nicht gehört hätte. »Vorhin habe ich es noch gesagt, dass ich die gebrochenen Äste irgendwie aus der Krone kriegen muss. Damit keiner so einen Knüppel abkriegt, habe ich gesagt.« Seine Stimme klang schleppend. »Was hat sie denn nur da draußen zu schaffen gehabt?« Er schlug sich die Hände vor das Gesicht. Frieda trat von hinten an ihn heran, schlang die Arme um ihn und drückte ihr Gesicht an seine Wange.
»Sie wollte ihren Schmuck verstecken«, erwiderte sie, als ob ihr Vater wirklich eine Antwort erwartete. »Sie hat an das Wohl der Familie gedacht. Bestimmt wollte sie ihn in Sicherheit bringen, damit wir ihn verkaufen können, wenn es hart auf hart kommt.« Sie dachte an Mutters Brosche, die Vater ihr zu einem Hochzeitstag geschenkt hatte, und an einen Brillantring. Frieda fiel auf, dass sie weder das eine noch das andere in dem Kästchen gesehen hatte. Eigenartig. Vermutlich hatte Rosemarie für die wertvollsten Exemplare ein Versteck im Haus gefunden.
Albert wischte sich über das Gesicht, atmete tief durch. »Wahrscheinlich ist es ihr ganz recht so«, sagte er plötzlich.
»Wie meinst du das?« Frieda zog sich einen Stuhl neben seinen und setzte sich.
»Sie hat in letzter Zeit oft zu mir gesagt, dass sie müde ist, dass sie unseren Sohn schon verstehen kann.«
»Was sollte das heißen?« Ein ungeheuerlicher Gedanke schlich sich an. Rosemarie hatte stets standhaft geleugnet, dass Hans seinem Leben ein Ende setzen wollte.
Albert sah sie an. »Du weißt genau, was ich meine. Mein Röschen hatte schon ihre Schwierigkeiten damit zu welken. Und jetzt auch noch von vorne anzufangen, allein zuhause zu sitzen, wenn ich mit meiner Tochter den Betrieb wieder aufbaue?« Er schüttelte den Kopf. »Sie hätte nicht die Kraft dazu gehabt. Wenn sie sich wenigstens um Hans hätte kümmern können, um seine Malerei. Aber er hat wohl für immer damit aufgehört.« Frieda schluckte. Es war gut, dass Vater wieder klare Gedanken fassen konnte, doch es tat auch weh, wie traurig er klang.
»Kann schon sein, dass das zu viel für sie gewesen wäre«, sagte sie nachdenklich.
Unvermittelt drang ein tiefes Schluchzen aus seiner Kehle. »Was wird denn jetzt aus mir?« Seine Augen füllten sich mit Tränen, liefen über. »Sie war doch meine ganze Freude.« Da saß er, grau, mit hängenden Schultern, bebend. Frieda suchte nach den richtigen Worten. Er hatte recht, er konnte wieder ins Kontor kommen. Vielleicht nur ein paar Stunden in der Woche. Sie konnten jede Hilfe gebrauchen, jetzt, wo sie das Geschäft bald wieder in Schwung bringen würden.
»Was mache ich denn nur ohne sie, Sternchen?« Frieda erstarrte. Mit einem Schlag schnürte ihr die Trauer die Kehle zu. Sie hatte funktioniert, hatte sich zusammengerissen, um für ihren Vater stark zu sein, für Sarah und Hans. Nur keine Schwäche zeigen. Sie hatte sich darauf konzentriert, das Nötige zu tun. Doch in dieser Sekunde gab es nur sie, ihren Vater und diesen ungeheuren Schmerz, der sie ohne Vorwarnung erwischte. Wie lange hatte er sie nicht mehr Sternchen genannt? Sie fühlte sich plötzlich wie ein Kind. Ein Kind, dem die Mutter fehlte. Erinnerungen stürmten auf sie ein. Ausflüge mit der ganzen Familie auf den Dom. Frieda war noch ein kleines Mädchen gewesen, Hans ein liebenswerter Angeber, dem die ganze Welt zu gehören schien. Wie stolz Rosemarie immer auf ihre Kinder gewesen war. Sie hatten so ihre Schwierigkeiten miteinander gehabt, Frieda und sie. Und doch … Frieda kam die Nacht in den Sinn, in der sie geglaubt hatte, ihr Kind zu verlieren. Blutungen aus heiterem Himmel, viel zu weit vor der Geburt. Ihre Mutter war für sie da gewesen. Sie hatte genau gewusst, was zu tun war, hatte ihre Hand gehalten und sie beruhigt. Herrgott, sie hatten so oft Streit gehabt. Alles Friedas Schuld. Warum hatte sie nicht manches Mal einfach den Mund gehalten? Warum hatte sie es ihrer Mutter oft so schwer gemacht? Zu spät, um sich zu entschuldigen, um es ab sofort besser zu machen. Zu spät. Rosemarie fehlte ihr in diesem Moment wie nie zuvor.
»Schon gut, meine Kleine, schon gut.« Frieda spürte die Hände ihres Vaters, die die ihren umschlossen. Faltig waren sie, doch noch immer stark. Ihr konnte nichts passieren, sie durfte ihren Gefühlen endlich freien Lauf lassen.
»Ich bin so traurig, Papa.« Es tat gut zu weinen. Es fühlte sich an, als würde eine Kruste, die Frieda sich zum Schutz hatte wachsen lassen, platzen und zerbröckeln. Ihre Erstarrung wich einer matten Erschöpfung.
Albert reichte ihr ein Taschentuch und tupfte sich selbst noch ein paar Tränen weg. Lange saßen sie so beieinander, redeten kaum, hielten sich nur fest und ließen gemeinsam Trauer und Sehnsucht zu.
»Du hast gesagt, du willst mit mir den Betrieb wieder aufbauen«, begann Frieda, als sie sich ein wenig beruhigt hatte. »Meinst du das ernst?«
»Natürlich.«
»Das ist eine gute Idee, glaube ich. Du wärst uns eine große Hilfe, und deine Arbeit war doch auch immer deine Freude, hm?«
»Das war meine Pflicht. Ich habe sie gern getan, trotzdem blieb es immer eine Pflicht.«
Sie sahen sich an. »Du hast noch uns«, sagte Frieda. »Du bist nicht allein. Ich kann mit Per sprechen, wenn er zurückkommt. Vielleicht ziehst du zu uns, wenn wir unser Haus wieder ganz für uns haben.«
»Noch ist es nicht so weit, noch wohnt ihr hier. Bei mir.« Er räusperte sich. »Alles andere findet sich irgendwie.«
Es tat weh, ihn so mutlos zu sehen. »Du hast uns und deine Schiffsmodelle. Sie wird uns allen immer fehlen, aber wir müssen weitermachen.« Was redete sie da nur? Aber sie musste ihm doch irgendwie Zuversicht geben.
Er hörte sie gar nicht. »Sie hat sich immer für mich schön gemacht«, sagte er leise.
»Ja, das hat sie.« Frieda zögerte. »War dir das eigentlich wirklich wichtig?«
»Nicht ihre Schönheit war mir wichtig, sondern dass sie es nur für mich getan hat, nur um mir eine Freude zu machen.« Er seufzte tief und stand auf. »Ich gehe jetzt zu ihr.« Frieda stand auch auf. »Allein.«
Die Meldung von Gauleiter Karl Kaufmann war trotz ihrer Bedeutung in den Hintergrund gerückt. Rosemarie Hannemann war tot, eine ebenso unabänderliche wie bestürzende Tatsache, die alles andere verblassen ließ und mit der alle zu leben lernen mussten. Frieda musste sich um die Beisetzung kümmern. Nur wie? Es herrschte Ausgangssperre. Aber was sollte sie denn tun, ihre Mutter tagelang im Haus liegen lassen oder sie im eigenen Garten vergraben? Unmöglich. Frieda konnte sich nicht an das Verbot halten, sie musste hinausgehen. Sie würde eben aufpassen, die Engländer konnten schließlich nicht alle Straßen gleichzeitig kontrollieren. Als sie das Haus verlassen wollte, trat Sarah in den Flur.
»Albert war die ganze Nacht bei ihr.« Ihre Stimme war belegt.
»Ich weiß.« Frieda versuchte ein Lächeln.
»Er hat auf dem Stuhl neben ihr geschlafen. In der engen Kammer. Er muss vollkommen erledigt sein.«
»Wir müssen dafür sorgen, dass er sich nachher gründlich ausruht.«
Sarah nickte, dann sah sie auf. »Wohin gehst du? Du darfst nicht raus, es ist …«
»Ausgangssperre, ich weiß.« Frieda senkte die Stimme. »Ich muss zum Kuhlmann, sehen, ob von seinem Bestattungshaus noch etwas übrig ist.«
»Aber das ist verboten.« Sarahs Augen waren vor Angst geweitet.
»Mutter muss abgeholt werden, sonst verbringt Vater auch die nächsten Nächte in der Kammer auf dem Stuhl. Sie hat ein würdevolles Begräbnis verdient«, sagte sie leise. Wieder nickte Sarah. »Kümmere du dich um Vater und um Hans. Ich komme so schnell ich kann zurück.«
»Hoffentlich«, flüsterte Sarah.
Frieda nahm den Weg durch den Jenischpark in nordöstlicher Richtung. Wenn das Bestattungsinstitut Kuhlmann nur nichts abbekommen hatte. Wen sollte sie sonst fragen? Es gab auch andere Bestatter, aber Vater, Otto Kuhlmann und dessen Sohn, der inzwischen die Geschäfte führte, kannten sich seit Jahren. Sie schob den Gedanken zur Seite und ermahnte sich, zuversichtlich zu sein. Hatte man das nicht gelernt in den letzten Jahren?
Für einen kurzen Augenblick hätte sie glauben können, dass das Leben leicht und schön war, wie sie es sich als junges Mädchen vorgestellt hatte. Der Himmel war blau, die Luft roch nach Frühling und nach Elbe, eine sanfte Brise spielte mit ihrem Haar, Bäume und Sträucher saßen voller dicker Knospen. Doch Frieda war inzwischen zweiundvierzig Jahre alt, und das Leben war alles andere als leicht.
Sie überquerte auf provisorisch montierten Brettern die Flottbek, lief weiter nördlich, erreichte schließlich die Waitzstraße. Kein Mensch war ihr bisher begegnet. In den Grünanlagen war ihr das normal vorgekommen. Vögel hatten gezwitschert, Blätter leise geraschelt. Auf der Straße zwischen Häusern, denen meist nur ein paar Fensterscheiben fehlten, war die Atmosphäre unheimlich. Instinktiv blieb sie nah an den Hauswänden, huschte von einer Nische in die andere, blieb zwischendurch immer wieder stehen und sah sich um. Niemand weit und breit, keine Gefahr, entdeckt zu werden. So arbeitete sie sich Meter um Meter, Block um Block vor, bis sie endlich die Bahrenfelder Chaussee erreichte. Gottlob, das Firmengebäude von Otto Kuhlmann stand noch. Frieda klopfte an, ihr Herz schlug viel zu schnell. Mit einem Mal kam es ihr völlig verrückt vor, dass sie sich auf den Weg gemacht hatte. Niemand würde ihr öffnen. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, Frieda wollte schon aufgeben, da hörte sie endlich Geräusche.
»Wer ist da?« Eine Frauenstimme, misstrauisch, ängstlich.
»Frieda Møller von Hannemann & Krüger Kakao-Import. Ich brauche Ihre Hilfe.«
Erst Stille, dann ein Rascheln und Knacken. Die Tür öffnete sich, Frieda wurde so schnell ins Haus gezogen, dass sie nicht wusste, wie ihr geschah.
»Sind Sie wahnsinnig, heute draußen herumzulaufen?« Frau Kuhlmann sah sie verständnislos an. Sofort wurde ihr Blick sanfter. »Sie brauchen die Dienste meines Mannes?« Frieda nickte. »Mein herzliches Beileid. Na, dann kommen Sie mal.« Sie führte sie in ein Kontor. »Bitte nehmen Sie Platz. Ich hole meinen Mann. Wir haben heute keine Kundschaft erwartet«, sagte sie entschuldigend und ging.
Wenig später war Bestatter Kuhlmann zur Stelle, ein Mann mit strahlenden Augen. Er begrüßte sie, setzte sich und sah sie erwartungsvoll an.
»Meine Mutter ist gestern verstorben. Ein Unfall. Könnten Sie sie bitte abholen und sich um alles kümmern, den Sarg, die Beisetzung?«
Er nickte. »Ein Unfall, sagen Sie.« Dann legte er den Kopf ein wenig schief. »Holz?«
Frieda war eine Sekunde sprachlos. »Ja, woher wissen Sie das?«, fragte sie dann.
»Ich wusste es nicht, ich habe es gehofft.«
»Sie haben gehofft, dass meine Mutter von einem Ast erschlagen wurde?«
Jetzt war er offenbar überrascht. Nicht lange. »Verzeihen Sie, manchmal springe ich ein wenig in meinen Gedanken. Ich fragte nach Holz, weil es doch ein sehr knappes Gut ist. Wenn Sie also noch Bäume im Garten hätten, die der Tischler haben könnte …«
»Ich verstehe.« Frieda dachte an die Buchen und die mächtige Eiche auf dem Grundstück ihrer Eltern. »Ein Baum sollte für einen Holzsarg doch genügen, oder nicht?«
»Hören Sie, Frau Møller, die Sache ist die: Wenn Sie für Ihre Frau Mutter eine Bestattung haben möchten, wie Sie sie von früher kennen, dann ist das eine kostspielige Angelegenheit.« Frieda schnappte nach Luft, doch Kuhlmann nahm ihr den Wind aus den Segeln: »Nicht etwa, weil wir uns bereichern wollen. Es ist nur so, dass es nichts gibt. Schokolade und Pralinen haben einen hohen Tauschwert. Möglicherweise können Sie mir dazu noch ein paar Lebensmittel mit langer Haltbarkeit anbieten oder Kohlen. Holz wäre natürlich das Beste.«
Frieda war darauf eingestellt gewesen, Blumenschmuck auszusuchen und den Stoff, mit dem der Sarg ausgeschlagen werden sollte. Wie töricht. »Es gibt eine alte Eiche«, begann sie.
Kuhlmanns Augen leuchteten. »Wie gesagt, wenn der Tischler sich die holen dürfte, könnte er mir daraus Särge fertigen.«
»Aber es dauert doch, bis das Holz überhaupt trocken ist«, wandte sie ein.
»Liebe Frau Møller, lassen Sie uns die Einzelheiten ganz in Ruhe besprechen. Ich kann Ihnen versichern: Wenn wir auch nicht mehr aus dem Vollen schöpfen können wie früher, werden wir alles tun, um Ihrer Mutter ein würdevolles Begräbnis auszurichten.«
Nach über einer Stunde stand Frieda wieder auf der Straße, ausgelaugt, aber auch erleichtert. Kuhlmann hatte ihr angeboten, sie mit dem Bestattungswagen nach Hause zu bringen und den Leichnam ihrer Mutter gleich mitzunehmen.
»Es ist ein einfaches Gefährt«, entschuldigte er sich, »gezogen von einem Pferd. Unser Automobil habe ich nicht mehr. Benzin ist ohnehin schwer zu kriegen. Aber ich denke, man wird mich trotz der Ausgangssperre passieren lassen.«
Frieda verzichtete. Sie bat ihn, erst am Nachmittag zu kommen, damit ihre Familie, vor allem ihr Vater, noch ein wenig Zeit hatte, ehe das Unvermeidliche geschah. Außerdem musste sie ja auch mit Albert besprechen, dass sie die Eiche opfern sollten. Genug zu tun also, Frieda sollte auf direktem Weg nach Hause gehen. Andererseits war das endlich die Gelegenheit, sich selbst einen Eindruck vom Zustand der Innenstadt zu verschaffen. Sie hatte so viel gehört, aber die Zerstörung nicht mit eigenen Augen gesehen. Also ging sie in Richtung Altona. Der rote Schein am Himmel nach dem Feuersturm fiel ihr ein. Frieda hielt die Ungewissheit nicht länger aus. Existierte der Meßberghof noch? War er wirklich unbeschädigt, wie Ernst ihr versichert hatte? In welchem Zustand mochten die Speicher sein? Es war nicht gerade klug, noch länger gegen das Ausgangsverbot zu verstoßen, doch bisher war ihr niemand begegnet, und britische Truppen würde sie sicher schon von Weitem sehen. Sie schlich vorwärts, der Sog, der sie dazu brachte, immer weiter zu laufen, wurde immer stärker. Frieda vergaß alles um sich herum, so sehr nahm die merkwürdige Stimmung sie gefangen. Unheimlich, wie still und menschenleer die Straßen waren.
Sie bog in den Neuen Kamp, ging weiter in die Feldstraße. Einige Häuser schienen unbeschädigt, die Fenster waren alle geschlossen. Niemand, der Fähnchen schwenkte und die Engländer begrüßte. Natürlich nicht, es waren Feinde, Besetzer. Dabei war es doch Deutschland gewesen, das diesen schrecklichen Krieg angezettelt hatte. Die Briten sorgten dafür, dass er aufhörte. Müsste man ihnen nicht einen herzlichen Empfang bereiten? Sie ging geduckt eilig an Gebäuden vorbei, in deren Mauern Löcher klafften. Ein Stückchen weiter hatten Bomben eine breite Lücke in eine Häuserreihe gerissen und nur noch Schutt und Asche zurückgelassen. Frieda musste husten, die trockene warme Luft hing voller Staub. Sie lief über den Sievekingplatz und zum Karl-Muck-Platz und von dort durch die Parkanlagen südlich Richtung Wasser. Nur wenige Schäden am Holstenwall. Am Zeughausmarkt blieb sie stehen, als wäre sie gegen eine unsichtbare Wand geprallt.
»O mein Gott«, flüsterte sie. »Großer Gott, das ist doch nicht möglich.« Zwischen ihr und dem Großneumarkt war nichts mehr. Das gleiche Bild, wenn sie zum Schaarmarkt blickte. Wo dicht an dicht mehrstöckige Bauten vielen Menschen ein Zuhause geboten hatten, war nur noch eine Trümmerlandschaft, geborstenes Glas, verkohlte Balken, Betonstücke kreuz und quer, Ziegelschutt. Kabel ragten sinnlos in den Himmel, ebenso verbogene Stahlträger und schwarz versengtes Holz. Sie hatte Verwüstung erwartet, doch dieser Anblick lag außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Der Turm der Michaeliskirche ragte über all dem in die Höhe. Dem Himmel sei Dank, wenigstens stand er noch. Am liebsten wäre sie davongerannt, aber sie war doch schon so weit gekommen. Jetzt musste sie auch sehen, ob das Kontorhaus noch existierte. Daran glauben konnte sie nicht mehr. Völlig unmöglich, dass ihre geliebten Walzen und Conchiermaschinen unbeschadet überstanden haben sollten, was hier gewütet hatte. Und doch … der Michel stand schließlich auch noch.
Sie merkte, dass sie zitterte, ihre Knie, ihr ganzer Körper fühlten sich an, als bestünden sie nur noch aus weicher Masse. Keine Knochen, keine Gelenke, nur weiches Fleisch, das sich nicht aufrecht halten konnte. Frieda versuchte, ruhig zu atmen, musste gleich wieder husten, würgte. Plötzlich hörte sie dumpfe Geräusche, ein Dröhnen, das sich näherte, das immer lauter wurde. Es kam von Süden. Kratzendes Metall, schwer auf Asphalt. Schließlich sah sie die ersten Fahrzeuge. Sie duckte sich hinter einem Mauerrest. Engländer! Eine ganze Kolonne von Kettenfahrzeugen, auf denen englische Soldaten hockten. Es mussten Hunderte Wagen sein.
In gebückter Haltung lief Frieda rückwärts. Wenn sie es unbemerkt zum Holstenwall schaffte, konnte sie von da durch den Park zum Heiligengeistfeld gelangen. Sie hatte keine Vorstellung davon, was die Briten täten, wenn sie sie entdeckten, und sie wollte es auch nicht darauf ankommen lassen. Immer weiter schlich sie rückwärts, ohne die Augen von der Kolonne zu nehmen, die sich wie ein giftiger Wurm auf sie zu bewegte. Keine Zeit mehr zu verlieren.
Plötzlich eine Bewegung nicht weit von ihr. Frieda drehte den Kopf, blieb mit dem Fuß an einem Brett hängen, strauchelte, versuchte, ihr Gleichgewicht wiederzubekommen. Jemand schlang von hinten die Arme um sie, fing sie auf, eine Hand legte sich über ihren Mund. Frieda wand sich, wollte sich aus dem Griff befreien, doch er war wie aus Eisen. Sie blähte die Nasenlöcher, um genug Luft zu bekommen. Da spürte sie etwas an ihrer Wange, Lippen an ihrem Ohr.
»Pst!« Eine schmutzige, blutverkrustete Hand deutete an ihr vorbei auf die Panzerfahrzeuge, dann wieder: »Pst!« Frieda verstand und deutete ein Nicken an. Die Finger lösten sich langsam von ihrem Mund. Frieda drehte sich um und blickte in das Gesicht eines Mannes. Sie wich erschrocken zurück. Die Züge verrieten, dass er noch jung war, Henriks Alter möglicherweise, doch das struppige Haar war schlohweiß. Die dunklen Augen waren riesig und voller Panik. Was mochten sie schon alles gesehen haben? Nachdem sie einander eine Sekunde angestarrt hatten, schnappte er sich eine einarmige Puppe, die er offenbar auf dem Schutt abgelegt hatte, packte Friedas Hand und zog sie mit sich, bis sie in den Parkanlagen untertauchen konnten und aus dem Sichtfeld der englischen Soldaten verschwunden waren.
Kapitel 3
Vier Tage waren seit der Begegnung mit dem Mann mit der Puppe vergangen. Er hatte Frieda in Sicherheit gebracht, ihr noch einmal lange und eindringlich in die Augen gesehen. Dann hatte er sie abrupt losgelassen und war davongerannt. Frieda hatte noch nach ihm gerufen. Sie wollte sich bedanken, ihm Hilfe anbieten, doch er blieb verschwunden. Es waren seltsame Tage gewesen. Einerseits fühlte es sich gut an, mit Albert und vor allem mit Sarah endlich wieder offen über alles sprechen zu können, auch über Politik. Mehr noch, nach anfänglicher Unsicherheit, ob dem Frieden wirklich zu trauen sei, genoss Frieda die Tatsache, auch außerhalb der eigenen vier Wände nun wieder sagen zu können, was sie dachte. Die Furcht, bei den Nazis angeschwärzt zu werden, verflog allmählich. Auf der anderen Seite waren alle still und bedrückt, als stünde ihnen das Schrecklichste noch bevor. Rosemaries Tod war doch schon das Furchtbare, das ihnen widerfahren war. Die Beerdigung würde ein Abschluss sein und in gewissem Sinn auch ein Neuanfang. Und doch graute ihnen allen entsetzlich davor.