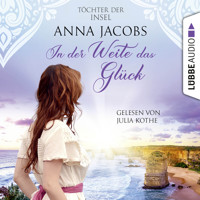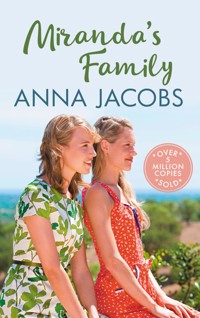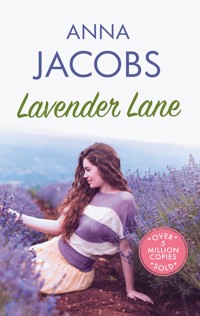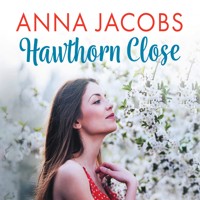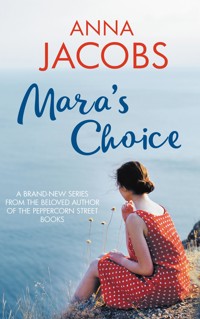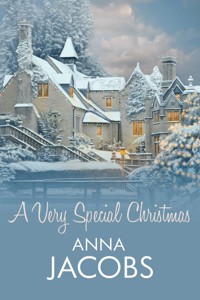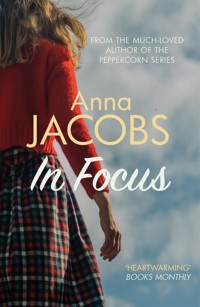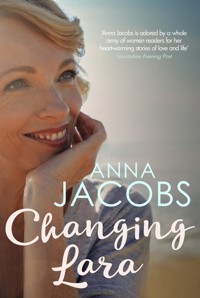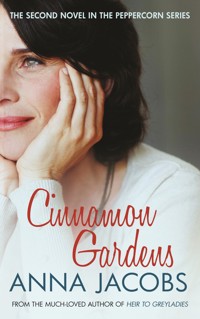7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die fesselnde Auswanderer-Saga von Bestseller-Autorin Anna Jacobs
- Sprache: Deutsch
Lancashire, 1863. Die kürzlich verwitwete Hannah Firth träumt von einem neuen Leben. Als ihre boshafte Schwiegertochter sie als unbezahlte Dienerin einsetzt, versucht Hannah zu gehen. Doch sie ahnt nicht, in welche Abgründe Pattys Bosheit sie führen und wie schwer sie es ihr machen wird. Auch Nathaniel Kings Leben ist ruiniert, als der Sohn seines Vermieters seine Gärtnerei verwüstet - und daraus eine üble Fehde entsteht. Als Hannah Nathaniel begegnet, hat sie nur noch ein paar Münzen und ihre Träume von einer glücklicheren Zukunft. Der Anziehung zueinander können sie nicht widerstehen, und sie tun sich zusammen. Doch ihre Feinde haben Geld und mächtige Verbündete auf ihrer Seite. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um sie loszuwerden ...
Manchmal muss das Schlimmste passieren, damit man seine Bestimmung findet.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Lancashire, 1863. Die kürzlich verwitwete Hannah Firth träumt von einem neuen Leben. Als ihre boshafte Schwiegertochter sie als unbezahlte Dienerin einsetzt, versucht Hannah zu gehen. Doch sie ahnt nicht, in welche Abgründe Pattys Bosheit sie führen und wie schwer sie es ihr machen wird. Auch Nathaniel Kings Leben ist ruiniert, als der Sohn seines Vermieters seine Gärtnerei verwüstet – und daraus eine üble Fehde entsteht. Als Hannah Nathaniel begegnet, hat sie nur noch ein paar Münzen und ihre Träume von einer glücklicheren Zukunft. Der Anziehung zueinander können sie nicht widerstehen, und sie tun sich zusammen. Doch ihre Feinde haben Geld und mächtige Verbündete auf ihrer Seite. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um sie loszuwerden ...
Manchmal muss das Schlimmste passieren, damit man seine Bestimmung findet.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Anna Jacobs
Töchter der Insel -In den Träumen die Sehnsucht
Aus dem Englischen von Freya Rall
1
Juli – August 1863
Lancashire
Hannah Firth stand hinter dem Vorhang der guten Stube und sah zu, wie ihr jüngerer Sohn Malachi auf dem Ladekarren die Straße hinunterrumpelte. Nur mit übermenschlicher Anstrengung hielt sie ein Schluchzen zurück. Australien war so weit fort, und wer wusste, was ihm dort alles zustoßen könnte? Er war doch erst neunzehn Jahre alt. Sicher, sein Erscheinungsbild war das eines Mannes und er war klüger als die meisten anderen – doch in ihrem Herzen war er noch immer ein Junge.
Hinter ihr ertönten Schritte, und sie drehte sich um.
»Dann ist er also fort?« Ihr Erstgeborener Lemuel starrte sie von der Tür her an.
Sie nickte. Noch traute sie ihrer Stimme nicht. Vor dieser Situation hatte sie sich seit dem Tod ihres Mannes gefürchtet: in einem Haus leben zu müssen, das nun ihrem Sohn und seinem Drachen von einer Ehefrau gehörte. Vollkommen von ihnen abhängig zu sein und niemanden zu haben, der sich bei Uneinigkeiten auf ihre Seite schlagen würde – und das mit einer solchen Schwiegertochter.
Im selben Augenblick stieß Patty schon ihren Gatten beiseite und kam herein. Sie hatte wieder diesen besitzergreifenden Blick aufgesetzt, der Hannah bereits jetzt irritierte. »Nun, vielleicht fällt dir dann endlich einmal auf, dass du noch einen Sohn hast, Mutter Firth – einen, der zehnmal so viel wert ist wie dein ach so verehrter Malachi.«
»Ich liebe beide meiner Söhne«, antwortete Hannah und wahrte dabei nur mit größter Mühe einen neutralen Tonfall, »aber es wird mir doch sicher gestattet sein, um den zu trauern, den ich nun verloren habe.«
Lemuel kam zu ihr und tätschelte ihr unbeholfen die Schulter – ein hochgewachsener junger Mann von dreiundzwanzig Jahren, schon jetzt auf dem besten Wege, ebenso massig zu werden wie sein Vater. Bei seiner Geburt war sie achtzehn gewesen, in vielerlei Hinsicht selbst noch ein Kind und angewiesen auf die Hilfe von Fremden in dieser Furcht einflößenden, schmerzhaften Situation. Ihr Mann war zweiundvierzig gewesen – so alt wie sie jetzt. Merkwürdig, dass er ihr damals so alt erschienen war, während sie sich noch immer jung fühlte.
John war ein bodenständiger, verlässlicher Mann gewesen und Lemuel kam ganz nach ihm. Er würde die Böttcherei exakt so weiterführen, wie sein Vater es getan hatte. Beide waren sie langweilig, so furchtbar langweilig, mit einem trägen Geist und altmodischen Ansichten. Wie schon so oft wünschte sie, ihre Eltern hätten sie nicht mit siebzehn Jahren in die Ehe mit einem so viel älteren Mann gedrängt. Sicher, John hatte sie stets freundlich behandelt – wenn auch anfangs eher wie ein Haustier denn wie eine Ehefrau –, doch hatte er erwartet, dass ihr Leben sich ausnahmslos um ihn und seine Bedürfnisse als Familienoberhaupt drehte.
»Ich mache wohl besser die Werkstatt auf. Diese Fässer machen sich nicht von selbst.«
Sie schaute Lemuel hinterher. Er verschwendete keinen Blick zurück, war bereits voll und ganz bei den Aufgaben des Tages.
»Nun, für Selbstmitleid haben wir keine Zeit, Mutter Firth«, erklärte Patty knapp. »Es gibt reichlich zu tun. Zuerst kannst du die Küche aufräumen, während ich Klein John füttere, dann machen wir uns Gedanken darüber, was es heute zu essen geben soll. Und dann ist natürlich noch Malachis Zimmer auszuräumen. Das wird ein feines Kinderzimmer abgeben.«
»Das übernehme ich«, sagte Hannah rasch.
»Nein, ich kümmere mich später selbst darum. Ich will die Möbel umstellen.«
Herausfordernd starrte Patty sie dabei an, als dürste sie nach einer Auseinandersetzung, und so biss Hannah sich auf die Zunge und machte sich daran, die Küche in Ordnung zu bringen. Einen Moment lang hielt sie inne und blickte sich um, ehe sie mit der Arbeit begann. Erst vor zwei Tagen waren ihr Sohn und seine Frau eingezogen, und schon jetzt hatte Patty ihre Spuren in dem hinterlassen, was mehr als zwanzig Jahre lang Hannahs Reich gewesen war. Alles hatte sie umgeräumt, ob notwendig oder nicht.
Warum hatte John ihr nicht wenigstens ein bisschen eigenes Geld hinterlassen können, sodass sie sich ein kleines Häuschen hätte mieten und in Frieden leben können? Sie war nicht gierig, viel hätte sie nicht gebraucht, doch was ihr jetzt noch blieb, waren nur die mageren Ersparnisse, die sie über die Jahre vom Haushaltsgeld zurückgelegt hatte – und davon hatte sie bereits einen großen Teil für Malachi ausgegeben, damit er einen Grundstock von Handelswaren mit nach Australien nehmen könnte.
Sie seufzte und schloss für einen Moment die Augen. Vielleicht hätte sie etwas mehr für sich behalten sollen, aber sie hatte ihm einen guten Start ermöglichen wollen. Er war so voller Träume von einem neuen Leben in einem Land voller Sonnenschein. Der Gedanke entlockte ihr ein Lächeln. Für große, wichtige Träume wie diesen hatten sie beide einen Namen: Drei-Penny-Träume. Malachi und sie waren einander in vielerlei Hinsicht so ähnlich: interessiert an der weiten Welt, hungrig nicht nur im Körper, sondern auch im Geiste.
Mit wem sollte sie nun ihre Träume teilen? Unvermittelt ging ihr auf, dass sie ohnehin keine mehr hatte, nicht einmal einen für einen halben Penny. Sie war noch immer wie betäubt nach Johns so unerwartetem Tod. Als ihr Blick aus dem Fenster zum grauen Himmel ging, fröstelte sie, obgleich es in der Küche warm war. Kein Wunder, dass Malachi nach Sonnenschein gierte. Gefühlt regnete es seit Wochen ununterbrochen, obwohl Hochsommer war.
Seufzend machte sie sich daran, das schmutzige Geschirr zusammenzusammeln. Wie sollte sie Jahre unter Pattys Knute durchstehen? Andere verwitwete Frauen arrangierten sich mit dieser Situation, aber ... Sie erstarrte, als ihr auf einen Schlag klar wurde, dass sie das schlicht nicht ertragen würde. Jene anderen Frauen hatten nicht Patty zur Schwiegertochter.
Sie würde sich überlegen müssen, was sie stattdessen tun sollte. Eine Weile würde sie es über sich ergehen lassen, bis sie einen Weg vor sich sah, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Schließlich war sie für ihr Alter noch jung geblieben, kräftig und energiegeladen wie alle Frauen in ihrer Familie. Erst wenige graue Strähnen zierten ihr Haar, und sie war noch immer rank und schlank. Es würde doch sicher nicht schwer sein, eine Anstellung zu finden?
Ungebeten schlich sich ein weiterer Gedanke in ihren Kopf: Oder sogar einen zweiten Ehemann. Nein, dazu war sie zu alt. Und eine reine Zweckehe könnte sie nicht noch einmal eingehen, nie wieder.
Ihr Mundwinkel verzog sich zu einem schiefen Lächeln. Von Patty fortzukommen war bloß ein Ein-Penny-Traum, denn es lag keine Freude darin, doch für den Anfang würde es reichen. Sie atmete tief durch und trug das heiße Wasser hinüber in die Spülküche, goss es in die Blechschüssel im Schüttstein und warf einige Sodakristalle hinein.
Als Patty nicht hinterherkam, nahm Hannah an, dass ihre Schwiegertochter bewusst trödelte und wartete, bis sie alles allein erledigt hätte. Was Hausarbeit anging, war Patty faul. Den Verdacht hatte Hannah schon seit Jahren gehegt, doch solange die andere Frau in ihrem eigenen Haus gelebt hatte, war das nicht von Bedeutung gewesen. Doch nun würde sich das ändern, sollte ihre Schwiegertochter versuchen, sie als unbezahltes Dienstmädchen zu behandeln.
Sie würde einen Ausweg finden müssen, sonst würde sie den Verstand verlieren.
* * *
Tags darauf war endlich wieder einmal gutes Wetter, und als Patty mit ihrem Geschimpfe und Genörgel anhob, ertrug Hannah es plötzlich keine Minute länger. Sie trauerte noch immer um Malachi, hatte noch immer Mühe, sich in ihre neue Rolle einzufinden. Hoch erhobenen Hauptes ging sie in die Küche, nahm sich ihr altes Schultertuch vom Haken neben der Tür und trat nach draußen in den Garten. Ohne dem Gezänk hinter ihr – »Wo willst du hin?«, gefolgt von: »Komm sofort zurück!« – Beachtung zu schenken, ging sie an der Böttcherwerkstatt vorüber, wo ihr Sohn zielstrebig seiner Arbeit nachging, und verließ durch das Hintertor das Grundstück.
Sie ging durch die schmale Gasse auf der rückwärtigen Seite der Häuserzeile und verlangsamte ihren Schritt, als sie das letzte Gebäude des Dorfes passierte: das Armenhaus, das auf einem unfruchtbaren Stück Land für die sechs benachbarten Gemeinden errichtet worden war. Es war ein hässlicher Ort, bei allen Anwohnern verhasst. Hannah erinnerte sich noch gut, wie sehr sich die Leute hier in der Gegend in ihrer Jugend dagegen gesträubt hatten, das neu erlassene Armengesetz zu erfüllen. Beinahe zehn Jahre hatten die von London eingesetzten Beamten gebraucht, um ihr kleines Hetton-Le-Hill und die umliegenden Dörfer mit dem Gesetz auf Linie zu bringen.
Beim Passieren der hohen Steinmauer, deren Krone mit Glasscherben gespickt war, überlief sie ein Schauer. Es war ein schrecklich trübsinniger, hoffnungsloser Ort, sah abweisend aus und war im Inneren dem Vernehmen nach sogar noch schlimmer. Nicht nur Arme waren dort untergebracht, sondern auch Zurückgebliebene, Geisteskranke und unverheiratete Mütter – die Unglücklichsten der Unglücklichen aus allen sechs Gemeinden. Und alle Welt wusste, wie streng der Umgang mit den Insassen war.
»Arme Seelen!«, murmelte sie wie jedes Mal, wenn sie hier vorbeikam. Seit der neue Pfarrer den Vorsitz des Aufsichtsrats übernommen hatte, war es noch schlimmer geworden. Sie mochte Pfarrer Barnish nicht, denn vor allem seinen ärmeren Gemeindemitgliedern gegenüber verhielt er sich in ihren Augen verächtlich.
Sie schritt hügelan in Richtung des Hochmoors oberhalb ihres Heimatdorfs, atmete tief die frische Luft, genoss den Wind und das Schattenspiel der vorübergleitenden Wolken auf den Hängen. Ihre Gedanken waren weniger erfreulich. Sie hatte gewusst, dass es schwer werden würde, mit ihrer Schwiegertochter zusammenzuleben, doch erwies es sich bereits jetzt als weit schlimmer als erwartet. Herumkommandiert zu werden wie eine begriffsstutzige Dienstmagd erfüllte sie mit Entrüstung – und war keineswegs nötig, denn sie war immer stolz auf ihre Fähigkeiten als Hausfrau gewesen. Tatsächlich war sie es eher gewohnt, um Rat gebeten zu werden, statt sich sagen lassen zu müssen, was sie zu tun habe.
Außer Atem machte sie halt bei einem Felsvorsprung und ließ sich nieder. Sie musste sich Tränen von den Wangen wischen. Doch was brachte Weinen schon? Das hatte sie in ihrer Ehe schnell gelernt. Sie lehnte sich zurück, schloss die Augen und ließ die leise Geräuschkulisse der Natur auf sich wirken. Eine leichte Brise flüsterte um sie herum, und irgendwo über ihr sang ein Vogel, eine flötende Stimme voll silbriger Freude. Dann und wann wärmte ihr die Sonne das Gesicht, abwechselnd verhüllt und wieder freigegeben von den Wolken. Langsam kam sie zur Ruhe und döste ein wenig vor sich hin.
»Alles in Ordnung, Missus?«
»Was? Oh!« Abrupt kam sie zu sich und sah einen Mann mit besorgter Miene auf sich herunterblicken. Es war einer der örtlichen Schäfer, sie kannte ihn vom Sehen. »Ja, mir geht es gut. Ich war nur ein wenig müde.«
»Es regnet bald. Sehen Sie lieber, dass Sie heimkommen, Mrs Firth.«
Verzweifelt kramte sie in ihrem Gedächtnis nach seinem Namen.
Er lächelte, als könne er ihre Gedanken lesen. »Ich bin Tad Mosely. Hab ein paarmal bei Ihrem Mann eingekauft. Brauchen Sie Hilfe beim Aufstehen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, vielen Dank, Tad. Ich bleibe hier nur noch ein Weilchen sitzen und gehe dann heim.«
»Warten Sie nicht zu lang. Sehen Sie sich nur an, wie die Wolken sich zusammenziehen.« Nach kurzem Zögern setzte er hinzu: »Das mit Ihrem Mann tut mir leid. War ein anständiger Kerl. Sie können immer gern bei uns in der Hütte vorbeischauen, wenn Sie hier oben unterwegs sind. Für eine Freundin haben wir für gewöhnlich eine Tasse Tee übrig.« Mit einer Hand wies er in die Richtung einer kleinen Steinhütte weiter oben am Hang, ein Schäferhäuschen, und nickte ihr zum Abschied noch einmal zu, ehe er seine Hunde herbeipfiff und davonstapfte.
Sie zog sich das Tuch enger um die Schultern, fröstelte in der kühlen, feuchten Luft und sah tatsächlich rasch mehr Wolken aufziehen, nun dunkler und drückender.
Doch erst als die ersten Tropfen fielen, machte sie sich wieder auf den Rückweg. Dabei war es ihr gleich, ob sie völlig durchnässt ankommen würde – ihre Schritte blieben schleppend und widerstrebend.
Das Leben konnte grausam sein. Dies war das zweite Mal, dass das Schicksal ihr übel mitgespielt hatte. Das erste Mal war ihr bei jedem Blick in Malachis Gesicht präsent gewesen – ein Gesicht, das dem seines Vaters so ähnlich sah und mit dem ihres Gatten so gar nichts gemein hatte.
* * *
An jenem Abend sagte Patty im Ehebett: »Ich sorge mich um deine Mutter, Lemuel. Sie wird immer konfuser. Und heute ist sie viel zu lange draußen geblieben, obwohl sie gesehen haben muss, dass es regnen würde. Als sie zurückgekommen ist, war sie klatschnass. Warum ist sie überhaupt da oben in die Berge gegangen? Ich brauche hier ihre Hilfe. Sie scheint vergessen zu haben, wie viel Arbeit so ein Baby macht.«
Er ließ ihre Worte an sich vorüberziehen, wie er es schon lange gelernt hatte. Er wünschte, sie würde nicht immer nur das Schlechteste in den Leuten sehen, wünschte, sie wäre freundlicher zu seiner Mutter. Doch wenn er das sagte, würde es nur noch schlimmer werden.
Als sie mit dem Reden aufhörte, streckte er die Hände nach ihr aus. Sie hatten sich darauf verständigt, es mit einem zweiten Kind zu versuchen. Nun – er hatte gesagt, dass er sich weitere Kinder wünschte, und sie hatte erwidert, auf eines würde sie sich einlassen und dann schauen, wie die Dinge sich entwickelten. Jedenfalls ließ sie seine unbeholfenen Bemühungen über sich ergehen, und auch wenn er sich leicht beschämt fühlte, als er zum Ende kam, hatte er wenigstens Erleichterung erfahren.
* * *
Im kleinen Dörfchen Marton westlich von Preston blickte Nathaniel King zum Himmel empor. Schon nach zwölf Uhr mittags. Zeit, zum Haus zurückzukehren und seiner Frau etwas zu essen zu machen. Nicht dass sie viel essen würde. Dieser Tage hatte sie kaum noch Appetit und sah beinahe aus wie ein Skelett. Kräftig war die arme Sarah nie gewesen, doch nun sagte der Arzt, ihr Herz werde immer schwächer und das Ende könne nicht mehr weit sein.
In dem kleinen steinernen Bauernhaus ging er in den Raum, der als Küche und Stube zugleich diente, denn das kleine, zugige Empfangszimmer an der Nordseite des Hauses nutzten sie kaum. Sarah lag auf dem Tagesbett und blickte verträumt aus dem Fenster. Sein Hereinkommen bemerkte sie nicht, und als er ihr eine Hand auf den Arm legte, zuckte sie erschrocken zusammen.
»Zeit fürs Essen, Liebes. Ich wasche mir nur rasch die Hände.«
»Ich möchte nichts, Nathaniel.«
»Du musst etwas essen, Sarah.«
»Warum?«
»Du kannst nicht einfach ... aufgeben.«
»Doch, das kann ich. Das habe ich. Ich denke schon die ganze Woche darüber nach, und wenn ich nicht essen möchte, dann werde ich das von nun an auch nicht mehr tun. Bitte versuche nicht, mich zu zwingen, denn ich werde nicht nachgeben – nicht einmal für dich.«
»Aber Sarah, Liebes ...«
»Nathaniel, ich falle dir doch nur noch zur Last, und was den armen Gregory angeht ... Nun, ein Junge von zehn Jahren sollte nicht mit ansehen müssen, wie seine Mutter häppchenweise stirbt, findest du nicht? Und mir fällt das Leben zunehmend ... schwer. Je schneller ich also Abschied nehmen kann, desto besser.«
»Ach, Sarah.« Er setzte sich zu ihr und nahm ihre Hand. Früher einmal hatten sie einander sehr geliebt, doch nach Jahren ihrer Krankheit war dieses strahlende Gefühl seinerseits zu einer bloßen Zuneigung verglommen – was sie heute für ihn empfand, wusste er nicht. Mittlerweile umgab sie ein Hauch von Jenseits, als sei sie gar nicht mehr wirklich Teil dieses Lebens, als sähe sie Dinge, die allen anderen verborgen blieben. Und sie hatte recht: Gregory litt furchtbar. Seiner Mutter beim Sterben zusehen zu müssen, würde jeden Jungen quälen. Wie lange war es her, dass Nathaniel seinen Sohn hatte lachen hören?
»Wie machen sich die Erdbeeren?«, erkundigte sie sich nach einer Weile.
»Recht gut. Ende der Woche sollte ich eine weitere Fuhre zusammenhaben, die ich zum Markt schicken kann.«
Sie nickte und ihr Blick glitt zurück zu dem Ausblick, der sich durch das Fenster bot: ordentliche Gemüsebeete und ein Streifen Blumen dicht am Haus, den ihr Gatte eigens für sie angepflanzt hatte, weil er wusste, wie sehr sie die Farbenpracht liebte.
Einen Moment lang betrachtete auch Nathaniel sein kleines Königreich, wie er es in Anspielung auf seinen Nachnamen gern nannte. Nachdem er auf einem »richtigen Bauernhof«, wie er es bei sich noch immer nannte, aufgewachsen war, hätte er nie geglaubt, er würde einmal ein Gemüsegärtner werden. Doch da sein Vater gestorben war, als er erst sechzehn gewesen war, hatte er keine Möglichkeit gehabt, die Pacht zu übernehmen. Für eine Weile waren seine Mutter und er nach Preston gezogen, doch das Leben in der Stadt war ihm zuwider gewesen, und so hatte er hart gearbeitet, jeden Penny gespart und nach dem Tod seiner Mutter seinen eigenen Weg gefunden, aufs Land zurückzukehren.
Der Obst- und Gemüseanbau war dieser Tage ein gutes Geschäft, denn hier in Marton waren sie nicht weit entfernt vom Industriestädtchen Preston. In den wachsenden Textilzentren von Lancashire schien ein unstillbarer Bedarf nach Lebensmitteln zu herrschen, während das Vieh, das noch immer in der Stadt gehalten wurde, damit die Wohlhabenderen frische Milch trinken konnten, steten Nachschub an Dünger für die ländlicheren Gegenden lieferte. Er selbst hielt es für eine Schande, die armen Kühe tagein, tagaus einzusperren, und hätte niemals einem Lebewesen jegliches Sonnenlicht verwehrt.
Doch auch wenn er gutes Geld verdiente, floss der Großteil davon im Augenblick in Haushaltsausgaben wie Unterstützung bei der Wäsche und in die Pflege seiner Frau. Viel zurücklegen oder die ersehnten Verbesserungen vornehmen konnte er deshalb nicht – Dinge, von denen er in der Zeitung gelesen oder bei seinen gelegentlichen Besuchen in Preston gehört hatte. Und selbst wenn er seinem Gutsherrn derlei Verbesserungen antrüge, war er sich nicht sicher, ob der diesen auch zustimmen würde.
Richard Dewhurst war ein anständiger Mann, der mit Baumwolle ein Vermögen gemacht und dann eine Adlige geheiratet hatte, um anschließend das Gut zu kaufen, zu dem Marton Hall gehörte. Viel Zeit hatte er hier allerdings nie verbracht. Seine Frau hatte ihm nur zwei Söhne geschenkt und war bereits vor Jahren verstorben. Von da an hatte ein Kindermädchen den jüngeren der Söhne aufgezogen, während man dem älteren die Zügel hatte schießen lassen. Kürzlich war Nathaniel zu Ohren gekommen, Dewhurst sei nun auf Dauer hergezogen. Nun, der Mann würde auch bald siebzig werden – da war es sicher an der Zeit, die Führung seiner Baumwollfabriken anderen zu überlassen? Zuletzt war er zum Friedensrichter ernannt worden, doch es blieb abzuwarten, wie er diese Rolle ausfüllen würde.
Seine beiden Sprösslinge hatten immer auf Marton Hall gelebt. Walter, der Ältere, war mit dem Eintritt ins Mannesalter nur noch niederträchtiger geworden, und wie die anderen Pächter mied ihn auch Nathaniel, wo es nur ging. Abgesehen davon, dass er immer wieder junge Frauen belästigte – ob sie nun willig waren oder nicht –, hatte er jüngst wieder einmal eine seiner Strohfeuer-Leidenschaften entwickelt. Diesmal ging es um die Jagd auf »Niederwild«, wie er es nannte. Das beinhaltete, rücksichtslos durch die Zäune und Felder der Leute zu preschen, um Kaninchen, Hasen und äußerst selten einmal einen Fuchs zu erlegen und dabei eine Schneise der Zerstörung zu hinterlassen. Bislang hatte es niemand gewagt, sich bei seinem Vater darüber zu beschweren, um nicht noch mehr Ärger zu bekommen, denn Walter war dafür bekannt, sich bei jenen zu revanchieren, die ihn erzürnten. Und schließlich zahlte der Verwalter stets eine Entschädigung, nicht wahr?
Nathaniel war sich nicht sicher, ob er einfach tatenlos zusehen könnte, wie Walter Dewhurst sein Land und seine Ernte verwüstete, doch glücklicherweise war der Bursche noch nicht in die Nähe seines Gehöfts gekommen.
Der jüngere Dewhurst, Oliver, hatte mit seinem Bruder so viel gemein wie Schleierkraut mit einem Schwein. In jungen Jahren war er oft krank gewesen, und das Leid hatte Spuren in seinen Zügen hinterlassen, wenn er auch zu einem recht gut aussehenden jungen Mann herangewachsen und mittlerweile bei weit besserer Gesundheit war. Ein Jammer, dass nicht er derjenige war, der alles erben würde, denn er hatte ein freundliches Wesen, half gern Bedürftigen und behandelte die Pächter stets mit Höflichkeit.
Nach einem weiteren vergeblichen Versuch, Sarah zu überreden, etwas zu sich zu nehmen, verbrachte Nathaniel den Nachmittag mit Umgraben, während der alte Tom Ringley sich verausgabte beim Versuch, zwischen den Erdbeeren Unkraut zu jäten. Nathaniel enthielt sich jeden Kommentars. Im Grunde war Tom längst über das Alter hinaus, in dem seine Kraft noch zum Arbeiten gereicht hätte, doch als Gegenleistung verlangte er nicht mehr als ein Bett im Schuppen, Essen für seinen gebeugten alten Körper und hier und da einen Beutel Tabak, und so beschäftigte Nathaniel ihn weiter. Wie bei vielen alten Leuten war es auch Toms größte Angst, ins Armenhaus gesteckt zu werden.
Nun, Nathaniel wäre wirklich ein armseliger Kerl gewesen, hätte er dem Mann, der ihm alles beigebracht hatte, nicht wenigstens das geben können. Tom war es, der ihn gelehrt hatte, wie man Obst und Gemüse anpflanzte, und der vor all den Jahren so großzügig sein Wissen mit ihm geteilt hatte. Damals war er ebenso groß und kräftig wie Nathaniel selbst gewesen. Und bis heute gab es Gelegenheiten, bei denen nur Tom Ringley die Lösung für ein Problem oder das Heilmittel gegen einen Ernteschädling kannte, während alle anderen hilflos waren. Nathaniel wurde immer ganz warm ums Herz, wenn er sah, wie der alte Bursche sich freute, wenn das der Fall war.
* * *
Hannah musste feststellen, dass das Zusammenleben mit Patty stetig schwieriger statt leichter wurde. Wenn niemand zugegen war, benahm ihre Schwiegertochter sich unverhohlen feindselig, blaffte Befehle und tat so wenig wie nur möglich selbst, weil das Baby sie angeblich so viel Zeit kostete. Dabei war John das stillste Baby, das Hannah je erlebt hatte, und machte kaum je Ärger.
Eines Tages ging sie in ihr Zimmer, um ein frisches Taschentuch zu holen, und ertappte Patty dabei, wie sie die oberste Schublade ihrer Kommode durchsuchte.
»Was machst du da?«
Patty drehte sich zu ihr um und starrte sie an, offenbar ohne die geringste Scham, beim Durchwühlen fremder Sachen erwischt worden zu sein. »Ich sehe mir an, was du hast. Ich weiß gern Bescheid, was in meinem Hause vor sich geht.«
Sprachlos sah Hannah zu, wie sie aus dem Zimmer schlenderte, ehe sie aufs Bett sank. Sie war tief erschüttert, dass jemand zu so etwas imstande war.
An jenem Abend wartete sie, bis sie alle zusammen beim Essen saßen, ehe sie leise, aber deutlich verkündete: »Wenn mir nicht einmal in meinem eigenen Zimmer etwas Privatsphäre vergönnt ist, bleibe ich nicht länger hier.«
Ein lastendes Schweigen senkte sich über den Tisch. Patty warf ihr einen wütenden Blick zu. Lemuel blickte von einer Frau zur anderen und sagte vorsichtig: »Selbstverständlich steht dieses Zimmer dir ganz allein zur Verfügung, Mutter, du kannst darin tun und lassen, was du willst. Inwiefern fehlt es dir da an Privatsphäre?«
»Ich habe deine Frau dabei erwischt, wie sie meine Sachen durchwühlt hat.«
Schockiert wandte er sich Patty zu, die naserümpfend wiederholte: »Ich habe ein Recht darauf, zu wissen, was in meinem Hause vor sich geht.«
»Nein, Liebes, das geht ein bisschen zu weit. Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, die Sachen meiner Mutter zu durchwühlen, und das solltest du auch nicht.«
Mit verengten Augen starrte sie ihn an, ehe sie abrupt ihren Stuhl zurückstieß, aufsprang und mit schriller Stimme keifte: »Entweder ist es mein Haus oder nicht! Entscheide dich, Lemuel! Aber wenn es das nicht ist, erwarte nicht von mir, dass ich hier auch nur einen Handschlag tue.« Dann brach sie in Tränen aus und stürmte die Treppe hinauf ins Schlafzimmer.
Auch Lemuel erhob sich und sah seine Mutter unglücklich an. »Ich weiß, sie benimmt sich unvernünftig, aber im Augenblick will ich sie nicht zu sehr aufbringen. Wir versuchen gerade, ein zweites Kind zu bekommen, und du weißt ja, wie das ist.«
Damit folgte er seiner Frau nach oben, und alsbald schallten wütende Stimmen nach unten. Hannah bemühte sich ehrlich, nicht zu lauschen, doch sie war schockiert angesichts der Beleidigungen, die Patty ihrem Mann an den Kopf warf. Ebenso von den Dingen, die ihre Schwiegertochter über sie sagte – sie deutete allen Ernstes an, Hannah versuche, sich vor ihren häuslichen Pflichten zu drücken, und sei geistig nicht mehr ganz da.
Als Lemuel wieder herunterkam, wich er dem Blick seiner Mutter aus und machte sich daran, sein mittlerweile erkaltetes Abendmahl aufzuessen.
»Das wird schon wieder«, behauptete er, als er zu dem großen Lehnstuhl vor dem Feuer ging. »Wir raufen uns schon noch zusammen, wenn wir es nur ehrlich versuchen.«
Automatisch machte Hannah sich daran, den Tisch abzuräumen, und bereitete den Abwasch vor. »Sie hat trotzdem kein Recht, meine Sachen zu durchwühlen.«
Er seufzte. »Ich wage zu bezweifeln, dass du sie davon abhalten kannst. Sie muss immer alles wissen. So ist sie nun einmal. Du gewöhnst dich schon daran. Schließlich hast du doch nichts zu verbergen, also spielt es wohl keine Rolle.«
An jenem Abend ging Hannah früh zu Bett, wie sie es sich angewöhnt hatte. Sie versuchte, im Licht einer einzelnen Kerze eines ihrer geliebten Bücher zu lesen, legte es jedoch seufzend zur Seite, als die Worte nicht zu ihr durchdringen wollten. Wäre sie nicht gerade noch rechtzeitig hereingekommen, hätte Patty ihr Erspartes gefunden und zweifellos versucht, es für den Haushalt zu beanspruchen. Gleich morgen würde Hannah das Geld zur sicheren Verwahrung zu ihrer Freundin Louisa bringen. Sie kannten einander schon seit ihrer Kindheit, und sie vertraute ihrer Freundin blind.
Sie blies die Kerze aus und rutschte im Bett hinunter, doch ihre Gedanken wollten nicht stillstehen. So konnte sie nicht weitermachen, sie würde eine Arbeit finden müssen, die sie von hier fortbrächte. Sie würde sich im Dorf umhören, vielleicht wusste jemand etwas von einer freien Stelle als Haushälterin. Aber Lemuel gegenüber würde sie nichts erwähnen, bis sie etwas hatte.
* * *
Am folgenden Tag war Patty noch zänkischer als gewöhnlich, klapperte mit den Töpfen, keifte Anweisungen, krittelte an allem und jedem herum.
Als der Mittagstisch abgeräumt war, nahm Hannah ihre Schürze ab. »Ich gehe ein wenig spazieren.«
»Ich brauche dich hier, Mutter Firth.«
»Heute wirst du eine Weile ohne mich auskommen müssen. Ich bin keine Sklavin, Patty, für niemanden, und ich arbeite hart genug, um mir ab und an ein paar Stunden Freizeit zu verdienen.«
»Du solltest froh sein, dass du uns auf diese Weise vergelten kannst, was wir alles für dich ausgeben.«
»Und du solltest im Gedächtnis behalten, dass ich nicht deine Bedienstete bin und es auch niemals sein werde.« Sie holte ihr gutes Schultertuch aus ihrem Zimmer, band sich die Haube um und kam mit ihrem Ersparten in der Tasche wieder heraus, fest davon überzeugt, dass Patty ihre Durchsuchung zu Ende bringen würde, sobald sie das Haus verlassen hätte.
»Wo willst du hin?«
»Das geht nur mich etwas an.« Schockiert blinzelte sie, als ihre Schwiegertochter sich vor die Tür warf.
»Ich verlange zu erfahren, was du treibst. In diesem Haus habe ich das Sagen und ...«
Mühelos schob die größere, kräftigere Hannah sie kurzerhand beiseite und öffnete die Tür, hielt sie offen gegen die Hand, die sie vor ihrer Nase wieder zuschlagen wollte.
»Das wirst du bereuen!«, keuchte Patty. »Er hört jetzt auf mich, nicht mehr auf dich. Du musst lernen, wo dein Platz in diesem Haus ist, und aufhören, mich herumschubsen zu wollen.«
Mit Mühe schluckte Hannah eine Erwiderung herunter, wer hier wen herumzuschubsen versuchte, und verließ entschlossenen Schrittes das Haus, um sich in Richtung Süden zu begeben. An der Ecke blickte sie zurück und sah ihre Schwiegertochter am Tor stehen, um zu beobachten, wohin sie sich wenden würde. Aus reiner Boshaftigkeit ging sie ganz bis ans andere Ende der Hauptstraße und bog auf die Abzweigung ein, die in die Berge hinaufführte, um dann jedoch umzukehren, sobald sie außer Sichtweite war, und über Schleichwege zum Haus ihrer Freundin Louisa zu gelangen. Dort angekommen, klopfte sie ans Küchenfenster und war sich ihres wohlwollenden Empfangs so sicher, dass sie zur Tür hineinschlüpfte, ohne auf eine Einladung zu warten.
»Hannah, Liebes. Also wirklich! Ich dachte schon, du hättest uns vergessen.« Louisa musterte das Gesicht ihrer Freundin. »Was ist denn?«
»Es ist ... schwierig daheim. Heute musste ich einfach einmal für eine Weile da raus.«
Louisa schnaubte. »Du meinst, mit Patty unter einem Dach zu leben ist schwierig. Ich habe dir doch gesagt, du solltest nicht einmal daran denken, dort bei den beiden zu bleiben.«
»Ich wollte Lemuel nicht wehtun, aber du hattest recht. Ich hätte mir gleich eine Anstellung suchen sollen.« Louisa hatte ihr angeboten, zeitweilig bei ihr Unterschlupf zu suchen, doch es ging wider Hannahs Natur, etwas anzunehmen, das sich so deutlich nach Almosen anfühlte – selbst wenn es von ihrer besten Freundin kam.
Louisa machte sich in der Küche zu schaffen und setzte einen Tee auf, ehe sie sich zu Hannah an den Tisch setzte, um ihn zu trinken. »Diese Patty ist wie ihre Mutter: Fasst jedes Wort als Beleidigung auf, kann es aber auch nicht ausstehen, wenn man schweigt. Leuten wie denen kann man es niemals rechtmachen. Andererseits sollte ich wohl nicht so schlecht über die arme Susan Riggs reden. Ich habe gehört, sie wird von Tag zu Tag vergesslicher.« Sie tippte sich mit einem Finger an die Stirn. »Ich hoffe wirklich, ich werde nie senil, das sage ich dir. Für die Verwandtschaft kann das unheimlich schwer sein.«
»Patty hat gar nichts davon erwähnt, dass ihre Mutter Schwierigkeiten hat.« Allerdings sprach Patty auch kaum je von ihrer Familie.
»Nun, das wundert mich nicht. Die gesamte Familie versucht, so zu tun, als wäre alles beim Alten. Aber am Ende werden sie Susan in die Anstalt geben müssen, merk dir meine Worte. Altersschwachsinn, heißt es. Das habe ich schon öfter gesehen. Manche Leute schaffen es, sich daheim um die armen Seelen zu kümmern, aber Pattys Schwester heiratet bald und zieht weg, was wird dann wohl mit Susan geschehen?«
»Neben solchen Sorgen erscheinen meine eigenen regelrecht klein.«
Louisa schüttelte den Kopf. »Das sehe ich anders. Du siehst reichlich zermürbt aus, Liebes, und es braucht so einiges, um dich in einen solchen Zustand zu versetzen. Die Frage ist: Was wirst du dagegen unternehmen?«
»Nun, als Erstes bitte ich dich, mein Erspartes in Verwahrung zu nehmen. Mittlerweile durchsucht sie schon meine Sachen, und ich bin fest davon überzeugt, sollte sie das Geld finden, würde sie versuchen, es an sich zu reißen.« Bei diesem Eingeständnis musste Hannah eine Träne der Scham fortblinzeln.
»Oh nein, Liebes, das würde doch nicht einmal Patty wagen?«
Hannah musste schwer schlucken und die Fingernägel in ihre Handflächen graben, um sich davon abzuhalten, in Tränen auszubrechen. Nichts ließ einen sicherer die Beherrschung verlieren als ein wenig Mitgefühl. Sie fingerte den abgewetzten Beutel aus ihrer Tasche hervor und machte einen Scherz daraus: »Da hast du ihn – all meinen irdischen Besitz.«
Louisa nahm die Börse entgegen. »Ich lege sie in meine Aussteuertruhe, niemand außer George wird davon erfahren – und der sagt kein Wort, da kannst du dir sicher sein.« Sie streckte die Hand aus und drückte die ihrer Freundin. »Wie kann ich dir sonst noch helfen?«
»Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht jemanden kennst, der auf der Suche nach einer Haushälterin ist. Du hast eine so große Verwandtschaft und weißt immer alles als Erste.«
»Gute Idee. Wer immer dich bekommt, kann sich glücklich schätzen. Ich höre mich um.«
»Aber bitte unauffällig. Ich will sie nicht noch mehr gegen mich aufbringen, solange es sich vermeiden lässt.«
* * *
Drei Tage später kam Patty von einem Besuch bei einer Freundin nach Hause und stürmte mit flammend roten Wangen in die Werkstatt ihres Mannes. »Weißt du, was deine Mutter treibt? Schande bringt sie über uns, oh ja. Mein Lebtag habe ich mich noch nicht so geschämt wie heute Nachmittag, als ich es herausgefunden habe.«
Erschrocken blinzelte er sie an, legte das lange Messer weg, mit dem er eben noch die Dauben genutet hatte, und bedeutete seinem Lehrling mit einer knappen Kopfbewegung, das Weite zu suchen. »Wovon redest du, Liebes? Meine Mutter würde uns niemals beschämen. In letzter Zeit gehst du aber wirklich hart mit ihr ins Gericht.«
»Das liegt daran, dass man jemanden erst dann wirklich kennenlernt, wenn man mit ihm zusammenleben muss«, gab sie Unheil verkündend zurück und blickte ihn dabei finster an.
Als er ihr einen Arm um die Schultern legte, schüttelte sie ihn bloß ab und begann, auf und ab zu gehen.
»Nun erzähl schon.«
»Deine Mutter ist auf der Suche nach einer Anstellung als Haushälterin, und wenn uns das nicht beschämen soll, dann weiß ich nicht, was sonst.«
Bestürzt starrte Lemuel sie an. »Das würde sie niemals tun. Dies ist ihr Zuhause.«
»Dann frag sie selbst.«
»Ich spreche heute Abend mit ihr.«
»Du sprichst jetzt mit ihr! Das muss geklärt werden. Und ich warne dich, das mache ich nicht mit!«
Seufzend folgte er seiner Gattin ins Haus und wünschte, sie hätte wenigstens ein bisschen weniger Wut auf die Welt.
Patty platzte in die Küche und fand Hannah mit Klein John auf dem Schoß vor, der sie fröhlich anlachte. Grob entriss sie ihn seiner Großmutter und drückte ihn so fest an sich, dass er zu weinen begann. Dann stieß sie theatralisch hervor: »Na los! Frag sie, Lemuel!«
Schockiert blickte Hannah von ihr zu ihm und spürte, wie ihr das Herz in die Hose rutschte, als sie die Miene der Jüngeren sah. »Was ist denn?«
Lemuel räusperte sich. »Patty hat gehört ... Es ist sicher nicht wahr, Mum, aber sie hat gehört, du würdest dich nach einer Stelle als Haushälterin umsehen.«
Seufzend sah Hannah ihren ernsten, oft etwas schafsköpfigen Sohn an. Lieber hätte sie die beiden vor vollendete Tatsachen gestellt. »Es stimmt.«
Ihm fiel alles aus dem Gesicht. »Aber Mum, wieso denn? Du hast doch hier ein Heim, das weißt du doch. Es gibt keinen Grund für dich, nach einer Anstellung zu suchen. Sag du es ihr, Patty!«
»Nicht den geringsten Grund, Mutter Firth. Ich bin bestürzt, dass du auch nur daran denkst, uns zu verlassen ... und uns so vor den Nachbarn bloßzustellen!«
Hannah versuchte es diplomatisch. »Ich denke, für ein junges Paar ist es besser, unter sich zu sein, ohne sonstige Verwandtschaft – erst recht, wenn ihr ein zweites Kind bekommen wollt.«
»Aber Mum ...«
Sie hob eine Hand und Lemuel verstummte. »Dann gibt es da auch noch meine Perspektive zu betrachten. Ich glaube, ich möchte noch etwas ...« Sie zögerte, suchte nach einer Formulierung, die nicht beleidigend klingen würde, und scheiterte. »... Interessanteres mit meinem Leben anfangen als hier im Hinterzimmer zu wohnen, bis ich sterbe. Ich fühle mich nicht alt, Lemuel. Nicht im Geringsten.«
Patty brach in hysterische Tränen aus und warf sich samt Kind in die Arme ihres Mannes. »Ich werde sterben vor Scham.«
Streng blickte er seine Mutter über die Köpfe seiner kleinen Familie hinweg an. »Das kommt nicht infrage, Mum! Patty hat recht. Es ist beschämend für uns, dass du so etwas tust.«
Hannah seufzte. Sie würde es wirklich unverblümt sagen müssen. »Lemuel, Patty hat ihre eigene Art, die Dinge anzugehen, und mir stößt es sauer auf, mich herumkommandieren zu lassen. Es wird für uns alle besser sein, wenn ich gehe, bevor wir in Streit geraten. Außerdem wird es mir Freude bereiten, einmal etwas anderes zu tun. Du weißt ja, dass ich schon immer gern reisen wollte.«
»Haushälterinnen gehen nicht auf Reisen!«, spie Patty verächtlich. »Sie bleiben daheim – und zwar im Heim anderer Leute –und erledigen genau dieselbe Arbeit, die du auch hier tust.«
»Aber sie werden für ihre Arbeit bezahlt und mit Respekt behandelt. Niemand durchwühlt ihre Sachen, wie du es abermals getan hast.«
Patty schnappte nach Luft und lief puterrot an. »Siehst du, womit ich es zu tun habe, was ich mir anhören muss? Sie wiegelt die Leute gegen mich auf, das weiß ich genau. Wie soll ich je wieder erhobenen Hauptes durchs Dorf gehen?«
Der Blick, mit dem Lemuel seine Mutter ansah, war der eines getretenen Hundes. »Ich lasse das nicht zu, Mum. Ich lasse nicht zu, dass du so mit Patty umspringst, und ich lasse dich nicht für fremde Leute arbeiten. Dein Zuhause ist hier, und hier wirst du bleiben.«
»Und wie willst du mich davon abhalten, zu gehen, wenn ich mich dazu entschließe?«, fragte Hanna beherrscht, ehe sie sich umdrehte, in ihr Zimmer ging und die Tür hinter sich zuwarf, statt es noch schlimmer zu machen, indem sie aussprach, warum genau sie gehen würde.
An das glatte Holz gelehnt betete sie darum, rasch eine Stelle zu finden. Je schneller, desto besser. Anderenfalls würde sie womöglich doch noch Louisas Angebot annehmen müssen – um den Preis, ihren Sohn tief zu kränken.
* * *
Als Lemuel zurück in die Werkstatt gegangen war, setzte Patty sich mit nachdenklicher Miene an den Tisch. Wenn ihre Schwiegermutter sie verließe, würde sämtliche Arbeit an ihr hängenbleiben, und warum sollte es dazu kommen, wenn sie doch jemanden hatte, der ihr diese Last abnehmen könnte?
»Wie willst du mich davon abhalten?«, hatte Mutter Firth gefragt.
Nun, irgendeinen Weg musste es geben. Und für gewöhnlich bekam Patty, was sie wollte, wenn sie es wirklich darauf anlegte.
2
Ende August 1863
Nathaniel beobachtete, wie Walter Dewhurst und seine zwei Spießgesellen durch ein nahegelegenes Haferfeld pflügten, längst zu betrunken, um die Kaninchen zu treffen, die sie angeblich jagen wollten, obwohl es noch mitten am Nachmittag war. Ihre Pferde sahen müde und schweißnass aus, und dazu bekamen die armen Kreaturen noch reichlich die Gerten zu spüren.
Bisweilen glaubte er, dass es die Zerstörung war, die diesem berüchtigten Dreigespann das größte Vergnügen bereitete – besonders, wenn er den Gesichtsausdruck von Walter Dewhurst beim Niedertrampeln der sorgsam angelegten Haferreihen sah. Nathaniel konnte nur hoffen, dass er einen anderen Pachthof finden würde, ehe dieser Tyrann das Gut erbte.
Noch hatte das Trio Nathaniels Gehöft nicht betreten, doch er zweifelte nicht daran, dass es eines Tages so weit kommen würde. Er allerdings würde ihnen weder das Tor öffnen oder auch nur so tun, als könne er lächelnd zusehen, was sie verbrachen. Irgendwo hatte ein jeder Mann seine Grenze.
Die seine war wenige Tage später erreicht. Er hörte aufgepeitschtes Hundegebell, sah etwas Rötlich-Braunes die Straße hinunterhetzen und erkannte mit einem unguten Gefühl in der Magengegend, dass die Halunken in den seltenen Genuss einer Fuchsjagd gekommen waren. Wie alle Bauern in der Umgebung achtete auch Nathaniel sorgfältig darauf, Füchse bei jeder Gelegenheit still aus dem Weg zu räumen, um Walter Dewhurst keinen Vorwand zu liefern, auf seinen Grund und Boden einzudringen.
Was dachten diese Narren sich überhaupt dabei? Dieser Teil von Lancashire war kein gutes Jagdgebiet, noch besaßen sie ein ausgebildetes Hunderudel – geschweige denn die Billigung des echten Adels, der die Jagd in der Grafschaft kontrollierte. So, wie er es sah, taten diese Söhne reicher Baumwollfabrikanten bloß so, als seien sie adelig – und überzeugten dabei niemanden.
Als der Fuchs, dünn und bereits hinkend, durch die Latten seines Eingangstors schlüpfte, stöhnte Nathaniel auf und wünschte, er hätte sich einen anderen Fluchtweg gesucht. Das arme Tier hechelte und war sichtlich in Panik. Sicher, es war ein Schädling, und auch er stimmte darin zu, dass es erlegt werden musste, doch warum auf so grausame Weise?
Ehe er sich abwenden und ins Haus gehen konnte, kam Walter die Straße entlanggeritten und rief: »Machen Sie auf, King! Ich hab den Fuchs auf Ihre Pacht laufen sehen.«
»Tut mir leid, Sir, ich habe hier eine sterbende Ehefrau und würde es vorziehen, ihre Ruhe nicht zu stören.«
»Verflucht, tun Sie, was man Ihnen sagt!«
Doch Nathaniel konnte nicht. Er brachte es einfach nicht über sich. Ihm wurde kalt bei der Vorstellung, wie die arme, sanfte Sarah den blutigen Tod eines Tieres oder die Verwüstung ihrer wenigen kostbaren Morgen inmitten der wichtigsten Erntesaison durch diese Rohlinge mit ansehen müsste.
Fluchend lehnte Dewhurst sich von seinem Pferd hinab und machte sich am Haken des Tors zu schaffen, während seine Kumpane hinter ihm ihn johlend anfeuerten.
Mittlerweile hatten diese Tölpel den Fuchs mit Sicherheit längst vertrieben, davon war Nathaniel überzeugt, doch als er einen Schritt vortrat, um seinen Besitz zu schützen, tauchte Tom hinter ihm auf und rüttelte eindringlich an seinem Arm.
»Lass es sein, Bursche! Sonst behaupten die, du wärst auf sie losgegangen, und schleifen dich vor Gericht, wie sie's mit Bill Dooney gemacht haben. Dann bist du dein Gehöft los.«
Also blieb Nathaniel stocksteif und mit verbitterter Miene stehen, während drei halb betrunkene junge Taugenichtse in seinen kostbaren Anpflanzungen auf und nieder galoppierten, sie unter Pferdehufen zertrampelten und aus unerfindlichen Gründen mit ihren Gerten auf die Obststräucher einschlugen. Doch an dem Blick, den Walter ihm zuwarf, ehe er das Ganze noch einmal von vorn begann, sah er, dass es ihnen Spaß machte, ihn so leiden zu lassen. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, ehe sie wieder davongaloppierten.
»Schicken Sie Pa die Rechnung!«, rief der Sohn seines Gutsherrn noch, während das Tor hinter ihm offen im Winde schwang.
Erst jetzt stieß Nathaniel ein langes, ächzendes Stöhnen aus.
»Teufel, was für 'ne gottlose Verschwendung!«, murmelte Tom. »Aufknüpfen sollte man die, jawohl.«
»Machen wir uns daran, den Schaden zu beziffern«, sagte Nathaniel mit einer Stimme, die sich durch rostigen Draht zu zwängen schien. »Ich gedenke dafür zu sorgen, dass der alte Mr Dewhurst jeden Penny davon ersetzt.«
»Vielleicht siehst du lieber erst nach deiner Missus«, gab Tom zu bedenken. »Die muss ja gesehen haben, was die Schufte angerichtet haben. Hat sie bestimmt schwer mitgenommen. All ihre schönen Blumen sind hin, keine einzige steht noch. Kannst mir nicht erzählen, das hätten die nicht mit Absicht gemacht.«
Nathaniel fand Sarah lang hingestreckt am Boden vor, als wäre sie von ihrer Liege aufgestanden und hätte zur Tür gelangen wollen. Sie war tot. Noch warm, aber mit jenem wächsernen Hauch auf ihren Zügen. Sie musste gesehen haben, was vorgefallen war, was bedeutete, dass ihre letzten Augenblicke auf Erden von hilfloser Qual erfüllt gewesen sein mussten. Plötzlich fand Nathaniel sich weinend auf Knien neben ihr wieder, tiefes Schluchzen schüttelte seinen Körper und drohte ihn zu zerreißen. Er weinte sich die Seele aus dem Leib, um seine Frau und um seine Ernte. Es war nicht gerecht, dass manche Leute so viel Macht über andere besaßen, das Leben ihrer Mitmenschen aus einer Laune heraus in solches Elend zu stürzen vermochten.
Der Arzt kam, starrte mit offenem Mund auf das Schlachtfeld, das einst ein blühender Gemüsegarten gewesen war, und untersuchte behutsam Sarahs Leichnam. »Was ist geschehen?«
»Walter Dewhurst«, erklärte Nathaniel und musste nicht mehr dazu sagen. »Der Schock angesichts seines Wütens hat sie umgebracht, da kann mir niemand etwas anderes erzählen.«
»Wahrscheinlich hat der Schock ihren Tod tatsächlich beschleunigt.« Seufzend schaute der Arzt auf ihr hageres Gesicht hinunter, auf dem noch immer die Pein geschrieben stand, dann wandte er sich an Nathaniel und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Ich wünschte, ich könnte irgendetwas tun, aber im Hinblick auf seinen Sohn stößt man bei Dewhurst schlicht auf taube Ohren. Er behauptet immer nur, der Bursche solle ich eben benehmen wie ein Adliger.«
»Ich würde mich schon deutlich besser fühlen, wenn ich dem Taugenichts wenigstens anstelle seines Vaters ein blaues Auge verpassen könnte«, murmelte Nathaniel. Und früher einmal hätte er sich dazu womöglich sogar hinreißen lassen, doch mittlerweile war er älter und vernünftiger.
»Mit Recht und Anstand hat das Treiben dieser Halunken jedenfalls nichts mehr zu tun, und ich werde persönlich dafür sorgen, dass überall bekannt wird, dass der Schock angesichts ihrer Taten zum Tod Ihrer Frau beigetragen hat.« Wieder seufzte der Arzt, ehe er etwas leiser fortfuhr: »Ich schicke Mrs Bostill her, um sie für Sie aufzubahren.«
Ein guter Kerl war dieser Arzt, dachte Nathaniel, als er ihn in seinem glänzenden neuen Einspänner davonfahren sah. Allerdings bezweifelte er, dass Dewhurst sich um den Vorfall scheren würde. Er mochte zwar nun Friedensrichter sein, aber Marton und die Menschen, die hier lebten, verstand er deshalb noch lange nicht.
Als Gregory von der Schule heimkam, starrte er schockiert auf die Verwüstung, ehe er ins Haus gerannt kam und beim Anblick seines Vaters und des leeren Tagesbetts seiner Mutter wie angewurzelt stehenblieb.
»Leider ist deine Mutter heute verstorben, mein Sohn.«
Mit geballten Fäusten stand der Junge da, vergoss keine Träne angesichts des Todes seiner Mutter, sondern hielt seinen Schmerz in seinem Inneren fest unter Verschluss, wie er es sich schon seit einiger Zeit angewöhnt hatte. Die angespannte Miene, die eher wirkte wie die eines alten Mannes, zerriss Nathaniel das Herz.
»Warum haben sie das getan?«, fragte der Junge an diesem Abend immer wieder. »Warum haben diese Männer unsere Ernte vernichtet, Dad?«
»Weil es selbstsüchtige Rohlinge sind, die keinen Gedanken an andere Menschen verschwenden.«
»Wovon sollen wir uns ernähren, wenn wir nichts mehr zu verkaufen haben?«
Nathaniel seufzte. »Der alte Mr Dewhurst wird uns den Schaden ersetzen. Allerdings hätte ich auch lieber meine Pflanzen als das Geld.«
Ein wenig später fragte sein Sohn leise: »Jetzt haben wir gar keine Blumen für ihr Grab, oder?«
»Wir treiben schon welche auf, mein Junge. Nicht nur, um sie daraufzulegen, sondern zum Einpflanzen. Das würde ihr gefallen.«
* * *
Erzürnt blickte Richard Dewhurst über den Esstisch und konnte ein Grollen nicht unterdrücken, als er seinen Erstgeborenen anstarrte. »Gestern hast du wirklich die Grenzen der Vernunft überschritten, Walter.«
»Hm?«
»Einfach so Kings Ernte zu vernichten.«
»Wirf ihm ein paar Pfund in den Rachen, dann gibt er schon Ruhe.«
»Und bringt ihm das seine Frau zurück?«
»Was soll das heißen?«
»Der Schock angesichts eurer Randale hat sie umgebracht.«
Walter schnaubte abfällig. »Der lügt doch! Die Frau war schon seit Jahren krank. Und diesmal hatten wir einen Fuchs im Visier. Hätten ihn sogar gekriegt, hätte King uns das Tor geöffnet, wie ich es ihm befohlen habe.«
»Warum hätte er dir das Tor öffnen sollen, wenn ihm klar war, dass du seine Ernte zertrampeln würdest?«, zischte Oliver.
»Weil es unser Land ist, nicht seins, und er besser lernt, wo sein Platz ist. Wenn er sich noch einmal so benimmt, wenn das alles mir gehört, setze ich ihn binnen Tagesfrist auf die Straße, das verspreche ich dir.«
»Beruhige dich, Bursche«, sagte Richard. »Diesmal zahle ich den Schaden noch, aber das muss aufhören. Von jetzt an beschränkst du deine Jagdausflüge auf unseren eigenen Besitz.«
Mit einem erstickten Ausruf der Empörung stieß Oliver seinen Stuhl zurück, warf die Serviette auf den Tisch und verließ den Raum. Jagdausflüge! Was sein Bruder und seine Kumpane da trieben, war keine Jagd, sondern willkürliche Zerstörung.
* * *
Zu Sarahs Begräbnis zwei Tage später erschien nahezu das gesamte Dorf. Frisch gebadet und in Sonntagskleidung kamen sie in die Kirche, selbst die Angestellten auf dem Besitz der Dewhursts hatten sich freigenommen, um teilzunehmen.
Nathan saß mit seinem Sohn in der ersten Reihe, konnte die lobenden Worte des Pfarrers über Sarah Jane King jedoch nicht wirklich aufnehmen, denn noch immer brodelte der Zorn in ihm. Als es an der Zeit war, den Sarg hinauszutragen, überließ er Gregory Toms Obhut und nahm seinen Platz als einer der vordersten Sargträger ein.
Der Sarg fühlte sich so leicht an, dass er abermals hätte weinen mögen. Vor seinen Augen war sie dahingesiecht, dabei war sie so ein dralles, hübsches Mädchen gewesen, als sie geheiratet hatten.
Erst als er das Ende des Mittelgangs erreichte, sah er, dass Oliver Dewhurst da war, allein in einer der letzten Reihen Niemand mochte seinem Blick begegnen.
Als sie vorbeigingen, erhob sich der junge Mann. »Was geschehen ist, tut mir leid, Mr King. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr.«
Nathaniel nickte. Oliver Dewhurst hatte ihm nichts getan. Wo sein älterer Bruder völlig verroht war, zeichnete dieser Bursche sich durch Güte aus.
Doch was brachte es schon, sein Beileid auszudrücken? Sarah war trotzdem unter Seelenqualen gestorben, hatte zusehen müssen, wie ihre geliebten Blumen zertrampelt worden waren – und die Tatsache, dass Nathaniel keine Möglichkeit hatte, die Schuldigen dafür zur Rechenschaft zu ziehen, lag ihm weiterhin bitter im Magen.
* * *
Walter sah wütend aus, als er an jenem Abend am Tisch erschien. »Wisst ihr, was heute geschehen ist?«, entrüstete er sich, noch ehe er sich gesetzt hatte.
»Wovon sprichst du?«
»Unsere Arbeiter haben sich freigenommen, um zur Beerdigung dieser King zu gehen. Ich hoffe, das ziehst du ihnen vom Lohn ab, Vater. Und die Krönung des Ganzen ist, dass mein lieber Bruder ebenfalls zugegen war.« Mit dem Knall frisch gestärkten Leinens schüttelte er seine Serviette aus und blickte finster über den Tisch.
Richard sah zu seinem Zweitgeborenen. »Stimmt das?«
»Ja.«
»Warum? Du hattest doch mit der Frau sicher nie etwas zu schaffen?«
»Ich war der Ansicht, wir schulden ihr ein Zeichen des Respekts, um wenigstens etwas Wiedergutmachung zu leisten für die Art, wie sie gestorben ist.«
»Dich sollte endlich jemand Loyalität lehren«, zischte Walter. »Deine eigene Familie steht an erster Stelle.«
»Ich kann keine Loyalität empfinden für jemanden, der Schwächere terrorisiert, und daran wird sich auch niemals etwas ändern.« Nun war es Oliver, der seinem Bruder einen zornigen Blick zuwarf.
»Auf unserem Grund und Boden habe ich jedes Recht, zu tun und zu lassen, was ich will«, spie Walter ihm entgegen.
»Nicht wenn die Pächter einen ordentlichen Pachtzins für diesen Grund und Boden zahlen. Dafür haben sie ein Anrecht darauf, ihn ungestört zu nutzen.«
»Ach, nun hört schon auf!«, befahl Richard. »Ich habe euch zweien schon oft genug gesagt, was ich von diesem Gezänk halte. Davon bekomme ich Verdauungsstörungen.« Damit hob er seinen Löffel an den Mund und kostete einen Löffel Suppe, um zufrieden zu brummen.
Walter aß vielleicht die Hälfte seiner Portion, ehe er so achtlos den Teller von sich schob, dass er das blütenweiße Tischtuch bekleckerte. »Also, ziehst du es ihnen nun vom Lohn ab oder nicht, Vater?«
»Lexham hat mir geraten, es nicht zu tun. Es herrscht böses Blut wegen dieser Angelegenheit. Lieber sollen wir es im Sande verlaufen lassen, hat er gesagt.«
»Lexham ist ein altes Weib. Ich weiß nicht, warum du den noch immer als Verwalter beschäftigst.«
»Weil er weiß, was er tut. Seit er übernommen hat, sind die Pachtrückstände gesunken. Die Pächter respektieren ihn.«
»Noch mehr würden die Rückstände sinken, wenn er die Leute nicht so verhätscheln würde.«
Verärgert starrte Richard seinen Erstgeborenen an. »Eines der Dinge, die ich gelernt habe, als ich mir mein Vermögen aufgebaut habe, war, mir jemanden zu suchen, der es besser kann als ich, denjenigen einzustellen und ihn machen zu lassen. Als Dienstherr wirst du zu nichts taugen, solange du das nicht verinnerlicht hast. Irgendwie werde ich einen Weg finden müssen, dir beizubringen, wie man einen Besitz wie diesen führt.«
»Das macht doch der Verwalter«, blaffte Walter. »Du hast eben gesagt, ich soll mir jemanden suchen, der es kann, und ihn machen lassen.«
»Trotzdem werde ich mich damit einmal näher befassen.« Richard warf seinem jüngeren Sohn einen Seitenblick zu. »Was deine Zukunft angeht, bin ich mir noch nicht schlüssig, Oliver. So kränklich wie früher einmal bist du nicht mehr, aber kräftig nun auch wieder nicht. Trotzdem kannst du dein Leben nicht im Müßiggang vertrödeln, wir werden also etwas finden müssen, womit du dir deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Das Erbe deiner Patin wird nicht ausreichen, um dir Umstände zu ermöglichen, wie du sie hier kennengelernt hast.« Stolz blickte er sich in dem weitläufigen Speisesaal um, über dessen getäfelten Wänden sich eine mit feinem Stuck verzierte Decke wölbte.
Darauf erwiderte Oliver nichts, sondern aß schweigend sein Mahl. Immer wieder wanderten seine Gedanken zurück zu der vollbesetzten Kirche und dem hochgewachsenen Mann mit dem gramgezeichneten Gesicht, der mit einer Hand auf der Schulter seines Sohnes hereingekommen war. Nie zuvor hatte er die Dorfbewohner so geeint gesehen und war erleichtert, dass sie ihre Empörung nicht an ihm ausgelassen hatten, auch wenn er durchaus einige finstere Blicke geerntet hatte.
Nur noch einen Monat, sagte er sich, als er den Teller von sich schob. Plötzlich war ihm übel angesichts des Überflusses auf diesem Tisch, während viele Menschen in Lancashire wegen der Baumwollhungersnot nicht genug zu essen hatten. In einem Monat würde er sein Erbe antreten können und die Macht – und das Geld – besitzen, einige Veränderungen in seinem Leben vorzunehmen. Er brauchte weder ein verschwenderisches Dasein noch ein riesiges Anwesen wie Marton Hall, bloß ein bescheidenes Heim und ein ruhiges, friedliches Leben. Noch hatte er seinem Vater gegenüber nichts von seinen Plänen erwähnt, und das würde er auch tunlichst vermeiden, bis er einundzwanzig wäre.
Wenn sein Vater und sein Bruder herausfänden, was er plante, würde die Hölle losbrechen, doch das war ihm gleichgültig. Er wollte einfach nur fort von Walter. Und sollte sein Bruder je auf seinem Land Schaden anrichten, würde er ihn vor Gericht bringen, Bruder hin oder her.
* * *
Im kleinen Dörfchen Blackfold, zu unbedeutend für eine Eisenbahnstation und zu weit östlich von Nathaniels Gehöft, als dass er ohne Weiteres auf Besuch kommen konnte, ging seine Nichte Ginny Doyle mit ihrer Familie zur Kirche – mit Mutter, Stiefvater und zwei Halbbrüdern. Sie konnte dem Gottesdienst kaum folgen, weil es sie noch zu sehr aufwühlte, wie ihr Stiefvater ihre Mutter vor dem Aufbruch angeschrien hatte. Er war ein grausamer Mann und sie hasste ihn. Selbst hier in der Kirche brodelte der Hass in ihr – und mit ihm die Angst. Ihre sanftmütige Mutter verdiente es nicht, so behandelt zu werden. Niemand von ihnen verdiente das. Seufzend bemühte sie sich abermals, sich zu konzentrieren, doch in seiner unmittelbaren Gegenwart war ihr das unmöglich.
Nach dem Gottesdienst verließ sie hinter ihrer Mutter die Kirche. Mit züchtig gesenktem Blick und an die Brust gedrücktem Gebetbuch betete sie, dass er ihre wachsende Vorfreude nicht bemerken würde. Als ihre Eltern stehenblieben, um sich mit einigen Nachbarn zu unterhalten, huschte sie zur anderen Seite des Kirchhofs, wo ihre beste Freundin Lucy Porter wartete.
»Dürfen Ginny und ich ein wenig am Kanal spazieren gehen?«, fragte Lucy ihre Mutter. »Nur ein paar Minuten.«
Mrs Porter lächelte sie an. »Aber natürlich, Liebes. Ich gebe deinem Vater Bescheid, Ginny. Den Heimweg findest du ja zur Not auch allein, falls deine Familie aufbrechen will, ehe ihr zurück seid.«
»Ich glaube, meine Mum mag deinen Vater nicht«, bemerkte Lucy, als sie Arm in Arm davongingen. »Sie verzieht immer das Gesicht, wenn von ihm die Rede ist.«
»Er ist nicht mein Vater, sondern mein Stiefvater!«, korrigierte Ginny sie. Wo immer sie konnte, achtete sie peinlich darauf, dass niemand ihn als ihren Vater bezeichnete, doch selbst Lucy vergaß es bisweilen.
Als sie Nick Halstead beim Kanal warten sah, ergriff Ginny ihre Freundin beim Arm. »Er ist gekommen.«
»Hab ich's doch gewusst. Wenn er allein mit dir reden will, bleibe ich ein Stück hinter euch zurück.«
»Aber nicht außer Sichtweite«, bat Ginny hastig. Den Zorn ihres Stiefvaters zu riskieren war das eine, ihn vor Wut zur Explosion zu bringen etwas ganz anderes. Ein- oder zweimal hatte sie ihn so aufgebracht erlebt, dass sie geglaubt hatte, er werde jemanden umbringen – schon bei der Erinnerung daran überlief sie ein Schauer. Und wie er mit ihrer Mutter umsprang, bedrückte sie sehr. Ihr eigener Vater hatte sie nie geschlagen. Vielmehr hatten die beiden miteinander gescherzt und gelacht. Dieser Tage lächelte ihre Mutter nur noch selten. Warum nur hatte sie Howard West geheiratet?
Über das zurückliegende Jahr hatte er auch Ginny zu drohen begonnen und ihr sogar schon hier und da eine Ohrfeige verpasst. Mittlerweile hatte sie Angst vor ihm, und ihre beiden Halbbrüder waren ihrem Vater schon immer mit großer Vorsicht begegnet, obgleich er Edwin und Andrew nicht annähernd so oft schlug wie Ginny.
Als sie das Ufer des Kanals erreichten, trat Nick vor und lüftete seinen Hut. Zuerst nickte er Lucy zu, dann richtete sein Blick sich auf das Mädchen, dessentwegen er gekommen war.
Ginny lächelte ihn an.
»Gehen Sie ein wenig spazieren, Miss Doyle?«
»So ist es, Mr Halstead.«
»Wie es der Zufall so will, hatte ich dasselbe vor. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten?«
»Das wäre ... nett.«
Als er sich an Ginnys Seite begab, nutzte Lucy die Gelegenheit, ihre Freundin noch einmal anzustoßen, und ließ sich dann zurückfallen.
Ginny bemerkte es kaum, so sehr war ihr Bewusstsein auf Nick gerichtet. Er war viel größer als sie – störte es ihn, dass sie so klein war? Sie liebte seine blauen Augen und das weiche braune Haar, das ihm immer über das linke Auge fiel und ihm etwas Jungenhaftes verlieh. Dazu war er nicht nur ein angenehmer Gesprächspartner, sondern schien die Unterhaltungen mit ihr ebenso zu genießen wie umgekehrt.
Die Zeit rann so vergnüglich dahin, dass sie überrascht war, als Lucy sie beim Arm fasste und entschuldigend sagte: »Ich denke, wir sollten besser umkehren. Du weißt doch, wie dein Stiefvater ist.«
Erschrocken fand Ginny zurück in die Realität. »Ja. Ja, da hast du wohl recht.«
»Ich könnte euch zurückbegleiten«, bot Nick an.
»Nein, lieber nicht«, wehrte Lucy rasch ab. »Jemand könnte uns sehen. Ihr Vater ist sehr streng.«
»Vielleicht sollte ich bei ihm vorstellig werden und um seine Erlaubnis bitten, mit dir spazieren gehen zu dürfen, Ginny?«
»Nein! Bitte nicht. Mit dieser Höflichkeit wüsste er nichts anzufangen.« Allein die Vorstellung der Auseinandersetzung, die das nach sich ziehen würde, ließ Ginny erschauern. Je weniger ihr Stiefvater von dieser Freundschaft ahnte, desto besser. Er mochte es nicht, wenn irgendeines seiner Familienmitglieder Freunde hatte oder Dinge außerhalb ihres Heims unternahm.
»Nun, dann verabschiede ich mich. Bis nächste Woche, hoffe ich?«
Ginny verbrachte die gesamten zehn Minuten, die der Rückweg in Anspruch nahm, damit, ihrer Freundin zu erzählen, wie umwerfend Nick war und welch ein interessanter Gesprächspartner.
Lucy lauschte ihrer Schwärmerei mit einem unterdrückten Lächeln. Einigermaßen anständig sah er aus, aber umwerfend konnte man ihn nun wirklich nicht nennen, während ihre Freundin ein sehr hübsches Mädchen war – ein wenig rundlich und mit herrlichen hellbraunen Locken, in denen um diese Jahreszeit ein Goldschimmer spielte. Ginny war ein lebhafter, unterhaltsamer Mensch – es sei denn, ihr Stiefvater war in der Nähe, dann wurde sie äußerst still. Fleißig half sie auf dem heimischen Bauernhof mit, war stets mit irgendetwas beschäftigt und sehr arbeitsam, da waren sich alle einig.
Lucy seufzte bedauernd angesichts der unmöglichen Lage. Im Grunde war es sinnlos, diese Treffen mit Nick fortzuführen. Mr West war ein strenggläubiger Anhänger der Anglikanischen Kirche und würde Ginny niemals gestatten, mit einem jungen Mann aus einer Methodistenfamilie auszugehen. Das wusste selbst Lucy. Auch Ginnys Vater war Methodist gewesen, und in Mr Wests Haus durfte nicht einmal sein Name genannt werden – auch wenn Lucy schleierhaft war, wie man jemanden, der seit zwölf Jahren unter der Erde lag, so verabscheuen konnte.
Am meisten sorgte sie jedoch, dass die Anziehung zwischen ihrer Freundin und Nick heller strahlte als jeder Stern am Nachthimmel, wann immer sie aufeinandertrafen – was diese Treffen umso riskanter machte. In einem Dörfchen wie Blackfold konnte man nichts lange geheim halten.
* * *