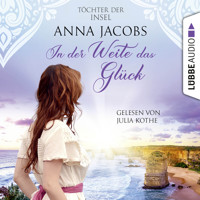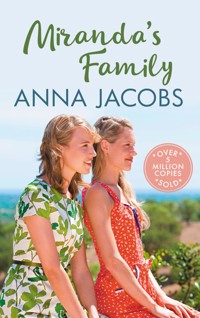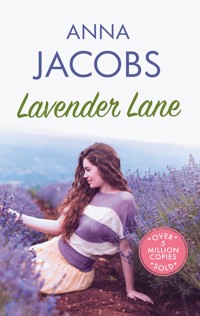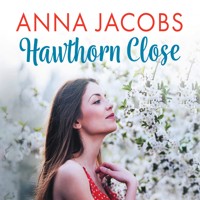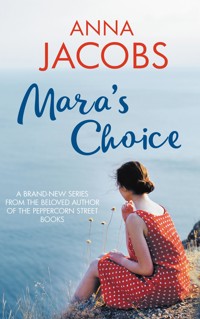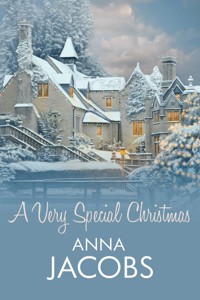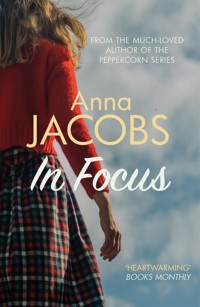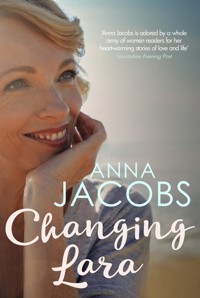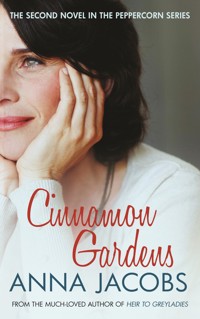7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die fesselnde Auswanderer-Saga von Bestseller-Autorin Anna Jacobs
- Sprache: Deutsch
Irland, 1863. Die Waisenmädchen Ismay und Mara werden gegen ihren Willen von den Behörden nach Australien geschickt. Der Abschied von der Heimat ist furchtbar, und in der Fremde wartet eine weitere böse Überraschung auf sie: Bei ihrer Ankunft in Melbourne werden sie voneinander getrennt. Während Ismay gezwungen wird, als Dienstmädchen auf dem Land zu arbeiten, muss Mara in der Obhut der katholischen Mission bleiben. In dem verzweifelten Versuch, einander zu finden, fliehen beide, aber Ismay gerät im Busch bald in Gefahr. Auch die ältere Schwester Keara macht sich auf die Suche nach Ismay und Mara. Sie hat sie nie aufgegeben, geschweige denn vergessen. Doch sie hat ihre eigenen Kämpfe zu bestehen, und als sie endlich Melbourne erreicht, gibt es von ihren Schwestern keine Spur mehr. Werden sie sich jemals wiedersehen?
Drei Schwestern. Drei abenteuerliche Reisen. Ein Ziel.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 699
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Über dieses Buch
Irland, 1863. Die Waisenmädchen Ismay und Mara werden gegen ihren Willen von den Behörden nach Australien geschickt. Der Abschied von der Heimat ist furchtbar, und in der Fremde wartet eine weitere böse Überraschung auf sie: Bei ihrer Ankunft in Melbourne werden sie voneinander getrennt. Während Ismay gezwungen wird, als Dienstmädchen auf dem Land zu arbeiten, muss Mara in der Obhut der katholischen Mission bleiben. In dem verzweifelten Versuch, einander zu finden, fliehen beide, aber Ismay gerät im Busch bald in Gefahr. Auch die ältere Schwester Keara macht sich auf die Suche nach Ismay und Mara. Sie hat sie nie aufgegeben, geschweige denn vergessen. Doch sie hat ihre eigenen Kämpfe zu bestehen, und als sie endlich Melbourne erreicht, gibt es von ihren Schwestern keine Spur mehr. Werden sie sich jemals wiedersehen?
Drei Schwestern. Drei abenteuerliche Reisen. Ein Ziel.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Anna Jacobs
Töchter der Insel -In der Weite das Glück
Aus dem Englischen von Freya Rall
1
Juli 1863
Irland
Die Männer mussten die zwei Mädchen gewaltsam in den Zug schleifen. Die Ältere wehrte sich lauthals protestierend mit Händen und Füßen, während die Jüngere – kleiner und damit leichter zu überwältigen – bitterlich weinte.
Ismay Michaels sah, wie ein oder zwei Umstehende sich unsicher in ihre Richtung bewegten, und wäre nicht ein Priester beteiligt gewesen, hätten sie ihr womöglich sogar geholfen – doch der Talar war unverkennbar, und so unternahm niemand etwas.
Schwer atmend stießen die Männer die Schwestern in ein Abteil.
»Diese Widerspenstigkeit wird euch nicht weiterbringen«, mahnte Vater Cornelius.
Als der Zug abfuhr, richtete Ismay ihre Kleider und half ihrer Schwester Mara, dasselbe zu tun, ehe sie sich so weit entfernt wie möglich von ihrem Dorfpriester und seinem Helfer niederließen. »Sie haben kein Recht zu alledem! Kein Recht. Wir würden auch allein zurechtkommen.«
Seufzend wiederholte der Priester, was er schon mehrfach erklärt hatte: »Du bist eben erst fünfzehn geworden und deine Schwester ist elf. Ihr könntet unmöglich allein euren Lebensunterhalt verdienen und ein Dach über eurem Kopf bezahlen, nun, da eure Eltern tot sind. Das weißt du.«
»Keara hat versprochen, dass sie nach Irland zurückkommt und wir uns alle drei zusammen durchschlagen.«
»Nun, eure Schwester wird in England gebraucht, um ihre Herrin zu unterstützen, die ein Kind erwartet. Deshalb kann sie nicht herkommen und ...«
»Ich werde ihr nie verzeihen, dass sie uns im Stich lässt, niemals!« Ismay legte einen Arm um Maras Schultern. »Keine von uns.«
»Keara handelt nur zu eurem Besten. Immerhin hat Mr Mullane persönlich die Überfahrt nach Australien in der Obhut der guten Schwestern von St. Martha und St. Zita arrangiert. Dort werdet ihr euch ein weitaus besseres Leben aufbauen können als daheim in Ballymullan.«
»Ich glaube Ihnen nicht. Außerdem wollen wir nicht aus Irland fort.«
Beim Aussteigen setzte Ismay sich wieder zur Wehr, schon aus Prinzip, doch sobald die schwere Tür des Konvents hinter ihnen ins Schloss fiel, gab sie ihren Kampf auf. Was hätte es jetzt noch gebracht? Ihr wurde bewusst, dass Maras Hand zitternd die ihre umklammerte, und als sie das tränenüberströmte schmale Gesicht ihrer kleinen Schwester sah, legte sie ihr einen Arm um die Schultern. Sie selbst wagte ihren Tränen nicht nachzugeben, denn sie musste jetzt stark sein. Also konzentrierte sie sich auf ihre Wut, während sie sich im Konvent umsah. Alles hier war aus Stein – große Quader, die einen zu erdrücken schienen –, und die Kühle dieses Orts ließ sie erschauern. Vielleicht war es aber auch die Angst, was nun aus ihnen werden würde.
Zwei aufgeräumte junge Nonnen in schwarzen Gewändern und weißen Schleiern betraten den Raum.
»Diese Männer haben uns entführt!«, verkündete Ismay sofort.
Nach einem erschrockenen Blick zu dem Priester sagte die größere Nonne ruhig: »Danke, Vater. Wir kümmern uns von nun an um sie.« Als die zwei Männer gegangen waren, erklärte sie: »Ich bin Schwester Catherine und werde mit euch nach Australien reisen. Wenn ihr mich in die Küche begleitet, besorgen wir euch etwas zu essen. Alle anderen sind schon zu Bett gegangen, aber wir haben auf euch gewartet.«
Schweigend folgten sie der Nonne. Ismay hielt ihre kleine Schwester noch immer fest im Arm.
Als Schwester Catherine ihnen etwas Kuchen vorsetzte, flüsterte Mara: »Essen wir das, Ismay?«
»Es wird wohl nicht schaden.«
Nachdem sie den Kuchen aufgegessen und jede ein großes Glas Milch getrunken hatten, folgten sie den Nonnen in einen langen, schmalen Raum, an dessen Wänden sich Regale voller ordentlich gefalteter Kleiderstapel reihten.
»Also, wie groß seid ihr?«, sagte die Größere mehr zu sich selbst und schüttelte einen Rock aus. »Ich denke, der sollte dir passen, Ismay. Probierst du ihn einmal für mich an?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Wir wollen Ihre schäbigen Kleider nicht. Wir wollen einfach nur nach Hause.«
Die Stimme der Nonne bekam einen stählernen Unterton. »Entweder du ziehst augenblicklich deine Sachen aus und probierst diesen Rock an, oder wir müssen Gewalt anwenden.«
Einen Moment lang starrte Ismay sie noch trotzig an, dann sackten ihre Schultern herab und sie blinzelte heftig. »Ich hab was im Auge«, murmelte sie, als sie Schwester Catherine besorgt herüberschauen sah. So langsam wie nur irgend möglich legte sie ihre eigenen Kleider ab und probierte an, was man ihr reichte, ehe sie auch diese Sachen wieder auszog und das schlichte weiße Nachthemd überstreifte, das ihr die Nonne gab. Mit Mühe gelang es ihr, zu verbergen, wie überwältigt sie von ihren nagelneuen Kleidern war – sogar ein langes Kleid nur zum Schlafen war dabei! Auch die Schuhe machten sie sprachlos: zwei Paar für jede von ihnen, und dazu noch Hausschuhe. Wozu brauchte man denn zwei Paar Schuhe? Man hatte doch nur ein Paar Füße!
Schwester Catherine und die zweite Nonne stellten ihnen beiden einen Stapel mit weiteren Kleidern in ihrer jeweiligen Größe zusammen. »Also gut. Ihr zwei könnt die Schuhe tragen, wir bringen euch nun in euer Zimmer.«
Der Raum war sehr einfach eingerichtet und makellos sauber. Selbst das Holz der Bettgestelle war poliert. Ismay musterte die zwei schmalen Betten und vergaß sich für einen Augenblick so weit, dass sie hinging und die weichen Decken und Laken befühlte. Neben den Betten gab es noch zwei Stühle, einen kleinen Waschtisch mit Krug und Schüssel sowie zwei saubere, ordentlich gefaltete Handtücher. Die Betten waren hoch genug, um den schlichten weißen Nachttopf hervorblitzen zu lassen, der unter einem davon bereitstand. Am Fußende wartete jeweils eine robuste Metalltruhe mit aufgeklapptem Deckel.
Die Nonnen packten den Großteil der neuen Kleider in die Truhen und ließen nur Röcke, Blusen und Unterwäsche für den nächsten Tag draußen liegen.
Schließlich trat Schwester Catherine zurück und nickte zufrieden. »So, nun habt ihr alles, was ihr für die Überfahrt brauchen werdet. Ihr könnt nun zu Bett gehen. Die anderen schlafen schon seit einer ganzen Weile.«
»Die anderen?«, hakte Ismay nach.
»Die anderen Waisenmädchen. Wir bringen eine zehnköpfige Gruppe nach Australien.« Nach einem Zögern fügte sie leise hinzu: »So schlimm wird es nicht. Wir werden uns gut um euch kümmern.«
»Man sollte uns erst gar nicht nach Australien schicken! Wir haben eine Schwester, die in England für die Mullanes arbeitet. Zu der sollte man uns bringen.«
»Sie muss ihre Erlaubnis für eure Umsiedlung erteilt haben, sonst wärt ihr nicht hier.« Doch da Schwester Catherine sah, wie furchtbar unglücklich die beiden waren, setzte sie hinzu: »Keine von uns hat es sich ausgesucht, nach Australien zu gehen.« Auf die überraschten Blicke der beiden hin erklärte sie: »Ich möchte Irland auch nicht unbedingt den Rücken kehren, wisst ihr?«
An dieser Stelle räusperte sich die andere Nonne und bedachte ihre Ordensschwester mit einem strafenden Blick, und so schluckte Catherine hinunter, was sie noch hatte sagen wollen, und verabschiedete sich stattdessen. »Schlaft gut, Mädchen.«
Die zwei Frauen verließen den Raum ebenso leise, wie sie auch alles andere zu tun schienen. Die Kerze nahmen sie mit und verriegelten hinter sich die Tür.
Augenblicklich erhob Ismay sich wieder, setzte sich kerzengerade auf die Bettkante und schwang ein Bein vor und zurück. Mara zauderte, blieb jedoch schließlich, wo sie war. Müde seufzend zog sie die Decke hoch. »Wollen wir nicht schlafen?«
»Noch nicht, nein.« Als ihre Augen sich ans Dunkel gewöhnt hatten, stellte Ismay fest, dass das Mondlicht für sie ausreichte, um auch den restlichen Inhalt der Truhen zu begutachten. Unter den Kleidern befand sich noch alles Mögliche: ein Gebetbuch, Nähwerkzeug, Schreibutensilien.
Erst als sie begann, die Kleider zurück in die Truhen zu räumen, kam ihr die Idee. »Denen zeige ich, was ich von ihren schäbigen Sachen halte!«, zischte sie und holte die Schere aus dem Nähmäppchen. Die Idee war so monströs, dass sie noch einen Moment zögerte, doch dann hob sie das Kinn und machte sich daran, die neuen Kleider zu zerschneiden.
»Ismay! Ismay, was machst du denn da? Nicht!«, flüsterte Mara entsetzt.
»Warum nicht? Siehst du nicht, was sie uns antun? Leg du dich nur schlafen. Ich werde hier noch eine Weile brauchen.«
Beinahe zwei Stunden dauerte es, bis sie mit ihrem Werk zufrieden war – bis dahin hatte sie Blasen an den Händen. Als ihre kleine Schwester irgendwann eingeschlafen war, hatte auch Ismay die Tränen nicht länger zurückgehalten, sodass der Lumpenhaufen vor ihr am Ende gut gewässert war.
* * *
Am Morgen wurden sie von Glockengeläut geweckt. Kurze Zeit später kam Schwester Catherine herein, den Mund bereits geöffnet, um etwas zu sagen – doch als sie die Berge aus Stofffetzen neben den Truhen erblickte, stockte sie. Auf ihrer Miene wandelte sich Schock zu Entsetzen. »Was hast du getan, Kind?«
»Nichts Schlimmeres, als Sie uns antun«, gab Ismay zurück und wappnete sich für eine Ohrfeige. Erstaunt stellte sie jedoch fest, dass die Nonne sie stattdessen voller Mitgefühl ansah.
»Das werde ich der Mutter Oberin sagen müssen. Sie wird furchtbar wütend sein. Ach, Ismay, kannst du nicht einfach akzeptieren, was nun mit euch geschehen soll?«
»Nein, das kann und werde ich niemals!«
Die von Schwester Catherine herbeigeholte Mutter Oberin starrte auf den Lumpenhaufen, zu dem das neue Mädchen ihre gesamte Ausstattung reduziert hatte, und betete leise um Geduld. Als sie schließlich das Wort ergriff, war ihr anzuhören, wie schwer es ihr fiel, ruhig und ausdruckslos zu sagen: »Wenn du das noch einmal tust, Ismay Michaels, werde ich euch beide trennen. Dauerhaft. Eine geht nach Australien, die andere bleibt hier.«
Mara heulte auf und warf die Arme um ihre Schwester.
Empört starrte Ismay die streng dreinblickende alte Nonne an. »Dazu haben Sie kein Recht.«
»Wir haben jedes Recht dazu. Ihr solltet dankbar sein, dass euer Grundherr eure Überfahrt nach Australien bezahlt. Dort drüben werdet ihr weit größere Chancen haben, euch ein gutes Leben aufzubauen. Es wird händeringend nach anständigen jungen Frauen gesucht, sowohl als Personal als auch als Ehefrauen.«
»Wir sind aber keine ...«
Warnend hob die Mutter Oberin einen Finger. »Schweig! Denkt nur an meine Worte, wenn ihr zusammenbleiben wollt!«
Ismay wusste nicht, was sie tun würde, sollte man sie von Mara trennen. Mühsam schluckte sie ein wütendes Schluchzen hinunter und starrte in das harte, unnachgiebige Gesicht empor, das mit der gütigen Miene von Schwester Catherine so gar nichts gemein hatte. »Ich hasse Sie!«, spie sie der Mutter Oberin entgegen.
Es wurden neue Kleider für sie zusammengesucht. Als die Mädchen wieder allein waren, selbst am Tage in ihrem Zimmer eingeschlossen, setzten sie sich eng aneinandergeschmiegt auf eines der Betten.
Aus Maras Kehle drang ein trauriger Laut, und sie wischte sich mit einem Zipfel der neuen weißen Schürze eine Träne fort. »Meinst du, Keara weiß vielleicht gar nichts von alledem?«
»Natürlich weiß sie davon. Wie könnte sie das nicht? Hat Vater Cornelius nicht einen Brief erhalten, in dem stand, sie wollte, dass wir nach Australien gehen? Sie konnte es uns ja nicht einmal ins Gesicht sagen oder ...« Einen Moment lang versagte ihr die Stimme. »Oder nach Ballymullan kommen, um sich zu verabschieden. Was mich betrifft, ist sie nicht länger unsere Schwester, und ich hoffe, ich sehe sie nie wieder, solange ich lebe. Und wenn doch, dann spucke ich ihr ins Gesicht, das sage ich dir.«
Mara schluchzte nur weiter leise vor sich hin.
Auch Ismay entwischten ein paar Tränen, doch sie machte keine Anstalten, sie fortzuwischen. Lieber hielt sie ihre Schwester fest im Arm. Sie war die Ältere und musste sich nun um Mara kümmern. Sollten sie durch irgendetwas getrennt werden, würde der Kummer sie umbringen, davon war sie überzeugt.
* * *
Lancashire
Malachi Firth schlich auf Zehenspitzen ins Haus. Er hatte gehofft, seine Familie läge längst im Bett, doch in der Küche brannte noch Licht. Vor der Tür war das kleine Penninendorf in so dichten Nebel gehüllt, dass er selbst auf den wenigen hundert Metern vom Pub bis hierher Mühe gehabt hatte, den Heimweg zu finden. Verfluchter Nebel und Regen! Seit Wochen hatten sie nichts anderes gesehen. Manchmal verzehrte er sich nach einem Sonnentag.
Als er die Hintertür schloss, sah er seinen Vater vom anderen Ende des geschrubbten Holztischs aufstehen, wie üblich mit finsterer Miene. Malachi rutschte das Herz in die Hose.
»Du warst wieder mit diesen Lumpen zusammen! Was denkst du dir, so lange auszubleiben, wo doch morgen ein langer Arbeitstag auf dich wartet?«
Malachi starrte seinen Vater ebenso finster an. Er war weder betrunken noch auch nur angesäuselt – das konnte er sich gar nicht leisten bei dem mageren Lohn, den sein Vater ihm zahlte. »Das sind anständige Kerle und ich hatte bloß ein oder zwei Glas Ale! Was schadet denn das?«
»Taugenichtse sind das. Mit solchen Leuten solltest du dich nicht abgeben. Dein Bruder wählt seine Freunde mit weit mehr Bedacht, und im Pub verschwendet unser Lemuel auch nicht seine Zeit.«
Das lag nur daran, dass Lemuel ohne die Erlaubnis seiner Frau kaum atmen durfte, geschweige denn einen Pub besuchen, doch Malachi würde sich hüten, seine Schwägerin seinem Vater gegenüber zu kritisieren. Immerhin hatte sie ihm vor Kurzem seinen ersten Enkel geschenkt, der den Familiennamen weitertragen würde. »Ich leiste hier meine Arbeit, da steht es mir wohl zu, in meiner Freizeit etwas Spaß zu haben.« Außerdem war heute der Musikabend gewesen, und Malachi mit seinem wohlklingenden Bariton liebte es, zu singen. Fünf Schilling hatte er gewonnen, weil er mit großer Mehrheit zum besten Sänger des Abends gekürt worden war, doch in den Augen seines Vaters war es unter der Würde eines Firth und Böttchermeistersohns, in der Öffentlichkeit zu singen. Malachi zog den Kopf ein, als sein Vater mit dröhnender Stimme seiner Verachtung Luft machte.
»Spaß! Was spielt denn Spaß für eine Rolle, wenn du ein Handwerk zu erlernen hast? Du solltest dein Geld lieber sparen, statt es für Bier zum Fenster hinauszuwerfen. Wie willst du deine eigene Böttcherei eröffnen, wenn die Zeit gekommen ist, wenn du deine Pennys nicht sparst? Aye, selbst die Farthings solltest du hüten!« Er gestikulierte um sich herum. »Dieser Besitz muss an den Ältesten gehen, und glaube ja nicht, dass ich ihn zwischen euch aufteile.«
Plötzlich barst aus Malachi hervor, was er schon lange zurückhielt: »Die Böttcherei ist ein sterbendes Gewerbe, Dad, und das wissen wir alle, selbst wenn du es dir nicht eingestehen willst!«
»Die Leute werden immer Wagenräder brauchen.«
»Ich sehe nicht ein, warum ich mich durch eine Lehre quälen soll, wenn es ohnehin nicht genug Arbeit für uns alle gibt.« Für gewöhnlich behielt Malachi seine Gedanken für sich, doch er stimmte mit jenen überein, die sagten, ein verzinkter Blecheimer sei besser als einer aus Holz, und leichter noch dazu. Selbst bevor die Baumwollhungersnot so viele Menschen in Lancashire in die Armut getrieben hatte, war den Böttchern die Kundschaft zu den maschinell gefertigten Fabrikaten abgewandert. Doch diese Diskussion wollte er nicht von Neuem beginnen.
Schon jetzt drangen angesichts dieser Ketzerei erstickte Zorneslaute aus der Kehle seines Vaters.
Malachi hatte die ewige Nörgelei satt und wandte sich zur Treppe, nur um erschrocken herumzufahren, als hinter ihm ein Poltern die Dielen erbeben ließ. John Firth lag lang hingestreckt auf dem Flickenteppich und zeigte bis auf einen zuckenden Fuß keine Regung. Angsterfüllt rief Malachi nach seiner Mutter.
Doch auch sie konnte nichts tun – ebenso wenig wie der Arzt, als er endlich eintraf.
Zwei lange Tage und Nächte lag sein Vater noch bewegungsunfähig im Bett, ehe er abrupt an einem weiteren Anfall starb.
Danach baute Malachis großer Bruder sich in der Küche vor ihm auf. »Ich hoffe, du kannst noch in den Spiegel blicken!«
»Was meinst du damit?«
»Du hast Vater vor seiner Zeit ins Grab gebracht mit all seinen Sorgen wegen deiner Trinkerei – und weil du dich nicht anständig in die Ausbildung gestürzt hast, wie du es hättest tun sollen. Ich sage es dir geradeheraus: Bei mir wirst du deine Lehre nicht fortsetzen, du undankbarer Lump! Du kannst hier ausziehen und dir eine andere Arbeit suchen – wenn du kannst. Was kümmert es mich, was aus dir wird.«
Schierer Trotz verleitete Malachi, zu brüllen: »Ich wollte ohnehin fortgehen. Glaubst du, mit dir würde ich arbeiten wollen?« Finster starrte er seinen größeren, stärkeren Bruder an, der nie davor zurückgeschreckt war, seine körperliche Überlegenheit einzusetzen, um zu bekommen, was er wollte. Lemuel kam nach ihrem Vater, in dessen Familie die Männer kräftig und muskelbepackt waren, während Malachi ihrer Mutter ähnelte – schmal und dunkelhaarig, voller nervöser Energie und mit einem Verstand, der nie stillstehen konnte und ewig staunend die Welt um sich herum erforschen musste.
In diesem Moment trat Hannah Firth leise in die Küche und tadelte ihre Söhne: »Schande über euch, dass ihr so miteinander zankt, während euer Vater noch unbegraben über euren Köpfen liegt!«
Lemuel verschränkte mit verbitterter Miene die Arme. »Ich habe es ernst gemeint, Mam. Er wird nicht hier wohnen bleiben, wenn Patty und ich einziehen, und seine Lehre übernehme ich auch nicht.«
Sie blickte von einem zum anderen und seufzte. »Nein, das würde nicht funktionieren. Dazu seid ihr zwei zu verschieden.« Sie hatten sich schon immer in den Haaren gelegen, schon als kleine Jungen – zu Hannahs großem Kummer. »Aber ich wäre euch dankbar, wenn ihr wenigstens bis nach der Beerdigung den Frieden wahrt. Dann können wir als Familie gemeinsam entscheiden, wie es für Malachi weitergehen soll.« Eindringlich sah sie beide junge Männer an, als sie mit Nachdruck hinzufügte: »Und du wirst ihn nicht aus dem Haus werfen, Lemuel, denn wenn du das tust, wirfst du auch mich hinaus. Der Bruder hat dasselbe Recht auf einen ordentlichen Start ins Leben wie du, und dies ist auch sein Zuhause.«
Lemuel scharrte ein wenig mit den Füßen, zuckte dann jedoch die Achseln und nahm ihre Anordnung hin.
* * *
An jenem Abend hatte Malachi seine Mutter noch für eine Stunde für sich allein, nachdem Lemuel und Patty heimgegangen waren. Alles war bereit für die Beerdigung. Und danach – nun, danach würde sich alles ändern.
»Ich mache mir Sorgen um dich«, sagte er ohne Einleitung.
»Um mich? Weshalb?«
»Wegen Vaters Testament. Er hätte dir auch etwas hinterlassen sollen.«
»Er hat darauf vertraut, dass Lemuel für mich sorgen wird.«
»Bei Lemuel mag er da vielleicht recht gehabt haben, aber nicht bei diesem boshaften Miststück, das er geheiratet hat.«
Hannah Firth seufzte. »Dein Vater war nun einmal, wie er war. Als ich ihn geheiratet habe, hätte ich ihn schon längst nicht mehr ändern können. Niemals hätte er das Haus oder gar den Betrieb einer Frau hinterlassen.«
»Warum hast du ihn überhaupt geh...« Er verstummte. Er wusste, dass es ihm nicht zustand, das zu fragen – schon gar nicht jetzt, da es gleich doppelt illoyal gegenüber jener leblosen Gestalt im Obergeschoss erschien.
Abermals seufzte seine Mutter. »Ich hatte meine Gründe. Eine Liebesheirat war es nicht, aber er war auf seine eigene Weise wirklich gut zu mir.«
»Und was willst du jetzt tun? Wenn Patty hier das Ruder übernimmt, wirst du niemals froh werden.«
Hannah schenkte ihm ein trauriges Lächeln. »Was bleibt mir schon für eine Wahl?«
»Du bist doch jung genug, um noch etwas anderes mit deinem Leben anzufangen. Schau nur, du hast noch kaum eine graue Strähne, außerdem bist du so rege wie eine weit Jüngere. Du könntest sogar noch einmal heiraten.«
Sie legte ihm einen Finger auf die Lippen. »Schhh. Dies ist nicht der Moment, so etwas zu bereden.«
Doch später, als Malachi im Bett lag, zerbrach er sich den Kopf ihretwegen. Schon jetzt reckte seine Schwägerin die Nase in die Luft und sah sich mit einem besitzergreifenden Ausdruck im Haus um. Lemuel würde sich ihr nicht in den Weg stellen. Der wagte ja kaum Luft zu holen ohne ihre Erlaubnis.
* * *
Als sich am folgenden Tag die letzten Trauergäste verabschiedet hatten, saß Patty mit ihrem kleinen Sohn an der Brust in der Küche, während Hannah Firth ihre Söhne in die Stube bat. »Es ist an der Zeit, dass wir uns unterhalten«, erklärte sie knapp und drängte ihren Kummer zurück. »Hast du schon eine Idee, was du nun unternehmen möchtest, Malachi?«
Er zögerte, denn er wusste, dass er ihr wehtun würde, doch dann sprudelte er hastig heraus: »Nach Australien auswandern.« Ein Blick aus dem Fenster zeigte denselben Regen, der schon den ganzen Tag über fiel. »Ich habe den grauen Himmel und die feuchte Luft satt. Es heißt, in Australien scheint die Sonne das ganze Jahr über.«
Lemuel schnaubte abfällig. »Die Sonne scheint nirgends das ganze Jahr, du Narr! Und was willst du in Australien machen, was du nicht genauso gut hier tun könntest?«
»Das weiß ich noch nicht. Vielleicht irgendetwas verkaufen.« Der Umgang mit Kunden, selbst wenn es nur ein junges Paar war, das einen Eimer kaufte, war der einzige Aspekt am Dasein als Böttcher, den Malachi mochte – und er war gut darin. Still um Verständnis flehend sah er seine Mutter an. »Ich denke schon eine ganze Weile darüber nach, war aber der Ansicht, ich könnte auch erst einmal meine Lehre zu Ende bringen. Jetzt wiederum ...« Er zuckte die Achseln. Trotz ihres Nickens war die Traurigkeit in den Augen seiner Mutter unübersehbar, doch er hatte keine Möglichkeit, ihr zu helfen.
»Ich weiß, dass du schon lange rastlos bist, mein Sohn. Aber du wirst das mit Bedacht angehen, deshalb wirst du hierbleiben, bis wir alles genau ausgetüftelt haben. Ich werde dich nicht mittellos in die Welt hinausschicken – und wenn ich meinen Ehering verkaufen muss, um dir ein Grundkapital mitzugeben.« Bei den letzten Worten sah sie Lemuel an, der wieder einmal nur mit den Füßen scharrte und ihrem Blick auswich.
In diesem Moment erschien Patty an der Stubentür, das Baby auf dem Arm und einen finsteren Ausdruck im Gesicht. »Das finde ich nicht gerecht, Mutter Firth. Dein Mann hat Lemuel das Geschäft hinterlassen, nicht Malachi. Er hat kein Anrecht auf das Geld daraus.«
»Was denkst du darüber, Lemuel? Fändest du es gerecht, dass Malachi gar nichts bekommt, nicht einmal eine Starthilfe für ein eigenes Leben?« Eindringlich starrte Hannah ihren Sohn an. Sie wusste, auch wenn er unter dem Pantoffel seiner Frau stand – und das schon lange vor der Hochzeit der beiden im vergangenen Jahr –, war er eine treue Seele. Mehr konnte ein Sohn seinem Vater kaum gleichen. Schon mit seinen zweiundzwanzig Jahren war er längst in seinen Ansichten festgefahren, während die drei Jahre jüngere Patty sich anschickte, ein echter Drachen zu werden. Hannah graute davor, mit den beiden zusammenzuleben. Doch damit würde sie Malachi nicht belasten. Wenigstens er sollte ein freies Leben genießen.
Lemuel sah von einem zum anderen, ehe er murmelte: »Eine kleine Starthilfe kann er meinetwegen haben, aber ich werde mein Kind nicht seines Erbes berauben. Hätte Dad Malachi überhaupt etwas geben wollen, hätte er ihm mehr hinterlassen als bloß seine Taschenuhr.«
Hannah sagte nichts dazu, dass das Erbe nicht so groß gewesen war, wie John gehofft hatte, da es mit dem Böttchergewerbe schon vor diesen schweren Zeiten bergab gegangen war. Sie sah Patty die Nase rümpfen und zurück in die Küche stapfen. »Morgen beginnen wir mit der Planung«, teilte sie ihren Söhnen mit und ging dann ebenfalls in die Küche, um ihrer Schwiegertochter beim Aufräumen zu helfen. Sie musste sich auf die Zunge beißen, als ihr scharfe Befehle um die Ohren flogen, als wüsste sie ihren eigenen Haushalt nicht zu führen. Patty riss schon jetzt die Macht an sich, noch ehe sie überhaupt eingezogen war.
Erst als Hannah in jener Nacht im Bett lag, zum letzten Mal in dem großen Elternschlafzimmer, gab sie sich ihrem Kummer hin – und wenn sie statt des Todes ihres Gatten den Verlust ihres jüngeren Sohnes beweinte, würde das an ihren geröteten Augen niemand ablesen können.
Wenn morgen Lemuel und Patty einzögen, würde sie das kleine Zimmer hinter der Küche bekommen, in dem ihre eigene Mutter ihren Lebensabend zugebracht hatte. Im Haus einer anderen Frau zu leben erfüllte sie so gar nicht mit Vorfreude, doch so geschah es nun einmal, wenn der Ehemann starb und es nicht genug Geld gab, der Witwe ein eigenes Heim zu stellen.
Fast wünschte sie, sie könnte Malachi nach Australien begleiten. Schließlich war sie erst zweiundvierzig, weder äußerlich noch innerlich alt. Doch diesen Vorschlag wagte sie nicht zu machen, denn sie wusste, sollte sie es versuchen, würde Lemuel sich furchtbar aufregen und sich weigern, auch nur einem von ihnen die Überfahrt zu bezahlen. Um ihres jüngeren Sohnes willen musste sie ihre neue Rolle hinnehmen und dankbar sein, dass sie überhaupt noch ein Dach über dem Kopf hatte.
Trotzdem würde es hart werden, mit Patty zusammenzuleben. Eins der schwierigsten Dinge, die sie je getan hatte.
* * *
Einige Tage später brachten die Nonnen die Waisenmädchen zum Hafen und eskortierten sie zu dem Dampfer, der sie alle nach Liverpool beförderte, wo sie in einem anderen Konvent einquartiert wurden. Um bei der Bewachung der zwei Aufrührerinnen zu helfen, begleitete sie eigens der Pförtner des ersten Konvents.
Als England am Horizont erschien, verspürte Ismay keine Aufregung – nur Enttäuschung, dass es ihnen nicht gelungen war, zu fliehen. Hier waren sie, näher an Keara, als sie es je wieder sein würden, und Ismay hatte keine Möglichkeit, ihre große Schwester zu finden.
Als sie wieder ein paar Tage später zu dem weit größeren Schiff geführt wurden, das sie nach Australien bringen würde, hielt die streng dreinblickende Nonne, die in Australien die Mutter Oberin des dortigen Konvents werden würde, Maras Arm in festem Klammergriff. Der Pförtner aus dem irischen Konvent drückte Ismays Arm sogar noch fester.
Schwester Catherine, die mit den restlichen Waisen hinter ihnen ging, fühlte mit den Michaels-Schwestern. Die meisten anderen Mädchen, die von den Nonnen nach Australien verschifft wurden, freuten sich über diese Gelegenheit. Sie sandte ein rasches Gebet gen Himmel, dass die zwei Rebellinnen in ihrem neuen Leben Glück finden würden. Dann wandte sie sich wieder ihren eigenen Schützlingen zu und verteilte sie auf die winzigen Vier-Kojen-Kabinen, während die Mutter Oberin und die Oberin des Ledigenquartiers der Damen die Michaels-Schwestern hinter Schloss und Riegel brachten.
Erst als das Schiff abgelegt hatte, ließ man Ismay und Mara aus der winzigen Endkabine, in der von nun an die zwei Nonnen wohnen würden – es war eine der wenigen mit einer richtigen Tür statt eines provisorisch aufgehängten Lakens vor dem Eingang.
An Deck gesellten sich die Schwestern zu den anderen Waisen, unschwer zu erkennen an ihrer dunklen Kleidung. Einige der Mädchen weinten, als das Schiff sich langsam von der Küste entfernte. Mit leisen Trostworten ging Schwester Catherine von einer zur anderen, doch auch ihren Blick zog es immer wieder zurück gen Horizont.
Ismay ging mit Mara zur Reling und sah zu, wie England zu einem nebligen Umriss verblasste. Durch ihren Tränenschleier erkannte sie ohnehin bloß bedeutungslose Farbkleckse. Der unermüdlich in ihrem Inneren summende Zorn gab ihr die Kraft, sich weiter um Mara zu kümmern und das Beste aus ihrer Situation zu machen. Wenigstens eine Schwester hatte sie noch. Das war das Wichtigste.
Unverhofft teilten sich die Wolken und ließen helle Lichtfinger herabstrahlen. Aus den Reihen der Passagiere erhob sich ein »Oooh«, als ein Regenbogen den Himmel überspannte, perfekt bis ins kleinste schimmernde Detail.
Verzaubert starrte Mara hinauf.
»Ein Regenbogen steht für Hoffnung«, sagte Ismay rasch. »Das ist ein Zeichen, ganz bestimmt.«
»Glaubst du das wirklich?«
»Ich bin fest davon überzeugt.«
»Weißt du noch, wie Mam uns immer gesagt hat, dass in der Ferne die Hoffnung liegt? Gleich hinterm Regenbogen ... Und wir sollen ihr Sonnenschein für einen Penny mitbringen, wenn wir zum Laden gehen?«, erinnerte Mara sich wehmütig.
»Dieser Regenbogen ist mehr wert als einen Penny«, verkündete Ismay. »Das ist ein Zwei-Penny-Regenbogen, eindeutig. Ach, Mara, Liebes – wir schaffen das schon, ganz bestimmt. Und von jetzt an werden wir jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, an Mam denken. Und an die Hoffnung glauben.«
Lächelnd lehnte Mara den Kopf an die Schulter ihrer Schwester. Ihr war dieser Gedanke ein Trost, doch Ismay brachte keine fröhliche Miene zustande. Die Farben des Regenbogens schienen zu zerlaufen, als ihr abermals Tränen in die Augen stiegen. Sie musste erst ihren Zorn wieder anstacheln, um sie zurückhalten zu können, und selbst so war sie überzeugt, dass Schwester Catherine wusste, wie kurz sie davorgestanden hatte, laut aufzuschluchzen.
* * *
Malachi arbeitete weiter mit seinem Bruder in der Werkstatt, sodass ihm niemand würde vorwerfen können, er käme nicht für seinen Lebensunterhalt auf, doch die Atmosphäre im Haus war angespannt.
Am meisten störte es ihn, wie Patty seine Mutter behandelte, die bislang Herrin dieses Hauses gewesen war und nun von ihrer scharfzüngigen Schwiegertochter herumgescheucht wurde wie eine Dienstmagd – und zwar eine recht begriffsstutzige.
»Warum lässt du dir das gefallen, Mam?«, fragte er.
Seine Mutter hob die Schultern. »Was bleibt mir denn anderes übrig, mein Schatz? Als Witwe ist man nun einmal von seinen Kindern abhängig.«
»Vielleicht solltest du dann mit mir nach Australien kommen? Ich würde niemals so mit dir umspringen.«
»Sei nicht albern. Für so etwas bin ich viel zu alt. Und hier habe ich mein eigenes Zimmer mit meinen liebsten Sachen. Das ist mir ein großer Trost.«
Einen Teil des letzten Abends verbrachte er – zu Lemuels lauthals zum Ausdruck gebrachtem Missfallen – mit seinen Freunden im Pub. Doch was spielte die Meinung seines Bruders schon noch für eine Rolle? Nach dem morgigen Vormittag würde er Lemuel nie wiedersehen, und vermissen würde er ihn sicher nicht.
Alle paar Minuten kam jemand im Pub vorbei, um Malachi alles Gute zu wünschen. Eine Stunde nach seiner Ankunft begannen seine engsten Freunde, einander mehr oder weniger unauffällig anzustoßen, bis John Dean ins Hinterzimmer verschwand.
In seiner Abwesenheit bugsierten die anderen Malachi auf einen Stuhl und legten ihm unter großem Gelächter eine Augenbinde an. Angestrengt lauschend saß er da und fragte sich, was sie vorhatten, bis ein Raunen Johns Rückkehr ankündigte.
»Streck die Arme aus, Junge«, erklang die tiefe Stimme seines Freundes vor ihm. »Wir haben dir was besorgt, was dich an uns erinnern soll.«
In Erwartung irgendeiner Art von Streich streckte Malachi schicksalsergeben die Arme aus und spürte plötzlich etwas unerwartet Großes darauf ruhen. Als sie ihm die Augenbinde abnahmen, starrte er hinunter auf ... Er musste sich täuschen, es konnte nicht sein ... Aber doch, es war eine Gitarre in einer robusten Segeltuchhülle.
»Die lag bei meinem Onkel seit Jahren auf dem Speicher herum«, erklärte John grinsend. »Da haben wir sie ihm abgekauft, als Abschiedsgeschenk für dich.«
Einen Moment lang verschlug es Malachi die Sprache. John wusste genau, wie sehr er sich nach einem eigenen Instrument gesehnt hatte, ganz gleich welcher Art – doch so etwas wäre John Firth natürlich nicht ins Haus gekommen. »Ach, Jungs.« Vor Rührung war seine Stimme so belegt, dass er kurz innehalten und schwer schlucken musste, ehe er hervorbrachte: »Ich weiß nicht, wie ich euch dafür je danken soll.«
Er öffnete die Schnallen der Hülle und holte die Gitarre hervor. Jemand hatte das Holz poliert – er roch noch das Bienenwachs.
»Mein Onkel hat eigens neue Saiten aufziehen lassen«, sagte John. »Und wir haben dir noch Ersatz dazugelegt.«
Behutsam ließ Malachi die Finger darübergleiten. Hell und weich stieg der Klang empor.
»Und dann bekommst du noch das hier.« John hielt ihm ein kleines Büchlein entgegen. »Da drin steht, wie man spielt.«
Malachi senkte den Kopf und stieß heiser hervor: »Ach, Jungs, ihr werdet mir so furchtbar fehlen!«
»Dann bleib hier!«, rief jemand von hinten. »Wer soll denn jetzt für uns singen?«
Er hob den Kopf und wusste, dass die anderen seine Tränen sehen mussten. Doch zum Teufel damit! »Ich werde jedes Mal an euch denken, wenn ich die hier spiele.«
Viel länger blieb er nicht, denn er wollte noch ein ruhiges Stündchen mit seiner Mutter verbringen.
Patty und Lemuel jedoch blieben lange über ihre übliche Zeit hinaus auf, und Patty ließ es sich nicht nehmen, immer wieder zu sticheln, hoffentlich würde er nicht bereuen, was er vorhatte – wo Malachi doch genau wusste, dass sie ihn in Australien scheitern sehen wollte.
Schließlich sagte Hannah leise: »Wenn ihr zwei heute lange aufbleiben möchtet, können Malachi und ich uns auch in meinem Zimmer noch ein wenig unterhalten.«
»Wir sind wohl nicht gut genug, um mit euch den Abend zu verbringen«, zischte Patty.
Doch Lemuel bedeutete ihr, still zu sein, und schob sie in Richtung Treppe. An seinen Bruder gewandt zauderte er einen Moment, ehe er sagte: »Ich wünsche dir alles Gute da drüben, auch wenn ich bezweifle, dass du Erfolg haben wirst. Du bist nicht beständig genug, dich auf eine Arbeit festzulegen. Aber von mir brauchst du dann keine Hilfe zu erwarten. Patty ist wieder guter Hoffnung, und ich muss an meine eigene Familie denken.« Nach einem weiteren kurzen Zögern streckte er die Hand aus.
Malachi atmete tief durch, verärgert über die Worte seines Bruders, schüttelte jedoch die dargebotene Hand und beließ es bei einem: »Eines Tages werde ich dir das Gegenteil beweisen.«
Daraufhin richtete Lemuel das Wort an seine Mutter. »Malachi war schon immer dein Liebling, aber ich hoffe, von jetzt an wirst du daran denken, dass ich der Herr des Hauses bin und für dich sorge, nicht er!«
Als Lemuel seiner Frau nach oben gefolgt war, breitete Malachi die Arme aus. »Komm her und lass dich drücken, Mam. So richtig fest. Damit werden wir für lange Zeit auskommen müssen.« Er spürte, wie sie bebte unter der Anstrengung versuchten, ihre Tränen zurückzuhalten. Nun, auch er hätte heulen mögen wie ein Baby, so wahr ihm Gott helfe.
Sie dachten nicht einmal daran, zu Bett zu gehen – keiner von ihnen wollte auch nur eine der verbleibenden Minuten auf Schlaf verschwenden. Manchmal redeten sie, bisweilen saßen sie auch nur schweigend beisammen. Die meiste Zeit über hielt Hannah seine Hand, und einmal döste sie für eine Weile, den Kopf an seine Schulter gelehnt.
Als er auf ihr dunkles Haar hinunterblickte, stellte er aufs Neue erstaunt fest, wie wenige Silberfäden erst darin zu sehen waren. Er war froh, dass sie jünger aussah, als sie war – hoffentlich jung genug, um noch einmal zu heiraten und Patty zu entkommen. Nun blinzelte er selbst angestrengt gegen die Tränen an. Teufel, er hatte nicht damit gerechnet, dass es ihn so schmerzen würde, sie zurückzulassen.
Als er am Morgen über ihnen seinen Bruder aufstehen hörte, rüttelte Malachi sie wach und erklärte eindringlich: »Eines muss ich dir noch sagen, Mam: Falls du je zu mir nach Australien kommen willst, bist du mir mehr als willkommen. Für dich würde ich durchs Feuer gehen, vergiss das niemals.«
»Dann vergiss du nicht, mir zu schreiben und mir deine Adresse zu geben«, erinnerte sie ihn zum zwanzigsten Mal.
»Als könnte ich das je vergessen.« Dabei musste er sie einfach noch einmal umarmen.
2
August 1863
Mit Beginn der Überfahrt verkündete der Schiffsarzt ein Programm verschiedenster Aktivitäten und Unterhaltung für die Passagiere. An zwei oder drei Abenden die Woche würde es Tanzmusik von der sogenannten Schiffskapelle geben – auch wenn diese Kapelle aus nur drei Männern bestand, die mit einer Fiedel, einer Konzertina und einer Blechflöte ein eher dünnes Gefiepe zustande brachten.
Am ersten Tanzabend stand Ismay mit den anderen Zwischendeckspassagieren an Deck und wippte munter im Takt der Musik, während sie die Tanzenden beobachtete. »Ich wünschte, die Nonnen würden uns mittanzen lassen«, flüsterte sie ihrer kleinen Schwester zu. »Es ist, als würden sie niemandem auch nur das kleinste bisschen Spaß gönnen.«
»Die Mutter Oberin hat gesagt, wir sollen die Überfahrt dazu nutzen, uns weiterzubilden.«
»Und wir sitzen jeden Tag in ihrem Leseunterricht, oder etwa nicht? Und lernen Arithmetik von Schwester Catherine?« Ismay stieß einen verächtlichen Laut aus. »Ach, diese alte Mutter Oberin will bloß alle dazu bringen, Nonnen zu werden wie sie.«
»Es muss ein herrlich friedliches Leben sein«, merkte Mara sehnsuchtsvoll an. »Und ich wette, die müssen nie hungern.«
Überrascht sah Ismay zu ihr hinüber. »Wir haben schon eine ganze Weile nicht mehr gehungert. Hast du ... davor immer noch Angst?«
Mara nickte. »Ja, jeden Tag. Erst als Mara die Arbeit im Herrenhaus angenommen hat, war genug Essen für uns alle da. Aber jetzt, wo wir sie nicht mehr haben, mache ich mir Sorgen, wie es uns in Australien ergehen wird.«
»Ich habe dir wieder und wieder gesagt, du sollst nicht von ihr reden!« Doch als sie sah, wie Mara Tränen in die Augen schossen, drängte Ismay ihre Wut zurück und drückte die Hand ihrer kleinen Schwester. »Verzeih. Ich wollte nicht mit dir schimpfen.« Mit einem Blick hinab auf ihre zweckmäßigen dunklen Kleider seufzte sie: »Aber was soll's – wer würde schon mit uns tanzen wollen? In dem Zeug müssen wir aussehen wie zwei hässliche alte Krähen!« Mit ihren fünfzehn Jahren störte es sie durchaus, dass ihr dunkelblauer Rock aufs Sparsamste zusammengeschnitten war – und aus einer groben, steifen Wolle, die für das wärmer werdende Wetter völlig ungeeignet war. Zudem waren die Röcke allesamt mit tiefen Säumen ausgestattet, damit man sie noch auslassen konnte, sollten die Mädchen wachsen, wodurch sie noch unschöner fielen. Dazu gehörten graue Blusen aus zweckmäßigem Baumwolltwill und enge dunkle Jacken aus demselben Stoff wie die Röcke, auch wenn die Mutter Oberin ihnen aufgrund der Wärme wenigstens erlaubt hatte, die Jacken wegzulassen. Allerdings wohl weniger aus Sorge um ihr Wohlergehen als in der Befürchtung, ihr Achselschweiß könne unschöne Flecken hinterlassen.
Der alten Nonne schien die Temperatur nichts auszumachen. Sie bewegte sich mit einer stoischen Miene durchs Leben, der nur im Umgang mit ihren Schützlingen ab und an ein Hauch von Irritation anzumerken war, der rasch wieder verbannt wurde. Schwester Catherine hingegen wirkte bisweilen äußerst erhitzt, und als ihr eines Tages beim Anblick einiger fliegender Fische ein freudiger Ausruf entfuhr, erntete sie dafür sogleich einen strafenden Blick von ihrer Vorgesetzten. Bei den Mädchen war Schwester Catherine allseits beliebt, während sie die Mutter Oberin fürchteten.
Ismay sah einen lächelnden Dr. Greenham auf sie zukommen.
»Mutter Oberin, warum sind Ihre Mädchen nicht auf der Tanzfläche?«
Missbilligend blickte die alte Nonne ihm entgegen. »Weil ich es nicht für angebracht halte, sie mit Fremden tanzen zu lassen. Das führt nur zu Schwierigkeiten.«
»Unsinn! Erst wenn man jungen Mädchen regelmäßige körperliche Betätigung verwehrt, die sie müde macht, bringen sie sich in Schwierigkeiten. Das habe ich auf diesen langen Überfahrten schon allzu oft gesehen. Außerdem wird es auf diesem Schiff ohnehin keine Fremden mehr geben, noch ehe die Reise halb vorüber ist.«
»Trotzdem werden sie von mir nicht die Erlaubnis zum Tanzen erhalten.« Ihre Lippen bildeten einen schmalen Strich, und ihre Augen glänzten hart wie Kieselsteine, während sie dem Arzt unerbittlich die Stirn bot.
Er senkte die Stimme. »Es tut mir leid, Ihnen da widersprechen zu müssen, meine sehr verehrte Dame, doch wenn es um das Wohlergehen unserer Passagiere geht, habe ich das Sagen – ohne Ausnahme.«
Nach dem ersten Schock ob dieser Anmaßung holte sie tief Luft und fixierte den Arzt mit einem Blick, vor dem für gewöhnlich selbst das rebellischste Mädchen den Kopf einzog.
Doch zu Ismays Entzücken wirkte er nicht im Geringsten eingeschüchtert. Seine Antwort war so leise, dass nur sie und Schwester Catherine nahe genug standen, um sie mitzuhören.
»Wenn es sein muss, Ehrwürdige Mutter, werde ich den Kapitän ersuchen, meine Anordnung durchzusetzen. Als Schiffsarzt bestehe ich darauf, dass sämtliche Passagiere sich regelmäßig körperlich ertüchtigen. Auch Sie sollten sich angewöhnen, täglich auf Deck spazieren zu gehen.«
Schwester Catherine schaltete sich ein: »Was kann es denn schaden, wenn die Mädchen hier unter aller Augen ein wenig tanzen, Ehrwürdige Mutter?«
Ismay sah, wie der jüngeren Nonne die Röte in die Wangen schoss, als ihr klarwurde, dass sie ihre Gedanken laut ausgesprochen hatte, und auch der wütende Blick der Mutter Oberin entging Ismay nicht.
»Worte einer Frau mit Verstand«, pflichtete der Arzt ihr gut gelaunt bei. »Und nun lassen Sie uns nach Partnern für die älteren Mädchen suchen.« Er wandte sich an Ismay. »Miss Michaels, Sie würden doch sicher gern tanzen, nicht?«
Ismay ignorierte die finstere Miene der Mutter Oberin und lächelte den grauhaarigen Mann an. »Aber natürlich – mit Freuden, Herr Doktor.«
»Dann warten Sie hier, bis ich jemanden für Sie gefunden habe.«
* * *
Malachi stand an der Reling, den Blick auf die ruhige, im Mondlicht schimmernde See gerichtet. Hinter ihm arbeiteten die drei Musiker sich ab und produzierten ein wohl rhythmisches, aber wenig melodisches Getöse, das an seinen Nerven zerrte. Ignorieren konnte er es jedoch nicht, denn die Planken unter seinen Füßen bebten mehr oder weniger im Takt unter den Schritten der Tänzer.
»Mr Firth ...«
Er fuhr herum und fand sich dem Schiffsarzt gegenüber wieder.
»... Sie tanzen ja gar nicht?«
»Ich habe mich am Mondschein auf dem Wasser erfreut.«
»Nun, davon werden Sie auf dieser Überfahrt noch reichlich sehen. Im Augenblick wartet dort drüben allerdings eine junge Dame auf einen Partner. Erlauben Sie mir, Sie vorzustellen.«
»Ich würde heute Abend lieber nicht tanzen, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
»Wir legen Wert darauf, unseren Passagieren etwas Bewegung zu verschaffen.«
Auch wenn der Arzt mit milder Stimme gesprochen hatte, lag doch ein unbeugsamer Unterton in seinen Worten, den mittlerweile alle Passagiere kannten. Dr. Greenham war äußerst auf Reinlichkeit, frische Luft und Bewegung bedacht und nahm seine Aufgabe, über ihre Gesundheit zu wachen, sehr ernst. Er rühmte sich gar damit, dass viele von ihnen das Schiff in besserer Verfassung verlassen würden, als sie es betreten hatten.
»Wer ist es?«, fragte Malachi schicksalsergeben.
»Ismay Michaels. Sie gehört zu den Schützlingen der Nonnen.«
»Ich dachte, deren Mädchen dürfen nicht tanzen. Die alte Krähe erlaubt ihnen ja kaum das Atmen.«
Mit strenger Miene erklärte der Arzt: »Da sie allerdings ebenso auf ein gesundes Maß an körperlicher Ertüchtigung angewiesen sind wie jeder andere Mensch – Sie eingeschlossen –, habe ich beschlossen, einzugreifen.«
»Und welche ist Ismay?«
»Die Dunkelhaarige ganz links.«
Malachi sah hinüber und erblickte ein schmales Mädchen, dessen Haar ebenso dunkel war wie das seine, auch wenn ihres sich sanft um ihr Gesicht lockte, während seines glatt war. »Das ist doch noch ein Kind!«
»Fünfzehn. Im einen Moment eine Frau, im nächsten wieder ein Kind, aber definitiv alt genug, um mit einem jungen Mann von neunzehn Jahren zu tanzen. Ich verlange ja nicht von Ihnen, sie zu heiraten«, besänftigte der Arzt ihn leise lachend, ehe er mit gesenkter Stimme hinzufügte: »Wir können doch diesen Nonnen nicht erlauben, die armen Mädchen zu erdrücken mit ihrer Moralversessenheit. Deshalb wäre ich Ihnen wirklich sehr verbunden für Ihre Unterstützung, Mr Firth.«
Was sollte er darauf entgegnen? Also folgte Malachi dem Mann über das Deck und hoffte, seine Partnerin würde sich als nicht allzu nichtssagend erweisen. Einmal mussten sie kurz stehenbleiben, um ein paar Kinder vorbeizulassen, die hüpfend und wirbelnd die Erwachsenen nachzuahmen versuchten, und er konnte nicht umhin, über das Schauspiel zu schmunzeln.
* * *
Ismay war das Widerstreben auf der Miene des jungen Mannes nicht entgangen, und war peinlich berührt von der Vorstellung, mit jemandem zu tanzen, der dazu gezwungen worden war. Wäre es nicht eine Gelegenheit gewesen, etwas gegen den Willen der Oberin zu tun, hätte sie ihn wieder fortgeschickt. So aber reichte sie ihm die Hand, als der Arzt sie einander vorstellte, und ließ sich von ihm ans Ende der Gasse führen, die sich bereits für den nächsten Tanz zusammenfand.
Als die Musik aufs Neue anhob, verzog er das Gesicht und sie konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Besonders gut sind sie nicht, was?«
»Überhaupt nicht gut«, stimmte er ihr zu. »Sie haben also ein Ohr für Musik, Miss Michaels?«
»Ich singe gern, aber vom Spielen weiß ich nicht viel.«
»Sie sollten sich dem Schiffschor anschließen.«
»Das hat Mutter Bernadette uns verboten.« Sie seufzte. »Ohne den Arzt würde ich jetzt auch nicht tanzen.«
»Ich auch nicht – was nichts mit Ihnen zu tun hat, sondern allein mit der Tatsache, dass ich froh war, mich einmal mit niemandem unterhalten zu müssen.«
»Auf einem Schiff hat man nirgends seine Ruhe, nicht?«
Es freute ihn, wie schnell sie erkannt hatte, worauf er hinauswollte. »Ja, aber wie man hört, ist es immer noch besser als in den Anfangszeiten. Damals hat man die Leute einfach eingepfercht, ohne sich um ihr Wohlergehen zu scheren. Auf dem Weg nach Australien sind schon viele Leute gestorben, vor allem auf schlecht geführten Schiffen. Heutzutage gibt es gesetzliche Vorschriften, wie die Passagiere unterzubringen sind.« Seine Mutter hatte ihn angehalten, so viel wie nur irgend möglich über die lange Reise nach Australien in Erfahrung zu bringen – und auch wenn es ihm gegen den Strich gegangen war, länger als unbedingt nötig in dem Haus zu bleiben, das nun Lemuels war, und sich ständig auf die Zunge beißen zu müssen, ganz gleich, wie sehr man ihn provozierte: Er hatte durchaus eingesehen, dass das sinnvoll wäre.
Darüber hinaus hatte seine Mutter nicht nur seinen Bruder dazu gebracht, ihm die Überfahrt zu bezahlen, sondern auch dafür gesorgt, dass er ihm ein kleines Startkapital mitgegeben hatte – und ihm dann selbst noch etwas Geld zugesteckt. Sie waren gemeinsam mit dem Zug nach Manchester gefahren und hatten einen Tag lang Waren ausgewählt, die er in Australien würde weiterverkaufen können: Haarnadeln, Kämme, Küchenmesser, Scheren. So etwas brauchten die Leute immer. Dabei hatten sie die Augen nach guten Angeboten offengehalten und sich ausschließlich für Dinge entschieden, denen Meerwasser und mehrmaliges Verladen nichts würden anhaben können.
Einige Liederbücher mit Gitarrenakkorden hatte er ebenfalls entdeckt und gekauft – ein kleiner Luxus, der sich nun bezahlt machte, da das Üben dieser Melodien ein angenehmer Zeitvertreib war. Zudem lernte er dadurch, sich nicht stören zu lassen von dem Publikum, das sich unweigerlich um ihn versammelte, wenn er an Deck übte.
Malachi verbannte jegliche Gedanken an seine Mutter, die ihm sehr fehlte. »Sie und Ihre Schwestern sind Waisen, wenn ich richtig informiert bin?« Es war eher höfliche Konversation als echtes Interesse.
»Ja.«
Auf ihrer Miene war eine solche Pein abzulesen, dass er beinahe mitten im Tanz stehengeblieben wäre. Was war geschehen, das sie so verletzt hatte?
Der Tanz führte sie voneinander fort und er fand sich einer anderen Partnerin gegenüber wieder, dann einer weiteren: freundlich lächelnde Frauen jeden Alters. Er mühte sich redlich, sich mit einer jeden zu unterhalten, wünschte jedoch, er hätte bei seiner ersten Partnerin bleiben und weiter mit ihr reden können.
Doch kaum hatten sie wieder zueinandergefunden, endete der Tanz, und er musste Miss Michaels zurück zu der mürrisch starrenden alten Nonne bringen. Aus reinem Mutwillen flüsterte er: »Soll ich Ihre kleine Schwester als Nächste zum Tanz bitten?«
Das strahlende Lächeln, das sie ihm daraufhin schenkte, machte ihm erst bewusst, wie hübsch sie wäre, hätte sie vernünftige Kleider und wäre glücklich – auch wenn sie im Augenblick etwas zu dünn wirkte, als hätte sie in letzter Zeit nicht genug zu essen bekommen.
»Oh, Mr Firth, das wäre fantastisch. Mara würde sich unheimlich freuen.«
Und so wandte er sich dem schmalen Kind zu, das seiner Schwester so ähnlich sah, nur kleiner und noch zierlicher, und bat um das Vergnügen des nächsten Tanzes. Seine Belohnung war ein schüchternes Lächeln, während sie vortrat, um seinen Arm zu ergreifen.
Schwester Catherine trat neben Ismay und sah mit ihr zu, wie der junge Mann Mara die Schritte beibrachte. »Ein angenehmer junger Mann, wie mir scheint. Hast du den Tanz genossen?«
»Ja, sehr.«
»Ich habe früher auch gern getanzt.«
Verblüfft starrte Ismay sie an. »Wirklich?«
Schwester Catherine lachte auf. »Ich war nicht immer Nonne, weißt du?« Dann wurde ihr bewusst, dass sie wieder gelacht hatte, was ihr einen weiteren Tadel einbringen würde. Die Ehrwürdige Mutter hatte sie schon reichlich getadelt, seit sie an Bord gekommen waren. Streng war sie schon immer gewesen, jedoch nie so übellaunig. Tatsächlich wirkte sie angeschlagen, ihre Gesichtsfarbe war teigig und ihre Augen wie von Schmerzen verschattet. Vielleicht rührte daher ihre schlechte Laune.
Was es auch sein mochte, es machte das Zusammenleben mit ihr sehr schwer.
* * *
Jene Worte, die sie so achtlos zu Ismay gesagt hatte, hallten später in ihrer Koje noch lange in Schwester Catherines Kopf nach. Schlaflos lag sie auf der schmalen Pritsche über ihrer schnarchenden Mutter Oberin, während ihr Magen knurrte.
Ich war nicht immer Nonne.
Geboren war sie als Eleanor Caldwell, und ihrer Sprache war noch immer eine Spur der Wurzeln anzuhören, die sie mit dem jungen Mr Firth und einigen anderen Passagieren aus Lancashire teilte. Manchmal fehlte ihr Lancashire furchtbar, selbst jetzt noch. Besonders ihr Heimatdorf – die langsame Sprechweise der Bewohner, die ordentlichen kleinen Häuser aus goldgelbem Sandstein, die wogenden Hochmoore und ihr Vater, allem voran ihr Vater, der teuerste Freund und Gefährte, den ein Mädchen sich nur wünschen konnte. Sie hatte Heiratsanträge abgelehnt, weil sie ihn nicht hatte verlassen wollen – für so etwas bliebe später noch genug Zeit, hatte sie geglaubt. Es war sein plötzlicher Tod, der sie ins Kloster hatte flüchten lassen – aus den falschen Gründen, wie sie nun wusste. Doch sie arbeitete hart daran, die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie eingegangen war, indem sie sich dem Leben im Glauben verschrieben hatte. Noch stand ihr finales Gelübde aus, und die Mutter Oberin daheim in Irland hatte ein ernstes Gespräch darüber mit ihr geführt, ehe sie Catherine nach Australien geschickt hatte.
»Bisweilen macht es den Eindruck, als seien Sie nicht ganz ... überzeugt«, hatte sie gesagt.
»Oh, aber das bin ich!«, hatte Catherine protestiert.
»Nun, auf der langen Reise werden Sie sich gründlich damit auseinandersetzen können, wie Ihre Zukunft aussehen soll. Sollten Sie auch nur den geringsten Zweifel haben – egal wie klein –, warten Sie noch etwas ab, ehe Sie endgültig die Profess ablegen.«
Dieser Rat war ein Fehler, den nur eine Frau hatte begehen können, die noch nie eine so lange Reise erlebt hatte. Schon nach wenigen Tagen an Bord, umgeben von Menschen, die zum Großteil nicht einmal katholisch waren, hatten sich rebellische Gedanken in Catherines Kopf geschlichen. Tausende kleine Dinge erinnerten sie an das Leben, das sie hinter sich gelassen hatte, zudem gab es kleine Kinder und Babys. Sie hatte vergessen, wie entzückend Kinder waren, und ertappte sich immer wieder dabei, wie sie verstohlen hinübersah und sich danach sehnte, mit ihnen zu schmusen, wie sie einst mit den Kindern ihrer Cousine geschmust hatte.
Reglos lag sie da, doch in ihrem Kopf herrschte ein Chaos von Gedanken und Erinnerungen. In Irland hatte ihre vertraute tägliche Routine sie gefordert, ihr jedoch auch Frieden geschenkt. Diese Überfahrt zu dem Konvent in Australien hatte schon jetzt ihr hart erarbeitetes inneres Gleichgewicht erschüttert, und langsam wurde ihr klar, dass die Ruhe, die sie mit solchem Stolz erfüllt hatte, nur ein Triumph des Willens über ihr Temperament war, doch kein Zeichen wahren inneren Friedens.
Hätte sie nur nicht ausgerechnet mit Mutter Bernadette reisen müssen! Von allen uneinsichtigen Menschen war ihre derzeitige Vorgesetzte die schlimmste: engstirnig, altmodisch und absolut überzeugt, sie allein wüsste am besten, was ihr strenger Gott von ihr und ihren Schützlingen erwartete. Und sollte Catherine ihr finales Gelübde ablegen, wäre es Mutter Bernadette, der sie in Australien unterstehen würde – bis zu dem Tag, an dem eine von ihnen starb.
Für eine Nonne sollte das keine Rolle spielen – doch für sie tat es das immer mehr.
Schon nach wenigen Wochen in dieser winzigen Kabine gerieten sie ständig aneinander. Die frische Seeluft war herrlich, das Essen an Bord einfach, aber reichhaltig. Doch als Catherine nach den vielen Stunden an Deck einen größeren Appetit entwickelt hatte, war die ehrwürdige Mutter empört über ihre angebliche Völlerei gewesen und hatte sie angewiesen, weniger zu essen.
Catherines Protest hatte ihr einen direkten Befehl eingebracht, eine Woche lang auf das Abendessen zu verzichten – als Buße für ihre »Widerspenstigkeit und Gier«.
War es nun schon eine Sünde, sich satt zu essen? Das mochte Catherine nicht glauben, obgleich sie ihrer Vorgesetzten selbstverständlich gehorcht hatte. Wieder knurrte ihr Magen, als sie in der schmalen Koje eine bequemere Position zu finden versuchte. Seufzend sagte sie in Gedanken eine Reihe von Gebeten auf – ein vergeblicher Versuch, sich von ihrem Hunger abzulenken.
Es funktionierte einfach nicht. Sie konnte noch immer nicht schlafen.
* * *
Hinter seiner gut gelaunten Fassade war der Schiffsarzt ein aufmerksamer Menschenkenner und sorgte sich um diese Waisenmädchen, seit er sie zum ersten Mal zu Gesicht bekommen hatte. Als er erfahren hatte, dass zwei von ihnen gegen ihren Willen an Bord gebracht und eingeschlossen worden waren, bis das Schiff abgelegt hatte, war ihm das sauer aufgestoßen. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er das niemals zugelassen.
Je länger Arthur Greenham das Grüppchen beobachtete, desto größer wurde seine Sorge. Die meisten der Mädchen wirkten völlig verschüchtert, und die Mutter Oberin war eine selbstgerechte Tyrannin, Nonne hin oder her. Bevor er in dieser Angelegenheit etwas unternahm, hatte er allerdings erst einmal für geregelte Abläufe auf dem Schiff sorgen wollen, was reichlich Aktivitäten und Unterrichtsangebote für die Zwischendeckspassagiere beinhaltete. Dann hatte es eine schwierige Geburt gegeben, die er – wenn er sich einmal selbst loben durfte – gut gehändelt hatte, sodass sowohl Mutter als auch Kind nun wohlauf waren.
Endlich hatte er in einem ersten Schritt die Schwestern dazu bewegt, die Mädchen an den Tanzabenden teilhaben zu lassen, die bei gutem Wetter dreimal wöchentlich stattfanden. Am Ende des Abends hatte er mit Befriedigung festgestellt, dass die Mädchen ausnahmsweise etwas Farbe in den Wangen hatten. Er wünschte nur, er könnte dasselbe auch von der Jüngeren der Nonnen sagen, die deutlich angespannt wirkte.
Am folgenden Abend begab er sich auf eine seiner Inspektionsrunden ins Zwischendeck, um das Essen zu begutachten und sich zu vergewissern, dass die Messkapitäne es gerecht verteilt hatten. Als er an dem langen Tisch im Ledigenquartier der Frauen vorbeikam, sah er die jüngere Nonne ohne Teller dasitzen und hielt inne. Warum aß sie nichts? Brütete sie etwas aus? Ein wenig blass sah sie heute aus, mit dunklen Schatten unter den Augen. Auf See musste man jegliche Anzeichen einer möglichen Erkrankung mit Argusaugen beobachten.
Als die junge Frau, die den Nachtisch austeilte, der Nonne eine Portion anbot, ging die verdammte alte Krähe dazwischen.
»Schwester Catherine isst heute Abend nichts.«
»Gestern Abend haben Sie auch schon nichts gegessen. Geht es Ihnen nicht gut?«, erkundigte das Mädchen sich in aller Unschuld.
»Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten und teilen Sie Ihr Essen woanders aus!«, fuhr die Mutter Oberin sie an.
Arthur wartete, bis das Mahl vorüber war, dann ließ er die jüngere Nonne zu sich rufen. Die Ältere begleitete sie – verflucht sollte sie sein.
»Soweit ich mich entsinne, habe ich nur Ihre Kollegin um ein Gespräch gebeten, nicht Sie«, sagte er verärgert.
»Das wäre unangebracht. Sie sind ein Mann.«
»Vor allem aber bin ich Arzt und werde wohl kaum in Hörweite von vierhundert Menschen über meine Patientinnen herfallen!«
Der Alten stieg die Röte ins Gesicht, doch sie sagte nichts. Irgendwann wich das Blut wieder aus ihren Wangen, die Nonne allerdings blieb.
Er wandte sich der Jüngeren zu. »Ich habe mit Sorge beobachtet, dass Sie heute Abend nichts gegessen haben, Schwester. Geht es Ihnen nicht gut?«
»Schwester Catherine kasteit sich diese Woche und nimmt deshalb am Abendessen nicht teil«, erklärte die Mutter Oberin. »Wir pflegen nicht der Völlerei zu frönen.«
Mit verengten Augen musterte er ihre selbstgerechte Miene. »Schließt das auch Wasser mit ein?«
»Ja, natürlich.«
»Ich fürchte, dem muss ich einen Riegel vorschieben.«
Sie richtete sich auf. »Das geht Sie nicht das Geringste an.«
»Und ob es mich etwas angeht. Ich bin verantwortlich für das Wohlergehen sämtlicher Passagiere, Sie und Schwester Catherine eingeschlossen. In derart warmen Gefilden ist es gefährlich, nicht ausreichend Wasser zu trinken, und unsere mitgeführten Vorräte sind noch frisch und rein.« Er hatte persönlich die Auswahl der Fässer und deren Befüllung überwacht und hielt zudem die Besatzung stets an, Regenwasser aufzufangen, wann immer es möglich war.
»Mir geht es gut, Doktor, wirklich«, sagte Catherine hastig, um nicht noch weiter in diese Auseinandersetzung zwischen zwei Erzfeinden hineinzugeraten. Heute hatten sie alle unter der Laune der Mutter Oberin gelitten – vermutlich weil der Arzt gestern ihr Tanzverbot für nichtig erklärt hatte.
»Unsere religiösen Praktiken sind allein unsere Angelegenheit, Doktor«, zischte die Alte und erhob sich. »Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns nicht noch einmal grundlos hierher zitieren.«
Arthur sprach noch einmal die jüngere Nonne an. »Wenn Sie weiterhin nichts zu sich nehmen, werde ich Sie auf die Krankenstation bringen lassen, bis Sie wieder essen.« Was seine Autorität ein wenig überstieg, doch schließlich diente es einer guten Sache.
Die Alte holte scharf Luft, behielt ihren Zorn jedoch für sich.
Als er sie nun ansah, bemerkte er besorgt ihre ungesund gelblich-weiße Gesichtsfarbe, auch wenn ihre Wangen im Augenblick dunkelrot überhaucht waren. »Ehrwürdige Mutter, das Leben auf See unterscheidet sich sehr vom Leben an Land, und ich kann nicht zulassen, dass unsere Passagiere durch gefährliche Praktiken ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Auf einer langen Seereise gilt es, bei Kräften zu bleiben, statt sich auszulaugen, denn es gibt schon genug andere Gefahren.«
Herausfordernd starrten sie einander an, bis sie nach langem Ringen den Blick senkte. »Dann werde ich eine andere Möglichkeit zur Sühne für meine Schwester finden.«
»Was hat sie denn getan, dass Sie sie bestrafen müssen?«
»Sie war ungehorsam. Das sollte selbst für Sie nachvollziehbar sein.«
»Bitte lassen Sie die Angelegenheit jetzt ruhen, Dr. Greenham«, murmelte Catherine. »Ich muss meiner Mutter Oberin Folge leisten.«
»Solange Sie vernünftig essen und trinken, ist alles andere Ihnen überlassen«, antwortete er sanft. »Aber das Wohlergehen jedes einzelnen meiner Passagiere liegt mir sehr am Herzen, deshalb werde ich auch Ihre Gesundheit nach bestem Wissen und Gewissen im Auge behalten.«
»Wenn Sie dann fertig sind, Doktor?«, ging die Mutter Oberin dazwischen. Als er nickte, verließ sie mit unheilverkündender Miene als Erste den Raum. Sobald sie außer Hörweite waren, blaffte sie Catherine an. »Haben Sie ihm gegenüber irgendetwas von der Buße erwähnt, die ich Ihnen auferlegt habe?«
»Natürlich nicht.«
»Nun, Sie nehmen wohl besser wieder am Abendessen teil, aber nur, um seiner diensteifrigen Einmischung ein Ende zu machen. Stattdessen können Sie jeden Abend einen vollen Rosenkranz beten.«
Catherine bemühte sich, diese Anweisung in ihrem Herzen zu akzeptieren, doch es wollte ihr nicht gelingen, denn die Strafe würde ermüdend sein und erschien ihr noch immer überzogen. Da sie jedoch Gehorsam gelobt hatte, folgte sie der eckigen Gestalt ihrer Mutter Oberin zurück auf den Teil des Decks, den ihre kleine Gruppe sich auserkoren hatte. Wieder einmal fragte sie sich, wie sie das Leben in Australien unter dem Befehl dieser Frau ertragen sollte.
3
Oktober – November 1863
Auch wenn die Nonnen einander beim Umziehen nicht ansehen sollten, konnte Catherine einige Tage nach dem Gespräch mit dem Arzt nicht umhin, zu bemerken, dass die Mutter Oberin am Morgen Mühe hatte, aus dem Bett zu kommen. Als die ältere Nonne stöhnend in ihre Koje zurücksackte, ging Catherine neben ihr auf die Knie. »Stimmt etwas nicht?«
»Geht mir ... nich' gut. Kümmern Sie ... Frühstück. Passen Sie auf ... Mädchen ... b'nehmen.«