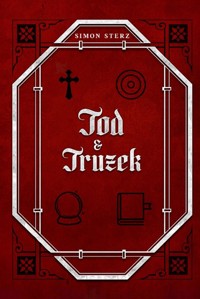
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Spätsommer des Jahres 1880 stehen vier Frauen in der deutschen Kleinstadt Mangerfeld vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Anfangs kaum merklich, dann jedoch immer rasanter, verflechten sich die Schicksale von Fabrikarbeiterin Frieda, Kindermädchen Emilie, Krankenschwester Mathilde und Bibliothekarswitwe Agnes untrennbar miteinander – und schließlich mit dem Schicksal der ganzen Stadt. Dabei sind die Vier mal Verbündete, mal erbitterte Feindinnen, mal Hindernisse, mal Helferinnen. Bei allen großen und kleinen Unterschieden prägt sie alle aber zweierlei: der Tod und Fabrikbesitzer Herr von Truzek
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simon Sterz
Tod & Truzek
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar.
© 2025 -Verlag, Altheim
Umschlag: Germancreative
Sprache und Text, Stefan Katgeli, 63811 Stockstadt am Main
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Für Dietmar
Teil I
Friederike I
E
s war nicht leicht, Frieda aus der Ruhe zu bringen.
Das Donnern der Maschinen, die niederhagelnden Hammerschläge und die Rufe der anderen Arbeiter machten es ihr schwer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, und doch hing ihr Leben in gleich zweierlei Hinsicht davon ab:
Damit das erhitzte und vorgeformte Metall am Ende eine möglichst makellose Schiene ergab, musste sie sicherstellen, dass es nicht zu heiß war und die Walzen keinen zu hohen Druck ausübten. Die gewaltige Maschine, an der sie stand, mochte über enorme Kraft verfügen, aber ihr Verstand, der war Frieda.
Seit sie vor einem knappen Jahr den heimischen Schweinehof verlassen und zu ihrem Bruder Karl nach Mangerfeld gezogen war, hatte sie schon tausende Schienendurchläufe mitgemacht. Niemand wusste so gut wie sie, welchen Farbton das Metall an genau dieser Stelle haben musste – und welchen es noch haben durfte. Eine unbemerkte Abweichung hätte bestenfalls eine unbrauchbare Schiene, schlimmstenfalls eine beschädigte Walze zur Folge. In jedem Fall aber Friedas sofortige Entlassung.
Die Walzerin wurde von einem Hilfsarbeiter angerempelt, der durch die überfüllte Werkshalle eilte. Sie konnte gerade noch ihren Instinkt unterdrücken, an der Walze vor ihr Halt zu suchen. Bei aller Konzentration auf die weiß-gelben Farbverläufe des glühenden Metalls, durfte sie sich auch nicht zu sehr darin verlieren. Denn im Gegensatz zu den abgeriegelten Stallboxen bei der Schweineschlachtung stand sie hier frei. Ein einziger unachtsamer Moment genügte, und sie würde den fatalen Schritt nach vorn stolpern, der sie unter die Walze befördert hätte.
Die Maschine war nicht nur Kraft ohne Verstand, sondern auch ohne Seele, ohne Erbarmen. Früher oder später wurden sie alle von ihr zermürbt, ob man nun sprichwörtlich oder buchstäblich von ihr zermalmt wurde. In diesem Punkt war sie dem Fabrikbesitzer, Herrn von Truzek, sehr ähnlich.
Frieda erinnerte sich noch gut an den Tag, an dem sie das wirklich verstanden hatte. Wann immer sie einen kurzen Blick auf den Boden rechts neben sich warf, sah sie im Geiste ihren damaligen Nebenmann Albert vor sich. Wie er dort gelegen hatte und ausgeblutet war. Dann glaubte sie wieder zu spüren, wie sich ihre Kleidung mit dem Blut aus seinem Armstumpf vollsog, während sie ihn hilflos im Arm gehalten hatte.
Keine halbe Stunde hatte die Walze danach stillgestanden. Den Rest des Tages hatte Frieda zitternd neben einer oberflächlich weggewischten Blutlache arbeiten müssen, deren Verfärbung im Boden sie auch jetzt noch manchmal zu sehen glaubte.
Dieser Vorfall war das letzte Mal gewesen, dass Frieda aus der Ruhe gebracht worden war. Sofort hatte sie erkannt, dass der Blutverlust zu groß war, um Albert retten. Doch so wie das erste Schwein, dass sie als junges Mädchen mit einem gezielten Stich ins Herz hatte abstechen müssen, hatte sie auch ihren Kollegen mit aller äußerlichen Ruhe, die sie aufbringen konnte, in den Tod begleitet.
Heute, am achtzehnten August achtzehnhundertachtzig, wurde sie wieder aus der Ruhe gebracht. Denn es blieb nicht bei dem einen Hilfsarbeiter, der sie mit seiner Rempelei fast unter die Walze befördert hätte. Weitere Arbeiter rannten an ihr vorbei, und es fiel ihr immer schwerer, ihren festen Stand zu wahren.
Schließlich riss ein durchdringender Schrei Frieda endgültig aus der Konzentration. Besorgt wandte sie den Blick in Richtung des Transportbereichs, wo die erhitzten Werkstücke im Anschluss an einen groben Vorformungsprozess an einem Kranarm befestigt wurden, der sie zu den Walzen trug. Von einer inneren Unruhe ergriffen trat die Walzerin einen Schritt zurück und suchte ihren Bruder Karl. Als sie ein anderes Gesicht als das seine schmerzverzerrt in der Menge fand, atmete sie erleichtert auf. Der Mann hatte sich offenbar beim Befestigen der glühenden Metallstange verbrannt, winkte aber bereits ab. Sofort hob der Kranarm das weiß-glühende, meterlange Metallstück über die Köpfe der Arbeiter und begann sich zu drehen.
Frieda wollte sich schon wieder ihrem Schienenabschnitt zuwenden, als ein Hilfsarbeiter über das allgemeine Getöse hinweg rief: »Halt! HALT!«
Seinem ausgestreckten Zeigefinger mit den Blicken folgend, erkannte die Walzerin, dass einer der beiden Haken nicht ordnungsgemäß am klobigen Werkstück befestigt war. Sollte er bei der Bewegung abrutschen, würde das glühend heiße Metall wie die Sense des Schnitters durch die Arbeiterschar fegen.
Frieda verfolgte das Geschehen wie versteinert. Sah zu, wie der alarmierte Maschinenführer den Kran stoppte, während die anderen Hilfsarbeiter und Arbeiter versuchten, dem Gefahrenbereich zu entkommen.
Durch das abrupte Anhalten des Krans rutschte das Werkstück tatsächlich von einem der Haken. Das glühende Metall sauste hinab durch die Menge, die auseinanderstob und sich zu Boden warf. Frieda stand noch immer reglos da, wie das Kaninchen vor der Schlange, während das verhängnisvolle Pendel auf sie und ihre Walze zu rauschte. Unfähig, etwas anderes zu tun, sandte sie ein Stoßgebet zum Himmel, dass das heiße Eisen sie verschonen möge.
Da bemerkte Frieda, dass es außer ihr noch einen weiteren Arbeiter gab, der sich nicht zu Boden geworfen hatte. Stattdessen hob er die Arme, um das glühende, schwingende Metall abzufangen, und im Augenblick des Aufpralls übertönte ein entsetzliches Bersten und Zischen für einen kurzen Moment allen Lärm in der Fabrik. Knochen wurden zertrümmert, Haut und Fleisch durch die Kleidung hindurch verbrannt. Einen Moment lang stand der Arbeiter da wie ein tapferer Zinnsoldat, das meterlange Werkstück ein mit ihm verschmolzenes Gewehr in die Höhe gereckt. Dann kollabierte er und riss die unfertige Schiene mit sich hinab.
Emilie I
W
enn sie lautlos durch das Heckenlabyrinth schlich, die Hände ineinander verschränkt, die Zeigefinger zum Pistolenlauf nach vorn gestreckt, bekam Emilie eine Ahnung davon, wie sorglos ihre eigene Kindheit hätte verlaufen können. Auch jetzt noch stellte Sorglosigkeit eine kostbare Seltenheit dar.
Es raschelte leise hinter ihr. Sie drehte sich um, doch Willi war nirgends zu sehen.
Sie kam zur Familiengruft der von Truzeks, in welcher der alte Fabrikant Weber bestattet war. Der Weg, der hierher führte, war gut einsehbar und fast zwei Meter breit. Rannte sie hinüber, wäre Emilie einige Sekunden lang ohne Deckung.
Sie sprintete los.
»Peng, peng!«, rief der kleine Willi, sprang hinter einer Hecke hervor und lachte begeistert. Mit unendlicher Geduld musste der sechsjährige Spross der von Truzeks ihr aufgelauert haben. »Du bist tot!«
Emilie verzog schmerzverzerrt das Gesicht und fasste sich an die Schulter. »Noch nicht, Cowboy!«
Willi kreischte und rannte zurück ins Labyrinth.
Er liebte es, Cowboy und Indianer zu spielen. Als sein Großvater einmal von einer Reise nach Amerika zurückgekehrt war, um mehr über Schienenproduktion zu lernen, hatte er für seinen Enkel die abenteuerlichsten Geschichten mitgebracht.
Die daraus erwachsene Liebe zu fantasievollen Geschichten, die Großvater Ernst ihm eingepflanzt hatte, war dem kleinen Jungen erhalten geblieben. Oft, wenn Emilie ihm eine Geschichte vorlas, unterbrach er sie, weil er sie selbst weitererzählen wollte. Meist konnte sie sich darauf einlassen, und dann sponnen sie gemeinsam die fantastischsten Geschichten.
So einen wie Willi hätte Emilie damals im Waisenhaus auch gebraucht.
Auf Zehenspitzen folgte sie den Schrittgeräuschen des Jungen, bis sie ihn nicht mehr hörte. Vorsichtig lugte sie um die Ecke, damit er sie nicht wieder überraschte.
Die Anstellung bei den von Truzeks war ein größeres Glück als Emilie sich je erträumt hätte. Und dass sie Willi die Abenteuer bescheren konnte, die ihr selbst verwehrt geblieben waren, gehörte sicher zum Besten. Willis Eltern waren in der Regel zu beschäftigt, um sich um ihn zu kümmern, sodass Emilie nicht nur Spielpartnerin, sondern vor allem Hauslehrerin, Erzieherin und Trösterin für ihn war. Trotzdem galt der Hausherrin, Augusta von Truzek, Emilies ganze Bewunderung, dafür, dass sie schier grenzenlose Freiheit erreicht hatte. Die Frau des Fabrikanten war wahrlich die Herrin ihres Schicksals.
Da. Emilie hörte Schritte, die rasch näher kamen. Diesmal würde sie ihn zuerst erwischen.
Er musste nun ganz nah sein. Emilie hielt den Atem an und rührte sich nicht.
Kurz vor der Biegung verstummten die Schrittgeräusche.
Mit einem Satz sprang Emilie aus der Deckung, streckte die rechte Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger nach vorn und rief: »Peng, Peng!«
Doch sofort wich alles Blut aus ihrem Gesicht.
Vor ihr stand nicht Willi, sondern die pikiert dreinblickende Hausherrin, Frau von Truzek.
»Wir müssen reden«, sagte sie streng.
Mathilde I
E
in sanftes Lächeln legte sich auf Matryonas Lippen, als ihre Finger das purpurne Tischtuch streiften. Jedes Mal, wenn sie so da saß und in die Augen einer Kundin schaute, fühlte sie sich an ihre Großmutter erinnert.
Wie oft hatte sie selbst auf ähnliche Weise dagesessen, die Nase vom Duft der Räucherstäbchen erfüllt, das Gesicht ihres Gegenübers nur vom glimmenden Schein einer Kohlenpfanne erhellt. Bis vor drei Jahren allerdings auf der anderen Seite des Tisches.
»Darf ich Sie beim Vornamen nennen, Frau Huber?«, fragte sie sanft, um die ängstlich umherhuschenden Blicke der mit hängenden Schultern vor ihr sitzenden Arbeiterin einzufangen.
Frau Huber nickte. »Henriette«, sagte diese leise.
Matryona lächelte. »Ich bin Matryona«, antwortete sie.
In Gesprächen wie diesen kam es ihr ehrlicher vor, ihren Geburtsnamen zu verwenden. Tagsüber war sie stets Mathilde, doch, wenn sie hier saß, umgeben von ihrer Vergangenheit, war sie ganz Matryona.
Zwei Seelen in einer Brust. Die alte und die neue. Das Medium und die Krankenschwester. Madam Matryona und Schwester Mathilde.
»Wenn du bereit bist, kannst du mir gern erzählen, warum du hier bist, Henriette«, sagte Matryona. Sie hob den Blick, um ihr Gegenüber nicht mit übermäßigem Starren zu beunruhigen, und betrachtete die schweren, dunklen Laken, die die Wände des Raumes zierten. Auf einige von ihnen hatte sie goldene Symbole gestickt, die sie an ihre Familie erinnerten.
»Mein Mann ist … Er ist gestorben«, sagte Henriette erstickt. »Ein Unfall in der Fabrik.«
Matryona nickte. »Ich habe davon gehört. Schrecklich.«
Henriette weinte leise.
Wie beiläufig legte Matryona die Hand auf den Tisch. Manche Kunden ergriffen sie dankbar, doch viele redeten lieber leise in sich hinein, als wollten sie ausblenden, dass Matryona da war.
»Wir … wir haben vier Kinder, wissen Sie?« Henriette lächelte kurz ein wenig beschämt und berichtigte sich: »Weißt du?«
»Sicher vermissen auch sie ihn«, vermutete Matryona und spürte, wie das Leid ihres Gegenübers allmählich auf sie überging. »Möchtest du mir von euren Kindern erzählen?«
»Zwei Buben haben wir, und zwei Mädchen«, fing Henriette an. Schüchtern lächelnd schaute sie zu dem Medium auf. »Josef, der Älteste, ist nach meinem Mann benannt. Er ist … ihm auch sonst recht ähnlich.« Ein Schluchzer entwich ihr, und sie zitterte.
Matryona bewegte kurz ihre Hand auf dem Tisch, die ihr Gegenüber daraufhin dankbar ergriff.
»Klara und Anna, die beiden braven Mädchen«, fuhr Henriette fort. »Tüchtig sind sie. Klara mehr als Anna.« Sie lachte leicht, während ihr eine Träne die Wange hinabfuhr. »Dafür ist Anna geduldiger.«
Matryona nickte.
»Otto … unser kleiner Otto ist erst sechs.« Unerwartet fest presste die Arbeiterin die Hand des Mediums, das einen überraschten Schmerzensschrei gerade noch unterdrücken konnte. »Er … er ist ein lieber Junge, aber…«
Sie begann zu weinen, und der Griff um Matryonas Hand entspannte sich.
Als Henriette nach einer ganzen Weile noch immer nicht weitergeredet hatte, sagte Matryona schließlich: »Du musst nicht weiter über Otto reden, wenn es dich zu sehr bedrückt.«
»Doch, das muss ich«, entfuhr es der Arbeiterin trotzig und unter Tränen. »Otto …« Sie blickte zu Boden. »Otto ist nicht Josefs Kind. Er … er wurde … ich wurde…« Sie ließ ihren Tränen freien Lauf.
Matryona legte ihre andere Hand ebenfalls auf den Tisch, die sofort dankbar ergriffen wurde, und schaute Henriette mit geduldigem Lächeln an.
Erst, als sich ihre Kundin wieder beruhigt hatte, sagte Matryona: »Ich verstehe schon. Das war sicher nicht leicht.«
»Josef wusste nichts davon«, sagte Henriette schnell und mit schamroten Wangen. »Ich … ich wollte nicht, dass er deswegen eine Dummheit macht.«
Matryona nickte. »Er hat ihn geliebt wie seinen eigenen Sohn«, bekräftigte sie.
»Das hat er«, presste Henriette hervor. »Sie alle hat er geliebt.«
Liebevoll strich Matryona mit den Daumen über die Handrücken ihres Gegenübers, so, wie ihre Großmutter das damals bei ihr getan hatte, wenn die Tränen kein Ende nehmen wollten.
Nachdem sie eine Weile gemeinsam geschwiegen hatten, ergriff Henriette wieder das Wort. »Du hast gefragt, warum ich hier bin«, flüsterte sie. »Sie sind der Grund: meine Kinder.« Die Arbeiterin holte tief Luft und richtete sich ein wenig auf, blickte Matryona sogar gelegentlich direkt an. »Ich habe eine Schwester in Amerika: Doris. Ich möchte mit den Kindern dorthin gehen, neu anfangen. In ihren Briefen klingt es so, als hätte sie es dort sehr gut.«
Matryona nickte und lächelte sanft. Es war nicht ungewöhnlich, dass Kunden zu ihr kamen, die ihre Entscheidung bereits getroffen hatten, aber noch Bestätigung suchten.
»Ich …«, fuhr Henriette fort. »Ich möchte wissen, was … Josef dazu zu sagen hat.« Unwillkürlich schaute sie nach oben.
Matryonas Lächeln verbreiterte sich wissend. Der Blick nach oben war eine Folge der Redewendung, dass jemand ›in den Himmel auffährt‹, und verriet, wo ein Kunde den Verstorbenen vermutete.
»Aber …«, setzte Henriette an und wandte den Blick wieder ab, »ich weiß nicht, ob ich … ob ich alle mitnehmen kann.«
Der Schmerz ihres Gegenübers versetzte auch Matryona einen Stich. Henriettes Plan war gut – eine bessere Alternative als den meisten kinderreichen Witwen in Aussicht stand. Doch das Medium verstand, dass die Arbeiterin nicht nur für eine Bestätigung, sondern für Hilfe bei einer unendlich schweren Entscheidung gekommen war.
»Zwei kann ich sicher mitnehmen«, flüsterte Henriette. »Vier wohl nicht.« Beklommen blickte sie zu Boden. »Sollte ich … soll ich dann ganz hierbleiben?«
Eine schlechte Idee, dachte Matryona sofort. Hier erwartete die Familie nur Elend, in dem einer nach dem anderen umkommen würde. Die Kinder würden in der Fabrik oder bei anderen Arbeiten ein frühes Ende finden, und Henriette würde sich vor lauter Schuldgefühlen darüber innerhalb weniger Jahre zu Tode arbeiten.
Doch auf so direkten Rat hörte niemand. Deshalb sagte Matryona stattdessen: »Ich verstehe jetzt, warum du hergekommen ist. Wenn du möchtest, kann ich Josefs Rat einholen. Hier, zu uns.«
Mit großen Augen schaute die Witwe sie an. »Und… und er kann mir dann wirklich helfen?«, fragte sie.
Matryona nickte. Das war eine Lüge, aber eine, die ihrem Gegenüber endloses Leid ersparen würde. Lieber ein neues Leben in Amerika als aus Angst hier zugrunde gehen.
»Ich kann meine Hände zur Verfügung stellen, damit er durch sie schreiben kann«, sagte das Medium sanft und strich Henriette ein letztes Mal mit den Daumen über die Handrücken. Dann stand es auf und holte Papier und einen Bleiweißstift aus dem Regal hinter sich.
»Gibt es ein Lied oder eine Melodie, die euch zwei verbindet? Oder eine Geschichte, die er besonders gern mochte? Damit wir ihn rufen können. Damit er weiß, dass er hier, bei uns, gebraucht wird.«
»Vielleicht ›Ein Prosit der Gemütlichkeit‹«, sagte Henriette und lächelte ein wenig beschämt. »Dabei haben wir uns das erste Mal angesehen und gewusst, dass wir füreinander bestimmt sind.«
Matryona lächelte. »Das kenne ich gut. Lass es uns summen, bis er kommt. Erschrick dann nicht, wenn meine Hände anfangen, zu schreiben.«
Henriette nickte verunsichert, worauf das Medium leise zu summen begann. Matryona lehnte sich entspannt zurück, schloss die Augen und lauschte der eigenen Melodie.
Irgendwann hörte sie, wie Henriette mit einstimmte. Erst kaum hörbar, bis ihr Summen schließlich bis zu Matryonas Lautstärke angeschwollen war.
So summten sie eine ganze Weile gemeinsam die vertraute Melodie, immer und immer wieder. Matryona wusste aus eigener Erfahrung, wie wohltuend das war. Das Summen einer bedeutsamen Melodie brachte ihre Kunden dazu, Erinnerungen mit den Verstorbenen noch einmal zu durchleben. Nur so konnte die Trauer wirklich bewältigt werden.
Als Matryona merkte, dass Henriettes Summen immer mehr aus dem Rhythmus geriet, wusste sie, dass der Zeitpunkt gekommen war. Langsam und gleichmäßig hob sie die Hände, während sie die Augen weiter geschlossen und an die Decke gerichtet hielt. Mit der einen Hand griff sie das Papier, mit der anderen ertastete sie den Stift und begann zu schreiben.
Henriette verstummte einen Moment – vermutlich vor Schreck –, stimmte dann aber, sobald der Stift über das Blatt huschte, von Neuem in die Melodie ein.
Als das Medium fertig geschrieben hatte, ließ es abrupt den Stift fallen und richtete sich schlagartig auf. Es keuchte, als hätte es lange die Luft angehalten, und riss die Augen weit auf.
Henriette blickte ängstlich aufs Papier.
In entsetzlich krakeliger Schrift standen dort die Namen ihrer Kinder.
Die Namen der Töchter waren eingekreist. Die werden ihr Trost spenden, dachte Matryona.
Vor ›Josef‹ stand eine verzogene Drei. Der kann seinen Bruder und sich versorgen, oder die Familie unterstützen.
Und vor Otto eine Vier. Die Chance, dass er auf der Reise irgendeiner Krankheit erliegt, ist zu hoch.
Erschöpft schaute sie in Henriettes Augen.
»Danke«, flüsterte diese und nahm mit zittrigen Händen das Papier vom Tisch. »Ich danke dir, Matryona.«
Friederike II
H
erzlichen Glückwunsch, kleiner Bruder«, sagte Frieda und schaute Karl stolz an. »Willkommen im Kreis der Lesenden.«
Damit machte sie eine ausschweifende Armbewegung auf die Bücherregale der Stadtbibliothek, wie eine Zirkus-Direktorin, die zum Eintreten auffordert.
Die Eintrittskarte lag noch vor ihm: ›Otto’s Lesebuch‹, von Doktor Friedrich Wilhelm Otto.
Sie lächelte zufrieden und nickte Karl kurz zu, auch wenn es nicht so war, wie sie es sich vorgestellt hatte.
Als sie ihn vor einem Jahr dazu überredet hatte, ihm das Lesen beizubringen, hatte sie gedacht, es würde aus ihm einen Verbündeten machen, mit dem sie in andere Welten abtauchen konnte, um die eine, echte Welt, in der sie beide nur kleine Zahnrädchen waren, eine Weile zu vergessen. Doch Karl hatte sich nie zu erdachten Geschichten, sondern stets zu Sachbüchern hingezogen gefühlt.
»Ein Jammer, dass ich nicht früher verstanden habe, was Lesen bedeutet«, sagte Karl und riss seine Schwester damit aus ihren Gedanken. »Das hätten unseren Eltern sicher einiges Geld für den Hauslehrer erspart, der es mir unwilligem Knaben ja doch nicht beibringen konnte.«
Frieda lächelte traurig, als sie daran dachte, wie wenig Beachtung ihre eigenen Lernerfolge gefunden hatten. Dann aber wandte sie sich Karl zu und sagte versöhnlich: »Besser spät als nie.«
Karl lachte. »Und selbst wenn nicht, sollte das Geld, das wir jeden Monat Mutter und Vater senden, das inzwischen mehr als aufgewogen haben.«
Doch im Gegensatz zu Karl fiel es Frieda noch immer schwer, ihre Schuldgefühle darüber, den heimischen Hof verlassen zu haben, abzuschütteln. Sie fragte sich, ob ihre seit dem Unfall wachsende Unruhe auch daher stammte, dass sie sich trotz des Umzugs nach Mangerfeld alles andere als frei fühlte. Denn wenn sie auch eigentlich nichts daran hinderte, die Arbeit in der Fabrik aufzukündigen, so würde ihr dann wohl keine andere Wahl bleiben als an den heimischen Herd zurückzukehren und den unausweichlichen Untergang des Hofes zu verwalten.
Für ihre Eltern wäre das sicher der beste Weg, vor allem, wenn man bedachte, wie unfähig Karl war, einen Hof zu führen. Vor dieser Möglichkeit war er schon vor Jahren geflohen, und niemand zweifelte daran, dass Frieda den Zuchtbetrieb länger am Laufen halten könnte. Gewiss laneg genug, um ihren Eltern ein bis zu ihrem Lebensende gesichertes Heim zu bieten. Ein ruhiger Lebensabend, in dem Wissen, ein einigermaßen sicheres Auskommen zu haben, den Hof in den guten Händen der Familie zurückzulassen, und mit dem Vertrauen, dass Frieda das schon schaffen würde. Irgendwie.
Im Grunde war es also die reine Selbstsucht Friedas gewesen, Karl nach Mangerfeld zu folgen. Vater und Mutter nicht zu ehren. Nie hatte sie große Pläne gehabt, was sie mit ihrem Leben anfangen wollte. Doch sich als verarmte Bäuerin zu Tode arbeiten, das wollte sie gewiss nicht.
Sie schüttelte sich, um sich selbst aus ihren Gedanken zu reißen.
»Hättest du gedacht, dass wir einmal ein solches Leben haben? Dass du ein Theater besuchen würdest? Selbst in einer Schenke dein Bier trinkst, statt hinter deinem besoffenen Gatten herzuräumen?«, fragte Karl verträumt.
Frieda lächelte. »Nein. Vor allem aber hätte ich nie gedacht, dass sich mein zappliger, kleiner Bruder mal dazu überreden lassen würde, sich von mir das Lesen beibringen zu lassen.«
Da lachte Karl, nahm dann aber die Hand von ihrer Schulter und schaute sie plötzlich ungewohnt ernst an. »Ich wusste gleich, dass ich dir das nicht ausreden könnte. In dir steckt eine Dampfmaschine, die dich immer weiter antreibt. Wenn du dir einmal etwas in den Kopf gesetzt hast, machst du das auch. Das war schon immer so.« Er grinste.
Peinlich berührt wandte Frieda den Blick ab. »Ach, Karl.«
»Es ist mir ernst«, sagte er. »Ich mag hier als Vorarbeiter der Schmiede mein Glück gefunden haben. Meinetwegen müsste sich nichts ändern, trotz aller Beschwerlichkeiten. Aber du, du bist immer noch unzufrieden. Wie der Mann, der dieses Buch geschrieben hat. Euch beide treibt etwas an.«
»Was denn für ein Buch?«, fragte Frieda verwirrt.
»Überraschung«, sagte Karl und grinste. »Ich habe es schon vor einem Monat gekauft, aber du hast mich ja ganz schön zappeln lassen, ehe du mich aus deiner Leseschule entlassen hast.«
»Du … du hast ein Buch für mich gekauft?«, fragte Frieda, die die Rührung in ihrer Stimme nicht ganz verbergen konnte.
Karl nickte feierlich. »Jawohl. Ein Geschenk, zum Dank. Ich muss zugeben, ich verstehe auch jetzt noch kein Wort von dem, was darin steht, aber etwas sagt mir, dass du die Richtige dafür bist. Ich setze darauf, dass du es mir beizeiten erklären kannst, große Schwester.«
»Und wie heißt es?«, fragte Frieda mit offener Neugierde.
»›Das Kapital‹«, antwortete Karl mit verschwörerischem Blick, und holte ein rotes Buch hervor.
Emilie II
E
milies Scham kannte keine Grenzen.
Augusta von Truzek war ihre verehrungswürdige Herrin, die sie aus der Gosse geholt und ihr zu einem Leben verholfen hatte, das sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht hätte ausmalen können. Die Dienerin einer so hohen und feinen Dame zu sein war ein so fernes Glück gewesen, dass Emilie es kaum je zu träumen gewagt hatte – und doch war dieser Traum vor vier Jahren wahr geworden.
Seit vier Jahren lebte Emilie inzwischen als Teil der Familie von Truzek in der Villa Abendroth. Neben ihr leisteten sich die von Truzeks noch eine Köchin und einen Hausmeister, aber so eng wie Emilie war niemand mit der Familie verbandelt. Sie empfand sich gewissermaßen als große Schwester des sechsjährigen Sprosses Wilhelm, dessen Erziehung – neben der allgemeinen Organisation und Verwaltung des Hauses, sowie der Einkäufe – ihre ganze Aufmerksamkeit galt.
Das Oberhaupt ihrer neugefundenen Familie hieß Theodor von Truzek, ein gebildeter Physiker. Er hatte die Mangerfelder Schienenwerke erst kürzlich von seinem Schwiegervater geerbt, und leistete zumeist schwerste Gedankenarbeit in seinem Arbeitszimmer, bei der er nicht gestört werden durfte.
Augusta von Truzek, die Tochter des alten Herrn Weber, leitete hinter der Fassade ihres Mannes die Geschicke der Fabrik ihres seligen Vaters. Sie hatte die Geschäftsführung von der Pike auf gelernt, und Herr von Truzek schien gewillt, ihr diese Macht zu überlassen. Nicht zuletzt dafür bewunderte Emilie diese Frau, die sich so vieles erarbeitet hatte, zutiefst.
Bereit, Schläge und Schelte für das ›Erschießen‹ ihrer Herrin zu ertragen, senkte die Dienerin unterwürfig den Kopf und faltete die Hände.
Doch nichts geschah.
Stattdessen räusperte sich Frau von Truzek kurz und setzte leise zu sprechen an. »Irgendetwas hat er vor«, flüsterte sie. »Du musst dem nachgehen, aber sei diskret.«
Zögerlich wagte es Emilie, zur hohen Herrin aufzuschauen, und bemühte sich um ein Lächeln, das ihr angesichts der merklichen Anspannung ihres Gegenübers schwer fiel. »Herr von Truzek, meinen Sie? Wie kommen Sie darauf?«, antwortete die Dienerin.
»Er hat mir von einer Ausstellung in Übersee erzählt, auf der er sich über neue Technologien informieren will. Aber ich habe nachgeforscht: Diese Ausstellung gibt es nicht. Du musst herausfinden, was er wirklich vorhat.«
Herr von Truzek benahm sich schon seit einigen Monaten seltsam und abweisend, nicht nur Emilie, sondern auch Willi und seiner Frau gegenüber. Doch eine geschäftliche Lüge, noch dazu in diesem Ausmaß, war ungewöhnlich. Vielleicht hatte er wirklich etwas vor. Etwas Großes, Dummes. Etwas, dass Emilies Herrin schaden konnte.
»Ich werde dem nachgehen«, sagte Emilie dienstbeflissen. » Sie haben mein Wort.«
Agnes I
J
edes Ende ist auch der Anfang von etwas Neuem.‹
Das war einer der vielen denkwürdigen Sätze, die Agnes’ Mann in ihren letzten Gesprächen vor seinem Tod hervorgeröchelt hatte. Seine Worte waren stets wie eine Salbe auf ihrer verwundeten Seele gewesen, und hatten oft davon gezeugt, was für ein belesener Mann er gewesen war.
Agnes lächelte traurig, als sie daran denken musste, wie oft sie ihn des Nachts im völlig zugerauchten Arbeitszimmer dabei ertappt hatte, wie er über der Übersetzung eines Reiseberichts eingeschlafen war, die Pfeife noch in der Hand.
Ihr Gegenüber – ein dicker kleiner Mann, der nicht so recht wusste, was er mit seinem respektvoll vom Kopf gezogenen Zylinder anfangen sollte – interpretierte ihr Lächeln zu seinen Gunsten: »Ich bin froh, dass wir uns da einig sind.«
Irritiert schaute Agnes ihn wieder direkt an. »Entschuldigen Sie bitte, was haben Sie gerade gesagt?«
Stadtrat Küfer nickte und lächelte verständnisvoll. »Aber gern. Nun, da seit dem Dahinscheiden ihres Gatten ein ganzer Monat verstrichen ist, wollte ich mit Ihnen über die Zukunft der Bibliothek sprechen.«
Agnes nickte. Soweit konnte sie sich noch an ihr Gespräch erinnern.
»Heinrich Michelson hat der Stadt als Bibliothekar einen großen Dienst erwiesen. Er hat sie nicht nur aufgebaut und bestückt, nein, er hat sie durch seine Leitung, seine Gewissenhaftigkeit und seine Emsigkeit zu einem Ansehen geführt, die Mangerfeld wahrhaft würdig sind«, lobte Stadtrat Küfer ihren Mann.
Wieder nickte Agnes. Auch das kam ihr noch bekannt vor. Wann war sie aus dem Gespräch gerissen worden?
»Und es ist diese Würde, die wir, der Stadtrat unseres schönen Mangerfelds, in seinem Andenken bewahren wollen. Wir sind zuversichtlich, dass das auch in Ihrem Interesse ist. Oder nicht?«
Agnes beschlich allmählich das Gefühl, dass er auf irgendetwas Ungutes hinauswollte, nickte aber brav.
»Ich bin sicher, Sie waren Ihrem Mann eine hervorragende Gehilfin, und man wird auch Ihrer mit Wonne gedenken. Aber um das Andenken Ihres Mannes und das Ansehen dieser Bibliothek zu wahren, sind wir uns als Stadtrat darin einig, dass es einen neuen Bibliothekar braucht. Einen Mann von zumindest ähnlichem Format wie es der Ihre war.«
»Wieso?«, fragte Agnes sofort. »Ich kann sie doch weiterführen. Mein Mann und ich haben alles gemeinsam gemacht.«
Stadtrat Küfer lächelte sie mitleidig an, als wäre sie ein unbelehrbares Kind. »Wollen Sie wirklich zugrunde richten, was Ihr Mann aufgebaut hat? Ihr Eifer ist löblich, aber wenn Sie sich dann beim Kaffeeklatsch oder im Bücherzirkel – oder auch vor wildfremden Bibliotheksbesuchern – nicht zurückhalten können, diskrete Rechercheanfragen der Mangerfelder Bürger auszuplaudern … ja, dann wird der Ruf dieser Bibliothek leiden.«
»Wie kommen Sie darauf, dass so etwas geschehen würde? Ich habe diese Bibliothek jetzt fünf Jahre mitgeleitet und bin immer diskret gewesen.« Agnes versuchte ruhig zu bleiben, obwohl alles in ihr gegen die drohende Ungerechtigkeit anschrie.
»Was gewiss auch dem mildernden Einfluss Ihres Mannes zuzuschreiben ist«, entgegnete Stadtrat Küfer versöhnlich. »Sie merken doch sicher selbst, wie hysterisch Sie gerade werden.«
»Ich bin keineswegs hysterisch, Stadtrat Küfer, lediglich irritiert«, stellte Agnes fest.
Wieder nickte ihr Gegenüber betont verständnisvoll. »Angenommen, das wäre alles so. Dann ist da immer noch die Sache mit dem Geld. Der Pachtvertrag lief auf Ihren Mann. Und der Stadtrat hat bereits mit dem florierenden Fortgang der Bibliotheksgeschäfte gerechnet. So eine Bibliotheksarbeit erfordert Köpfchen, wissen Sie? Mathematik, das Arbeiten mit Zahlen … Können Sie mir folgen?« Er zögerte, dann strahlte er sie an. »Sehen Sie das doch als Chance. Jedes Ende ist auch der Anfang von etwas Neuem.«
Da war der Satz wieder. Hier war Agnes beim letzten Mal in sich gekehrt. Doch diesmal blieb sie konzentriert.
»Wie hoch ist die Pachtanzahlung?«, fragte sie entschlossen. In einem guten Jahr waren ihnen bis zu zweihundert Mark als Reingewinn geblieben.
»Wie bitte?«, fragte Küfer.
»Sie reden von Geld, das die Stadtverwaltung bereits verplant hat. Wie viel, damit Sie Ihre Pläne umsetzen können, und ich die Bibliothek meines Mannes fortführen kann?«
»Eintausend Goldmark«, erwiderte Stadtrat Küfer. Er lächelte nicht mehr. »Bis Ende des Monats. Und dann monatlich weitere einhundert Goldmark.«
»Abgemacht«, sagte Agnes und reichte ihm die Hand.
Und zum ersten Mal seit Beginn des Gesprächs war sie es, die lächelte, auch wenn es sie alles kostete.
Mathilde II
N
a, Sie meinen es aber heute gut mit mir«, stellte Wachtmeister Hoffmann fest, als er die Zeitung zurückschlug, um auf den Frühstückstisch zu blicken.
Mathilde lächelte freundlich, nahm den gusseisernen Wasserkessel vom Kohleherd und goss ihm und sich einen Tee auf. »Nicht, dass Sie mir im Dienst zusammenbrechen«, antwortete sie und setzte sich.
Wachtmeister Hoffmann legte die Zeitung beiseite und wandte sich dem Wurstbrot zu, das prominent in der Mitte seines Tellers lag. »Ebenso«, erwiderte er. »Was nützt eine Krankenschwester, die selbst behandelt werden muss?«
Ohne zu antworten, schlug Mathilde das frisch gekochte Ei auf und verteilte es über die eben geschnittene Brotscheibe, sodass der weichgekochte Dotter darüber verlief.
Hier, in ihrem neuen Zuhause, war sie ganz Mathilde, die Krankenschwester vom Lande. Matryona hatte hier keinen Platz, auch wenn sie bis vor drei Jahren ihre einzige Identität gewesen war.
»Ich habe gerade von dem Unfall in der Fabrik gelesen«, sagte Wachtmeister Hoffmann ernst. »Schrecklich. Aber zumindest gab es neben dem Toten wohl keine weiteren Verletzten.«
Mathilde nickte und antwortete erst, nachdem sie den letzten Bissen heruntergeschluckt hatte. »Wir haben oft genug Verletzte aus der Fabrik bei uns im Sankt-Antonius-Krankenhaus.« Tatsächlich hatte Mathilde zu Beginn ihrer Ausbildung vor allem mit einem Salbenrezept ihrer Familie auftrumpfen können, das vornehmlich aus Ringelblumen und Kamille bestand. Die Salbe half hervorragend gegen Verbrennungen, was zu den häufigsten Leiden der Fabrikarbeiter zählte.
»Schlimm sowas«, bemerkte Wachtmeister Hoffmann. »Aber das gehört wohl zum Fortschritt dazu.«
Darauf antwortete Mathilde nichts, sondern beschmierte eine weitere Brotscheibe mit Margarine.
Plötzlich verschluckte sich ihr Gegenüber. Der Polizist räusperte sich kräftig, ehe er sprechen konnte. »Fast hätte ich es vergessen!«, presste er hervor, nahm dann einen letzten Schluck Tee und holte einen Umschlag heraus.
»Ein Brief«, sagte er und hielt ihn Mathilde hin.
›Frau Matryona, Weberstraße 10, Mangerfeld.‹ Mathilde bemühte sich, ruhig zu bleiben. Der Wachtmeister wusste nichts von ihrer Nebentätigkeit als Medium, und dabei wollte sie es auch belassen.
Außerdem ahnte sie anhand der Anschrift, von wem dieser Brief stammte, und allein die Vorahnung beschleunigte ihren Puls. Am liebsten hätte sie ihm das Papier aus der Hand gerissen.
»Wissen Sie, wer das ist?«, hakte er nach.
»Das ist … ein Spitzname von mir. Von einer alten Bekannten«, erwiderte sie. »›Matryona‹ bedeutet ›Mathilde‹, so wie das englische ›George‹ und das deutsche ›Georg‹. Sie muss sich einen Scherz erlaubt haben.« Damit nahm sie ihm den Brief aus der Hand, als wäre der Sachverhalt hinreichend erklärt.
Der Polizist schaute sie noch einen Moment lang eindringlich an, dann wurden seine Gesichtszüge mit einem Mal wieder weich und warm. »Drei Jahre beziehen Sie jetzt schon ein Zimmer bei mir, und noch immer lerne ich etwas Neues über Sie. Sie müssen ein aufregendes Leben auf Ihrem Bauernhof zurückgelassen haben.«
Mathilde nickte nur, während ihr Blick immer wieder zum Brief huschte. Auch, dass sie nicht von einem Bauernhof stammte, sondern aus einer umherziehenden Familie, wusste er nicht. Zu oft war sie als ›Zigeunerin‹ beschimpft worden. In ihrem neuen Leben, als Mathilde, wollte sie nie wieder diese Ausgrenzung erfahren. Erst recht nicht zuhause.
»Na los, Sie dürfen ihn ruhig schon aufmachen«, bekräftigte der Polizist freundlich. »Ich merke doch, wie begierig Sie ihn anschauen.«
Dankbar lächelte Mathilde und riss den Brief auf. Sie legte ihn in den Schoß, damit ihr Gegenüber nicht mitlesen konnte.
Dabei hätte er ohnehin nichts verstanden. Der Brief war in einem Kauderwelsch geschrieben, das mit deutscher Lautschreibung versuchte, ihre Muttersprache nachzuahmen. Sie erkannte die Handschrift ihrer Mutter und strich beim Lesen zärtlich über das Papier. Unauffällig sog sie Luft durch die Nase, um womöglich einen Hauch ihres Dufts zu erhaschen.
Ihre Familie war auf dem Weg nach Osten, und würde in gut einem Monat an Mangerfeld vorbeiziehen. Ihre Mutter bat sie eindringlich, mitzukommen, und schrieb, dass dies ihre letzte Gelegenheit sei, in ihr altes Leben zurückzukehren.
Als sie geendet hatte, faltete sie den Brief sorgfältig, damit kein Wort davon mehr zu sehen war, und schloss die Augen.
»Schlimme Nachrichten?«, fragte ihr Gegenüber ernst.
Mathilde nickte zaghaft. »Es ist eine private Angelegenheit.«
»Nun, ich will mich Ihnen nicht aufdrängen«, sagte Wachtmeister Hoffmann, stürzte schnell seinen restlichen Tee hinunter und stand dann auf. »Ich muss ohnehin zum Dienst. Ich hoffe, der Brief verdirbt Ihnen nicht den Tag. Auf Wiedersehen.«
Damit wandte er sich ab, nahm Dienstmütze, Schlagstock und Pistole von der Garderobe und trat hinaus.
Matryona blieb allein am Tisch zurück. Langsam atmete sie ein und aus, um ihre Gedanken zu sortieren.
Es ärgerte sie, dass der Brief in der Lage war, solche Zweifel in ihr zu wecken. Dabei hatte sie sich doch schon vor Jahren gegen jeden Widerstand dazu entschieden, in Mangerfeld sesshaft zu werden. Hier hatte sie alles, was sie wollte. Sie war frei. Frei von Anfeindungen. Frei zu tun, was sie wollte. Und hatte sie mit ihrer Nebentätigkeit als Medium nicht sogar einen Weg gefunden, das Vermächtnis ihrer Familie weiterhin zu ehren? Mit ihrer Arbeit als Krankenschwester eine Möglichkeit, das kostbare Wissen anzuwenden und weiterzugeben, das sonst so achtlos abgewiesen worden war?
Mathilde zerknüllte den Brief in der Hand und stand auf.
Friederike III
W
ie gewohnt zu solchen Anlässen trug Frieda eine graue Bluse und einen schwarzen Rock. Während ihr Blick über die vielen Arbeiter in der Friedhofskapelle schweifte, fiel ihr auf, dass sie die meisten ihrer Kollegen nur in schwarz kannte: geschwärzt vom Ruß der Kohleöfen oder in schwarzer Trauerkleidung.
Den Priester, der vorn auf der Kanzel inbrünstig seine Predigt hielt, kannte sie inzwischen gut. Das beeindruckendste an Pfarrer Ketteler war wohl seine Fähigkeit, aus dem immer gleichen Anlass immer wieder neue, einfühlsame Trauerreden zu spinnen: mal ging es um Gier, mal um den Lohn im Himmelreich. Mal ging es um Solidarität, mal um Opferbereitschaft. Gelegentlich ließ er die eine oder andere Spitze gegen Herrn von Truzek fallen, doch die trafen nach Friedas Meinung auf das falsche Publikum. Denn Truzek war nicht hier.
Seit Frieda in Mangerfeld lebte und arbeitete, war er noch nie bei einer Beerdigung einer seiner Arbeiter gewesen. Die Wenigen, die ihm noch immer wohlgesonnen waren, behaupteten, er bliebe allein aus Furcht vor der erbosten Arbeiterschaft fern. Schließlich war sein Vorgänger, Herr Weber, von einigen Arbeitern zu Tode geprügelt worden. Doch der Rest wusste, dass das nur ein Vorwand war. Denn es kümmerte ihn schlicht nicht. Keine volle Stunde nach dem jüngsten Vorfall war die Produktion wieder aufgenommen worden – selbstverständlich mit der Auflage, die verlorene Zeit wieder aufzuholen.
Karl stieß sie unauffällig von der Seite an. »Wenn du weiter so böse guckst, kriegt Pfarrer Ketteler noch Angst vor dir«, flüsterte er.
Frieda entspannte ihre Gesichtsmuskeln und richtete den Blick wieder nach vorn. So wenig der Priester mit seinen Predigten auch änderte, hatte sie doch die Hoffnung, dass er zumindest ihr unruhiges Herz beruhigen würde. Denn bei aller Machtlosigkeit war doch sein Herz immerhin am rechten Fleck.
»Wir wollen nun nicht vergessen«, setzte Pfarrer Ketteler bedeutungsschwanger an, »dass uns erst dieser tragische Unfall Josef Hubers Opferbereitschaft vor Augen geführt hat. Ohne ihn« – er schaute ernst in die Runde – »säßen einige von euch heute wohl nicht auf den Kirchenbänken, sondern lägen neben ihm oder an seiner statt bei mir hier vorn. War es Heldenmut, der ihn antrieb? Torheit? Hoffnung, dass es gut gehen würde? Nein, liebe Gemeinde, das alles war es sicher nicht.
Woher ich das wissen soll, fragt sich sicher mancher hier. Vielleicht nimmt der ein oder andere sogar Anstoß daran, da er in Josef einen Helden sieht. Und dem möchte ich keineswegs widersprechen. Doch war es nicht Heldenmut, der ihn zu diesem Opfer führte, sondern Heldenliebe. Die selbstlose Liebe zu seinen Genossen. Als er sah, welches Unheil den geliebten Menschen in seinem Leben drohte, welcher Gefahr sie ausgesetzt waren, konnte er nicht anders, als sie zu retten. Und das, liebe Gemeinde, ist doch die höchste Form der Liebe, nicht wahr?
Kann uns Josef darin nicht ein Vorbild sein? Wäre die Welt nicht ein besserer Ort, wenn wir mehr wie Josef wären? Man stelle sich vor, Josef hätte nicht allein dort gestanden, um das Unheil abzuwenden. Hätte sich nur die Hälfte nicht zu Boden geworfen, sondern mit starker Hand das verhängnisvolle Eisen abgewehrt, so hätte es sicherlich viele verbrannte, vielleicht sogar gebrochene Hände gegeben – doch Josefs Hand wäre nur eine unter vielen gewesen. Und das, liebe Anwesende, ist die Kraft der Gemeinde. Verbrennen wir uns alle die Hand – aus Liebe zueinander.«
Als Frieda sich umschaute, sah sie an den grimmigen Gesichtern, dass bei Weitem nicht alle Pfarrer Kettelers Aufforderung zur Solidarität als solche verstanden, sondern als unterschwelligen Vorwurf, nicht geholfen zu haben.
Eilig fuhr Pfarrer Ketteler fort: »Doch größer noch als die Liebe zueinander ist die Liebe des Herrn. Sicher nicht ohne Grund hat er uns diesen Vorfall beschert, auch wenn es für uns schwer sein mag, das zu akzeptieren. Die Wege des Herrn mögen unergründlich sein, doch es sind gute Wege, auch wenn uns auf Erden zuweilen die Weisheit fehlt, sie zu begreifen.« Er machte eine kurze Pause. Dann sagte er abschließend: »Wir wollen nun beten.« Gehorsam stimmte Frieda mit den anderen ins Vaterunser ein.
»Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Übel.
Amen.«
»Amen«, hallte es von den Wänden der kleinen Kapelle wider.
Aber was, wenn unser Schuldiger und das Übel die gleiche Person sind?, dachte Frieda, und die Unruhe in ihr wuchs. Doch dann verwarf sie den Gedanken: Ein Gotteshaus war kein Ort, um sich den Tod eines Menschen zu wünschen, und eine Beerdigung erst recht kein passender Anlass.
Nach dem Gebet traten sechs kräftige Männer vor und packten die Griffe des Sargs. Frieda kannte sie. Wie Josef arbeiteten auch sie im Transportbereich zwischen Vorformung und Walzen. Ihren ernsten, finster dreinblickenden Gesichtern glaubte sie anzusehen, dass ihnen nur allzu bewusst war, dass sie es hätten sein können, die nun von Kollegen zwischen den Kirchenbänken hindurchgetragen wurden.
Und dass sie ahnten, dass jeder von ihnen der nächste sein konnte.
Emilie III
E
s war ein warmer, heller Augustmorgen, an dem Theodor von Truzek zu der angeblichen Ausstellung in Übersee aufbrach. Die Gaslaternen des neuen Bahnhofsvorplatzes waren bereits gelöscht, und die gewaltige Uhr unter dem Dach zeigte fünf Uhr in der Früh an.
Emilie wartete schon eine Weile auf ihn. Sie hatte sich in Lumpen gehüllt und ihr schönes Gesicht beschmutzt, um unter dem Bettelvolk vor dem Zaun, der das überwachte Bahnhofsgelände umgab, nicht aufzufallen. Aus Erfahrung wusste sie, dass niemand den Armen Beachtung schenkte, und Herr von Truzek würde da gewiss keine Ausnahme sein.
»Wer wollen wir heute sein?«, fragte Emilie den schläfrigen Willi an ihrer Seite. Er war so zerlumpt und verdreckt wie sie. Wenn er aber seinen Vater direkt anspräche, würde wohl selbst der ihre Tarnung durchschauen. Damit der Sechsjährige sie nicht verriet, musste sie das Ganze als Spiel gestalten.
»Ich bin Oliver Twist!«, sagte Willi nach kurzem Überlegen.
»Gut«, erwiderte Emilie und versuchte sich fieberhaft an dessen Geschichte zu erinnern. »Und ich bin … Fagin. Dein Papa ist Mr. Brownlow, den wir beobachten müssen, um eine Gelegenheit zum Beklauen zu finden.«
Willi nickte eifrig und mit roten Wangen. Sofort war er wieder in seiner ganz eigenen Welt.
Hoffentlich würde er nicht wirklich versuchen, seinen Vater zu bestehlen.
Sobald Herr von Truzek hindurchgelassen worden war, würde sie unauffällig ihre Lumpen abwerfen, sich den Schmutz von den Wangen reiben und sich mit einigem Abstand ebenfalls zu dem mächtigen Portal aufmachen, das als einziges Einlass in die große Bahnhofshalle und damit zum Bahnsteig bot. Willi würde unauffällig in ihrem Windschatten folgen müssen. Selbstverständlich würden sie nicht mit dem Zug mitfahren, in den der Hausherr einstieg – aber zumindest, dass er in einen Zug gestiegen war, und in welchen, würde sie weitergeben können.
Während sie wartete, betrachtete sie gemeinsam mit Willi die Kutschen und Pferdefuhrwerke, die aufgereiht auf dem Vorplatz standen. Die Kutscher unterhielten sich müde, und gelegentlich schaute einer zum Bahnhof, ob wohl ein Zug einträfe.
»Können wir nicht spielen, dass jemand anders Mr. Brownlow ist? Das dauert mir zu lange«, beschwerte sich Willi.
»Nein, das ist meine Diebesausbildung für dich, Oliver«, erwiderte Emilie streng und mit verstellter Stimme. »Aber schau doch mal, ob du rauskriegst, wo all die Leute hier ihr Geld aufbewahren.«
Damit war er zumindest für den Moment beschäftigt.
Unwillkürlich musste Emilie daran denken, dass es ohne die von Truzeks und die Mangerfelder Schienenwerke diesen Bahnhof nie gegeben hätte. Das Gebäude, den umzäunten Vorplatz, die Gaslaternen – all das gäbe es nicht. Zudem gäbe es auch die Kutscher nicht, und all die anderen Leute, die hier Arbeit gefunden hatten. Oder vielmehr gäbe es sie, aber ihren Wohlstand nicht.
Ohne die von Truzeks wäre sie aus gleich dreierlei Gründen nicht hier:
Bevor der Mangerfelder Bahnhof letztes Jahr fertiggestellt worden war, war dieses Gelände der Acker irgendeines unbedeutenden Bauern gewesen. Warum hätte sich irgendjemand hier aufhalten sollen?
Und ohne die von Truzeks wäre sie immer draußen vor dem Bahnhofsgelände, beim gemeinen Pöbel, geblieben, denn erst bei ihnen hatte sie Kleidung und all die Mittel bekommen, mit denen sie ihre Vergangenheit endgültig hinter sich gelassen hatte.
Zuletzt war sie natürlich auch hier, um Frau von Truzeks Wunsch zu erfüllen. Als gute Dienerin war es Emilies Pflicht, diesem Wunsch Folge zu leisten. Auch wenn sie nicht glaubte, dass in ihrer perfekten Familie etwas Bedenkliches vor sich gehen konnte.
Frau von Truzek war durchaus klug, und der Mensch, den Emilie am ehesten Mutter nennen konnte. Aber auch sie konnte sich täuschen. Wer vermochte schon alle Ausstellungen zu erfassen und zu verzeichnen, die sich über die Welt verbreiteten wie Bettler über Mangerfeld? War es nicht umso vielversprechender, dass Herr von Truzek eine unbekannte Ausstellung ansteuerte, als eine, zu der jeder ging? Vielleicht hatte ein Studienkollege oder sonst einer der gewiss zahlreichen Kontakte Herrn von Truzeks ihn auf diese einmalige Gelegenheit hingewiesen, um einen seltenen technologischen Vorteil für die Mangerfelder Schienenwerke zu erlangen.
Nein, nein, dachte Emilie. Es wird sich alles noch als albernes Missverständnis herausstellen. Herr von Truzek wird mit den Plänen einer genialen Apparatur zurückkehren, die die Fabrik zu ungeahnten Höhen beflügelt, und Frau von Truzek wird ihm lachend ihre eitle Neugier gestehen. Der kleine Wilhelm hatte wahrhaft Glück, in eine so vollkommene Familie hineingeboren worden zu sein.
»Ich will aber kein Dieb sein«, sagte Willi, ganz in der Rolle des Oliver Twist.
»Hör mal zu, mein Lieber«, erwiderte Emilie mit verstellter Stimme, legte die Spitzen der gespreizten Finger ihrer Hände zusammen und zog den Kopf ein wenig zwischen die Schultern. »Ich kann dich nicht umsonst durchfüttern, verstehst du? Gleich kommt er, ganz gewiss. Hab Geduld.«
Willi strahlte ob der gelungenen Darbietung des verschlagenen Fagin, nahm dann aber schnell wieder ernst seine Rolle ein und tat so, als würde ihm das überhaupt nicht behagen.
Zum Glück mussten sie tatsächlich nicht mehr lange warten. Als ein Zug einfuhr und die Kutscher sich bereit machten, die Neuankömmlinge zu empfangen, sah sie von Weitem ein Fuhrwerk heranrollen, auf dessen Rückbank unverkennbar Herr von Truzek saß. Sie selbst hatte ihm gestern Abend noch die beige Leinenhose und das zugehörige Jackett, die graue Weste und das dünne, weiße Baumwollhemd rausgelegt. Der aus Stroh geflochtene Panama-Hut und die Sonnenbrille mit dem braunen Glas musste er angesichts der frühen Stunde noch in seinem Koffer verwahrt haben, denn er trug sie nicht, sodass vor allem sein prächtiger Vollbart sein Gesicht definierte.
Seine linke Hand ruhte wie immer auf einem elfenbeinernen Adler, der den Griff seines kunstvollen Spazierstocks bildete. Emilie hatte den Verdacht, dass er ihn nur besaß, weil sein linker Zeigefinger wegen einer Schnitzverletzung aus Kindertagen sonst schlaff herunterhing, und seine sonst so gekonnt ausgestrahlte Stärke untergraben hätte. Eine kaum merkliche Imperfektion.
Er stieg ab, bezahlte den Fuhrmann und betrat scheinbar unbekümmert den Bahnhofsvorplatz. Willi hüpfte aufgeregt von einem Bein aufs andere, und Emilie fürchtete schon, dass er sich vor Aufregung einnässen könnte.
»Also«, zischte sie ihn an. »Leg deine Verkleidung ab, und dann folge mir unauffällig. Er darf dich nicht bemerken, damit er später nicht ahnt, wer ihn bestohlen hat.«
Sie warfen ihre Lumpen ab und folgten ihm in einiger Entfernung. Als sie den Vorplatz auf halber Strecke überquert hatten, strömten die ausgestiegenen Reisenden des eben eingetroffenen Zuges heraus. Emilie verlangsamte ihre Schritte, um Willi bei der Hand zu nehmen, damit er im Gedränge nicht verloren ging. Jemand mit weniger Scharfsinn hätte Herrn von Truzek womöglich verloren, doch Emilie nutzte die Gelegenheit, um sich noch besser vor ihm zu verbergen.
Als sie den Pulk durchquert hatten, ließ sie den aufgeregten Willi wieder los, und folgte Herrn von Truzek durch die große Halle zum Bahnsteig. Er schien nichts zu ahnen, denn kein einziges Mal drehte er sich um. Als er in den Zug stieg, lächelte sie zufrieden und kniete sich hinter eine Säule, um mit Willi zu flüstern.
»Das hast du gut gemacht, mein Junge«, sagte sie mit verstellter Stimme. »Jetzt weiß ich, dass du bereit bist. Das nächste Mal, wenn du ihn siehst, kannst du dir seinen Geldbeutel schnappen.«
»Darf ich … darf ich dem Herrn Vater jetzt noch winken?«, fragte Willi und machte Anstalten, vorsichtig hinter der Säule hervorzulugen.
Emilie packte ihn fest am Arm und hielt ihn zurück. »Auf keinen Fall. Das ist doch unser Spiel, Willi. Dein Vater wird viel stolzer sein, wenn er es jetzt noch nicht erfährt.«
Willi nickte zögerlich. Ihre Begründung schien er nicht zu verstehen, aber zumindest, dass sie versteckt bleiben mussten.
Sie warteten noch eine Weile, bis Emilie sicher war, dass er an seinem Platz angekommen sein musste. Dann ergriff sie Willis Hand und gemeinsam gingen sie in die große Bahnhofshalle.
Dort notierte sie sich pflichtbewusst, welcher Zug am Bahnsteig stand, ehe sie wieder hinausgingen und das umzäunte Gelände verließen.
Draußen vor dem Eingang wollte sie gerade die Hand heben, um einen der Kutscher auf sich aufmerksam zu machen, als Willi an ihrer Hand zog.
»Soll ich jetzt, Mister Fagin?«, fragte er.
Irritiert drehte Emilie sich zu ihm um, im Begriff, ihm zu erklären, dass sie nicht wirklich stehlen durften. Doch ihre Worte blieben ihr im Halse stecken.
»Einmal zur Villa Morgenthau, bitte. Und Ihre Diskretion soll Ihr Schaden nicht sein«, hörte sie Herrn von Truzeks Stimme. Im Gegensatz zu vorher trug der Fabrikant nun wie zur Tarnung Panama-Hut und Sonnenbrille. Er stieg in die Kutsche des Mannes, mit dem er gerade gesprochen hatte, und zog die Vorhänge zu.
Und Emilie begriff, dass er nicht zu einer Ausstellung in Übersee fahren würde.
Sondern zur Villa Morgenthau. Zum verrückten Doktor Hovenreutz.
Mathilde III
H
aben Sie noch Fragen?«, fragte Doktor Crivenbach gereizt.
»Wieso soll denn ausgerechnet ich das machen?«, erwiderte Mathilde. Die Aussicht, nicht mehr bei ihren Patienten zu sein, entfachte eine solche Wut in ihr, dass sie sogar gegen ihren Vorgesetzten die Stimme erhob.
Der davon jedoch gänzlich unbeeindruckt schien.
»Himmelherrgott, Sie renitenter Rotschopf, wenn ich Ihnen eine Anweisung erteile, dann haben Sie der Folge zu leisten, und keinen Disput anzufangen.« Er atmete einmal tief durch und schaute sie dann eindringlich aus seinen tief liegenden Augen an. »Weil Sie gut mit Menschen können.« Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, dachte Mathilde, während sie seinen Blick herausfordernd erwiderte. »Wir dürfen bei dieser Sache keine Unruhe stiften, und da sind Sie nun mal geeignet für. Bis auf Weiteres sind Sie von ihrem Dienst hier im Krankenhaus entbunden, und haben nur hier zu erscheinen, um Meldung zu machen.«
Doch so leicht gab Mathilde nicht auf. Sie liebte es, den Patienten ihrer Station helfen zu können. Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, Hoffnung zu schenken, sie bei ihrer Genesung zu unterstützen. Und jetzt sollte sie in den Außendienst versetzt werden? Für möglichst effiziente, unpersönliche Bestandsaufnahmen bei Sterbenskranken?
»Jede andere Krankenschwester würde sich freuen, diesem Seuchenherd von einem Krankenhaus eine Weile zu entfliehen«, fuhr Doktor Crivenbach genervt fort.
Jede andere Krankenschwester würde sich freuen, Ihnen zu entfliehen, dachte Mathilde, als sie sah, wie sein gieriger Blick Luise, einer jüngeren, zugegebenermaßen auch hübscheren Krankenschwester, folgte.
»Aber sind wir dann nicht hier überlastet? Können Sie wirklich eine Krankenschwester entbehren?«, unternahm Mathilde einen letzten Versuch. Zwar wollte sie keinesfalls in den Außendienst, aber ihre Anstellung im einzigen städtischen Krankenhaus würde sie sicher nicht riskieren.
»Ja, wir sind überlastet«, räumte Doktor Crivenbach genervt ein. Die junge Krankenschwester verschwand hinter einer Tür, und sein Blick – nun wieder voller Kälte – richtete sich auf Mathilde. »Und zwar von den immer gleichen Symptomen: Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, und ein ungeheures Brandgefühl im Mund. Was sagt uns das? Hm?«
»Cholera, Typhus – ich verstehe Ihre Sorge«, erwiderte Mathilde fest. »Aber was ist mit Magengeschwüren oder einer Vergiftung? Immerhin breitet sich die Krankheit kaum aus.«
»Sie breitet sich nicht nachvollziehbar aus«, korrigierte Doktor Crivenbach. »Verstehen Sie nicht, wie gefährlich das ist? Überall sind Keimzellen verstreut. Finden wir heraus, was es ist und wie man es behandelt, können wir eine Ausbreitung auf ganz Mangerfeld verhindern. Und wenn es sich als Magengeschwüre oder eine Vergiftung herausstellt, fein, umso besser. Finden wir es aber nicht heraus, könnten wir es von heute auf Morgen mit einer Epidemie unkontrollierbaren Ausmaßes zu tun haben. Haben Sie es jetzt verstanden?«
Das hatte Mathilde schon gleich bei der ersten Andeutung: sie war sein Bauernopfer. Sollte es wirklich zum Ausbruch einer Seuche kommen, und sie die Krankenschwester sein, die die Ausbreitung untersuchte und verzeichnete, war sie nicht nur selbst in hohem Maß gefährdet, sich anzustecken. Schon bald würden die Leute ihre Ankunft als böses Omen deuten. Als die Bringerin von Krankheiten.
Wie früher, als sie noch mit ihrer Familie herumgereist war.
Alles, was sie sich aufgebaut hatte, den guten Ruf ihrer heilenden Hände, die Freundlichkeit ihrer Patienten – alles würde dann schwinden, und sie wäre der Todesengel, den man mied.
Doch wenn sie keine Kündigung riskieren wollte, durfte sie kein weiteres Widerwort geben. Doktor Crivenbachs Geduld schien vollständig erschöpft.
»Ich verstehe«, sagte sie niedergeschlagen. »Gleich Morgen fange ich an.«
Agnes II
I
ch möchte den Bibliothekar persönlich sprechen.«
Es kostete Agnes einige Mühe, ihr Lächeln angesichts des wilden Blicks ihres Gegenübers aufrechtzuerhalten. Doktor Hovenreutz‘ riesige Brille vergrößerte seine Augen zu grotesken Dimensionen, und seine fast formlose Kappe bändigte sein wirres Haar nur dürftig. Wann immer er redete, entwickelte sein in alle Richtungen wuchernder Bart ein unruhiges Eigenleben.
»Die Angelegenheit ist mit höchster Diskretion zu behandeln!«, sagte er, beugte sich über die Theke, hinter der Agnes stand, und hob ermahnend den Zeigefinger. »Höchste!«
Sofort trat die Witwe des Bibliothekars einen Schritt zurück. »Herr Michelson ist vor über einem Monat an Lungenkrebs verstorben. Ich bin seine Nachfolgerin.« Zumindest noch bis Ende des Monats, dachte sie. All ihre Ersparnisse zusammengenommen ergaben etwa dreihundert Goldmark. Wenn sie ihre wertvollsten Bücher verkaufte – darunter Heinrichs jahrhundertealte Lutherbibel –, könnte sie wohl nochmals zweihundert Mark dazugewinnen.
Fehlten noch immer fünfhundert Goldmark. Für die Anzahlung.
Doktor Hovenreutz trat nun ebenfalls von der Theke zurück. »Oh«, sagte er nur, und musterte sie dann eingehend. Er schaute sich zu allen Seiten um, als sei er auf der Suche nach einem anderen Bibliothekar, oder als wollte er sicherstellen, dass niemand in der Nähe war.
Dann flüsterte er: »Also gut. Aber die Sache erfordert wahrhaftig äußerste Diskretion! Haben Sie das verstanden?«
Agnes lächelte und nickte, auch wenn sie sich fragte, warum jemand mit so einem fürchterlichen Ruf wie Doktor Hovenreutz überhaupt noch etwas darauf gab, was man über ihn dachte.
»Sie kennen sich doch vielleicht mit dem Spiritismus aus? Das ›Buch der Geister‹ von Allan Kardec?«
»Ja, das kenne ich.« Das war keine ungewöhnliche Anfrage. Trotz ihrer Gottesfurcht hatten Heinrich und sie es irgendwann in den Bibliotheksbestand aufgenommen, da es doch recht oft erbeten wurde. »Wenn Sie möchten, kann ich nachsehen, ob es gerade vorliegt.«
Doktor Hovenreutz lachte kurz und schrill. »Ich besitze es selbst, und ich habe es etliche Male gelesen. Das sollten Sie auch, wenn Sie meinen Rechercheauftrag annehmen. Eine gute Grundlage.«
Agnes faltete die Hände und übte sich in Geduld.
»Der Spiritismus hat einige wesentliche Dinge über das Jenseits richtig erkannt und verzeichnet. Doch wo er sich von Moral und Ethik in Ketten legen lässt, wo er sich mit religiöser Schwammigkeit statt mit wissenschaftlicher Präzision zufrieden gibt – da müssen Sie bei Ihrer Recherche ansetzen. Verstehen Sie?«
Agnes lächelte und nickte. »Ich verstehe. Sie möchten das Jenseits auf wissenschaftliche Weise untersuchen.«
»Das wäre wohl kaum ausreichend«, sagte Doktor Hovenreutz. »Aber es ist ein Anfang. Vielmehr geht es mir um die Brücken, die zwischen dem Jenseits und dem Diesseits geschlagen werden können. Phänomene wie Geisterscheinungen, automatisches Schreiben, Besessenheit. All sowas. Finden Sie alles heraus, was es darüber herauszufinden gibt. Und ich meine: wirklich alles. Sie haben hier doch sicher Reiseberichte aus aller Welt, oder? Ich möchte alles, von allen Kulturen dieser Welt, wissen.«
»Das ist ein sehr umfangreicher Rechercheauftrag«, setzte Agnes vorsichtig an. Die Aussicht, sich mit all den Vorstellungen von Totenreichen auseinanderzusetzen, wo ihr Mann doch erst vor einem Monat bestattet worden war, nur, um dann von Doktor Hovenreutz ein paar Pfennige zu bekommen, missfiel ihr.
»Überfordert Sie das?«, fragte Doktor Hovenreutz schroff, und so laut, dass zwei Bibliotheksbesucher, die in einigen Metern Entfernung an einem Tisch saßen, aufschauten.
»Das meinte ich nicht«, entgegnete Agnes leise, um die Diskretion des Gesprächs wiederherzustellen. »Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass ein so undeutlich eingegrenzter Rechercheauftrag nahezu endlose Summen verschlingen kann, und Sie am Ende womöglich trotzdem kein zufriedenstellendes Ergebnis vorliegen haben werden.«
»Geld spielt keine Rolle«, zischte Doktor Hovenreutz. »Bloße Materie, angesichts der metaphysischen Sphären, die ich zu durchdringen bestrebt bin. Was ist denn viel für Sie? Einhundert Goldmark? Eintausend Goldmark? Würde das genügen, um Sie zu gründlichster Recherche anzuspornen?«
Agnes schwirrte der Kopf, als sie den Betrag hörte. »Ja«, brachte sie schließlich hervor. »Eintausend Goldmark würden wohl genügen.«
Friederike IV
V
on ihrem Platz an der Theke konnte Frieda unauffällig beobachten, wie die Witwe Huber ihr Schicksal mit all der Tapferkeit ertrug, die man von einer vierfachen Mutter erwarten konnte. Sie saß auf einem Holzstuhl in der Ecke der Feierabendschenke und quittierte jedes Zuprosten und jede Beileidsbekundung mit einem nachdrücklichen Lächeln. Einzig ihre Augen verrieten, wie sehr die Sorge sie von innen auffraß. Jedes Mal, wenn jemand bei Knut ein Bier bestellte, formte sie mit den Lippen unhörbar ein Wort, als zähle sie mit, wie viel getrunken wurde. Und sicher tat sie das auch.
Neben ihr saß Karl und leerte ein Bier nach dem anderen, während er sich mit einigen anderen Schmieden aus der Fabrik unterhielt, als wären sie nach einem weiteren, gewöhnlichen Arbeitstag hier.
Als Frieda sich bald nach ihrer Ankunft in Mangerfeld bei den anderen Arbeitern erkundigt hatte, warum sie für Hinterbliebene und Verunfallte keine allgemeine Arbeiterkasse eingerichtet hatten, war sie stets mit einem nichtssagenden Verweis auf Herrn von Truzek abgewiesen worden. Inzwischen wusste sie, dass es wohl tatsächlich mal den Versuch gegeben hatte, eine solche Kasse unter dem alten Fabrikanten Weber heimlich umzusetzen: Jeder Arbeiter hatte einen kleinen Teil seines Lohns eingezahlt, um sich im Falle eines Arbeitsausfalls – vorübergehend oder, wie im Fall der Hubers, dauerhaft – abzusichern. Doch kaum hatte Herr Weber davon Wind bekommen, hatte er das Geld einkassiert und alle Arbeiter, die in die Kasse eingezahlt hatten, entlassen. Das zersetze die Arbeitsmoral und sporne die unehrlichen Arbeiter zur Ausnutzung der anderen an, indem sie sich einen faulen Lenz machten, ohne dafür Geld zu verlieren. Im Grunde hatte er den Arbeitern also einen Gefallen getan, indem er die Saat des Zwists schon vor dem ersten Keimen ausgerottet hatte.
Gedankenverloren schüttelte Frieda den Kopf. Das war im Falle der Witwe Huber – wie in den meisten Fällen – natürlich Unsinn. Im Grunde blieb ihr kaum eine andere Wahl als schnell wieder einen Mann zu finden, der bereit war, einen großen Teil seines Lohns zu opfern, um die vier Kinder auch noch durchzubringen. Aber wer sollte sich so jemanden ans Bein binden wollen?
Nein, ihre letzte Hoffnung war die Feierabendschenke. Sie wurde von ehemaligen Arbeitern der Mangerfelder Schienenwerke geführt, die entweder gekündigt oder von Unfällen so verstümmelt worden waren, dass sie nicht mehr arbeiten konnten. Hier wurde zumindest ein kleiner Teil der Arbeiter aufgefangen, die aus welchem Grund auch immer ihre Arbeit bei Truzek verloren hatten. Ein sicherer Hafen, außerhalb der Reichweite des Fabrikanten.
Für Todesfälle hatte sich unter den Arbeitern ein Brauch etabliert, der den Hinterbliebenen zumindest durch die ersten Wochen half. Nach einer Trauerfeier verließen zum Feierabend alle außer den Hinterbliebenen die Schenke. Diese nahmen sich dann die Einnahmen des Abends und brachten Knut später den Schlüssel, der sich für seine Vergesslichkeit entschuldigte.
Im Grunde wurde er also bestohlen, ohne, dass er es anzeigte. Dagegen hatte weder Weber, noch von Truzek vorgehen können.
Und deshalb zählte die Witwe Huber nun jedes einzelne Bier, das bestellt wurde. So geistesabwesend, wie sie in den vollen Raum starrte, rechnete sie sich sicherlich aus, wie lange das Geld reichen würde.
Frieda wandte den Blick von der zusammengesunkenen Frau in der Ecke ab. »Hier nochmal die Luft rauslassen«, sagte sie zu Knut und deutete auf das Glas vor sich.
Knut nickte ihr zu, um zu zeigen, dass er sie gehört hatte, und bewirtete die Arbeiter, die vor ihr an der Reihe waren.
Links neben sich hörte sie Karl über den derben Witz eines Kollegen lachen.
»Schon wieder zu Scherzen aufgelegt, was?«, fragte sie missmutig.
»Das Leben geht weiter.« Karl winkte ab.
»Das hätte Truzek wohl kaum besser sagen können«, erwiderte Frieda leise.
Darauf drehte sich ihr rechter Sitznachbar, ein Kollege Josef Hubers, zu ihr um. Sein gerötetes Gesicht verriet, dass er heute schon viel gespendet hatte. »Was sagst du da?«, fuhr er sie an. »Was hat der Name dieses Dämons heute hier verloren?«
»Ruhig Blut, Michael«, erwiderte Karl und prostete ihm mit dem leeren Glas zu, was Knut daran erinnerte, es endlich aufzufüllen. »Frieda wollte sicher nur darauf hinweisen, wie zynisch mich die Arbeit hier gemacht hat. Sie hat die heimische Idylle erst vor einem Jahr verlassen, da hat sie noch Hoffnung.«
Das ließ Frieda nicht auf sich sitzen. »Nie und nimmer entsag ich der Hoffnung. Was sind wir denn ohne sie?«
»Zufrieden mit dem, was wir haben«, entgegnete Karl und grinste sie frech an.
Michael nickte verwirrt, und sein glasiger Blick schweifte in die Ferne. Agathe, eine Arbeiterin, die ebenfalls im Transportbereich arbeitete, stellte sich zu ihm. »Heute vielleicht«, sagte sie. »Aber wer weiß, wie lange noch?« Auffordernd schaute sie in die Runde. »Der alte Weber mag unseren Kampfgeist gebrochen haben, doch Truzek haben wir noch nie wirklich auf die Probe gestellt, seit er die Fabrik geerbt hat.«
»Was schlägst du vor?«, fragte Frieda mit gesenkter Stimme. Mit einem Mal steckten die vier die Köpfe zusammen wie Verschwörer.
»Nichts Großes, und ich schon gar nicht«, antwortete Agathe zögerlich. »Aber Karl, du vielleicht? Als Vorarbeiter könntest du doch mit den anderen Vorarbeitern –«
»Auf gar keinen Fall!«, erwiderte dieser und wandte sich demonstrativ ab, um dem Kreis der Verschwörer zu entfliehen.
»Aber er kann nicht alle Vorarbeiter feuern. Die Produktion käme zum Erliegen«, flehte Agathe.
»Ich werde nicht den Posten riskieren, für den ich so lange gearbeitet habe, und die anderen Vorarbeiter auch nicht«, zischte Karl sie von der Seite an. »Und wenn du sie fragst, werden sie dich bei Truzek melden. Schluss jetzt.« Damit nahm er seinen Bierkrug in beide Hände und wippte nervös mit dem Kopf.
»Nur, dass wir eine Kasse haben dürfen, für uns. Ihn kostet das doch nichts. Vielleicht war es falsch, das damals im Geheimen zu versuchen. Vielleicht, wenn wir offen darum bitten?«, flehte Agathe. Frieda wusste, dass sie zwei Kinder hatte, und sich vermutlich schon in der Ecke auf dem Platz der Witwe Huber sitzen sah.
»Ich sagte, Schluss jetzt, verdammt nochmal!«, fuhr Karl sie an und sprang auf.
Mit einem Mal war es sehr still im Schankraum. Alle starrten die Streitenden an.
»Eine Runde für alle, auf mich!«, rief Karl, und bemühte sich wieder um ein freches Grinsen. Die anderen Arbeiter prosteten ihm dankbar zu, und Agathe wandte sich ab.
Aus den Augenwinkeln sah Frieda, wie die Witwe Huber lächelte.
Emilie IV
S





























