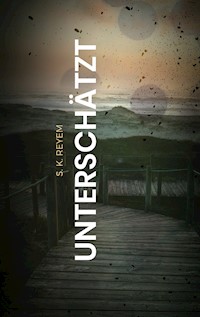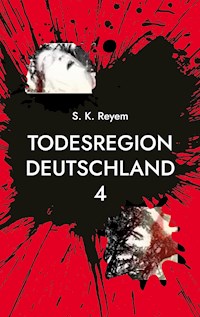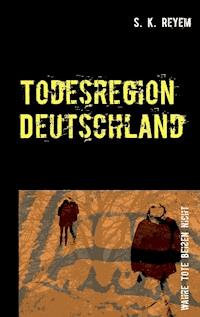
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Katastrophe, deren Ursprünge niemand kennt, mit deren Auswirkungen jedoch jeder zu kämpfen hat, bricht herein. Deutschland verwandelt sich in eine Todesregion. Die wenigen Überlebenden bilden Notgemeinschaften, denn nicht alle, die umkamen sind wirklich tot. Dabei offenbaren die Einen ihre dunklen Seelen, andere wachsen über sich hinaus und wagen einen Neuanfang. Ständigen Bedrohungen ausgesetzt, begeben sich die Davongekommenen auf die lange Suche nach einer friedlichen und dauerhaften Bleibe, die ihnen das Überleben sichert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Abschnitt 1: Eingesperrt
Kapitel (1)
Kapitel (2)
Kapitel (3)
Kapitel (4)
Kapitel (5)
Kapitel (6)
Abschnitt 2: Katastrophe
Kapitel (1)
Kapitel (2)
Kapitel (3)
Kapitel (4)
Kapitel (5)
Kapitel (6)
Kapitel (7)
Kapitel (8)
Kapitel (9)
Kapitel (10)
Kapitel (11)
Kapitel (12)
Kapitel (13)
Abschnitt 3: Chaos und Flucht
Kapitel (1)
Kapitel (2)
Kapitel (3)
Kapitel (4)
Kapitel (5)
Kapitel (6)
Kapitel (7)
Kapitel (8)
Kapitel (9)
Kapitel (10)
Kapitel (11)
Kapitel (12)
Kapitel (13)
Kapitel (14)
Kapitel (15)
Kapitel (16)
Kapitel (17)
Kapitel (18)
Kapitel (19)
Kapitel (20)
Kapitel (21)
Kapitel (22)
Kapitel (23)
Kapitel (24)
Kapitel (25)
Kapitel (26)
Kapitel (27)
Abschnitt 4: Die lange Reise
Kapitel (1)
Kapitel (2)
Kapitel (3)
Kapitel (4)
Kapitel (5)
Kapitel (6)
Kapitel (7)
Kapitel (8)
Kapitel (9)
Kapitel (10)
Kapitel (11)
Kapitel (12)
Kapitel (13)
Kapitel (14)
Kapitel (15)
Kapitel (16)
Abschnitt 5: Zu Hause
Kapitel (1)
Kapitel (2)
Kapitel (3)
Kapitel (4)
Kapitel (5)
Kapitel (6)
Schluss
Prolog
Ich bin Marc.
Ich bin derjenige, der euch alles über diese grässlichen Ereignisse berichten kann. Ereignisse, die mich und unser aller Leben veränderten, die mir neue Freunde brachten und liebe Menschen nahmen. Zum Einstieg ist es vielleicht angebracht, euch zuerst etwas über mich zu erzählen. Ihr sollt ja schließlich wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Und ihr solltet mir, wenn ihr von den Erfahrungen, die ich mit der Tragödie machen musste, lernen wollt, vertrauen können.
Meinen Vornamen – ich sagte ja schon, ich heiße Marc - habe ich eigentlich nie sonderlich gemocht. Aber in den 26 Jahren vor der Katastrophe habe ich mich schließlich daran gewöhnt. Besonders zuwider waren mir immer schon Verniedlichungen oder Verunglimpfungen meines Namens. Als Präsident des Mini Cooper Clubs Niederrhein nannte man mich zum Beispiel MM, den Mini-Marc. Ich hasste das.
Gute Zensuren in der Schule interessierten mich nicht, so lange das Ziel auch mit einer Vierminus erreicht werden konnte. „Fröne lieber deiner Freizeit“, hieß mein Lebensmotto. Getreu diesem konzentrierte ich mich viel lieber auf mein Motorrad, meinen Mini Cooper, auf Fußball und auf die verrückte Idee, alle Millionenstädte dieser Erde einmal im Leben besucht zu haben. In jungen Jahren spielte ich häufig im Internet das Action-Spiel „best vacances“, in dem der Held alle denkbaren Orte der Welt bereiste. Das steckte mich an. Dem wollte ich nacheifern. Oft stellte ich mir vor, mit meiner großen Liebe durch die Welt zu reisen, in den Millionenstädten der Erde mit ihr zu shoppen und in den tollsten Hotels vor Ort zu wohnen. Nur eben diese große Liebe fehlte genauso wie das nötige Kleingeld für tolle Weltreisen.
Warum erzähle ich euch das? Na ja, diesen Traum werde ich mir jetzt nie mehr erfüllen können.
Später surfte ich häufig in den sozialen Netzwerken und gab zu allem Möglichen meinen Senf dazu. Bald besaß ich dort den Ruf eines leicht verpeilten Einzelgängers.
Meine lieben Eltern enttäuschte ich häufig. Verantwortung im Beruf wollte ich nie übernehmen. Das war nicht mein Ding. Führungspositionen strebte ich nicht an, denn sie machten mir Angst. So redete ich mir lieber ein, dass sie mich nicht ausfüllen würden. Gut, wenn es sein musste oder wenn es mich besonders interessierte, dann konnte ich mich schon um eine Sache intensiv kümmern und bemühen. Dann ging ich gerne auch mal voran. Das aber jeden Tag, im Beruf? Nein danke, lieber nicht. Das sollten andere machen.
Geld, außer ich benötigte es für meine Fahrzeuge, meine Reisen oder meine Stadionbesuche, stellte für mich keinen besonderen Wert dar. Ich konnte ganz gut ohne auskommen. Meine wenigen Freunde und Kumpel vom Mini-Club Niederrhein, meine Familie und erst recht die Vereinsfarben meines Fußballclubs zählten für mich mehr. Ihnen gegenüber verspürte ich eine besondere Loyalität. Sie waren auf jeden Fall zu verteidigen.
Als alles seinen Anfang nahm, lebte ich in einer bescheidenen Wohnung mit zwei Zimmern am Niederrhein. Warum Niederrhein? Ja, damals zog ich leichtgläubig meiner großen Liebe hinterher – und das völlig vergeblich. Aber das ist eine andere Geschichte. Letztendlich blieb ich dann hier hängen.
Bei dem einzigen Verwandten, der mir nach dem frühen Tod meiner geliebten Mutter im vergangenen Dezember noch blieb, handelte es sich um meinen vierundachtzigjährigen Vater. Er lebte in meiner Heimatstadt Essen, rund vierzig Kilometer entfernt. Meinen Vater besuchte ich so oft es ging. Wenn es der Job zuließ und sich die Baustellen in der Nähe befanden, fuhr ich zwei- oder dreimal in der Woche zu ihm. Wir verbrachten ein paar Stunden miteinander, kochten, aßen und tranken etwas und unterhielten uns über Gott und die Welt. Eigentlich war mein Vater mein bester Freund.
Gerne und regelmäßig gingen wir gemeinsam zu den Heimspielen von Rot-Weiss Essen. Diesem Verein gehörte neben Vater, Mini und Motorrad meine eigentliche Liebe. Mehr als einmal fand ich mich in heftigen Schlägereien wieder, wenn es galt die Farben des Vereins gegenüber Hooligans anderer Vereine zu verteidigen. Selber als Hooligan sah ich mich nicht. Wenn man aber genauer hinsah... Aber auch das gehört jetzt nicht hierhin.
Meine Mutter, deutlich jünger als ihr Mann, war von schwacher Gesundheit. Sie starb im Alter von 61 Jahren nach einer langen, bösartigen Krankheit. Dieser Verlust traf mich schwerer, als ich es je erwartet hatte. Bei meiner Mutter konnte ich immer der kleine Junge bleiben und bei ihr war ich es gern. Dieses Nest fehlte mir jetzt.
Wie auch immer. Jetzt könnt ihr mich vielleicht besser einschätzen, wenn es darum geht, die Bewältigung der Katastrophe und das, was damit auf uns alle zukam, zu bewerten. Man macht sich ja vorher keinen Begriff davon, wie man reagiert, wenn man in solche Situationen gerät.
Also, ich erzähle euch von den Geschehnissen, die meine Welt veränderten. Die Katastrophe könnte auch euch eines Tages treffen.
Seid besser vorbereitet als ich!
Abschnitt 1
Eingesperrt
(1)
»Es ist 10:30 Uhr«, klang es aus dem Radio, »hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit den Kurznachrichten. Der Überblick:
Krieg in Osteuropa, russische Truppen überrennen Minsk.
Naher Osten, Verbände des Islamischen Staats IS stehen vor Teheran.
Ebola außer Kontrolle, mutierter, grippeähnlicher Virenstamm wütet in Südspanien.
China, mysteriöse, plötzliche auftretende Massenaggressivität in Peking und Shanghai. Viele Tote.
Energiewende, Schwierigkeiten beim Herunterfahren des letzten Atomkraftwerks auf europäischen Boden.«
Ich konnte es einfach nicht mehr hören und drückte auf den Aus-Knopf. Gute Nachrichten gab es sowieso nicht mehr.
»Der Mist interessiert mich nicht mehr«, schrie ich das Radio an.
Heute, an diesem heißen Sommertag, befand ich mich wieder einmal mit dem Auto auf dem Weg nach Essen. Ich wollte in der Stadtmitte zunächst in meinem Tattoo-Studio vorbeischauen, danach in der Hauptsparkasse etwas Bargeld abheben und anschließend zu meinem Vater fahren. Mit ihm wollte ich gemeinsam den Abend bei einer Pizza und mindestens einem Glas Bier genießen. Ich freute mich, ihn bald zu sehen.
Der Sommer brachte in diesem Jahr schon so manchen schönen und warmen Tag hervor. Heute aber war es extrem heiß. Das Außenthermometer in meinem Auto, einem kleinen hellblauen Mini Cooper Cabriolet, zeigte 34 Grad Celsius an. Hinzu kam eine recht hohe Luftfeuchtigkeit, die dafür sorgte, dass ich mich am ganzen Körper klatschnass und klebrig fühlte. Irgendwie ist das heute ein komischer Tag, dachte ich und wusste da noch nicht, wie Recht ich damit behalten sollte.
Wie immer dann, wenn ich etwas in der Essener Innenstadt erledigen musste, parkte ich mein Auto im Parkhaus der Hauptstelle der Sparkasse Essen. Das lag direkt unterhalb der Geschäftsstelle der Bank in einem mehrstöckigen Gebäude.
Das Parkhaus bot Raum für viele Fahrzeuge auf drei Ebenen. Ich fand einen freien Platz für meinen Wagen auf der untersten Ebene des Parkhauses.
Als ich das Tattoo-Studio auf der Limbecker Straße betrat, kam mir Claudio, der italienische Tätowierer, schon mit wehendem Kittel entgegen.
»Hallo Marc, mal wieder ein neues Bild für die Haut aussuchen? Blödes Wetter, was?«
»Ja, ziemlich heiß. Macht die Leute alle so seltsam aggressiv,«
»Das stimmt«, meinte Claudio, »hatte heute schon eine ziemlich wilde Figur im Studio. Dachte schon, der wollte mich beißen.«
Dabei lachte Claudio laut auf und machte sich gleich daran, mir den Katalog mit seinen Vorschlägen zu reichen. Eigentlich besaß ich schon genug Tattoos, aber ich dachte mir, es könnte schick aussehen, wenn ich dem kleinen Mini Cooper auf dem Oberschenkel noch einen kleinen Bruder spendieren würde. Claudio stach mir schon Tattoos, als ich gerade einmal fünfzehn Jahre zählte.
»Was machen die Mädels? Mittlerweile die richtige gefunden?«, sprach Claudio eines meiner unliebsamen Themen an.
»Nein, in der Disco geht immer mal was, aber die Richtige war noch nicht dabei«, antwortete ich verlegen.
»Ach Marc, vielleicht bist du ja auch nicht der Richtige!«, traf Claudio meinen Wunden Punkt und lachte schallend.
Ich liebte solche Gespräche nicht sonderlich, hielten sie mir doch einen Spiegel vor, in dem ich erkannte, wie einsam ich mich eigentlich fühlte. Also besser Themenwechsel.
»Muss morgen bei der Hitze in Wuppertal ein Gerüst ausstellen«, stöhnte ich, »ist gar nicht so einfach, die Stangen und Bohlen Etage für Etage hoch zu schleppen.«
»Ach komm Junge, hast aus deiner Kinderfigur doch einen ganz schönen Brocken werden lassen – muskulös, braungebrannt, hellblonde Haare, ein markantes Gesicht mit exakt drei Sommersprossen und tiefblaue, meist leuchtende Augen,– da willst du dich noch beschweren? Und außerdem hast du mir selbst erzählt, dass deine Eltern sich für dich einen ganz anderen Job gewünscht haben. Hättest du eben besser lernen sollen.«
Schon wieder das falsche Thema. Sollte wohl heute nicht mein Tag sein. Dass es noch viel schlimmer kam, ahnte ich da noch nicht.
Claudio lag richtig – hatte es ihm ja selber einmal erzählt. Studieren kam für mich trotz Abitur nicht infrage. Das hätte ich zwar geschafft, aber nur mit dem eben notwendigen Aufwand und den entsprechenden Zensuren. Aufgrund meiner Faulheit blieben mir direkt nach der Schule somit leider nicht so viele Möglichkeiten bei der Jobsuche. Ungeduldig ergatterte ich deswegen nur den körperlich anstrengenden Job als Gerüstbauer bei einem Essener Unternehmen.
Nachdem ich mich von Claudio verabschiedet hatte und ihm - wie jedes Mal - versprechen musste, bald wieder vorbeizukommen, strebte ich der Sparkasse entgegen.
Bis zum heutigen Tage gelang es mir nicht, mit meinem Beruf Reichtümer zu erarbeiten. Ich legte aber auch keinen gesteigerten Wert darauf. Jetzt wollte ich ein paar Hundert Euro abheben. Das sollte mein Konto noch soeben hergeben.
(2)
Mit einem dünneren Konto und einer dickeren Geldbörse als vorher, befand ich mich auf dem Weg zurück zu meinem Mini. Gerade als sich die letzte schwere Eisentür hinter mir schloss und ich mich auf der Parkhausebene befand, auf der mein Auto stand, ertönte ein ohrenbetäubender, schriller, auf- und abschwellender Heulton. Der so plötzliche erschallende und so bedrohlich wirkende Ton ließ mich zusammenzuckten.
»Was ist das denn?«, fragte eine Dame mittleren Alters, die in diesem Augenblick direkt neben mir stand.
»Keine Ahnung, besser wir gehen nach draußen.«
Ich drehte mich zu der Tür um, durch die ich gerade getreten war. Doch die ließ sich nicht mehr öffnen. Ich drückte die Türklinke herunter und warf mich mit der Schulter gegen die schwere Metalltür. Doch nichts tat sich. Die Tür wirkte wie im Rahmen festgesaugt. Erstaunt schaute ich die Frau neben mir an.
»Da hinten ist noch ein Ausgang«, meinte diese und setzte sich gleich in Bewegung.
Ich folgte ihr schnellen Schrittes. Mann, ist die klein! Erst jetzt fiel mir auf, dass die Frau bestenfalls einen Meter und fünfzig Zentimeter messen konnte. Selten zuvor sah ich so hochhackige Schuhe. Die kann sich darauf verdammt gut bewegen, musste ich einräumen. Ich schmunzelte gedankenverloren, wurde aber gleich wieder von der anschwellenden Sirene in die Wirklichkeit zurückgeholt.
Als die Frau, mit mir im Schlepptau, den Eingang auf der gegenüberliegenden Seite des Parkhauses erreichte, standen vor diesem schon vier weitere Personen, die vergeblich an der Tür rüttelten. Ein kleiner Junge von rund vier Jahren, hielt sich mit der linken Hand ein Ohr zu und umklammerte mit dem rechten Arm das Bein der neben ihm stehenden jungen, knallrot gefärbten Frau. Dabei handelte es sich offensichtlich um seine Mutter. Daneben stand ein Mann, der etwa im selben Alter wie die Rothaarige sein musste. Er hämmerte mit beiden Fäusten gegen die Stahltür. Die vierte Person war eine Frau, die ich auf 22 bis 25 Jahre schätze. Ihr langes, dunkelbraunes Haar schien ihr bis an den Po zu reichen. Ebenso dunkel wie ihr Haar, wirkten ihre großen, von langen Wimpern umrahmten Augen, die mich aufgeregt anblickten. Geht so, dachte ich. Ich stand eher auf blond. Das Mädchen mit dem schlanken Gesicht und der kleinen Stupsnase maß gut einen Meter fünfundsiebzig, war sehr schlank gebaut, wenn nicht sogar dürr.
Die Frau, mit der ich herübergekommen war, stellte sich wortlos zu den anderen.
»Hi«, grüßte ich mit einem Nicken.
Die Aufregung in den Augen des jungen Mädchens legte sich etwas und alle anderen drehten sich zu mir um. Von oben schaute ich herab, die anderen überragte ich um einige Zentimeter.
»Wir kommen hier nicht raus. Wissen Sie was los ist?«, sagte der Mann, der bisher hämmernd die Tür malträtierte.
Bei ihm handelte es sich wohl um den Vater des kleinen Jungen, denn dieser schaute zu mir empor und schmiegte sich nun an den Oberschenkel des Mannes.
»Nee, ich weiß auch nicht. Wir haben es da drüben versucht und sind auch nicht rausgekommen.«
Dabei wies ich in die Richtung der anderen Tür.
In dem Augenblick fuhr ein schwarzer Fünfer-BMW mit Bochumer Kennzeichen, in dem zwei Personen saßen, an uns vorbei.
»Zur Ausfahrt«, rief die Frau laut, mit der ich herübergekommen war und die nun dem BMW nachsah.
Sie setzte sich auch gleich in Marsch. Die anderen folgten ihr wie auf Kommando. Das junge Mädchen und ich kamen als letzte. Sie schaute mich eindringlich an und ihr leicht geöffneter Mund mit den vollen Lippen entblößte tadellose, weiße Zahnreihen. Toll - ich starrte das Mädchen an.
» Ich bin Fiona«, sagte sie da.
»Freut mich, ich bin..., mein Name ist Marc.«
Dabei griff ich nach ihrer Hand und zog sie hinter mir her, um den Anschluss an die anderen Personen nicht zu verlieren.
Die Gruppe befand sich gerade auf Ebene 3 des Parkhauses. Die Aus- sowie die Einfahrt befanden sich auf der ersten Ebene. Über die Fahrrampe konnten wir leicht zu dieser Ebene kommen. Auf der zweiten Parkhausebene trafen wir keine Menschenseele an. Nach wenigen Augenblicken erreichten wir unser Ziel.
Auch auf diesem Plateau versuchten Menschen, die Stahltüren zu den Ausgängen zu öffnen. Um wie viele es sich dabei handelte, konnte ich nicht auf Anhieb erkennen. Das An- und Abschwellen des Sirenenheultons ließ nicht nach und machte alle Anwesenden von Sekunde zu Sekunde nervöser. Hier lag etwas verdammt im Argen. Das war kein Probealarm oder etwas Vergleichbares. Das machte mir Angst und ich griff etwas fester Fionas Hand.
Schon von weitem konnte ich sehen, dass der dunkle BMW, der eben noch an uns vorbeigefahren war, die Ausfahrt zwar erreicht hatte, dort aber ebenfalls vor verschlossenen Türen stand. Auf der letzten Rampe zur Ausfahrt versperrten schwere Stahltore den Weg hinaus. Die Tore befanden sich aber nicht nur in normalen, für die Größe der Türen üblichen Halterungen und Führungsschienen. Nein, sie schienen in eine Art Dämmschicht eingelassen zu sein. Rein gar nichts, auch kein Sauerstoff, konnte dieses Tor passieren. Ein Blick hinüber zur Einfahrt, die ich von hier sehen konnte, zeigte mir, dass es dort nicht anders aussah.
Ein Mann und eine Frau stiegen aus dem BMW aus. Oh Gott, Punker, dachte ich, als ich den roten Irokesen beim ihm und den blauen Irokesen bei ihr entdeckte. Beide kleideten sich zudem in schwarzes Leder. Die Frau schrie gerade im schrillsten Ton den man sich vorstellen konnte und der sogar die Sirene übertönte.
»Bernd, ich will hier raus!«
Der so Angesprochene guckte nicht minder panisch als seine Freundin und schrie ebenso schrill zurück.
»Wat soll ich machen, Elke?«
Der kleine vierjährige Junge, der mit unserer Gruppe von der unteren Ebene heraufgekommen war, fing laut an zu weinen. Seine schwarzen Haare hingen wirr um sein kleines, rundes Gesicht und Tränen liefen seine Wangen hinab.
Genau in der Sekunde rief von hinten jemand, ebenso panisch, wie all die anderen.
»Hilfe, Hilfe, ist ein Arzt hier?«
Alle drehten sich zur rufenden Stimme um. Zwischen zwei Fahrzeugen ragten zwei Beine, die in braunen Hosen steckten, in die Fahrspur. Davor erkannte ich eine kniende Person, ein Mann. Von rechts lief ein weiterer Mann mittleren Alters heran.
»Mein Name ist Dr. Manter, ich bin Arzt.«
Jetzt liefen alle zusammen und bildeten einen aufgeregten Kreis um die am Boden liegende Person. Ich konnte nur erkennen, dass es sich um eine Frau handelte, die wohl so um die 35 Jahre sein musste. Der vor ihr kniende grauhaarige Mann, war mindestens doppelt so alt.
Die mit geöffneten Augen daliegende Fünfunddreißigjährige sah sich hilfesuchend um und sprach von Verwirrtheit, Insulin und ihrer Handtasche. Ich konnte das nicht richtig verstehen. Die zu lauten Stimmen um mich herum dröhnten in meinen Ohren.
»Alles in Ordnung Leute. Lasst der Frau doch Luft zum Atmen«, rief Dr. Manter in die Runde.
Da aber die Sirenen immer noch ihren Heulton von sich gaben, niemand wusste, was gerade passierte und die allgemeine Atmosphäre eines Parkhauses auch nicht die nötige Ruhe ausstrahlte, wurden die Stimmen immer lauter und wahnsinniger. Der kleine Junge, der gerade schon vor sich her schluchzte, fühlte sich dadurch angespornt und heulte noch lauter.
Ich bemerkte, dass ich immer noch Fiona an der Hand hielt und das gefiel mir komischerweise. Aber in mir stieg auch die sichere Gewissheit auf, dass ich etwas unternehmen müsste, sollte hier nicht alles ganz aus dem Ruder laufen. Gleich würden sie sich anschreien und in Panik auseinanderrennen oder noch schlimmer, aufeinander losgehen. Hysterie würde sich verbreiten und es würde erst Streit und dann Verletzungen geben.
Ein Blick auf mein Handy zeigte mir, dass es hier keinen Empfang gab. Fiona, die meinem Blick folgte, nickte dazu. Auch sie hielt ihr Mobiltelefon in der Hand.
Eine kurze Zeit lang überlegte ich. Dann war es die Angst vor dem Vorhersehbaren, die mich antrieb. Neben mir stand ein dunkelroter Mazda BT 50, ein Pickup, auf dessen Ladefläche ich mich stemmen konnte.
»Leute, haltet mal Ruhe und hört zu«, rief ich so laut es ging den Leuten entgegen.
Alle, auch die Frau, die soeben noch am Boden lag und mittlerweile wieder stand, wendeten sich mir zu. Offensichtlich beruhigte es die Menschen, wenn es jemanden gab, der für sie das Heft in die Hand nahm.
»Leute, wir müssen Ruhe bewahren. Wir wissen nicht, was hier los ist. Alle Schotten sind dicht, es kommt nichts und niemand rein oder raus. Die Handys funktionieren nicht. Aus den Autoradios kommt im Parkhaus sowieso nur ein Rauschen. Also was können wir anderes tun, als abzuwarten. Ich kann mich erinnern, dass vor langer Zeit mal in der Zeitung stand, dass das hier, also das Parkhaus, auch als Schutzraum dienen könnte, wenn mal irgendwas passiert. Das ist vielleicht jetzt der Fall. Klar ist doch, wenn draußen alles ok ist, holen sie uns in den nächsten Stunden hier raus. Wahrscheinlich spätestens morgen. Bis dahin heißt es Ruhe bewahren. Lasst uns zusammentragen, was wir so an Lebensmitteln und Wasser finden können. Schlage vor, dass der Pickup hier als Zentrale dient. Vielleicht gibt es irgendwo ja auch eine Toilette, oder so. Und wenn wir hier übernachten müssen, können wir in unseren Autos pennen.«
Das zeigte tatsächlich Wirkung. Die Leute wurden ruhiger, unterhielten sich nur noch leise und entfernten sich in alle Richtungen – wohl auf dem Weg zu ihren Autos.
(3)
Ich pustete laut durch und kletterte wieder vom Pickup herab. Fiona stand immer noch da und kam nun zu mir herüber. Von der Seite schritt ein junger, klein wirkender Mann schnellen Fußes an Fiona vorbei und ebenfalls auf mich zu.
»Tach, ich bin Klaus«, sagte der bestenfalls einen Meter sechsundsechzig große Mann.
Blonde und ganz kurz geschorene Haare zierten sein ovales Gesicht mit der langen Nase. Er trug blaue Jeans. Auf einem ebenso blauen T-Shirt konnte ich in großen Buchstaben das Wort „Quartalssäufer“ lesen.
»Hi Klaus, ich bin Marc und das ist Fiona«, antwortete ich und deutete auf Fiona, die nun auch bei uns stand.
»Hör zu, Marc. Ich habe da so eine Idee. Wenn das Parkhaus tatsächlich ein Schutzraum ist, dann hat der auch eine Schaltzentrale – und zwar von innen.«
Mit großen, erwartungsvollen Augen sah der kleine Mann zu mir auf und strich sich dabei über seinen kleinen Kugelbauch.
»Das wär was«, antwortete ich, »wie kommst du denn auf so was? Kennst du dich aus?«
»Ich bin Bauleiter und habe schon oft ähnliche Gebäude gebaut.«
Bau, da haben wir ja etwas gemeinsam, dachte ich.
Na ja, wir verfügten hier im Parkhaus sowieso nicht über besonders tolle Beschäftigungsmöglichkeiten. Da konnten wir uns auch mit dieser ominösen Schaltzentrale beschäftigen.
»Komm, lass uns mal nach der Schaltzentrale oder nach einem Gebäudeplan oder so suchen«, meinte ich und stieß Klaus sanft vor die Schulter.
Klaus, der sich nun offenbar verstanden und wichtig fühlte, wirkte gleich ein paar Zentimeter größer. Er drehte sich auf dem Absatz um und strebte, den Kugelbauch vor sich her schiebend, einem der Ausgänge entgegen. Schon einige Meter vor dem Ausgang hob Klaus den Arm und ging, diesen ausgestreckt haltend auf ein großes Plexiglasschild mit einem Etagenplan zu. Na ja, ich folgte ihm.
Das Gebäude, in dem wir uns befanden, bestand aus elf Etagen über und fünf Etagen unter der Erde. Alle Eingesperrten hielten sich auf den untersten drei Etagen unter der Erde auf. Alle über der Erde befindlichen Stockwerke konnten von hier aus auf gar keinen Fall erreicht werden. Sie schienen für uns auch uninteressant zu sein. Hier befanden sich diverse Abteilungen der im Hause befindlichen Sparkasse und im Erdgeschoss deren Kundencenter. Ob sich Menschen dort aufhielten, wussten wir nicht. Die verschlossenen Türen ließen keine Geräusche herein. Die erste Etage unter der Erde beherbergte den Kundentresor. An jedem anderen Tag wäre das vielleicht interessant gewesen, heute nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde der Raum mehrfach gesichert. Direkt über den drei Etagen des Parkhauses befand sich eine mit U2 bezeichnete Etage. Sie kennzeichnete nur der Zusatz „kein Zugang“. Der normalerweise vom Parkdeck zu erreichende Aufzug fuhr an U2 vorbei. Das konnte es sein. Da könnte die Schaltzentrale stecken.
Klaus und ich beschlossen, erst einmal zum roten Truck zurückzugehen. Dort wollten wir überlegen, wie wir U2 erreichen könnten.
Zurück am Truck sah ich, dass alle vorhin zu ihren Fahrzeugen gegangenen Personen sich wieder eingefunden hatten. Sie saßen oder standen in kleinen Gruppen zusammen und redeten teils aufgeregt, teils stark gestikulierend über die Lage, in der sie steckten. Als Klaus zusammen mit mir an den Gruppen vorbeikam, stocken die Gespräche und verstummten. Alle Augen richteten sich auf mich. Die Menschen schienen irgendetwas von mir zu erwarten.
Was wollen die denn von mir? Nur weil ich mal was gesagt habe, bin ich noch lange nicht der Chef hier, dachte ich und steuerte auf den Truck zu. Dort wartete Fiona und lächelte mich aus ihren dunkelbraunen Augen an. Vielleicht ist die doch nicht so übel, huschte es durch meinen Kopf. Ich lehnte mich lässig an den Truck, schaute Fiona tief in die Augen und wollte ein paar lockere Sprüche loslassen. Genau in diesem Augenblick hörten die Sirenen auf zu heulen und vollkommene Stille breitete sich im Parkhaus aus.
»Die Leute hoffen, dass du was tust«, meinte Fiona.
Erneut schaute ich in die Runde. All die anderen wandten sich mir zu und warteten auf irgendetwas. So ein Mist, dachte ich. Das hier war gar nicht mein Ding. Ich wollte nicht den Boss spielen, wollte ich noch nie. Aber drücken würde ich mich auch nicht.
Was sollte ich machen? Ich fühlte mich in dieser Situation etwas verloren und alleine. Da stieß mich Fiona leicht in die Seite und deutete mit einem kurzen Kopfnicken in Richtung Truck. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, dachte ich noch. Mit schwitzigen Händen kletterte ich auf das Fahrzeug.
»Wir«, dabei zeigte ich auf Klaus, »glauben, dass es irgendwo im Gebäude eine Schaltzentrale geben muss. Da wollen wir hin, wenn wir in den nächsten zwei Stunden nichts von außen hören.«
Eine mir bisher nicht aufgefallene dünne Frau, die sich in einer der hinteren Gruppen aufgehalten hatte, kam nun nach vorne an den Truck. Ich schätze sie auf 45 Jahre. Ihre wasserblauen Augen besaßen etwas Stechendes. Ihr Gesicht mit der ziemlich platten Nase wurde von mittelbraunen, schulterlangen Haaren gesäumt. Sie verschränke ihre Arme vor der Brust, sah zu mir auf und verzog etwas den schmalen Mund.
»Wenne da rein gehs, komm ich mit. Ich kenn mich aus, bin Elektrotechnikerin. Und die dahinten«, dabei wies sie mit dem Finger zurück über ihre Schulter ins Parkhaus hinein, »kommt auch mit, die kann gut klettern. Komma nach vorne, Kindchen.«
Eine junge Frau, die ebenso dünn aussah, wie diejenige, die sie rief, kam nun zum Truck.
»Das ist meine Tochter Jenny.«
Jenny, ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, besaß dieselbe Figur und dieselbe Frisur. Sie war nur rund 25 Jahre jünger.
»Ok«, sagte ich leicht irritiert, »wir starten in zwei Stunden.«
Erst jetzt fiel mir auf, dass es sich hier nicht so warm anfühlte, wie vorhin draußen. Dafür roch es nach Parkhaus. Das war auch kein Gewinn. Ich sah mich um. Dahinten stand die Familie mit dem kleinen Jungen. Der Junge weinte mittlerweile nicht mehr, hielt sich aber immer noch an seinem Vater fest. Dafür sah seine Mutter nun so aus, als ob sie jede Sekunde mit dem Heulen anfangen wollte. Die Frau, die vorhin auf dem Boden gelegen hatte, weil ihr Insulin fehlte, saß vor einem grauen Mercedes auf dem Betonboden und unterhielt sich mit dem Mann, der sich Dr. Manter nannte. Rechts daneben stand...
(4)
Plötzlich drang ein lautes, hysterisches Geschrei und Gepolter von der zweiten Parkebene zu uns herüber. Da schlug jemand heftig mit Metall auf Metall und eine weibliche Stimme kreischte dazu.
»Nein, du bringst uns alle um. Lass das nicht herein.«
Ich fuhr herum, Klaus sprang auf, ebenso Bernd mit der roten Irokesenfrisur, der eben noch neben seiner Freundin in Blau gehockt hatte. Irgendwo fing eine Frau an zu weinen und Stimmen riefen durcheinander.
» Was ist jetzt schon wieder?«
»Jetzt rasten sie bald alle aus«, rief ich zu Klaus hinüber und zusammen mit Bernd liefen wir die Fahrrampe zur zweiten Ebene hinab. Ich sah noch, wie der Vater des kleinen Jungen sich vor dem Siebzigjährigen mit grauen Haaren, der unlängst bei der am Boden liegenden Frau gekniet hatte, aufbaute und beide sich offenbar Nase an Nase bedrohten.
»Ruhig bleiben«, schrie ich zu ihnen hinüber, erreichte die Rampe und kam bald auf der nächsten Parkebene an.
Hier blieben Klaus, Bernd und ich wie angewurzelt stehen.
Hinten an der Aufzugtür stand ein großer, breitschultriger Mann, den ich auf mindestens zwei Meter zwanzig schätzte – ein Riese. Der hämmerte mit einer Rohrzange gegen die Aufzugtür. Dies versuchte eine Frau, die zwar nicht so breit, aber fast genauso groß war, dadurch zu verhindern, indem sie am Arm des Schlagenden hing und dabei ohrenbetäubend kreischte.
»Hey, was soll das!«, rief ich.
Der Lange unterbrach seine Arbeit an der Tür und drehte sich zu uns um. Die Frau hing immer noch an seinem Arm, doch dies schien ihn gar nicht zu stören. Als er das ungleiche Dreigestirn bestehend aus Klaus, Bernd und mir erblickte, lachte er kurz auf, kniff dann die Augen zusammen und sprach mit sonorer Stimme.
»Ich will hier raus, was sonst?«
Die Frau, die nach wie vor an seinem Arm hing, lärmte immer noch.
»Der bringt uns alle um. Da draußen ist alles verseucht.«
»Ach halt die Klappe«, rief der Lange und schüttelte sie nun endgültig ab, drehte sich um und malträtierte wieder die Aufzugtür.
Die große Frau krümmte sich am Boden zusammen und wimmert in embryonaler Haltung vor sich hin.
Scheiße, dachte ich, ging auf den Langen zu und packte ihn an der Schulter. Von hinten – die anderen waren mittlerweile wohl auch die Rampe herab gekommen – hörte ich Rufe wie »stopp den« oder »der soll aufhören, ich drehe durch«.
Der Lange wirbelte herum und es sah so aus, als ob zwischen uns nun eine wüste Schlägerei ausbrechen sollte. Ich war bereit. Wir sahen uns eine Weile an, da ließ der Lange seine Rohrzange, die er zur Bedrohung vor sich hielt, sinken.
»Lass uns reden«, meinte ich.
Den anderen rief ich zu: »Geht wieder hoch und bleibt ruhig. Panik hilft uns auch nicht weiter. Wir wissen nicht, was da draußen ist.«
Die kleine Frau, die ich hier als erste getroffen hatte, konnte sich nicht beruhigen.
»Meine ganze Familie ist da draußen!«
Fiona, die neben ihr stand, nahm sie in den Arm und führte sie zurück, die Rampe hinauf. Ihr Schluchzen konnte ich noch hören.
(5)
Ein halbe Stunde später hatten sich die Leute wieder etwas beruhigt. Ich saß mit dem Langen, der sich als Fritz vorstellte, zusammen. Wir überlegten gemeinsam, was geschehen sein konnte und was zu tun sei. In unserer Nähe hielten sich Jenny, die gute Kletterin, und ihre genauso aussehende Mutter auf. Fiona kümmerte sich immer noch um die kleine Frau. Die große Freundin von Fritz, die wohl Bärbel hieß, stand Fiona bei. Sie tätschelte der kleinen Frau ohne Unterlass den Hinterkopf. So groß und grob, wie sie optisch daherkam, so liebevoll ging sie mit ihren Mitmenschen um.
Wieder sah ich mich um. Die Familie, die mit dem kleinen Jungen, dem einzigen Kind hier unten, saß einige Meter entfernt an einem Ford. Die Eltern spielten irgendein Fingerspiel mit dem Jungen. Bernd und Elke, die mit den Irokesenfrisuren, standen weiter abseits und stritten sich heftig. Dr. Manter und der grauhaarige, ältere Herr unterhielten sich, ziemlich entspannt, so wie es aussah, mit der Diabetikerin. Nur Klaus konnte ich nicht entdecken.
Fritz teilte nach kurzer Diskussion mit mir die Meinung, hier erst einmal abzuwarten. Man würde uns schon von draußen befreien. Ja, es konnte etwas passiert sein da draußen. Schlimme Nachrichten gab es ja genug. Vielleicht leidete dieses Parkhaus aber auch nur unter einer Art Funktionsstörung. Bisher hörte man allerdings keinen Laut, der auf einen Befreiungsversuch von außen hätte schließen lassen könnten.
Die Zeit verrann nur langsam. In dieser stickigen Luft fühle ich mich nicht wohl und ich dachte an meinen Vater. Wie ging es ihm wohl. Immer wieder schaute ich auf die Uhr. Zum Glück wurde inzwischen niemand mehr hysterisch. Die Menschen verbrachten ihre Zeit lieber damit, sich gegenseitig vorzustellen. Schließlich saß man ja gemeinsam in einem Boot.
Die kleine Frau, die ich zuallererst im Parkhaus getroffen hatte, war 48 Jahre alt, hieß Marlene und arbeitete als Bäckerin. Heute, an ihrem freien Tag, wollte sie in der City shoppen. Sie machte sich Sorgen um ihren Ehemann und ihre zwei Kinder.
Der Name des kleinen Jungen war Karim, seine Mutter hieß Serife und sein Vater hörte auf den Namen Mahmut. Mahmut arbeitete für die Essener Feuerwehr an der Wüstenhöfer Straße. Die kleine Familie befand sich gerade auf dem Weg zum Supermarkt, als das Unglück über sie hereinbrach. Der kleine Junge fragte immer wieder nach Oma, was den düsteren Gesichtsausdruck seiner Mutter verstärkte.
Dr. Manter hieß mit Vornamen Helmut. Er war 51 Jahre alt, alleinstehend und praktizierte als Internist in Essen-Rüttenscheid. Im nahe gelegenen Sanitätshaus besorgte er sich immer neue Einweghandschuhe. So auch heute.
Die Frau, mit der er sich die ganze Zeit beschäftigte, diejenige, die Insulin benötigte, kam aus Herne und hörte auf den Namen Doris. Doris arbeitete als Verkäuferin beim „Der Heimwerker“ in Bochum. In Essen traf sie immer eine alte Freundin aus Schulzeiten in einem Café am Kennedyplatz. Nun saß sie, wie alle anderen auch, im Parkhaus fest und sorgte sich um ihre Lieben.
Der grauhaarige, alte Mann hatte sich mittlerweile allen Umstehenden als Manfred vorgestellt. Er genoss seinen Ruhestand und wollte sich das Treiben in der Innenstadt ansehen. Früher arbeitete er als Landwirt in Velbert, hatte seinen Hof aber bereits vor zehn Jahren an seinen Sohn weitergegeben. Auf ihn warteten zuhause seine Frau, sein Sohn mit Frau und drei Enkelkindern sowie ein jüngerer Bruder.
Die Frau, die ihre Tochter Jenny als gute Kletterin anpries und selber als Elektrotechnikerin arbeitete, hörte auf den Namen Anke. Ich bewunderte die ungeheure Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter. Wer einmal Jenny heiraten würde, konnte da schon sehen, wie diese in 25 Jahren aussehen würde. Vielleicht lag darin aber gar kein Vorteil. Jenny studierte übrigens noch – sie wollte Bauingenieur werden. So gut klettern konnte sie, weil sie schon mehrere Jahre in ihrer Freizeit dem Bergsteigen frönte und dabei die höchsten Berge Deutschlands und Österreichs erklommen hatte. Ob die beiden irgendwie liiert waren oder sich um ihre Verwandtschaft sorgten, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen.
Zu guter Letzt waren da noch der lange Fritz und seine fast ebenso große Freundin Bärbel. Letztere wich dem Fritz nicht mehr von der Seite. Beide unterhielten sich angeregt miteinander. Fritz, 34 Jahre alt, hatte mir erzählt, dass er als gelernter KFZ-Mechaniker und Meister eine Werkstatt im Essener Norden leitete. Die 33 Jahre alte Bärbel arbeitete als Bibliothekarin an der Essener Universität. Sie hatten sich im Parkhaus getroffen, um ihre Mittagspause in der Innenstadt gemeinsam zu verbringen. Die beiden wollten in drei Wochen mit ihren weit verzweigten, großen Familien und 150 Gästen ihre Hochzeit feiern.
Ach ja, Bernd und Elke, unsere rot-blauen Irokesen. Beide im Alter von 25 Jahren, studierten gemeinsam in Bochum Lehramt. Er für die Fächer Physik und Geografie, sie für die Fächer Mathematik und ebenfalls Geografie. Als Lehrer konnte ich mir die beiden wahrlich nicht vorstellen. Aber wir lebten eben in einer bunten Welt.
»Du hast jetzt mit allen gesprochen, aber was machst du eigentlich?«, riss mich eine Stimme aus meinen Gedanken.
Fiona lehnte sich an mich und richtete nun das Wort an mich, als ob sie meine Gedanken lesen könnte.
»Dich habe ich doch noch nicht gefragt. Was machst du?«, antwortete ich auf ihre Frage mit einer Gegenfrage.
»Ich hab gerade angefangen zu studieren. Landwirtschaft und Agrarwissenschaften.«
Hoppla, dachte ich, ganz schön viele Studenten hier. Na ja, wer weiß, wofür wir die schlauen Köpfe noch brauchen können.
»Super«, sagte ich, »ist bestimmt interessant. Ich bin nur Gerüstbauer.«
»Was heißt nur, macht doch offensichtlich einen durchtrainierten Körper und eine gesunde Gesichtsfarbe« scherzte Fiona. »Arbeitest viel draußen, was? Ich werde später auch viel draußen arbeiten«, schwärmte sie weiter. »In ein paar Jahren übernehme ich den Hof meines Onkels auf den Ruhrhöhen. Der hat keine Kinder.«
Ganz unvermittelt wechselte sie das Thema und ihre Stimme wurde ein Hauch dunkler.
»Wartet da jemand auf dich, da draußen?«
Dabei sah sie mich fragend an und eine Sekunde lang stockte mir der Atem.
»Nein, ich hab nur meinen Vater. Der wohnt in Essen-Haarzopf. Sobald ich hier raus bin, muss ich da sofort hin. Und du, hast du jemanden?«
Bei der Frage bekam ich ein leichtes Drücken im Bauch. Von irgendeinem Freund wollte ich jetzt nichts hören.
»Meine Mutter«, sagte Fiona, »ich hab Angst, ihr könnte was passiert sein. Sie arbeitet im Finanzamt an der Altendorfer Straße«, schaute sie mich mit großen Augen an.
»Bleib mal ganz ruhig. Vielleicht ist da draußen gar nichts Bedeutendes geschehen. Wenn du magst, schauen wir gemeinsam nach ihr, wenn wir hier raus sind«, machte ich ihr und mir Hoffnung.
»Kein Freund?«, schob ich hinterher.
Fionas Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. Sie schaute mir ein paar Sekunden zu lange in die Augen und ich meinte, da ein Blitzen zu sehen – wobei da sicherlich der Wunsch der Vater des Gedanken war.
»Nein«, antwortete sie spitz, »aber vielleicht habe ich einen gefunden, der mir gefällt.«
Dabei tippte sie mir leicht auf die Schulter, warf mir einen vielsagenden Blick zu, stand auf und ging um den Truck, bei dem wir saßen, herum.
Wir steckten jetzt nicht wirklich in der Situation, in der man sich verlieben sollte, dachte ich und rieb mir die Augen. Irgendwie fühlte ich mich müde.
(6)
Da tauchte plötzlich Klaus wieder auf.
»Hey Klaus, wo warst du denn?«
»Ach egal, dahinten gibt’s nen Schacht. Wo ist die Kleine, die klettern kann? Die schicken wir da hoch.«
»Mach mal langsam, Klaus.«
Ich erhob mich, packte Klaus am Ärmel und zog ihn mit in Richtung Jenny, unserer Bergsteigerin.
»Jenny, der Klaus hat einen Schacht gefunden. Der führt vielleicht zur Schaltzentrale. Eigentlich wollen wir dich da hoch schicken. Du kannst hier am besten klettern. Was meinst du?«
»Ich kann Berge, aber doch keine Schächte«, lachte Jenny, »das war die Schnapsidee von meiner Mutter.«
Sie stand aber auf und folgte Klaus und mir in den hinteren Teil des Parkhauses. Fritz folgte uns eilig und schüttelte dabei Bärbel etwas unsanft ab, was diese mit einem Kopfschütteln und einer eindeutigen Handbewegung kommentierte. Jennys derweil eingeschlafene Mutter bekam nicht mit, dass wir zur Schaltzentrale vordringen wollten.
Neben einem verschlossenen Ausgang an einer Wand, befanden sich drei Schalter. Einer für Feueralarm, einer für das Licht und einer mit unbekannter Funktion. Direkt kam mir die Idee, den Feueralarm zu drücken. Klaus sah das und hielt mich zurück.
»Dann bimmeln uns hier nur wieder die Ohren«, meinte er. »Lass uns erst mal schauen, ob wir in die Zentrale kommen. Wenn nicht, kannst du immer noch drücken.«
Klaus selber drückte den dritten, den roten Knopf. Ein helles Surren, etwa so wie das einer elektrischen Nähmaschine, erklang und eine Kamera, die sich oben rechts an der Decke befand, zeigte ein blinkendes, rotes Licht. Sie filmte nun offensichtlich. Klaus zeigte auf die Kabelverbindungen des roten Knopfes und der Kamera. Beide führten in einen unter der Decke befindlichen breiten Blechschacht, der sich über weite Teile der Parkhausdecke dahinschlängelte. Genau an der Stelle aber, wo die beiden Kabel im Schacht verschwanden, führte ein weiterer Schacht nach oben und dort durch die Decke hindurch.
»Da muss es lang gehen«, meinte Klaus. »Durch die Tür und durchs Treppenhaus geht es nicht. Die kriegen wir nicht auf. Beim Fahrstuhl habe ich es versucht. Da kommen wir nicht rein. Das hier ist der einzige Weg.«
Dabei schaute er erwartungsvoll in meine Richtung. Ich stand erst einmal da und wartete darauf, dass irgendjemand was sagen würde. Aber es geschah nichts. Ich schaute mich um und sah, dass nicht nur Klaus mich anschaute, sondern die anderen beiden, Fritz und Jenny, ebenfalls. Sie hatten mich in die Schublade mit der Aufschrift Entscheider gesteckt. Das wollte ich nicht.
»Wie soll Jenny da rein kommen und, wie sollen wir anderen dann später dadurch kommen?«
»Schau mal«, sagte Klaus und deutete auf eine nur schwach zu erkennende Schweißnaht an der Stelle, wo der durch das Parkhaus verlaufende Schacht mit dem Schacht, der nach oben führte, verbunden war.
»Los Langer, hiev mich mal hoch.« sagte Klaus zu Fritz.
Und der ließ sich nicht lange bitten. Mir nichts, dir nichts packte der zwei Meter zehn große Fritz den einen Meter sechsundsechzig kleinen Klaus und lud ihn sich auf die Schultern. Klaus hantiert nun mit einem Schraubendreher an der besagten Naht herum und fand auch sofort einen kleinen Schlitz. Selbigen versuchte er nun durch unentwegtes darin Herumstochern zu vergrößern. Na, das konnte ja was werden.
Mittlerweile gesellte sich auch Mahmut, der Feuerwehrmann zu uns. Als ob er hellsehen könnte, führte er ein stabiles, langes Nylonseil aus seinem Auto mit sich.
Klaus prockelte und prockelte und tatsächlich wurde der Riss zu einem Spalt, der Spalt zu einer Lücke und die Lücke langsam zu einem Durchlass. Am Ende ging es ganz leicht und er konnte das Blech soweit aufbiegen, so dass jeder von uns dadurch gepasst hätte.