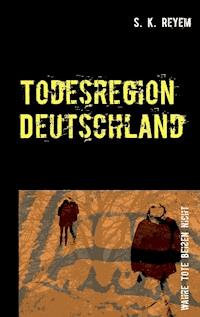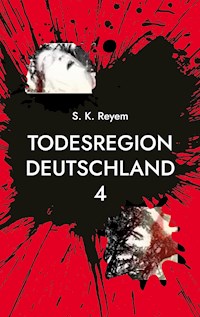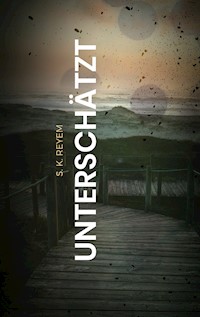
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Kontinent, drei Männer, ein Schicksal Während der blinde Pit, Überlebender eines blutigen Anschlags, alles daransetzt, seinen entführten Neffen ausfindig zu machen und Amir versucht, seine Familie aus den Kriegswirren in Vorderasien in Sicherheit zu bringen, muss Leon all seine Kraft aufwenden, einer über Deutschland und schließlich Europa hereinbrechenden tödlichen Epidemie zu entfliehen. Dass sie Teile eines einzigen heimtückischen Geschehens sind, mit dem ihr Schicksal eng verwoben ist, ahnen die Männer nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Irgendwann und irgendwo
18. April
19. April
20. April
21. April
22. April
23. April
24. April
25. April
26. April
27. April
28. April
29. April
30. April
1. Mai
2. Mai
Epilog
Irgendwann und irgendwo
»Mist, was ist das denn jetzt bloß? Das hat mir gerade noch gefehlt«, jammerte sie.
»Was? Was ist denn los?«, stammelte er.
»Mir ist plötzlich so unheimlich übel. Ich glaub, ich muss mich übergeben.«
»Ach du meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein. Komm hier an den Rand. Hast du was Schlechtes gegessen? Die Bratkartoffeln waren doch ok, die hatte ich auch. Vielleicht war es der Fisch …«
»Weiß nicht ... kann nicht mehr.«
»Du hast aber nichts anderes gegessen als ich. Eventuell …«
»Ich ...«
Gabi eilte zwischen die Büsche, die in dieser Gegend den Straßenrand zierten. Ein Röhren und Würgen, das nicht zur Schönheit des tiefen Grüns der mannshohen Sträucher passte, erreichte die Ohren ihres Freundes. Gabis ausgestoßene Töne gingen mit einem Schlag in ein lautes Stöhnen über.
Olafs Finger strichen über seine Nase und Wange. Er stand verloren da. Was sollte er jetzt unternehmen? Er vermochte sich nicht zu erinnern, Vergleichbares je mit Gabi erlebt zu haben.
Sie wurde doch eigentlich nie krank.
Erst mit dem dritten Versuch gelang es ihm, ein Taschentuch aus seiner Hosentasche zu fingern, um es Gabi zu reichen.
Bis zum Auto brauchen wir gut und gerne zwanzig Minuten und das auch noch zu Fuß. Wie sollen wir das denn jemals in diesem Zustand schaffen?
Olaf schaute sich um. Irgendjemand musste nun augenblicklich in der Lage sein, ihnen zu helfen. Die Würgegeräusche seiner Freundin in den Ohren suchten seine Augen die menschenleere Straße ab.
Menschenleer? Nein, dahinten stand doch irgendwer. Jemand stützte sich an einer Laterne ab und ... übergab sich ebenfalls.
Was ist denn hier los, dachte Olaf, ist das Zufall?
Olaf kräuselte seine Stirn. Das Lid seines linken Auges zuckte heftig. Sein Blick wanderte mehrfach zwischen seiner Freundin und dem Fremden an der Laterne hin und her. Voller Sorge heftete er sodann seine Augen auf Gabi. Die richtete sich mittlerweile auf. Mit dem Ärmel ihrer Bluse versuchte sie umständlich, sich Teile ihres Gesichts zu reinigen. Dabei schaute sie im Wechsel angewidert und hilfesuchend zu Olaf hinüber. Der zuckte bei Gabis Anblick zusammen. Den linken Arm wie zur Abwehr weit ausgestreckt, wich er zwei Schritte zurück.
Blut lief in feinen Bächen aus beiden Augen Gabis. Das rote Rinnsal fand seinen Weg über ihre Wangen. Es tropfte sodann auf ihre eben noch weiße Bluse. Sie blutete offensichtlich schon minutenlang. Die großen, feuchten Flecken auf ihrem Oberteil bewiesen dies.
Jetzt riss Gabi ihren Mund wie zu einem stummen Schrei weit auf. Ihre Augen weiteten sich.
Olaf stand stocksteif da. In seinen Augenwinkeln erkannte er, dass das von Gabi erbrochene Blut die Sträucher und obendrein den Boden großflächig bedeckte.
Sein Unterbewusstsein nahm erneut den Fremden von der Laterne wahr. Der Mann schwang seine Arme wie nach Insekten schlagend um sich. Mit Gejaule und Gestöhne eilte er schnellen Ganges auf Olaf zu.
Gabi öffnete ihre Handtasche. Blutbesudelt hing sie nach wie vor über eine ihrer Schultern. Olaf schaute regungslos zu, wie seine Freundin der Tasche ein Schweizer Taschenmesser entnahm. Sie versuchte, mit ihren blutverschmierten Fingern die große Klinge des Messers aufzuklappen. Dabei rutschte sie mehrfach ab. Mit dem nächsten Versuch gelang es ihr jedoch.
Was hat sie denn jetzt damit vor?
Gabi nahm das Messer in die linke Hand. Ihre Absicht konnte man ihrem wütenden Gesicht nicht ansehen. Urplötzlich stach sie sich drei-, viermal in den Leib. Sie trieb die Klinge bis zum Schaft in ihren eigenen Körper.
Olaf entwich ein Stöhnen. Er schrie auf, verstand die Welt auf einmal nicht mehr. Von der Seite stürmte weiterhin der Fremde von der Laterne heran.
Gabi ließ das Messer fallen. Ihre rechte Hand fuhr zu ihrem Bauch. Die soeben aufgerissenen Augen schlossen sich. In der Sekunde schoss ein Schwall rötlich-grüner Flüssigkeit aus ihrer Nase. Ein letztes Röcheln. Gabi sackte, wie vom Blitz getroffen, an Ort und Stelle zusammen.
Der mit boshaftem Blick laut kreischende, mit den Armen um sich schlagende Fremde hatte die Distanz verkürzt. Er befand sich in diesem Augenblick nur fünf Schritte von Olaf entfernt.
Jetzt erst löste sich seine Schockstarre. Er hob abwehrend die Arme. Bei einem Schritt vorwärts stolperte er über seine eigenen Füße. Sein Blick richtete sich starr auf seine am Boden liegende Freundin. Da verkrampften sich seine Bauchmuskeln. Seine Wangen blähten sich auf. Er drückte sich eine Hand auf den Bauch und presste die Lippen aufeinander. Den aus seinem Mund schießenden Schwall konnte er dennoch nicht aufhalten.
18. April
Journalistin, vor der es keine Geheimnisse gibt! Zu gerne hätte sich Martha diese Berufsbezeichnung auf ihre Visitenkarten drucken lassen. Sie liebte es, wenn sie von Lesern wegen ihrer Artikel auf der Straße angesprochen wurde. Sendeten Fans Leserbriefe ein, in denen sie als Kämpferin gegen unerhörte Vorgänge in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft bezeichnet wurde, genoss sie das. Sie liebte es, gelobt zu werden. Dafür lebte sie. Martha schnalzte bei dem Gedanken mit der Zunge. Mit beiden Händen strich sie sich über die Oberschenkel. Der Stoff der Jeanshose schmeichelte ihren Handflächen. Die dünn wirkende Frau mit der konturenarmen Figur stand von ihrem Schreibtisch auf. An der nahen Kaffeemaschine wollte sie ihre Tasse neu füllen.
Martha formte ihre dünnen Lippen zu einem Kussmund. Behutsam nippte sie an dem Getränk. Gedankenverloren schaute sie den menschenleeren Flur zur Ausgangstür ihrer Redaktion entlang. Aus keinem anderen Raum drang Arbeitslärm herüber. Es war bereits zu spät. Sie war alleine.
Die Gedanken an die kommenden Tage ließen Marthas Augen leuchten. Dank ihrer guten Freundin Roswitha, befand sie sich in der von ihr so sehr geliebten Situation. Sie durfte ermitteln. Es hatte nicht zu verachtende Vorteile, die Vorzimmerdame eines der größten deutschen Pharmakonzerne zu kennen.
Jetzt bin ich dran an der Geschichte, das wird ein gewaltiger Fall.
Martha klopfte mit dem Zeigefinger an ihre Tasse. Schon eine Weile beschäftigte sie sich mit der Recherche in dieser Affäre. Ihre bisherigen Resultate hatte sie ihrer Redaktion längst präsentiert. Die Ergebnisse hatten ihre Chefs tief bestürzt. Ein beispielloser Skandal. Die endgültige Aufdeckung der Hintermänner würde für sie einen einmaligen Erfolg darstellen. Ihre Leserschaft würde aus allen Wolken fallen.
Martha nickte mehrmals. Sie kniff ihr rechtes Auge zu und dachte an geschlossene Betriebe, verhaftete Übeltäter und Pressekonferenzen. Die Gedanken an die ihr dafür zu überbringenden Ehrungen ließ sie lächeln. Sie glaubte, schon den festen Händedruck des Bundespräsidenten zu verspüren. Martha zucke zusammen. Jetzt riss sie sich lieber wieder aus den Träumen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Zurück an ihrem Schreibtisch im Bürogebäude der Medien-Kunkel-Gruppe ordnete sie die Schriftstücke, die vor ihr lagen. Der Bürostuhl knarrte bedächtig. Sie beugte sich vor, um im Computer erneut ihre Beweise durchzugehen. Ein weiteres Mal kam ihr dabei Roswitha in den Sinn. Mit einem Schmunzeln blickte Martha auf das erste Aufeinandertreffen mit ihrer späteren Informantin von Asketis Pharma international zurück. Zufall, reiner Zufall, so hieß der Kollege, der ihr diese Quelle direkt in die Arme getrieben hatte.
Wie so oft im Leben.
Wie in einer Filmvorführung im Kino erlebte Martha die erste Begegnung mit Roswitha aufs Neue. Mit geöffneten Lippen und weiten Augen verfolgte sie gespannt die Szenerie, die sich vor ihr im Geiste abspielte.
Wie so oft, war sie einer langjährigen Leidenschaft gefolgt. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte sie am FKK-Strand der Nordseeinsel Borkum gesessen. Ein Sonnenbrand hatte sich angekündigt. Wegen des heißen Gefühls hatte sie ihre Schultern mit einem Seidentuch bedeckt. Ansonsten trug sie nichts. Die Nordsee hatte kleine Wellen mit weißer Schaumkrone geschlagen. Am überfüllten Sandstrand hatte sich nur schwer ein freies Plätzchen gefunden. Ein angemessener Abstand zwischen den unbekleideten Leibern war ihr schließlich wichtig.
Eine unübersehbar attraktive Dame betrat damals den Zugang zum Strand. Kurz hatte sie ihren Blick über die Umgebung schweifen lassen, als wollte sie abwägen, ob es sich lohnen könnte, die eine oder die andere Richtung einzuschlagen. Letzten Endes schien sie zu einem Entschluss gekommen zu sein. Wie eine Welle wogte sie an den Strand. Die Gespräche der Umliegenden hatten gestockt. Gesichter hatten sich der Frau zugewandt. Aber die junge Lady hatte durch sie hindurchgesehen, als wären sie Luft. Lag es an ihrer auffällig wohlgeformten Figur, dass in den Männeraugen etwas Gieriges aufgeblitzt hatte? Die Fremde hatte lächelnd ihr Kinn gehoben. Ihre Augen hatten weiter nach einem freien Platz für ihr Handtuch zwischen den in der Sonne bratenden Körpern gesucht. Neben Martha war sie zum Stehen gekommen. Ihre auffällig blauen Augen hatten sich eingetrübt, während sie zu allen Seiten Ausschau gehalten hatte.
»Suchen Sie ein freies Plätzchen? Nehmen Sie doch hier neben mir Platz. Ich beiße nicht«, hatte Martha, die zielgewiss den Anfang einer neuen Story gerochen hatte, lachend geäußert.
»Oh, gerne!«, hatte die junge Frau geantwortet.
Roswitha hatte ihr Badetuch auf dem Boden ausgebreitet. Dabei lächelte sie aufreizend. Martha fielen ihre geschmeidigen Bewegungen auf. Mit einem anmutigen Schwung ließ sie sich auf dem Tuch nieder.
»Ich heiße übrigens Martha. Martha mit Te-Ha.«
Die junge Frau hatte herzhaft gelacht. Sodann hatte sie sich vorgebeugt. Zwischen ihren Augenbrauen hatte Martha deutlich die drei sich kräuselnden Lachfältchen ausgemacht.
»Und mein Name ist Roswitha – ebenfalls mit Te-Ha.«
Diese erste Begegnung lag acht Monate zurück. Aus der harmlosen Plauderei über Vornamen und deren Schreibweisen entwickelte sich bald eine gute Freundschaft. Häufig hatten sie sich seitdem getroffen. Dabei wurden immer intensivere Gespräche geführt. Das ging weit über lockere Plaudereien hinaus. Aus der Strandbekanntschaft wurde eine Freundin. Aus der Freundin wurde ein hoch interessanter Firmenkontakt. Roswitha wusste so einiges zu erzählen. Aus dem Firmenkontakt wurde letzten Endes eine Informantin. Matha hatte damit eine Quelle gewonnen, die sich ohne Scheu oder Gewissensbisse mit Betriebsgeheimnissen brüstete. Roswitha hatte unzählige Berichte über ihren Arbeitgeber verfasst. Dazu legte sie Unterlagen und Beweise vor.
Das alles erzeugte eine Gänsehaut auf der Haut der Pressefrau. Sollte Asketis Pharma International es tatsächlich gewagt haben? Hatten sie in der Tat Versuche an Menschen in Osteuropa durchgeführt? Nutzten sie dazu Mittel, die nicht zugelassen waren? Stück für Stück hatte Martha die Fakten zusammengetragen. Das Ungeheuerliche lag in dieser Sekunde schwarz auf weiß vor ihr.
Martha räusperte sich. Sie hüstelte einmal und schaute auf ihre Recherche. Der Kloß im Hals störte immer noch. Sie hob den Kopf und nickte. Das letzte, entscheidende Puzzle-Stückchen sollte sich morgen einfügen. Roswithas Worte aus dem unlängst geführten Telefonat schwirrten in Marthas Ohren.
»Ich habe es genau durch die angelehnte Bürotür gehört. Mein Chef hat es ganz laut gesagt. Glaub mir, ich habe jedes Wort und alle Einzelheiten absolut klar verstehen können. Wenn sich die Zwei treffen, kommt das dem Startschuss der ganzen Sache gleich. Dann gäbe es keinen Point of Return mehr. Die Galgenvögel. So hat er sie genannt. Die hätten früher schon immer ihre Finger drin gehabt, wenn es sich um Versuche an Menschen handelte.«
Martha sah darin den entscheidenden Beweis. Die Leute würden die ganze Geschichte in ihren Zeitungen lesen. Sie würden auf sie absolut undenkbar wirken. Deswegen benötigte sie unbedingt diesen Beleg. Die zwei Männer verband sonst nichts miteinander. Einzig und allein ihr kriminelles Vorleben hatten sie gemein. Trafen sich diese beiden Kerle jetzt im Namen des Pharmaunternehmens, läge das Unaussprechliche unübersehbar auf der Hand.
Wenn ich es wage, den Artikel, ohne diesen Beweis zu veröffentlichen, vernichten die Mistkerle alle Beweismittel. Die Beschuldigungen würden sie hemmungslos dementieren. Meine Vorwürfe laufen dann ins Leere. Ich brauche den Beweis.
Sonst stände am Ende Aussage gegen Aussage. Marthas auf einen Spitzel aufgebaute Argumentation würde von gegnerischen Anwälten zerpflückt. Ihre Reputation in der Branche wäre zerstört. Das durfte sie auf keinen Fall zulassen.
Wenn ich euch morgen an der Angel habe, schlage ich zu. Dann lest ihr das in einer der größten Tageszeitungen Deutschlands, und zwar in der Samstagsausgabe. In dem Moment habe ich euch. Somit bewahre ich die Welt vor euren Schandtaten. Das Schönste dabei, ich werde gefeiert. Für euch geht es dann nur noch in eine Richtung, in den Knast.
Hollywood hätte seine Freude an der verschlagenen Mine Marthas gehabt. Sie lachte laut auf, atmete heftig. Ihre Gedanken kreisten durch ihr Hirn wie Beute umzingelnde Haifische. Kleine Schweißperlen zeigten sich auf ihrer Stirn. Sie biss sich leicht in die Unterlippe. Im Angesicht des zu erwartenden Erfolgs gab sie laut vernehmbar einen Seufzer von sich.
Und Roswitha? Was wird aus ihr?
Martha rümpfte die Nase. Egal war ihr das nicht.
Die ist doch jederzeit in der Lage, sich einen neuen Job und einen anderen Kerl zu suchen. So wie die aussieht, wird jeder Personalchef willenlos. Am Ende habe ich ihr nur einen Gefallen getan, dass sie weg von diesem Wahnsinnigen kommt. Ich glaub, das wird ihr guttun.
Martha machte eine wegwerfende Handbewegung. Damit wischte sie ihre anfänglichen Bedenken beiseite. Es war nichts mehr zu ändern.
Für den morgigen Tag stand alles bereit. Hochzeit eines Kollegen. Sie nickte selbstgefällig. Nicht zum ersten Mal in ihrer beruflichen Laufbahn würde sie sich optisch verändern. Der Bräutigam schätzte ihre Kostümierung. Die kleine Freude würde sie ihm bereiten. Wie der Schriftsteller sein Pseudonym, liebte sie die Maskerade. Marthas Verkleidung zur alten, gebrechlichen Dame war ihr zur zweiten Haut geworden. Viele Menschen in ihrem Umfeld kannten sie nur in diesem Outfit. Das eine oder andere Mal erleichterte das die Recherche. Einige Kollegen vermuteten sogar zwei Personen dahinter, einmal Martha, zum anderen eine alte, kränkliche ehemalige Kollegin.
In Gedanken ordnete sie: Der Rollator stand neben der Bürotür, Hörgerät und graue Perücke lagen ebenso, wie eine Tube Schminke und Puder auf der kleinen Ablage vor dem Badezimmerspiegel, der auf der anderen Seite der Tür an der Wand hing. Alles da.
19. April
Ein Mann mit nicht zu bestimmenden Alter bewegte sich auf der Hauptgeschäftsstraße in der Essener Innenstadt. Uniformiert mit dunklem Anzug und weißem Hemd, näherte er sich dem ältlich wirkenden Café. Auf den Stufen, die zum Eingang des Cafés führten, wischte er sich, erst links, dann rechts, mit raschen Handbewegungen die Nässe des Regens von den Schultern, der den lieben langen Tag aus dem wolkenverhangenen Himmel fiel.
Er betrat sodann das Café, verharrte eine Zeit am Eingang und schaute sich suchend um. Nur zwei Gäste saßen an unterschiedlichen Tischen und nippten an ihren Getränken.
Nicht gerade gut besucht der Schuppen.
Der Mann versuchte erneut, sich die Nässe von den Schultern zu wischen. Er stellte seinen Stockschirm in eine Vase neben dem Eingang. Dabei reckte er seinen Hals, um etwas Abstand zwischen diesem und der eng gebundenen Krawatte zu schaffen.
»Mein Gott«, flüsterte der Neuankömmling, »Robert von Ortwich lag goldrichtig. Die Falle ist zugeschnappt.«
Ohne dass sich sein Gesichtsausdruck nur im Geringsten änderte, steuerte er sodann auf einen Tisch im hinteren Areal des Cafés zu. An diesem saß ein anderer Mann, der soeben das mit seinem Milchkaffee gelieferte Plätzchen aß. Diese Person saß in einem ebensolchen Outfit da, wie es der Hereinkommende trug.
»Schmidt aus Hamburg«, stellte sich der an den Tisch Gekommene seinem Gegenüber ungewöhnlich laut vor.
»Angenehm, Lehmann aus Bremen«, grüßte der andere in ebensolcher Lautstärke zurück. Dabei hob er flüchtig den rechten Arm.
Nach kurzem Getuschel beugten sich die beiden Herren umgehend über diverse Unterlagen und Papiere. Diese lagen ausgebreitet vor ihnen die auf dem kleinen Tisch. Sie steckten die Köpfe zusammen, unterhielten sich nicht mehr so laut wie bei der Begrüßung. Im Gegenteil. Sie flüsterten miteinander. Immer wieder schauten sie sich suchend und misstrauisch um. Schmidts Blick blieb dabei häufig an der älteren, grauhaarigen Dame hängen, die zwei Tische weiter bei einem Kännchen Kakao saß. Die elegante Frau versuchte die ganze Zeit, ihr auffälliges Hörgerät in ihrem rechten Ohr verborgen zu halten.
Dass es sich ausgerechnet um sie handelte, damit konnte beim besten Willen niemand rechnen. Ihre Maskerade hielt er, obwohl er die Gestalt darunter eindeutig erkannte, für recht gelungen.
Feiner Trick, dachte Schmidt.
Die betagte Dame hatte sich absichtlich auf dem von ihr eingenommenen Platz niedergelassen. Von hier aus war sie in der Lage, das gesamte Café einzusehen. Als erst Lehmann und später Schmidt das Kaffeehaus betraten und einen Tisch im hinteren Teil einnahmen, nickte sie unmerklich. Ohne die Notwendigkeit, die Position zu wechseln, vermochte sie die beiden Herren in den dunklen Anzügen zu beobachten. Durch das Spiegelbild der Glasscheibe der antiken Vitrine entging ihr nichts. Nur das Abhören mit dem als Hörgerät getarnten Aufnahmegerät funktionierte mal wieder nicht so, wie es sollte. Martha tippte mit dem Zeigefinger ein ums andere Mal gegen das Gerät.
Wohl schlechter Empfang, dachte Schmidt und feixte in sich hinein.
Robert von Ortwich irrte sich mal wieder nicht. Jetzt würde die Alte ihren Zeitungsartikel im Sinn haben. Der sollte vermutlich in einer der größten Tageszeitungen Deutschlands erscheinen. Aus den von Schmidt und Lehmann ab und an hingeworfenen Sprachfetzen würde sie versuchen, sich ihre Sensationsgeschichte zusammenzuzimmern. Doch soweit würden sie es nicht kommen lassen.
Irgend so eine Dummbratze von der Presse meint zu durchschauen, worum es wirklich geht oder zumindest ahnt derjenige etwas.
Genau das waren die Worte von Robert von Ortwich. Nur wer in persona dahinter steckte, war bis eben im Verborgenen geblieben.
Wieder tippte die alte Dame an ihr Hörgerät.
Schmidt sah sich geheimnisvoll um. Ein verschmitztes Grinsen umspielte seine Lippen. Das Schauspiel überzeugte.
Die zwei Tische weiter sitzende ältere Lady hatte genug gehört. Martha fummelte an ihrem Aufnahmegerät herum, stellte es auf stumm, zahlte ihren Kakao, erhob sich und schleppte sich an ihrem Rollator geklammert, behäbig in Richtung Ausgang. Dabei nahm sie sich fest vor, die auffällig quietschende Gehhilfe bald zu ölen. Martha spürte die ebenso prüfenden, wie boshaften Blicke der beiden Herren in dunklen Anzügen in ihrem Nacken. Den Griff des einen zum Handy nahm sie im Augenwinkel wahr.
20. April
Robert von Ortwich zog sich in sein Arbeitszimmer zurück. Das ewige Gezeter seiner Ehefrau raubte ihm den letzten Nerv.
Zum Glück hat das bald ein Ende, dachte er.
Von Ortwich lehnte sich in seinem Ledersessel zurück. Stufe Eins des Projekts nahm in diesen Tagen seinen Anfang. Er würde nur noch wenige Wochen ausharren müssen. Dann würde er auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Seiner gewohnten Umgebung würde er Lebewohl sagen. Ein neues, besseres Leben wartete auf ihn.
Der Geruch des alten Leders erinnerte Robert von Ortwich an seine Jugend. Vor seinem geistigen Auge tauchte ein junger Mann mit langen, blonden Haaren und blauen Augen auf. Von der stattlichen Mähne war nichts geblieben. Die stahlblauen Augen, die es verstanden, so hart und unbarmherzig ihr Gegenüber zu mustern, leisteten ihm bis zum heutigen Tage treue Dienste. Häufig hatte er sie gewinnbringend für sich eingesetzt.
Robert von Ortwich war der Spross einer dem Soldatentum verhafteten Familie. Seinen Großvater väterlicherseits hatte er nie kennengelernt. Der war im Ersten Weltkrieg gefallen. Das Geschoss einer Granate hatte ihm förmlich den Kopf von den Schultern gerissen. Als letzter Überlebender seiner vollkommen aufgeriebenen Einheit hatte er versucht, einen französischen Schützengraben zu erstürmen. Oberst von Ortwich, auf sich allein gestellt, hatte so den Tod gefunden. Das kleine Dorf in der Eifel, aus dem er einst stammte, widmete ihm, einem entfernten Abkömmling von Friedrich dem Großen, ein Reiterdenkmal mit Oberst in Uniform. Jedes Jahr legte die Familie von Ortwich hier einen Kranz mit lautem Tamtam nieder.
Roberts Vater hatte ebenfalls den Rang eines Obersts getragen. Sein Leben wurde zum Ende des Zweiten Weltkriegs ausgehaucht. Seinen Befehlen folgend hatte er versucht, den Führerbunker mit einer Hand voll jugendlicher Volkssturmsoldaten zu verteidigen. Aufrechtstehend und den mit einer roten Hakenkreuzbinde versehenen rechten Arm in die Höhe richtend, war er durch die Kugel eines russischen Infanteristen gestorben.
Robert selbst war dem Vorbild vieler Generationen seiner Familie vor ihm nicht gefolgt. Er war nie Militarist geworden. Diesen Makel ließ ihn seine Verwandtschaft, angefangen bei der Großmutter und endend bei seiner Schwester, bei jeder sich bietenden Gelegenheit spüren.
Sein Einser-Abitur, das Studium der Wirtschaftswissenschaften in nur vier Semestern, seine dreijährige Hochschulausbildung der Pharmazie, welche er als Jahrgangsbester mit dem zweiten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung abschloss – das alles zählte für seine Familie nicht. Seine exzellente Ausbildung fand keine Anerkennung. Die Tatsache, dass Robert von Ortwich als Vorstandsvorsitzender des weltweit agierenden Pharmakonzerns Asketis Pharma International jedes Jahr mehrere Millionen Euro nach Hause brachte und seine komplette Familie davon in Saus und Braus leben konnte, blieb ebenso ohne Akzeptanz.
Für ihn selbst dagegen spielte sein Vermögen keine wichtige Rolle. Geld empfand Robert von Ortwich nur als notwendig. Man besaß es, sonst nichts. In Respekt, Anerkennung und Macht – von Robert immer gerne mit den Anfangsbuchstaben RAM abgekürzt – bestand sein Lebenselixier. Wie die nach Salz gierende Ziege oder die nach Blut lechzende Stechmücke verlangte es Robert von Ortwich nach RAM, immer und immer wieder RAM.
Und seine Ehefrau? Die verstand es, sein Geld im hohen Bogen aus dem Fenster zu werfen. Ein Kleidchen hier, ein Blüschen dort, ein Techtelmechtel an der einen Ecke und einen Liebhaber an der anderen Ecke. Dazu ewig und drei Tage lang dieses Genörgel. Lass die Socken nicht liegen, mach das Licht an, mach das Licht aus, wie läufst du denn heute rum, ich hab nichts anzuziehen, der Mann von meiner Freundin ist viel netter – und so weiter und so fort.
Robert von Ortwich huschte ein Lächeln über die schmalen Lippen.
Sie alle, einer nach dem anderen, werden in den kommenden Wochen und Monaten ihre wohlverdiente Quittung bekommen. Dann werden sie den höchst denkbaren Preis für ihre Respektlosigkeit mir gegenüber zum guten Schluss zahlen.
Jetzt, wo endlich die undichte Stelle im Unternehmen entdeckt war. Jetzt, wo die Falle für die Presse zugeschnappt hatte. Jetzt, wo auch dieses Problem morgen gelöst werden würde. Jetzt, wo nur noch ein paar klinische Tests, die in Osteuropa abgewickelt werden sollten, fehlten. Just in diesem Moment würde er seine treudummen Vasallen Lehmann und Schmidt zur Tat schreiten lassen. Dann dauerte es nur noch wenige Wochen.
RAM, dachte von Ortwich.
Ein verwegener Gesichtsausdruck zog sich über sein wie aus Erz gegossenes Gesicht.
Eine Ameise hatte den Weg aus dem Garten in das Arbeitszimmer gefunden. Sie krabbelte über Roberts Schreibtisch. Genussvoll streckte von Ortwich den Zeigefinger seiner rechten Hand aus, ließ ihn eine Zeit lang oberhalb der Ameise schweben, grinste und zerdrücke das Tier sodann.
21. April
Pit ertastete den Deckel seiner Armbanduhr, öffnete diesen und fingerte nach der Uhrzeit. Einer seiner Finger touchierte den kleinen Zeiger, der auf die Vier deutete. Schließlich fand er den großen Zeiger, der direkt die Sechs berührte.
Sechzehn Uhr dreißig, dachte Pit, Zeit, um die Schuhe anzuziehen.
Heute feierte Pits Nichte ihren dreiunddreißigsten Geburtstag. Dazu lud sie die gesamte Familie in ein stadtbekanntes Steakhaus ein. Es lag in der Nachbarschaft des Essener Erholungsparks Gruga. Pit freute sich darauf.
Pits Leben gestaltete sich in den Jahren nach der Diagnose seines Augenarztes nicht mehr sonderlich ereignisreich. Der hatte eine exsudative Netzhautablösung festgestellt. Da stellte die Geburtstagsfeier seiner Nichte durchaus einen besonderen Anlass für ihn dar.
Ungern erinnerte er sich an die Worte des Arztes, in denen Pit eine gewisse Euphorie mitschwingen hörte.
Das bekommen wir in den Griff.
Nichts bekam er in den Griff. Die Blitze vor Pits Augen wurden zunehmend heller. Die Mückenschwärme, die von seinen Augäpfeln hin und her zuckten, entfalteten sich in steigendem Maße. Sein Gesichtsfeld zeigte eine gegenteilige Reaktion. Es wurde immer kleiner. Von den Rändern her legte sich ein schwarzer Vorhang über seine Augen, jeden Tag ein bisschen mehr. Und dann, eines Tages, war und blieb alles dunkel.
Zu den heutigen Feierlichkeiten würde er seine gesamte Familie, einmal wiederhören. Dazu zählen seine Schwester, sein Schwager, seine Nichte und ihr Ehemann, deren kleiner Sohn Simon, den Pit immer gerne Pepe nannte, sein Vater sowie eine alte Tante.
Geschniegelt und gespornt auf der Straße angekommen, zog Pit ein rund zwanzig Zentimeter langes, stabiles, rotes Gummiband aus der Hosentasche. Die Enden des Bandes nahm er je in eine Hand, ließ das Band locker, hob beide Hände nahe an ein Ohr. Er zog das Gummi schlagartig stramm. Fasziniert lauschte er den Geräuschen, die von den Schwingungen des Bandes erzeugt wurden.
Pünktlich hielt das von ihm vorher bestellte Taxi neben der Straßenlaterne, an der er lehnte. Pit verstaute sein Gummiband, welches er immer bei sich trug. Ein Griff zur Tür des Fahrzeugs – der Türgriff befand sich exakt auf Gürtelhöhe – und Pit wuchtete sich mit Unterstützung seines weißen Stocks auf den Rücksitz.
»Anschnallen«, quäkte die Stimme des Fahrers von vorne.
»Ich weiß, Herbert. Mach ich.«
»Wie geht’s dir denn so, mein Junge?«
»Ganz gut so weit. Freue mich auf das Essen.«
»Wird ja auch mal Zeit, dass du wieder was an die Rippen kriegst.«
»Wieso das denn?« lachte Pit, »kannst du dich vielleicht nicht mehr an früher erinnern, was?«
»Oh doch, mein Junge. Das kann ich sehr wohl. Weiß noch genau, wie du am Porscheplatz fast die Autotür aus der Verankerung gerissen hast. Ich dachte noch, was kommt da denn an.«
»Na komm, so schlimm war das nicht.«
»Das glaubst auch nur du. Auf deine Größe – na was mag es gewesen sein? Einhundertachtzig Zentimeter vielleicht. Darauf verteilten sich doch locker einhundertfünfundsiebzig Kilogramm aus Knochen, Fleisch und hauptsächlich Fett.«
»Guck lieber auf die Straße«, sagte Pit und lachte.
Einmal angefangen ließ sich Herbert nicht mehr stoppen.
»Deine unförmige Masse steckte in einer grauen, pluderigen Jogginghose. Du trugst ausgeleierte Sportschuhe. Ein blaues T-Shirt bedeckte nur notdürftig die diversen Bauchrollen.«
Pit grinste vor sich hin, sagte dazu lieber nichts. Herbert, der Taxifahrer, der über lange Jahre hinweg zu seinen besten Freunden zählte, lag ja richtig.
Wie lange war das her?
»Zwei Dinge trugst du damals zwischen deinen dicken Fingern mit dir herum. Kannst du dich noch erinnern? Einen ausgefüllten Mitgliedsantrag für den Kampfsportclub Frohnhausen-Ost und einen Fünf-Euro-Schein. Mit dem wolltest du den ersten Monatsbeitrag begleichen. Frohnhauser Löwe werden, so hieß dein Traum. Das hast du, so unglaublich das auch klingt, voller Überzeugung gesagt.«
Pits Blick verdunkelte sich. Seine Gedanken wanderten zehn Jahre zurück. Innerhalb von sechs Monaten hatte sich zu jener Zeit sein Leben geändert. Zunächst war seine Mutter verstorben, die zeitlebens den Ärzten und der modernen Medizin vertraut hatte. Pits Nichte behauptete sogar einmal, sie hätte mehr Arztbesuche als Mahlzeiten aufzuweisen. Dann starb Pits Schwiegermutter, die nach dem Credo ›was kommt geht auch wieder‹ gelebt hatte. Sie hatte auf Gott vertraut, daher nie einen Arzt besucht. Zu guter Letzt war Pits Frau erkrankt. Sie hatte den Heilpraktikern vertraut und auf gute Ernährung geschworen. Das hatte ihr keinen Nutzen eingebracht. Pits Frau war ebenfalls gestorben. Aus seiner Sicht leider viel zu früh.
»Da sind wir. Ruf durch, wenn ich dich wieder abholen soll. Wünsch dir ne Menge Spaß«, riss Herberts fröhlich klingende Stimme Pit aus seinen trüben Gedanken.
Pit verharrte einen Augenblick auf der Rückbank des Wagens, um sich zu sammeln. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sein rechtes Auge tränte. Letztendlich verließ er das Taxi. Da hörte er schon die kindliche Stimme seines Großneffen und kleinen Freundes Pepe.
»Pit, hier bin ich. Komm hier hin!«
Der Fünfjährige wartete direkt am Eingang des Restaurants aufgeregt auf Pit. Er nahm ihn freundlich in Empfang und geleitete ihn an der Hand zu seinem Platz. Das zählte immer zu seinen Aufgaben, wenn sie sich trafen. Pepe hatte den Durchblick, wie er Pit am besten platzierte, damit diesem die Nahrungsaufnahme ohne größere Unglücke gelang. Dieses wichtige Amt ließ sich der kleine Junge auf gar keinen Fall nehmen.
Wie immer saß Pepe direkt neben Pit. Dabei erzählte er ihm spannende Geschichten aus seiner Kindergartenwelt. Ab und an fragte Pit einmal nach oder verlangte um genauere Erklärungen und Einzelheiten. Ansonsten redete nur Pepe.
Da sich die Familie nicht zum ersten Mal in diesem Restaurant traf, benötigte Pit keinerlei Hilfe bei der Auswahl seiner Speisen. Er kannte das Angebot. Schon seit Tagen freute er sich auf das saftige Rindersteak.
Pits Vater sprach mit seinem Schwager und mit Pepes Vater über Rot-Weiss Essen. Diesmal bedauerten sie nicht die jahrelange Unfähigkeit des Vereins, sich im Profifußball zu etablieren. Heute freuten sie sich über den kürzlichen Aufstieg in Liga drei. Die Frauen am Tisch fanden ihre eigenen Themen. Für Pit und die anderen Männer waren diese eher uninteressant.
Schon kurz nachdem die Bestellung des Essens hinter ihnen lag, wartete Pit hungrig auf die Rückkehr der Kellnerin. Bald würde sie mit vielen Tellern vollbeladen an ihrem Tisch stehen.
»Hat dich Herbert wieder gefahren«, fragte aus heiterem Himmel Pits Nichte.
Pit schaute auf. Pepe maulte mürrisch ob der Unterbrechung. Die Fußball-Kenner stoppten ihr Gespräch.
»Na klar, dem brauche ich nicht großartig zu erklären, dass ich nichts sehe. Wo ich hinwill, versteht er sofort.«
»Ja, ja. Sei ehrlich. Du magst den Herbert. Das ist der Grund, warum du mit ihm immer fährst, oder? Ich möchte darauf wetten, dass kein anderer Taxifahrer der Welt überhaupt merkt, dass du nicht in der Lage bist zu sehen.«
Pits Vater strich sich über den stoppeligen Bart.
Wohl wieder heute Morgen nicht rasiert, dachte Pit.
Seinem feinen und so ausgezeichneten Gehör entging so etwas nicht.
»Der war doch nach deinem Absturz dein erster Freund, hab ich recht?«
»Stimmt, Paps. Herbert hat mir immer zugehört«, sagte Pit nachdenklich.
»Das müsst ihr euch mal vorstellen – sechs Monate mit drei Todesfällen und einer Erblindung. Der Junge war mal ein voranstrebender Angestellter im mittleren Management. In diesem florierenden Bauunternehmen. Wie hieß das gleich? Das warst du doch Pit, oder? Dann wurde aus ihm im Handumdrehen ein nicht mehr zu gebrauchender Arbeitsloser«, fuhr Pits Vater fort.
Dabei trommelte er immer schneller werdend mit den Fingern der rechten Hand auf den Holztisch vor sich.
»Das ist schon lange Vergangenheit«, mischte sich Pits Tante schnippisch ein.
Sie konnte wegen ihrer oft hochmütigen Art niemand am Tisch leiden. Dadurch ließ sie sich nicht aufhalten und fuhr fort.
»Oder willst du uns etwa schon wieder erzählen, dass aus einem anerkannten und gern gesehenen Mitglied eines großen Freundeskreises ein einsamer, nicht mehr eingeladener Behinderter wurde? Das kenne wir doch schon zu Genüge.«
Pits Vater atmete tief durch. Pit wusste sofort, dass er sich in der Sekunde aufrichtete. So wirkte es, als ob er um einige Zentimeter wuchs.
»Jetzt reicht es aber Margarete! Der Junge quälte sich ganz schön mühevoll durchs Leben. Darüber kann man auch nach Jahren noch reden. Oder kennst du spannendere Geschichten?«
Jetzt streiten sie wieder. Pit legte seine Stirn in Falten. Wie immer.
»Ich weiß, ich weiß, Rudi. Verbittert und enttäuscht bot der Junge der kleinen Welt, die ihm blieb, das Bild eines bedauernswerten Mitglieds am Rande der Gesellschaft – nicht mehr benötigt, nicht mehr gerne gesehen. Von Selbstmitleid zerfressen. Völlig verarmt. Abhängig von den Behörden. So bezog der Eiterpickel am Arsch der Gesellschaft eine Einzimmerwohnung in einem Heim im Norden der Stadt. Das kann ich schon alles singen.«
»Hört doch auf zu streiten. Wir wollen Geburtstag feiern«, bat Pits Nichte um Mäßigung.
»Ich weiß, ich weiß«, äffte Pits Vater die Tante jetzt nach.
Pit vernahm den schwerer gehenden Atem seiner Tante, die rechts von ihm saß.
Zum Glück habe ich heute ausgezeichnete Laune. Könnte ihr ja mal mit der Handkante …
Die in zehn Jahren erworbenen Fähigkeiten in Jiu Jitsu, gepaart mit den Befähigungen seines Gehörs, hätten ihm die Möglichkeiten gegeben, mit der Handkante gezielt zuzuschlagen. Doch Pit zählte nicht zu den als gewalttätig einzuschätzenden Männern. Eine Frau, selbst wenn es sich um seine Tante handelte, die ihn seit der Erblindung wie einen Menschen zweiter Klasse behandelte, würde er schon gar nicht schlagen. Obwohl, manchmal gab sie sich alle Mühe, es einem verdammt schwer zu machen.
Pits Schwester legte einen singenden Unterton in ihre Stimme.
»Ja, ja, in der Gewissheit, nichts wert zu sein, wählte Pitt die Einsamkeit. Seine liebsten Begleiter wurden Currywurst, Pommes und Mayonnaise, was sich schon bald auf seine Körpermaße auswirkte. Und die gute alte Currywurst liebt er heute noch.«
Jetzt brachen alle am Tisch in Gelächter aus. Pit verstand die auf ihn gemünzte Anspielung. Er lachte herzhaft mit. Seine Schwester kannte ihn gut. Sie begriff seinen Humor. Er wusste, dass sie wusste, dass es ihn nicht störte, wenn über seine schwergewichtige Vergangenheit geredet wurde. Heute wog Pit nur knapp die Hälfte der damaligen Kilos. Darüber hinaus zählte er zu den wendigsten Jiu-Jitsu Kämpfern Deutschlands.
Das brach die lausige Stimmung. Vater und Tante würdigten sich keines Blickes mehr, was Pit an deren Atmung festmachte. Alle anderen widmeten sich wieder den Gesprächen, die sie vor der kleinen Auseinandersetzung führten.
Die Familie saß am Ende des mittleren Ganges im hinteren Teil des Restaurants. Pit folgte einer alten Gewohnheit. Er horchte in die Umgebung. Rechts von ihm ratterte ein Rollator über das Parkett. Die quietschenden Kunststoffräder waren deutlich zu vernehmen.
Merkwürdig, dachte Pit, der Schritt der Person, die das Gerät schiebt, passt nicht dazu. Kein Schlurfen, kein Humpeln, wie bei Gehbehinderungen üblich.
Auf der linken Seite fand allem Anschein nach, eine größere Feier, wohl eine Hochzeit statt. Es wurde getanzt. In unregelmäßigen Abständen ließ jemand mit kratziger Stimme die Braut hochleben.
Die Schuhe der Bedienung knatschten bei jedem Schritt. Gummisohlen. Sie kam genau jetzt, mit vielen Tellern beladen, aus der Küche. Mehrere Personen, mindestens sieben, betraten soeben die Lokalität. Deren Füße steckten in schweren Stiefeln.
»Ich muss mal Pippi«, verkündete da Pepe mitten in seine eigenen Erzählungen hinein.
Pit wusste, alle Anwesenden am Tisch schauten nun auf ihn. Er verstand, was Pepe von ihm erwartete. Das gehörte mittlerweile zu ihren Ritualen.
»Ok Junge, dann gib mir bitte einmal meinen weißen Stock.«
Den Gang herauf, links, schon lag die Toilette rechts. Im Eingang zum WC drängelten sich zwei Herren in Schuhen mit Ledersohlen an Pit und Pepe vorbei, die sich aufgeregt unterhielten.
»Was ist das für eine Hochzeitsfeier. Die Alte leiert die ganze Zeit mit ihrem quietschenden Rollator durch die Gegend. Sie fährt einem nach dem anderen in die Hacken und merkt gar nicht, wie sie mit ihren quiekenden Reifen allen auf den Wecker geht. Die hat doch eine Perücke auf, oder?«
»Na klar, hat sie. Kennst du die denn nicht? Das ist doch diese Martha von Kunkel Medien. Warum die zur Hochzeit des Sportredakteurs ihrer Zeitung in dieser Maskerade erscheint, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie vor, was vorzuführen.«
»Ach so. Keine Spur. Kenn ich nicht. Hast du denn die Transe bemerkt, die sich unter die Mädels gemischt hat? Und dann hat sie den Brautstrauß gefangen. Ich halt es nicht mehr aus.«
Also tatsächlich, eine große Hochzeit, dachte Pit.
Schon zogen die Herren davon. Pit und Pepe blieben alleine auf dem stillen Örtchen zurück.
Pepe erledigte sein kleines Geschäft. Stolz strebte er nach dieser Tat dem Händewaschen entgegen. Da wurden sie von einem ohrenbetäubenden Knall aufgeschreckt. Die Tür zur Toilette bebte heftig. Der kleine Pepe wurde von den Beinen gerissen. Pit vernahm das Klatschen, als er auf seinem Hosenboden landete. Dem Explosionsknall folge ein seltsames Knattern. Das erinnerte Pit an Maschinengewehrfeuer. Er kannte das aus einschlägigen Hollywood-Filmen.
Pits Sinne verdichten sich. Seine volle Konzentration gehörte jetzt seinen Ohren. Irgendetwas Fürchterliches entlud sich über die Gäste und das Personal des Restaurants auf der anderen Seite der Tür.
Ein metallischer Gegenstand hüpft über die Steinfliesen. Das klackende Geräusch ließ Pit sofort an eine Handgranate denken. Überraschend, hatte er doch noch nie so etwas gehört. Der wenige Sekunden darauf folgende Knall bestätigte ihm seinen Verdacht. Wieder wackelte die Toilettentür bedenklich.
Das muss in der Küche gewesen sein.
Kein Schrei kam aus dieser Richtung, was Pit vermuten ließ, dass niemand vom kochenden Personal in der Küche den Anschlag überlebt hatte.
Pit glaubte, sich in einen schlechten Film wiederzufinden. Sein trockener Gaumen verursachte ein Hüsteln. Die Schockstarre löste sich, als Pepe ihm angsterfüllt am Hosenbein zupfte. Er nahm den Kleinen auf den Arm und legte ihm sanft einen Finger auf die Lippen.
»Keinen Laut, Pepe.«
Pit, der unzählige Kämpfe bei Turnieren seiner Kampfsportart deshalb gewann, weil er den Gegner nicht sah, seinen Atem jedoch hörte, die Schwingungen seiner Bewegungen spürte und – so behaupten es nicht wenige seiner Gegner – dessen Position roch, lauschte in die Umgebung. Seine Augen, die nichts sehen, allerdings Luftzug empfinden konnten, weiteten sich. Pit richtete sie auf die immer noch geschlossene Tür vor ihm.
Die vorhin durch die Küchentür gekommene Bedienung mit den Gummisohlen stoppte ihren Gang. Das Quietschen ihrer Sohlen hörte schlichtweg auf. Es ging im Lärm einer Maschinengewehrsalve unter und wurde vom Getöse des herabfallenden Geschirrs abgelöst.
Im Toilettenraum breitete sich der Geruch der Angst aus. Die eindeutigen Geräusche, die aus dem Schankraum hereindrangen, ließen keine positiven Prognosen zu. Pit hatte den kleinen Jungen wieder abgesetzt. Jetzt hüpfte Pepe von einem aufs andere Bein. Das sorgte dafür, dass Pit dem Drang, die Türklinke herunterzudrücken, zu seiner Familie zu eilen und gewahr zu werden, was da geschah, widerstand.
Pit rieb sich mehrfach mit beiden Händen durch sein Haar. Kaum zu vernehmende, klatschende Geräusche ließen Pit erschaudern. So musste es sich anhören, wenn Projektile auf Fleisch treffen.
Panik brach unter den Gästen und vermeintlichen Opfern aus. Davon zeugten umfallende Tische und Stühle sowie grausige Schreie voller Angst und Entsetzen.
Pit verspürte Wärmeschübe. Die Vorstellung dessen, was hinter der Tür geschah, bereitete ihm Schmerzen. Hinzu quälte ihn seine augenblickliche Hilflosigkeit.
Offensichtlich gingen die Angreifer mit ihren Waffen gezielt gegen die noch lebenden Gäste vor. Ein Stöhnen nach dem anderen erlosch. In der Nähe der Toilettentür wurden Besucher des Restaurants erschossen. Ihre bettelnden Worte fanden kein Gehör. Ihre Bitten erstarben.
In Pits Gehirn arbeitete es. Was sollte er tun? Wohin mit dem Jungen? Was geschah mit seinen Leuten?
Nach wie vor wurde geschossen.
»Ich werde es euch geben, ihr Mörder!«
Das war eindeutig die Stimme seines Vaters, die klar und deutlich zu Pit herüberdrang. Pit drückte sein Ohr an die Tür in der Absicht, mehr zu hören. Doch sein Vater blieb stumm.
Stattdessen erkannte Pit das Geräusch-Gemisch, welches sich aus den schweren, ausgehärteten Gummisohlen von Springerstiefeln und dem platschenden Geräusch nasser, schweißdurchtränkter Socken bildete. Das konnte ohne Zweifel nur der Ehemann von Pits Nichte, der Vater von Pepe sein. In Pit wuchs Hoffnung. Der war ja Polizist. Das Geräusch erstarb wenige Augenblicke später.
Pits Tante trug Schlappen – egal ob es regnete oder schneite. Sie begründete das damit, zu dicke Füße für gewöhnliche Schuhe zu haben. In unmittelbarer Nähe von Pits Versteck hörte dieser den Lauf der Latschen. Sie musste von der Damentoilette kommen. Kurze Zeit später stürzte sie. Einer der Schlappen flog in hohem Bogen gegen eines der Fenster.
Das alles lief vor Pits geistigem Auge wie ein Film in Zeitlupe ab. Kreidebleich lauscht er dem Massaker. Sein Selbsterhaltungstrieb riss ihn schlussendlich aus seiner Lethargie. Die Tragödie, hilflos den Menschen im Restaurant und seiner eigenen Familie beim Sterben zuhören zu müssen, schärfte seine Aufmerksamkeit.
Pit legte seinen Zeigefinger der rechten Hand vor die Lippen. Er gebot dem zitternden Kleinen so erneut, absolut still zu sein. Pits Unterbewusstsein nahm die großen, feuchten Augen des Jungen wahr, mit denen er seinen Onkel anstarrte.
Beim Lauschen durch einen kleinen Spalt der geöffneten Tür ins Restaurant hinein, horchte Pit weiterhin geradewegs ins Chaos. Stühle fielen um. Fenster barsten. Menschen schrien panisch oder stöhnten besorgniserregend. Es roch nach Blut. Zwischen dem Lärm hörte er Schüsse. Eine dunkle Stimme rief einen Befehl im gebrochenen Deutsch, der ihn erschaudern ließ.