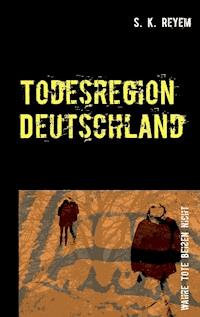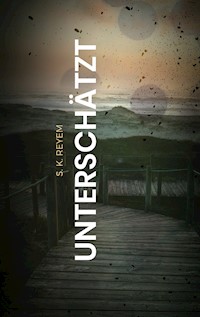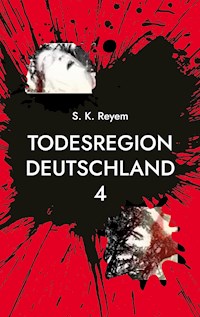Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Todesregion Deutschland
- Sprache: Deutsch
Bald zwanzig Jahre nach der Katastrophe haben sich die Überlebenden auf der Festung eingerichtet und führen ein beschauliches Leben. Ihre heranwachsenden, unerfahrenen Kinder gelangen an Informationen, die ihre Neugierde weckt. Heimlich begeben sie sich auf die Suche nach neuen Lebensumständen. Ihre Eltern sind gezwungen, ihnen in die Todesregion Deutschland zu folgen. Die erneute lange Reise stellt sie vor alte und neue Herausforderungen, die alles verändern werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel (1)
Kapitel (2)
Kapitel (3)
Kapitel (4)
Kapitel (5)
Kapitel (6)
Kapitel (7)
Kapitel (8)
Kapitel (9)
Kapitel (10)
Kapitel (11)
Kapitel (12)
Kapitel (13)
Kapitel (14)
Kapitel (15)
Kapitel (16)
Kapitel (17)
Kapitel (18)
Kapitel (19)
Kapitel (20)
Kapitel (21)
Kapitel (22)
Kapitel (23)
Kapitel (24)
Kapitel (25)
Kapitel (26)
Kapitel (27)
Kapitel (28)
Kapitel (29)
Kapitel (30)
Kapitel (31)
Kapitel (32)
Kapitel (33)
Kapitel (34)
Kapitel (35)
Kapitel (36)
Kapitel (37)
Kapitel (38)
Kapitel (39)
Kapitel (40)
Kapitel (41)
Kapitel (42)
Kapitel (43)
Kapitel (44)
Kapitel (45)
Kapitel (46)
Kapitel (47)
Kapitel (48)
Kapitel (49)
Kapitel (50)
Kapitel (51)
Kapitel (52)
Kapitel (53)
Kapitel (54)
Kapitel (55)
Epilog
Prolog
»So ein Mist. Wie konnte das denn jetzt passieren? Wie ist die allgemeine Wettersituation?«
»Das ist doch jetzt scheißegal. Willst du hier tot umkippen? Wir müssen schnellstens hier raus.«
»Hier raus? Was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Du glaubst im Ernst, wir kommen hier noch weg? Nein, nein mein Freund, wir sind so oder so nicht mehr zu retten. Das kannst du abhaken. Was meinst du, wie es da draußen aussieht?«
Mit einem lauten Knall flog die Tür zum Überwachungsraum auf und Madison sauste herein. Liam schaute sich zu ihr um und kniff die Augen zusammen. William hielt sich die Ohren zu. Bei offener Tür ließ sich der heulende Lärm der an- und abschwellenden Alarmanlage kaum ertragen.
»Schlimmer kann es nicht kommen. Den Idioten ist der ganze Behälter umgekippt, siebzig Liter. Wie sind die bloß auf die wahnwitzige Idee gekommen, so einen Scheiß überhaupt zu produzieren? Bestimmt wieder die Generäle«, schrie Madison, die erste Sekretärin der Forschungsabteilung, den beiden Jungs an den Kontrollbildschirmen entgegen.
Dabei warf sie einen neugierigen Blick auf die Wand von Projektionswänden, Knöpfen, Schiebern und Kontrollanzeigen. Die komplette hintere und die rechte Wand des Kontrollraums wurden von ihnen eingenommen.
Madison kannte den Raum gut. Täglich besuchte sie hier ihren Freund Liam, auch wenn es gegen die Vorschriften verstieß. Jetzt erkannte sie anhand der unzähligen roten und blinkenden Anzeigen die Miesere. Ihre schon lange gehegten, schlimmsten Alpträume bewahrheiteten sich heute. Eigentlich durfte das nie passieren. Jede einzelne Tätigkeit in diesem Hause wurde strengsten Sicherheitsbestimmungen unterworfen. Und doch...
»Was ist das denn überhaupt – die siebzig Liter?«, zeigte sich William trotz der Aufregung neugierig.
»Genau kann ich das nicht erklären. Ist wohl ein Kampfstoff. Soweit ich weiß, haben sie resistente Bakterien gezüchtet und dann in die Bakterien ein tödliches, genmanipuliertes Virus gepflanzt – das alles in einer Flüssigkeit. Bekämpft man das Bakterium mit Antibiotika, kann man damit nicht den Virus bekämpfen und geht man mit einem Virostatika gegen den Virus vor, bleibt das Bakterium unbehelligt. So ähnlich zumindest. Ein genialer biologischer Kampfstoff. Mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das mit den Menschen sonst noch macht.«
»Es ist einfach in die Klimaanlage gelaufen«, bemerkte Liam trocken und zeigte auf eine kleine, wild wackelnde Nadel einer Anzeige.
»Dann nichts wie raus«, argumentierte Madison in dieselbe Richtung, in die William vor wenigen Minuten redete.
»Ich hab es doch grade schon gesagt, es ist zu spät«, sagte Liam und fuhr dabei aus der Haut, »ich muss jetzt wissen, wie die Wetterlage ist!«
»Es scheint die Sonne, das hast du doch vorhin selber gesehen. Was soll das? Willst du uns verarschen?«
William regte sich jetzt ebenfalls auf.
»Versteht du Blödmann noch irgendetwas?«
Liam verzog sein Gesicht.
»Siebzig Liter toxische Substanz, Klimaanlage, mit vierhundertzwanzig Metern höchster Schornstein der Welt, Hochdruckwetter, Jetstream. Alles klar?«
»Nein, verstehe ich nicht. Ich weiß nur, dass uns hier bald der Arsch auf Grundeis geht, wenn wir nicht sofort abhauen.«
William sprang auf und griff Liam an den Arm, wollte ihn von seinem Sitz zerren.
»Finger weg!«
»Nun gebt endlich Ruhe. Hier geht alles den Bach runter und ihr streitet über das Wetter!«, fuhr Madison dazwischen.
»Also ganz ruhig Leute«, meinte Liam schwitzend, »Punkt Eins: Die siebzig Liter hätten niemals auslaufen dürfen. Irgendein Schwachkopf hat die Sicherheitsbestimmungen umgangen, ohne darüber nachzudenken, mit welcher Art Substanzen in unserem Labor gearbeitet wird. Punkt Zwei: Weil sie gleich mit siebzig Litern rummachen mussten, besaßen sie viel zu viel von dem Zeug. Bis sie die Belüftungsanlage abstellen konnten, sind ihnen ein paar Liter in die Anlage gelaufen. Punkt Drei: Je nachdem, welche Schieber offen waren, sind damit mindestens die obersten sechs Etagen verseucht. Wenn wir Glück haben, sind unsere Etage sowie Etage sieben und acht sauber – aber eben nur, wenn wir Glück haben. Punkt Vier: Mit dem Glück können wir trotzdem nichts anfangen. Als sie im Labor endlich die Belüftungsanlage ausgestellt hatten, sorgte das für das Anspringen der Gebäudeentlüftung. Dadurch saust das Zeug mit Höchstgeschwindigkeit durch unseren Schornstein. Die digital gesteuerte Filteranlage darin ist aus – wurde heute gereinigt.«
Mit verzerrter Fratze wies Liam auf einen der Bildschirme oben rechts. Der überlegene Gesichtsausdruck, den er aufsetzen wollte, misslang.
»Dann haben wir die Scheiße in die Umwelt gepustet?«, wollte Madison wissen.
»Genau das«, bemerkte Liam, »doch vermutlich kommt es noch schlimmer.«
»Wie jetzt?«
»Wir haben draußen einen riesigen Hochdruckeinfluss. Jahrhunderthoch sozusagen. Das Teil dreht sich im Uhrzeigersinn und reicht von Miami im Süden bis Portland in Maine. Deswegen muss ich wissen, was mit den Jetstreams ist.«
»Was hat das mit den Jetstreams zu tun? Was ist das überhaupt?«
»Jetstreams sind Starkwindbänder, die sich in der Troposphäre um die ganze Welt legen. Hast wohl im Studium geschlafen, was?«
»Ich hab das kontrolliert«, mischte sich jetzt William ein und man konnte seinem Gesicht die erschütternden Nachrichten ansehen, die er vermelden musste.
»Wie sieht’s aus, William?«
»Der subtropische Jet verläuft exakt über Florida und der Polar Jet streift Michigan und die New England Staaten. Es ist alles aus.«
»Was heißt das, es ist alles aus?«, kreischt Madison hysterisch.
»Ganz einfach, Madison. Ein halber Liter genügt, um ganz Virginia zu infizieren. Durch den Kamin sind mindestens fünfzehn bis zwanzig Liter gegangen, bevor wir das abstellen konnten. Wir befinden uns direkt am Rande des Hochdruckgebiets. In zwei Stunden ist das Zeug über New York gezogen und nach weiteren drei Stunden ist jeder in Florida, der sich an der freien Luft aufhält, verseucht. Die Jetstreams befinden sich in zwölf Kilometern Höhe und besorgen den Rest. Sie verteilen das Zeug über die ganze Welt. Europa ist in zwei oder drei Tagen dran. Nordafrika einen Tag später. Über dem indischen Ozean schiebt der Nordostpassat den Mist nach Süden und zack, bleibt von Südafrika, Südamerika und Australien auch nichts mehr übrig. Keiner kann das mehr aufhalten.«
»Was heißt das? Es bleibt nichts mehr übrig? Wir werden alle krank?«
Plötzlich schwang die Tür zum Gang erneut auf und donnerte mit einem Höllenkrach gegen die Wand. Drei gierig aussehende Gestalten mit weit aufgerissenen Mündern drängten herein und stürzten sich grunzend auf Madison, Liam und William. Denen blieb kaum Zeit zur Reaktion. Eine der Gestalten trieb seine Zähne tief in Madisons Hals. Sie zuckte zurück und riss dadurch ein großes Stück ihres Fleisches mit heraus. Blut spritze, Menschen schrien, Madison zuckte heftig und William schlug und trat wild um sich. Nur Liam saß ruhig da und schaute der ersten Gestalt, die sich vor ihn aufbaute, direkt in die leblosen Augen. Diese biss ihn mitten ins Gesicht und er starb ohne einen Laut von sich zu geben. Riecht nach ranziger Leberwurst, dachte er noch.
Fünf Minuten später herrschte Stille.
(1)
»Georg«, sagte seine Mutter ab und an und erhob dabei mahnend den Zeigefinger der rechten Hand, »mach so weiter und du wirst einsam und alleine enden.«
An diese Worte dachte der baumlange Georg jetzt. Er raffte seinen Gleitschirm zusammen, schnappte sich seine Sachen und machte sich auf den Weg zur Grundhütte. Dem angesagten Durchzug einer größeren Wolke mit Nieselregen wollte Georg ausweichen. Der Verzehr eines Kaiserschmarrens aus Luises Küche in der Berghütte würde über die Wartezeit hinweghelfen. Sollten doch die Anderen in der Schlange stehen, um sich mit ihren Gleitschirmen noch vor dem Wetterwechsel ins Tal zu stürzen. Er, Georg, würde warten können. Mit den Anderen wollte er nichts zu tun haben. Die gingen ihn nichts an.
Jede freie Minute nutzte Georg zur Ausübung seines Hobbies. Knappe siebenhundert Kilometer betrug die Entfernung zwischen seinem Wohnort in Essen und dem Tannheimer Tal – einem Mekka für Gleitschirmflieger. Neue Freunde fand er bei seinem Sport nicht – wollte er auch nicht - und seine Familie mied er sowieso.
Größere Menschenansammlungen stießen ihn ab. Es existierte nur ein einziger Ort, an dem ihm große Menschenmengen nicht störten – das Stadion seines Heimatvereins Rot-Weiss Essen. Im Fußballstadion fühlte er sich wohl, da lebte er ebenso auf wie in den Zeiten, in denen er in seinem Gleitschirm über die Landschaften schwebte. Von seinem bewegten Leben in der Fanszene dieses Vereins zeugte das große Tattoo, welches die komplette rechte Seite des Halses zierte. „Nur der RWE“ stand dort zu lesen, direkt neben dem bekannten, runden Logo des Vereins Rot-Weiss Essen.
An der Grundhütte angekommen, suchte er im Inneren nach einem Tisch, an dem er alleine saß - gerade so wie er sich am wohlsten fühlte. Nach einer Weile verließen die anderen Gäste die Berghütte. Luise servierte ihren berühmten Kaiserschmarren und verschwand dann ebenso wie die letzten Gäste, die sich zur Seilbahn aufmachten. Der gesamte Schankraum lag nun menschenleer vor ihm.
Georg dachte über das Alleinsein nach und fühlte sich dabei durchaus wohl. Draußen setzte der erwartete Nieselregen ein.
Ein paar Gedanken an verschmähte Lieben und einige Zeigerumdrehungen später stand ein leergefegter Teller und ein geleertes Weizenbierglas vor Georg auf dem Tisch. Er legte die Euro, die er Luise für Speise und Getränk schuldete, auf den Tisch, raffte abermals seine Sprungutensilien zusammen und verschwand durch die Eingangstür. Die Wolke, die den Nieselregen brachte, zog mittlerweile weiter gen Süden. Der trockene Boden sog die kleinen Mengen an Regenflüssigkeit auf.
Diese Ruhe, dachte Georg und wunderte sich, ganz alleine zu sein. Kein Mensch hielt sich in seiner Umgebung auf.
Eine leichte, über seine Haut streichende Briese, zauberte ein Lächeln in sein Gesicht. Das sind die richtigen Bedingungen für einen Flug, dachte er. So würde er gut und gerne vierzig Minuten in der Luft bleiben können.
Am westlichen Startplatz angekommen, zurrte Georg seinen Gleitschirm zurecht, legte ihn für den Start bereit und ordnete die einzelnen Seile, die er fest mit dem dazugehörigen Sitz und seinem Geschirr verband.
Genüsslich steckte er sich den rechten Zeigefinger in den Mund und befeuchtete ihn mit Spucke. Dann schloss er die Augen und hob den Zeigefinger steil in die Luft. Ja, das würde passen. Genau das richtige Wetter.
Ein kurzer Zug an den Seilen und der Gleitschirm erhob sich in die Lüfte. Georg drehte sich zum Abhang. Zwei, drei Schritte und der Gleitschirm segelte mit Georg davon. Rasch kamen durch den Auftrieb zu den Höhenmetern am Startplatz weitere dreihundert Meter Höhe dazu.
Am Ende des Tals fuhren Fahrzeuge mit Blaulicht in das Tal ein.
Georg beachtete das nicht weiter. Seine Aufmerksamkeit gehörte einem anderen Gleitschirmflieger, der eine Weile vor ihm gestartet sein musste. Offenbar verlor er die Kontrolle über sein Fluggerät. Jetzt geriet er vollends ins Trudeln und fiel die letzten hundert Meter wie ein Stein vom Himmel. Davon erschrocken, konnte Georg seine Blicke nicht mehr von der Szenerie lösen. Zu seiner Verwunderung bewegte sich der eben abgestürzte Kollege noch, trotz des Sturzes aus dieser Höhe.
Quietschende Bremsen und ein lauter Knall, der entsteht wenn Metall mit hoher Geschwindigkeit auf Metall trifft, rissen Georg aus seiner Starre. Zwei Autos begegneten sich auf der Bundesstraße, die durch das Tal führte. Sie wichen einander nicht aus, sondern stießen frontal zusammen. Was ist denn jetzt los, dachte Georg.
Er beobachtete, wie vier Personen zur Unfallstelle gingen – langsam gingen – die Türen der Fahrzeuge öffneten und die in den Autos befindlichen Menschen herauszerrten. Das sah so gar nicht nach erster Hilfe aus und verwirrte ihn vollends.
Georg wollte jetzt lieber schnell landen. Irgendetwas konnte hier nicht stimmen.
Sein Fluggerät näherte sich dem Landeplatz. Aus Richtung des nächsten Dorfs kam eine größere Gruppe von Menschen herangelaufen. Scheinbar wollten sich die Leute in den nahen Feldern verstecken. Eine ebenso große Gruppe von Personen folgte der ersten, nur viel langsamer. Dabei entwichen den Menschen der zweiten Gruppe seltsame, gurgelnde Laute. Die letzten beiden Leute der ersten Gruppe, zwei ältere Herrschaften, befanden sich nicht in der körperlichen Verfassung den Hetzern zu entkommen. Georg beobachtete, wie sie von ihren Verfolgern eingeholt und gegriffen wurden. Dann triefte die Wiese, auf der die Alten gerade noch standen, vor Blut. Georg spürte, die aufkeimende Angst, die durch seinen ganzen Körper zog. Er suchte nach Auftrieb und beförderte seinen Gleitschirm wieder hoch in die Lüfte. Ein leichter, süßlicher Geruch hing in der Luft.
In der Ferne zucken immer noch die Blaulichter verschiedener Fahrzeuge. Viel länger konnte Georg sich nicht in der Luft halten und er beschloss abseits auf einer Wiese zu landen. Weiter hinten kroch der vorhin verunglückte Gleitschirmflieger mit seltsam anmutenden Bewegungen die Bundesstraße entlang.
»Da bin ich ja froh. Einer lebt noch«, schreckte Georg eine männliche Stimme auf.
Der von hinten sich anschleichende Mann legte nun seine rechte Hand auf Georgs Schulter. Dieser ließ von seinen Flugutensilien ab und wirbelte angstvoll herum.
Vor Georg stand ein Bauer aus der Gegend, der sich sicherlich schon jenseits des Renteneintrittsalters befand.
»Ruhig Blut, junger Mann.«
»Was ist den hier los?«
»Alle sind sie verrückt geworden. Der Holzerwirt, der von der Schänke da, kam über die Straße und hat unserem Bürgermeister in den Unterarm gebissen. Der ist gar nicht umgefallen. Zusammen sind sie dann ins Rathaus gerannt. Ich wollte gerade hinterher, da fiel einer ihrer Kollegen einfach vom Himmel. Da wusste ich nicht, was ich tun sollte. Dann kam unser Apotheker. Blutüberströmt machte er seinen Mund weit auf und versuchte mich runterzureißen und zu beißen. Ich bin dann weggelaufen.«
»Oh Gott Alter, beruhig dich erst einmal«, versuchte Georg nun den Bauern zu beschwichtigen, der ohne Luft zu holen sprach.
»Ich kann doch jetzt nicht ruhig sein«, sprach der Alte und packte sich an den Kopf, »ich muss nach Jutta sehen.«
Der Mann wendete sich ab und trabte auf die nächsten Häuser zu. Aufgrund des kurzen Gesprächs übersahen Georg und er die drei Figuren, die sich schlurfenden Schrittes näherten. Diese griffen nun den Bauern und rissen ihn förmlich in Stücke. Drei, vier tiefe Bisswunden, in welche die Kreaturen ihre Hände stießen und heftig an dem zerrten, was sie zu fassen bekamen. Der Bauer wehrte sich nach Leibeskräften. Schreiend vor Schmerzen und Panik hieb und trat er um sich, besaß jedoch nicht den Hauch einer Chance.
Georg beobachtete das Geschehen und sah sich nicht in der Lage, dem Bauern zur Hilfe zu eilen. Wie angewurzelt stand er da und betrachtete das direkt vor ihm stattfindende Grauen.
Die drei Angreifer labten sich an Blut und Fleisch des Bauern. Der erste der Drei wendete sich nun Georg zu. Der glaubte ein Lächeln im blutverschmierten Gesicht der Bestie zu erkennen, deren Mund weit offen stand. Das dabei entstehende rülpsende Geräusch ließ Georg aus seiner Lethargie erwachen. Er, der Bär von einem Mann, dreht sich um und rannte – rannte so schnell er es vermochte. Schließlich verschwand Georg zwischen den Bäumen der nächsten Anhöhe aus dem Sichtfeld der ihn verfolgenden Kreaturen.
(2)
Jan, das ist der Name, den meine Eltern mir gaben. Fiona, meine Mutter, mochte lieber Sven, Sören oder Fabian. Doch mein Vater Marc setzte sich nach tagelanger Diskussion durch.
Vor bald sechzehn Jahren brachten meine Eltern das Abenteuer am Leipziger Flughafen unbeschadet hinter sich. In der Zeit danach gründeten sie ihre eigene kleine Familie. Das lebende Resultat ihrer Liebe bin ich.
Vor drei Tagen feierten wir meinen fünfzehnten Geburtstag. Während der Feierlichkeiten ahnten wir noch nichts von der dramatischen Wendung, die unser Leben nehmen sollte.
In meinen ersten Jahren, an die ich mich noch erinnern konnte, lebte mein Großvater Rudolf noch. Auf seinen Abendsparziergängen rund um die Festung begleitete ich ihn, wenn es sich irgendwie einrichten ließ, täglich. Bei jeder Gelegenheit erzählte mir der Alte von früher und oft konnte ich mir nur schwer vorstellen, wovon mein Großvater da sprach. Große Städte mit Millionen von Menschen, Straßen und unzählige Autos, mehrstöckige Gebäude mit zahlreichen Geschäften, in denen man alles kaufen konnte, volle Fußballstadien, Kinos, Fernsehen und Radio hören – unvorstellbar. Mein Opa sang mir Lieder vor, von roten und weißen Fahnen, von Toren und Aufstiegen und ich konnte mir das, was er vor seinem geistigen Auge sah, nicht recht ausmalen.
Dann verstarb der alte Mann. Er stürzte und brach sich den linken Oberarm. Dr. Manter, unser Arzt, konnte nicht viel für ihn tun. Er bekam hohes Fieber und fünf Wochen später starb der alte Zausel.
Den abendlichen Spaziergang rund um unser Zuhause behielt ich ihm zu Ehren bei. Sehnsüchtig schaute ich dabei in die Ferne und erinnerte mich an Opas Erzählungen.
Wenn sich meine Lerngruppe nicht zum Unterricht traf, bestand meine Aufgabe auf der Festung Königstein darin, bei den Reparaturen und Instandhaltungen der Gebäude zu helfen. Die Arbeit verrichtete ich zusammen mit meinem besten Freund Lennart, dem Sohn von Fritz und seiner Frau Bärbel, einem Weggefährten meines Vaters. Lennart wurde nur drei Wochen nach mir geboren, dafür maß er schon bald dreißig Zentimeter mehr als ich – ein Riese, wie sein Vater.
Auf der Festung Königstein lebten wir glücklich und zufrieden – wie Bauern eben auf einem kleinen Hof. Alles entwickelte sich zu unseren Gunsten. Es herrschten friedliche Zeiten. Hörte ich meinen Eltern und den anderen zu, die unsere alte Welt noch kannten, lebten wir anders als vor der Katastrophe, doch wir lebten gut. Die Schrecken des Desasters und die beschwerlichen Reisen unserer Altvorderen nach Königstein und Leipzig gehörten der Vergangenheit an.
Nur uns jungen Leuten reichte das manchmal nicht. Wir kannten nur die wenigen Quadratmeter der Festung. Hin und wieder erwischte ich den einen oder anderen Jugendlichen dabei, wie er den Hals reckte und den ausgezeichneten Blick hinab ins Tal ausdehnen wollte – so, wie ich es auch tat. Der Fluss, der dort floss, hieß Elbe. Doch das half uns nicht weiter. Andere Flüsse kannten wir nicht.
Mein Vater meinte, das wirkte sich nachteilig auf die Entwicklung der Jugend aus. Er verglich uns mit den Jugendlichen seiner eigenen Zeit. Wir erschienen ihm deutlich naiver. Und unsere Entwicklung dauerte länger, sagte er immer. Mehrmals diskutierte er mit meiner Mutter darüber. Ich kam ihm eher wie ein Zwölfjähriger als wie ein junger Mann in der Pubertät vor. Im Vergleich zu den Menschen unter uns, die unsere alte Welt noch kannten, kamen ihm die jungen Leute oft wie Hinterwäldler vor. Ich fürchte, er lag damit sogar richtig. Wir lebten in einer so unendlich kleinen Welt. Fünfzehn Jahre lang versäumten es die Erwachsenen diese Welt für uns größer werden zu lassen.
Nur ein einziges Mal setzte ich meine Füße auf die andere Seite der Festungsmauern. Mein Vater nahm mich damals mit. Aus einem der Autos, die auf dem Parkplatz vor der Festung parkten, wollten wir etwas holen. Stolz präsentierte er mir dazu seine alte Waffe, einen alten Tapezierigel - ein Holzstiel, an dessen Ende sich eine Gummirolle mit spitzen Dornen befand. Eine gute Waffe gegen die Schlurfer, meinte er.
Doch das lag mittlerweile auch schon vier Jahre zurück. Ich kannte Schlurfer nicht. Nie bekam ich ein Exemplar zu Gesicht. Die letzten Kreaturen sichteten wir von der Festung aus vor fünf Jahren. Ob es später noch welche gab, wussten wir nicht. Ich konnte mir nicht viel unter den Untoten vorstellen. Der Tapezierigel lehnte seitdem unbeachtet neben meinem Bett an der Wand.
Meine Freunde und ich klebten an den Lippen derjenigen, die noch das alte Leben, die Katastrophe und den Kampf der untergehenden Zivilisation erleben durften. Bernhard von der Flughafensicherung auf Zypern und Nils, der Pilot, redeten schon mal gerne über wilde Tiere und andere Menschen – spannend.
Vor drei Jahren sahen wir Rauch aufsteigen. Mit den Feldstechern beobachteten wir eine Woche lang ein Lagerfeuer, in dessen Schein wir mehrere Personen vermuteten. Dann erlosch es und wir erhielten nie wieder einen Hinweis auf andere Menschen.
Mit Vaters erstem Hund, dem ehemals wilden Hund Gordi, spielte ich früher häufig. Wir wurden ein Herz und eine Seele. Ich erinnere mich an zwei Hunde, die auf der Festung lebten. Gordi und Pepe, der meinem Opa in der Nähe seiner früheren Wohnung zulief. Die beiden Tiere lebten schon lange nicht mehr. Der Hund und Freund, der mich jetzt begleitete, hieß nun Oskar. Er stammte direkt von Gordi und Pepe ab.
Insgesamt lebten mehr als sechzig Menschen auf Königstein. Im Großen und Ganzen lebten wir zufrieden, freuten uns über täglich gefüllte Teller und verstanden uns gut. Nur selten entstand Streit, der schnell von den gewählten Altvorderen geschlichtet wurde. Sie stellten das Gesetz dar.
Zu unseren größten Problemen zählte die Freizeitgestaltung. Viel zu oft verliefen die Abende gleich. Es gab Sport-, Lese-, Spiel- und Gesprächsgruppen, die sich regelmäßig trafen, doch ein ums andere Mal wurde das langweiliger.
Andrea und Mona gingen oft in die Gesprächsgruppe, in der sich ihre Altersgenossen trafen. Der Sohn des ehemaligen Feuerwehrmannes Mahmut, Karim, vier Jahre älter als ich, leitete diese Gruppe. Wegen Andrea und Mona gingen Lennart und ich auch hin. Wir redeten über alles Mögliche und träumten von fremden Welten außerhalb der Festung.
Lennart liebte heimlich Mona. Was er an dem ewig zickigen Mädchen fand, blieb sein Geheimnis. Ebenso wie ihre Eltern, Bernd und Elke, trug Mona eine rote Irokesenfrisur, die ihr überhaupt nicht stand. Trotzdem bewunderten sie die anderen für die Mühen, die man sich auf der Festung Königstein machen musste, um eine solche Frisur herzustellen. Mona wusste nicht, warum ihre Eltern solche Frisuren trugen. Sie meinte, es hätte mit Protest und alten Zeiten zu tun, und das gefiel ihr.
Monas beste Freundin mochte ich dafür umso mehr. Andrea hieß die Tochter von Ebenezer Arissi, einem Mann mit tiefschwarzer Haut und Jenny, von deren Kletterkünsten Opa Rudolf immer berichtete. Sie war die Erste des Flüchtlingstrecks, die einst ihren Fuß auf die Festung Königstein setzte. Andreas Haut strahlte im Sonnenlicht wie Milchschokolade. Jedenfalls erklärte mein Vater einst, so sähe Milchschokolade aus. Ich selbst wusste nicht, was Schokolade sein sollte.
»Ist dir das eigentlich schon aufgefallen? Alle Mädchennamen enden auf a?«
Verdutzt schaute ich zu Lennart hinüber, der neben mir auf einem wackeligen Gerüst an einem der Hauptgebäude der Festung seiner Arbeit nachging. Mit seiner linken Hand klammerte er sich an einem Fensterahmen fest.
»Was? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.«
»Dann wird’s aber langsam Zeit«, lachte Lennart, »hast du Andrea schon gefragt?«
»Nein, hab ich nicht. Du bist ja selbst nicht besser. Ober weiß Mona wovon du träumst?«
Glockengeläut unterbrach unsere Arbeit und schob unsere Gedanken und Träume beiseite. Gülsens Beerdigung.
In den letzten Jahren musste nicht nur mein Opa von uns gehen. Nach Oma Johanna, die den Weiberhaushalt auf dem letzten Hof führte, vor dem die Leipzig-Fahrer zuletzt rasteten und nach Agnes, die bereits auf der Festung lebte, als die Katastrophe ausbrach, verstarb auch kürzlich Gülsen, die Oma von Karim. Sie wurde eines Morgens einfach nicht mehr wach.
(3)
»Das mit deiner Oma tut mir leid.«
»Danke Jan, das ist nett von dir.«
»Vorhin hast du gesagt, du müsstest mir was zeigen.«
»Ja stimmt, lass und zur Blitzeiche gehen. Da warten die anderen.«
»Welche anderen?«
»Wirst du schon sehen.«
Die Blitzeiche trug diesen Namen, weil der Baum in der Vergangenheit gerne mal von Blitzen getroffen wurde. Menschen ließen in der Nähe der Eiche vom Blitz getroffen ihr Leben. So stand es zumindest auf der neben dem Baum angebrachten Gedenktafel. Doch dabei handelte es sich um alte Geschichten, die sich schon lange vor der Ankunft der Flüchtlinge auf der Festung Königstein zutrugen und die bei uns Jugendlichen keine weitere Beachtung fanden.
Die Blitzeiche stand außerhalb der Gebäudeansiedlung und damit entfernt vom üblichen gesellschaftlichen Treiben auf einem kleinen Plateau. Von hier aus besaß man einen herrlichen Blick ins Elbtal und auf die nicht weit von hier liegende Bastei – einer Felsformation auf der anderen Seite der Elbe. Im Tal selbst lag der Ort Königstein. Bedeutende Einzelheiten des Orts konnte man von hier aus nicht mehr erfassen. Pflanzen überwucherten große Teile der Ansiedlung. Das eine oder andere, teilweise eingestürzte Häuserdach konnte man noch einsehen. Früher sammelten im Ort die Leute aus der Festung allerhand Zeug ein – alles, was man so gebrauchen konnte. In den letzten Jahren zog es niemanden mehr dorthin.
Neben Mona, Andrea und Lennart standen noch weitere Bewohner der Festung im engen Kreis an der Eiche beieinander. Der Vollwaise Marvin, der auf Zypern einst seine Eltern verlor und Emma, die asiatisch aussehende Tochter von Bernhard und Isa sowie Luisa warteten auf Karim und mich. Gretes und Nils’ Kind, Gretes insgesamt vierte Tochter, hieß Luisa.
Wir näherten uns dem Versammlungsplatz. Das Geschnatter der Wartenden ebbte ab. Alle starrten gebannt auf die Neuankömmlinge.
Karim kletterte auf ein kleines Mäuerchen, strich sich eine Strähne aus der Stirn und guckte einen nach dem anderen eindringlich an.
Ich stellte mich direkt neben Andrea.
»Hi, schön, dass du da bist«, flüsterte sie leise und nur für mich hörbar in meine Richtung.
Schweiß rann mir die Stirn hinab und lief mir brennend ins linke Auge. Dieses Mädchen mit ihren schwarzen Augen und den breiten Lippen brachte mich noch um den Verstand. Ich muss unbedingt meinen Vater fragen, wie er das mit Mama gemacht hat, dachte ich.
»Es gibt interessante Neuigkeiten«, begann Karim seine Rede, »es kann nicht verschoben werden, bis wir uns zur nächsten Runde treffen. Gülsen, meine Oma, hat mir kurz vor ihren Tod diesen Umschlag hier gegeben und gesagt, ich solle ihn erst nach ihrer Beerdigung, also heute, öffnen.«
Karim öffnete seine Augen weit, schaute erneut in die Runde und nickte dabei leicht mit dem Kopf. Und seine Jünger ersehnten geduldig weitere Worte. Er hob den Umschlag hoch und öffnete ihn für alle gut sichtbar.
Den Zettel, der zum Vorschein kam, hielt er nahe vor seine Augen und las ihn durch. Seine Stirn legte er dabei in Falten. Seine Lippen formten lautlos die Worte, die er sah.
»Ich lese euch das Schreiben vor«, kündigte er ehrfurchtsvoll an, »nur wenige Menschen kennen den Inhalt der folgenden Zeilen. Nur Bernhard, Nils, Marc und Fiona wissen überhaupt von der Existenz des Papiers. Marc, Fiona und meine Oma kennen den Inhalt.«
»Boh ist das spannend«, warf Marvin ein.
Auch allen Anderen konnte ihre Erregung angemerkt werden. Lennart rieb sich ohne Unterlass die Hände. Mona strich ständig ihr Haar zurecht und Luisa hüpfte von einem Bein aufs andere. Auch ich musste mir meine Aufregung eingestehen. Das Gehörte ließ mich neugierig werden.
Innerlich lachte ich über meine arglosen Freunde. Für Gewöhnlich gab es auf Königstein für Jugendliche nicht viel Dramatisches zu erleben.
»Vor mehr als fünfzehn Jahren hat Nils während seines Flugs von Zypern nach Leipzig einen Funkspruch empfangen«, fuhr Karim fort, »der Funkspruch wurde nicht eindeutig klar gesendet, doch wir konnten die Fragmente zusammensetzen. Marc kam damals zu dem Schluss, es wäre besser, darüber nichts verlautbaren zu lassen. Ich teilte diese Meinung. Doch die jungen Leute sollen jetzt erfahren was wir einst gewahr wurden. Sie haben das ganze Leben ja noch vor sich. Der Funkspruch lautet: „Hallo, kann das jemand hören? Kommt nach Norden! Oberhalb des sechzigsten Breitengrads ist die Welt noch in Ordnung. Hallo, ich wiederhole. Kann das jemand hören? Kommt nach Norden.“«
Jetzt redeten alle begeistert durcheinander und mir schoss ein Gedanke durch den Kopf. Wollten wir das Gehörte sinnvoll diskutieren und in geordnete Bahnen lenken, müsste ich für Ruhe sorgen. Also stieg ich zu Karim auf die Mauer.
»Ruhe! Seid ruhig!«
Jetzt schauten alle gebannt zu mir auf. In Andreas Augen glaubte ich ein Blitzen und Leuchten zu erkennen. Ich gehe runter und küsse sie sofort, dachte ich, traute mich aber nicht und wendete mich wieder an meine Zuhörerschaft.
»Auf keinen Fall dürfen unsere Eltern erfahren, was wir jetzt wissen. Das muss unter allen Umständen unser Geheimnis bleiben. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Geschichte geht. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr möchte ich herausbekommen, was hinter dieser Information steckt. Gibt es noch andere Menschen auf der Welt? Wenn ich mir vorstelle, die leben sogar noch so, wie unsere Eltern früher. Ich will das unbedingt wissen – und wenn ich bis zum sechzigsten Breitengrad zu Fuß gehen muss.«
Den Beifall der Anwesenden genoss ich bei diesen Worten. Ich hob den linken Arm hoch über den Kopf und sie klopften mir auf die Schultern.
Gemeinsam schmiedeten wir Pläne, wie wir von den anderen unbemerkt die Festung verlassen und große Abenteuer erleben konnten. Emma guckte zuerst noch skeptisch drein. Doch nach wenigen Minuten wurden sich alle Jugendlichen einig. Wir wollten uns heimlich auf die Reise zum nördlichen sechzigsten Breitengrad machen – wo immer der auch sein mochte.
Schnell schworen wir uns gegenseitig ein und versprachen einander absolutes Stillschweigen.
»Wir müssen das auf das Genaueste planen«, warf Lennart ein und alle nickten bedächtig.
(4)
Sieben Tage später, die Nacht brach herein und es regnete, schlich eine kleine Gruppe von jungen Männern und Frauen den Tunnelgang zum Ausgang der Festung hinab.
»Sind alle da?«, flüsterte ich.
Wie einst mein Vater die Führung der Überlebenden übernahm, übernahm ich jetzt, ohne es zu bemerken, die der Ausreißer.
»Stopp mal, ich zähl schnell durch«, meinte Lennard mit wichtigem Unterton, »Mona, Andrea, Luisa, dein Hund Oskar. Und dahinten kommen Karim und Marvin. Alle da.«
»Stimmt doch gar nicht«, mischte sich Mona schnippisch ein, »Emma fehlt noch.«
Damit lag Mona vollkommen richtig. Emma, mit dreizehn Jahren das Nesthäkchen und nach meiner Meinung für diese Expedition viel zu jung, fehlte.
»Was ist los? Wo ist Emma?«, polterte auch gleich Marvin heran, »ohne Emma können wir nicht gehen. Die heult rum und verrät uns sofort.«
»Pst, leise«, ermahnte ich meine Freunde, »wir wissen alle, Emma ist im Nahkampf die Beste von uns, egal wie alt sie ist. Kein Wunder bei der Mutter. Keiner kann hierbleiben, der weiß was wir vorhaben. Ich habe keine Lust, von den Alten sofort wieder eingefangen zu werden.«
»Seid mal still. Da oben, da kommen Leute.«
»Das ist doch Emma. Wen hat sie denn dabei?«
»Jetzt schleppt die auch noch Paul und Irma an. Was sollen wir denn mit denen?«
Die Eltern der Zwillinge Paul und Irma, die Bogenschützen Torben und Paula, zogen vor fünfzehn Jahren gemeinsam mit Eddi durch die Lande. Ebenso alt wie Emma, hielt diese die beiden Gleichaltrigen für ihre besten Freunde.
Ich zeigte mich nicht sonderlich erfreut darüber, die Zwillinge im Schlepptau zu haben. Für viel zu kindisch hielt ich sie. Die Beiden zurücklassen ging allerdings auch nicht mehr. Sie kannten offensichtlich unsere Pläne und würden sofort ihren Eltern davon erzählen. Noch vor Sonnenaufgang wäre unser kleines Abenteuer beendet.
So baute ich mich vor meinen Freunden auf. Mit leiser Stimme flüsterte ich in die Runde.
»Es ist jetzt wie es ist. Wir gehen alle gemeinsam. Niemand bleibt zurück. Langsam, ganz langsam schleichen wir durch das Tor hier und ich will keinen einzigen Mucks hören. Es wird nicht gesprochen. Und niemand rennt an mir vorbei oder sonst irgendetwas. Ist das klar?«
Meine Zuhörer nickten, was ich in der Dunkelheit gleichwohl nicht erkennen konnte.
Das große Tor ließ sich problemlos und zum Glück geräuschlos öffnen. Meine kleine Gruppe stand auf der anderen Seite des Tores und harrte aus. Ich schloss das Tor wieder ab. Mich beschlich ein schlechtes Gewissen. Den Schlüssel meines Vaters, den ich ohne sein Wissen aus seiner Tasche entwendete, warf ich durch den engen Durchlass zwischen den groben Holzbalken zurück in das Areal der Festung.
Außerhalb der Mauern ging ich aufrecht und stolz durch die Nacht und meine Meute folgte mir. Fühlte es sich für mich innerhalb der Festung noch unbedeutend an, verspürte ich nun Größe. Es musste sich dabei um das Gefühl der Freiheit und die Lust auf ein großes Abenteuer handeln. Meinen Mittstreitern ging es ähnlich. Ein Großteil von ihnen setzte das erste Mal im Leben einen Fuß vor die Festung und so ins unbekannte Land der Untoten.
Vor uns lag der kleine Parkplatz, den ich noch vom Ausflug mit meinem Vater kannte. Die hier befindlichen, schon lange ausgeschlachteten Fahrzeuge würden uns keinen Nutzen bringen können. Dahinter führte ein schmaler Weg den Hügel hinab.
»Geradewegs nach Norden«, flüsterte Lennard beschwingt, der unmittelbar hinter mir daherschlich.
Bald erreichten wir eine zweispurige Querstraße. Das musste die ehemalige Bundesstraße sein, die einst Pirna und Königstein miteinander verband, über die ich in alten Landkarten las. Auf der anderen Straßenseite begann der Wald, in dem ich das erste Mal mit meinen Freunden innehalten wollte, um die Lage zu prüfen.
Der nasse, brüchige Belag der Bundesstraße glänzte im Schein des Mondes, der sich durch die Wolkendecke kämpfte. Schon längst eroberte die Natur von den Rändern her die Straße zurück. Das Gestrüpp rechts und links der Straße stand dicht und hoch. Kein Geräusch störte die Stille.