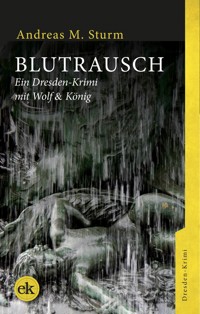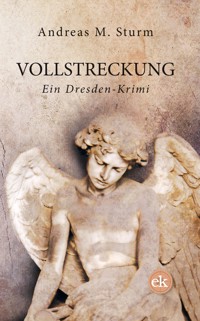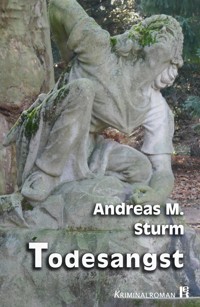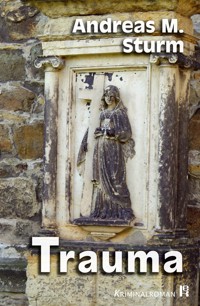9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach einer durchfeierten Nacht findet Callcenter-Agentin Zoe Mohn im Bett neben sich einen erdrosselten Mann. Zoe hat einen Filmriss und kann sich an die Nacht und den vorhergehenden Abend nicht mehr erinnern. Sie flieht aus der Wohnung, beginnt aber umgehend Nachforschungen anzustellen. Noch bevor Zoe mit ihren Untersuchungen weiterkommt, stolpert sie nach ihrer Schicht im Callcenter über ihren erdrosselten Teamleiter Marco Sörensen. Da Zoe kein gutes Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten hatte, setzt die Polizei sie ganz oben auf die Liste der Verdächtigen. Um ihre Unschuld zu beweisen, setzt Zoe ihre privaten Ermittlungen fort. Bald wird ihr klar, dass die Ursache für die Morde in der Vergangenheit liegt. Ihre Recherchen führen sie ins Milieu der Spielsüchtigen bis hin zum Organisierten Verbrechen. Bei ihren Recherchen schafft Zoe sich Feinde, schon bald wird sie von der Jägerin zur Gejagten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Andreas M. Sturm
Tödliche Wetten
Ein Dresden-Krimi
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
Navigationspunkte
Cover
Sturm, Andreas M.: Tödliche Wetten. Ein Dresden-Krimi. Hamburg, edition krimi 2025
Originalausgabe
ePub-eBook-ISBN 978-3-949961-30-4
Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
Print-ISBN: 978-3-949961-29-8
Lektorat: Kerstin Müller
Satz: © Sarah Schwerdtfeger, edition krimi
Umschlaggestaltung: © Annelie Lamers, edition krimi
Umschlagmotiv: Foto: Kerstin Müller
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://www.dnb.de abrufbar.
Der Verlag behält sich das Text- and Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
Die edition krimi ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 [email protected].
_______________________________
© edition krimi, Hamburg 2025
Alle Rechte vorbehalten.
https://www.edition-krimi.de
1. Kapitel
Außer einem grellen Blitz, der in regelmäßigen Abständen durch meinen Kopf hackte, drang nichts durch die mich umgebende Dunkelheit.
Vermutlich war ich tot.
Okay, es fiel mir schwer, mich dieser Erkenntnis zu stellen, aber eine andere logische Erklärung hatte ich nicht auf Lager. Vermutlich kamen daher auch die rasenden Kopfschmerzen, bestimmt verspachtelte ein Rudel Maden gerade mit großem Appetit meine Gehirnwindungen. Der Gedanke war nicht gerade prickelnd, aber was blieb mir als ihn zu akzeptieren? Trotzdem fand ich es unfair, dass tot sein so weh tat.
Eigentlich hatte ich mir das Dasein nach meinem Ableben ein bisschen anders vorgestellt. Gut, meine Träume vom Paradies waren vielleicht etwas zu optimistisch gewesen: ich an einem weißen Sandstrand unter Palmen, neben mir ein potenter Engel, vor mir eine Bar gefüllt mit Hochprozentigem, Obst, Eiscreme und massenhaft Schokolade.
Diese abgrundtiefe Finsternis voller Qualen, die ich gerade durchlitt, wollte ich jedenfalls nicht akzeptieren. Duldete man solche rebellischen Erwägungen auf der anderen Seite überhaupt? Ich denke, eher nicht.
Eventuell war ich also doch nicht tot.
Meine gesamte Kraft bündelnd, versuchte ich, die Augen zu öffnen. Nach mehreren Minuten intensivster Anstrengung gelang es mir. Es war kein richtiges Öffnen, mehr ein zaghaftes Blinzeln, und gleich nachdem ich es geschafft hatte, presste ich meine Augen so fest zusammen, wie es nur ging.
Autsch, war es hier hell!
Ich schnaufte durch, sammelte mich und wagte es erneut. Diesmal klappte es besser, da ich schlau genug gewesen war, meine Lider nur so weit zu öffnen, dass sie sich an die Lichtflut gewöhnen konnten. Nach einer Weile lösten sich Konturen aus dem gleißenden Weiß, ich wurde mutiger und meine Augen größer. Misstrauisch musterte ich alle Dinge, die ich, ohne meinen Kopf zu bewegen, erfassen konnte.
Keine Wölkchen. Keine Harfenspieler. Juhu, ich lebe noch!
Über mir breitete sich eine stinknormale Zimmerdecke aus. Merkwürdig war bloß, dass sich die eingelassenen Lampen im Kreis drehten.
Immer schneller.
Einem Reflex folgend kniff ich meine Augen wieder fest zusammen, doch es war zu spät, inzwischen rotierte auch das Bett. Ich presste die Lippen aufeinander und bemühte mich, ruhig durch die Nase zu atmen. Vergeblich, mein Magen hatte sich bereits der Kreisbewegung angeschlossen. Zwei, drei Runden, dann schoss eine gallebittere Flüssigkeit meine Speiseröhre hinauf. So schnell ich konnte, drehte ich mich auf die Seite, entdeckte einen Eimer neben dem Bett und was immer ich in den letzten Stunden zu mir genommen hatte, landete mit lautem Platschen im Kübel.
Als meine Verdauungsorgane sich berappelt hatten, zog ich meinen Oberkörper zurück aufs Laken und blieb zur Sicherheit auf der Seite liegen.
Einige tiefe Atemzüge später ging es mir besser. Der Raum hörte auf, Karussell zu spielen, und bis auf die wahnsinnigen Kopfschmerzen regenerierte ich mich physisch und psychisch.
Neugierig geworden schaute ich mich in dem fremden Zimmer um. Wow, war es hier riesig! Da musste man ja rufen, wenn man sich unterhalten wollte. Also meine Wohnung war das definitiv nicht. Deren Abmaße waren eher – vorsichtig ausgedrückt – bescheiden.
Das Nächste, was mir ins Auge stach, waren meine Klamotten. Hübsch verteilt auf einer weißen Ledergarnitur und dem Fußboden. Wider besseres Wissen lüpfte ich die Bettdecke und warf einen besorgten Blick darunter. Ich hatte es befürchtet: barfuß vom Scheitel bis zu den Zehen.
Angestrengt arbeitete ich daran, meinen trägen Geist in Schwung zu bringen. Ergebnislos. Daraufhin entschied ich, dass eine Nummer, an die ich mich nicht erinnerte, wohl nicht der Knaller gewesen sein konnte.
Der aus diesem Schluss resultierende Gedanke ließ Panik in mir aufsteigen. Bloß nicht!, fuhr es mir durchs Gehirn und hastig schickte ich meine Blicke auf die Jagd. Eine aufgerissene Kondompackung auf dem Boden ließ mich aufatmen. Wenigstens ein kleiner Teil meines Verstandes war letzte Nacht nicht in einem Meer von Alkohol ertrunken.
Grenzenlos erleichtert sah ich mich weiter um. An den Wänden standen einzelne Regale, weiß, schlicht und verdammt teuer aussehend, passend zur Ledergarnitur. Dominiert wurde der Raum von einem riesigen Bild. Ich schätzte es auf mindestens zwei mal vier Meter. Die Farben waren leuchtend, intensiv und bedrohlich. Auf mich wirkte es wie die Überreste eines Kettensägemassakers. Dass ich trotz dieses hässlichen Monstrums letzte Nacht in Stimmung geraten war, sah mir eigentlich gar nicht ähnlich.
Ich blendete die Frage vorerst aus, drehte mich auf den Rücken, hob stöhnend den Kopf und ließ ihn auf der Stelle zurück in die Kissen sinken. Durch die Glaswand gegenüber knallte eine unbarmherzige Sonne. In meiner derzeitigen Verfassung war das eindeutig zu viel Licht.
Umgehend wuchtete ich mich auf die andere Seite, um den Rest des Zimmers zu inspizieren. Es brauchte nicht den Anblick des mammutgroßen Fernsehers und die Bang & Olufsen-Anlage, ich hatte verstanden: Wer immer hier hauste, stank vor Geld. Und der- oder diejenige lag versteckt hinter einer aufgetürmten Bettdecke. Nur ein Arm ragte aus dem Kissengewühl. Haarig, die Muskeln deutlich ausgebildet, eindeutig ein Mann. Ich packte zu und rüttelte kräftig. Keine Reaktion. Ich rüttelte stärker, wieder nichts.
Na, den musste ich ja letzte Nacht rangenommen haben. Jetzt wollte ich aber wissen, wie der Typ aussah. Ohne einen weiteren Moment zu verlieren, zog und zerrte ich an Kissen und Bettdecke, bis ich sein Gesicht freilegte. Irgendwie wirkte er seltsam auf mich, zu still. Viel erkennen konnte ich allerdings nicht. Eventuell wurde es langsam Zeit, mir eine Brille zuzulegen. Ich rutschte ein Stück nach hinten und nahm ihn genau in Augenschein. Der blutunterlaufene Streifen um seinen Hals und der starre, glanzlose Blick ließen mich schlucken. Einige Sekunden brauchte es, bis ich mich der Wahrheit stellte und Gänsehaut am ganzen Körper bekam.
Ich war vielleicht noch nicht tot, der Typ auf der anderen Bettseite dagegen unter Garantie.
2. Kapitel
22 Jahre zuvor, April 2001 – Ronald
Zurückgezogen in einen Winkel des alten Betriebshofs, lehnte Ronald an den Resten einer halb verfallenen Ziegelmauer. Sämtliche Lampen in diesem Teil des Areals waren schon vor Jahren eingeschlagen worden. Vorn an der Straße, wo die sensationsgeile Menge herumlungerte, spendeten verbeulte Laternen ausreichend Licht. Ihn dagegen hatten die schwarzen Schatten der Gebäude wie mit einem Umhang verhüllt. Ronald fand das gut so, diejenigen die heute Abend das Glück erzwingen wollten, kannten seinen Platz, andere Leute sollten nicht auf ihn aufmerksam werden.
Ein zufriedenes Lächeln spielte um seine Lippen, als seine Hand wie von selbst zu seiner Bauchtasche glitt. Gierig drückten seine Finger in den festen Stoff, kosteten die Fülle in vollen Zügen aus. Prall war die Tasche, voller Geldscheine. Der Abend hatte sich gelohnt. Selbst nach Abzug der Prämie für die wenigen Gewinner blieb ausreichend für ihn übrig, um die Schulden zu begleichen.
Früher hatte er sich der Gunst der fallenden Würfel und Karten unterworfen und zu spät erkannt, dass sie ihn täuschten. Der Weg zu dieser Einsicht war hart und schmerzhaft gewesen. Lange hatte es gebraucht, bis er die Lektion gelernt hatte: Der Spieler gewann nie. Zu Beginn vielleicht eine geringe Summe, die jedoch nur den Hunger auf mehr weckte. Einen Hunger, der den Süchtigen verschlang und unweigerlich in den Strudel des Verderbens zog.
Ronald verzog weinerlich das Gesicht. Der pochende Schmerz in seiner linken Hand war Mahnung genug. Bitter war die Lehre gewesen, doch er hatte begriffen, welche Chance die Erkenntnis ihm bot. Nur die Bank zog die Scheine an wie eine hübsche Prostituierte die Freier.
Jetzt hielt er die Bank, jetzt befand er sich auf der Straße der Gewinner.
3. Kapitel
Fassungslos starrte ich auf den erwürgten Mann. Mein Gott, da hatte mir doch glatt jemand den Quickie unter dem Hintern weggemordet.
Trotz des Restalkohols gefror mir das Blut in den Adern. Den Atem anhaltend lauschte ich, es bestand ja durchaus die Möglichkeit, dass der Mörder in diesem unüberschaubaren Raum noch zugange war. Da ich absolut nichts hören konnte, japste ich Sekunden später erleichtert nach Luft.
Während meine Angst abflaute, betrachtete ich den Toten. Zwei Dinge erkannte ich auf Anhieb: Erstens, er war mit einer dünnen Schlinge erwürgt worden. Bei der tiefen Wunde tippte ich auf eine Draht- oder Kunststoffschnur. Zweitens, den Typ hatte ich noch nie gesehen. Gemerkt hätte ich mir dieses Gesicht und die Figur ganz bestimmt, denn zu Lebzeiten war er ein Schnuckelchen gewesen. Als mir die Konsequenz dieser Überlegung aufging, wurde mir noch kälter. Bei der Vollkommenheit meines Blackouts musste letzte Nacht mehr als nur Alkohol in meinen Organismus geraten sein.
Ich zog die Bettdecke ganz fest um die Schultern, schloss die Augen und horchte in mich hinein. War es möglich, dass ich den Typ ins Jenseits befördert hatte?
»Nein«, sagte ich schließlich laut in die drückende Stille hinein und flüsterte weiter: »Das mich jemand so in Rage bringt, dass ich ihm vor Wut oder Angst einen Gegenstand kräftig über den Schädel ziehe, okay, das liegt im Bereich des Möglichen. Aber einen Menschen langsam zu Tode strangulieren, dazu bin ich definitiv nicht in der Lage.«
Erleichterung durchflutete mich, wenigstens die schlimmste Befürchtung konnte ich ausschließen. Ein Anlass für einen Freudentaumel war das allerdings nicht, denn die Tatsache, dass ich nackt neben einem ermordeten Mann im Bett lag und höchstwahrscheinlich die Nacht mit ihm verbracht hatte, versetzte mich in eine katastrophale Situation. Wenn jetzt die Bullen hier aufkreuzten, brauchten sie bloß eins und eins zusammenzählen und im Nu säße ich in U-Haft. Sämtliche Unschuldsbeteuerungen meinerseits würden nur einen gewaltigen Heiterkeitsausbruch auslösen. Bei dem riesigen Haufen von Indizien hätte ich vor Gericht keine Chance. Mit sehr viel Glück würden die Richter auf Totschlag im Affekt urteilen und ich wanderte für die nächsten zehn Jahre in den Knast. Bei guter Führung acht.
So weit durfte es nicht kommen. »Reiß dich zusammen, Zoe!«, sagte ich laut. »Heul nicht rum, lass dir lieber etwas einfallen und zieh den Kopf aus der Schlinge.«
Das war gut gesagt, in meinem derzeitigen Zustand musste ich es ruhig angehen lassen. Zunächst befahl ich meinem alkoholgeschädigten Leib, sich aus dem Bett zu quälen. Kämpfte gegen den Schwindel an und sammelte meine Sachen ein. Die Bewegung brachte meinen Kreislauf in Schwung und obwohl ich schwitzte, wie ein Rennpferd beim Zieleinlauf, ging es mir von Minute zu Minute besser. Wesentlich sicherer auf den Beinen zog ich mich an.
Bis jetzt war es mir gelungen, meine Blase in Schach zu halten, wollte ich jedoch keine Sauerei riskieren, wurde es höchste Zeit zur Toilette zu gehen. Noch ein wenig wacklig tapste ich durch den Raum und hielt Ausschau. Im letzten Moment erblickte ich in der hintersten Ecke die rettende Tür. Sekunden später hallte mein dankbarer Seufzer in dem gefliesten Raum wider. Das war knapp gewesen.
Kurz überlegte ich, ob es Sinn machte, alles abzuwischen, was ich angefasst hatte. Mit einem resignierten Auflachen verzichtete ich darauf. Meine DNA war höchstwahrscheinlich gleichmäßig in allen Ecken verteilt. Selbst wenn ich die große Putzaktion durchzog, würde ich es niemals schaffen, mein gesamtes Erbgut aus der Wohnung zu entfernen.
Erschöpft von der Anstrengung lief ich zu einer Essecke, sank auf einen Stuhl, öffnete meine Handtasche und überprüfte, ob alle Gegenstände, die ich mit mir führte, noch an Ort und Stelle waren. Nach der Taschenrazzia atmete ich auf. Alles war an seinem Platz. Dankbar seufzend presste ich mein Samsung an die Brust, der Verlust des Smartphones wäre ein Desaster gewesen. Die darauf gespeicherten Daten hätten mich jedem schlechten Menschen ausgeliefert. Und ein Mörder war bestimmt keine Vertrauensperson.
Der Gedanke an den unbekannten Würger aktivierte irgendeine geheime Kraftreserve in mir, von deren Vorhandensein ich bis jetzt nichts geahnt hatte. Mich hielt es nicht auf dem Stuhl. Ruhelos tigerte ich hin und her, zog Runden durch den riesigen Raum, und plante mein weiteres Vorgehen. Allmählich klärte sich mein Kopf und ich begann konzentriert zu handeln. Zunächst einmal fotografierte ich das Zimmer bis ins kleinste Detail, danach den Toten von jeder Seite.
Neugierig, wie ich war, ging ich bei meiner Schnüffelaktion gleich mit durch die Schränke. Zischend zog ich die Luft ein. Der Verblichene hatte augenscheinlich nicht am Hungertuch genagt. Seine Garderobe war sauteuer. Valentino, Boss, Hackett London, Gucci, ausschließlich Marken der Luxusklasse.
Anschließend begab ich mich auf die Jagd nach dem Mordinstrument. Ich sah in die kleinsten Winkel, robbte über den Fußboden, schaute unters Bett – nichts, was einer Schlinge ähneln würde.
»Mist!«, machte ich laut meiner Frustration Luft, denn ich hegte den Verdacht, dass der Täter, während ich schlief, meine Hände mit der Tatwaffe in Kontakt gebracht haben könnte.
Resigniert gab ich die Suche auf, hier konnte ich nichts mehr ausrichten, zudem wurde es höchste Eisenbahn zu verduften. Der Gedanke, die Bullen zu rufen, kam mir nicht einmal im Ansatz. Da konnte ich ja gleich am Tor der JVA klopfen und für die nächsten zehn Jahre ein gemütliches Zimmer buchen.
Bevor ich die Wohnung verließ, drehte ich zur Vorsicht eine letzte Runde, ob ich auch nichts übersehen hatte. Neben dem Bett blieb ich stehen und schaute nachdenklich auf den Eimer. Ich hatte schon einiges erlebt, aber noch nie das ein sexhungriges Paar sein Liebesspiel unterbrach, um einen Kotzkübel bereitzustellen.
4. Kapitel
Eine unbarmherzige Mittagssonne tauchte den Straßenzug in gleißendes Licht, das von den hellen Häuserfassaden reflektiert wurde. Geblendet kniff ich die Augen zusammen und wühlte in meiner Tasche nach der Sonnenbrille. Die getönten Gläser schälten zwar die Konturen aus dem brennenden Weiß, meine Kopfschmerzen linderten sie allerdings nicht. Sie reagierten sehr ungehalten auf die Hitze und fielen mit doppelter Wucht über mich her. Stöhnend massierte ich meine Schläfen. Ich durfte jetzt nicht schlappmachen. Zeit für einen Zusammenbruch war später, wenn ich mein Programm abgespult hatte. Der Sack voller Aufgaben lastete schwer auf meinen Schultern, denn dass die Bullen bei ihren Ermittlungen irgendwann auf mich stoßen würden, konnte ich nicht ausschließen. Die Zeit bis dahin galt es zu nutzen. Zwar wusste ich nicht, ob ich bei Fortuna einen Stein im Brett hatte, aber vielleicht gelang es mir, den wahren Täter aufzuspüren, um als Unschuldslamm aus dieser fatalen Angelegenheit hervorzugehen.
Da ich meinem Erinnerungsvermögen seit heute nicht mehr über den Weg traute, fotografierte ich das Haus, aus dem ich gerade getreten war, die Briefkästen sowie den Straßenzug. Das Türschild an der Wohnungstür hatte mir verraten, dass hier jemand namens Glück hauste. Ob der Tote im Bett auf diesen Namen gehört hatte, leider nicht.
Nachdem ich einen Orientierungsblick in die Runde geschickt hatte, wusste ich in etwa, in welchen Stadtteil mich mein böswilliges Schicksal verschlagen hatte. Tapfer ignorierte ich meine Schwäche, setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen und marschierte in Richtung der nächstliegenden Straßenbahnhaltestelle. Bereits nach hundert Metern ertrank ich fast in meinem Schweiß. Ich war vollkommen erschöpft und verzweifelt, meine Glieder schwer und brüchig. Am liebsten hätte ich mich einfach fallen lassen, gleich hier an Ort und Stelle, nur um ein wenig auszuruhen. Woher ich die Kraftreserven nahm, die mich weiter vorwärtstrieben, wussten vielleicht die Götter, ich nicht.
Immer öfter überfielen mich Schwindelanfälle. Oft schaffte ich es erst im letzten Augenblick, Halt an einer Hauswand zu finden. Die Ursache für die Aussetzer lag auf der Hand: Flüssigkeitsmangel. Im Stillen verfluchte ich mich dafür, dass ich vergessen hatte, in der Wohnung meinen Mund an den Wasserhahn zu halten. Zu meiner Entschuldigung konnte ich nur anführen, dass mir der Boden unter den Füßen gebrannt hatte und ich schnellstmöglich vom Tatort verduften wollte. Zusätzlich focht ich einen harten Kampf mit meinem Willen aus. Ständig war ich versucht, die Flasche, die ich immer in meiner Handtasche bei mir trug, herauszureißen, um das darin befindliche Wasser herunterzustürzen. Das verbot sich natürlich von selbst, hatte ich doch keine Ahnung, ob eine heimtückische Hand ungute Chemikalien hineingemischt hatte.
Nach einer gefühlten Ewigkeit an der Haltestelle angekommen, zog ich eine Viererkarte am Automaten und sank völlig geschlaucht auf eine Bank. Zehn Minuten später trudelte die Bahn ein. Unter Zuhilfenahme all meiner Kraft zog ich meinen von Giftstoffen vergewaltigten Leib am Türgriff in den Wagen. Einmal musste ich die Prozedur des Umsteigens auf mich nehmen, dann verließ ich am Uniklinikum die Bahn. In der prallen Sonne vor mich hin dampfend, bewältigte ich die letzte Etappe bis zur Gerichtsmedizin.
Fast ängstlich lief ich zu dem mir vertrauten Büro und seufzte erleichtert, als ich den Namen Dr. Eisenhuth an der Tür las. In drei Jahren fließt viel Wasser die Elbe hinunter, spülte alte Dinge weg, setzte neue an deren Platz. Mir fiel ein Stein vom Herzen, dass meine alte Freundin immer noch als Gerichtsmedizinerin ihre Brötchen verdiente.
Meine geballte Faust zum Klopfen erhoben, verharrte ich unentschlossen. So, wie ich Marlies kannte, würde sie sich bei meinem Auftauchen in einen Gletscher verwandeln und das mit Recht. Ich konnte froh sein, wenn sie mich nicht achtkantig wieder rausschmiss. Da mir keine Wahl blieb, riss ich mich am Riemen, pochte zaghaft und betrat nach Marlies’ »Herein« das Büro.
Ich hatte es befürchtet, das Lächeln meiner Freundin fiel bei meinem Anblick in sich zusammen. Demonstrativ senkte sie den Kopf und schenkte ihr ganzes Interesse einem vor ihr liegenden Schriftstück. »Was kann ich für Sie tun, Frau Mohn?«
Früher hätte ich mich, einen flotten Spruch auf den Lippen, auf ihren Besucherstuhl gepflanzt. Jetzt traute ich mich das nicht. »Du hast allen Grund, sauer auf mich zu sein. Es tut mir unendlich leid, dass ich mich nicht bei dir gemeldet habe, ich …«
Marlies half mir kein Stück und schaute weiter grimmig auf das Dokument.
»Ich bin damals in ein tiefes Loch gefallen und wusste nicht, wie ich da jemals rauskommen soll.«
Immer noch keine Reaktion.
»Erst viel später ist mir aufgegangen, dass ich vielleicht entschlossener hätte kämpfen sollen, da war es leider zu spät.«
Ein böses Brummen ließ mich Hoffnung schöpfen, immerhin hörte sie zu. Ich beeilte mich, weiterzureden. »Irgendwann habe ich aufgegeben, mich verkrochen, in Selbstmitleid gesuhlt und mich nicht getraut, dir unter die Augen zu treten.« Vor Verlegenheit trat ich von einem Bein auf das andere.
Marlies Kopf ruckte hoch. »Drei Jahre!«, zischte sie. »Drei verdammte Jahre wusste ich nicht, wie es dir geht. Wusste nicht, ob du in der Gosse liegst, auf den Strich gehst oder dich erhängt hast. Hast du eigentlich mal nachgezählt, wie oft ich dich angerufen und deine Mailbox vollgelabert habe?« Sie musterte mich aus zusammengekniffenen Augen. »Du brauchst gar nicht so zerknirscht rumhampeln, die Masche zieht bei mir nicht.«
Jetzt war es an mir zu schweigen, schuldbewusst ließ ich den Kopf hängen.
Marlies war noch nicht fertig. »Ich bin vor Sorge fast gestorben. Denk nur nicht, dass du einfach hier aufkreuzen und um gut Wetter bitten kannst.«
Ihre letzten Worte erreichten meinen Verstand nicht mehr, der Schreibtisch und das Regal vor mir hatten angefangen, zu schwanken. Ich war vollauf damit beschäftigt das Gleichgewicht zu halten. Instinktiv suchte meine Hand nach einem Rettungsanker und fand keinen. Sämtliche Kraft wich aus meinen Beinen, ich vollführte eine misslungene Pirouette und machte es mir auf dem Fußboden gemütlich.
Ein klatschendes Geräusch holte mich ins Leben zurück. Ich öffnete die Augen, sah Marlies’ erschrockenes Gesicht über mir und spürte die Schläge ihrer Handfläche auf meinen Wangen. »Du kannst aufhören, mich zu schlagen, ich bin wieder da.« Meine Stimme war kaum mehr als ein Hauch.
»Ich sollte viel stärker auf dich einprügeln, verdient hättest du es«, knurrte meine Freundin grimmig. Ihr besorgter Blick und die Tränen in den Augen straften ihre Worte Lügen. Sie richtete sich auf, nahm ihr Handy vom Schreibtisch und murmelte etwas von Notarzt.
Sofort kam Leben in mich. Das fehlte mir gerade noch. »Nicht!«, flüsterte ich so laut ich konnte und zog mich am Stuhl in die Senkrechte.
Marlies hob den Kopf. Ihr Blick durchbohrte mich förmlich.
»Ich brauche nur einen Schluck zu trinken, bin komplett dehydriert.«
Argwöhnisch verzog sie das Gesicht, ließ mich keinen Moment aus den Augen, während sie eine Flasche vom Tisch nahm und ein Glas füllte.
Mein Körper zitterte vor Schwäche, mit beiden Händen führte ich das Glas zum Mund, stürzte das Wasser herunter und saute mich dabei voll.
Kommentarlos schenkte Marlies nach.
Der Inhalt des zweiten Glases folgte dem ersten. Noch nie hatte mir lauwarmes Wasser so gut geschmeckt. Glücklich lächelnd stieß ich leise auf, mir ging es bereits besser.
Mit einem Papiertuch tupfte Marlies meine Bluse trocken. Der Ärger war aus ihrem Gesicht verschwunden, ihre Augen schimmerten feucht vor Mitgefühl. »Dass Wassermangel der Grund für deinen Zusammenbruch war, kannst du einer Idiotin erzählen. So beschissen, wie du aussiehst, ist da weit mehr.«
»Nettes Kompliment.«
»Sei froh, dass ich überhaupt noch mit dir rede. Und jetzt erzählst du mir, was passiert ist, und wage ja nicht mich anzulügen.«
Notgedrungen berichtete ich meiner Freundin von meinem Erwachen in der mir unbekannten Wohnung, dem Filmriss und meinem Verdacht, dass man mir K.-o.-Tropfen oder etwas Ähnliches verabreicht haben könnte. Dabei retuschierte ich toten Typ aus der Geschichte, schwafelte stattdessen etwas von einem Liebhaber, der sich vor meinem Aufwachen verdrückt hatte.
Eigentlich war ich ganz gut im Lügen und imstande den Leuten die abwegigsten Ausreden unterzujubeln. Nur bei Menschen, die ich mochte, wollte mir das partout nicht gelingen. Dann wurde ich zapplig, geriet ins Stocken und verhedderte mich in Widersprüche. Dummerweise hatte ich Marlies sehr gern, dementsprechend wacklig kam mein Lügengespinst rüber.
Kommentarlos nahm meine Freundin die Story zur Kenntnis. Ich wog mich bereits in Sicherheit, wollte erleichtert aufatmen, da traf mich ein scharfer Blick aus ihren graugrünen Augen.
»Ich werde dir jetzt Blut abnehmen. Wenn der Test positiv ausfällt, die Daten an die Polizei weiterleiten. So kannst du umgehend Anzeige erstatten.« Das Lächeln auf ihren Lippen pendelte zwischen fies und lauernd.
Während sie die Hände wusch, Handschuhe überzog und ihr Folterequipment zurechtlegte, fiel kein Wort. Als die Kanüle in meine Vene eindrang, wandte ich schnell den Blick ab und interessierte mich für Marlies’ verwegene Kurzhaarfrisur. Einmal umkippen reichte mir völlig.
Nachdem das Röhrchen mit meinem roten Lebenssaft gefüllt war, presste Marlies Zellstoff auf den Einstich. »Fest draufdrücken«, kam der knappe Befehl, danach legte sie mir eine Manschette an den anderen Arm und maß meinen Blutdruck. »Fünfundachtzig zu sechsundfünfzig, bisschen niedrig. Puls einhundertzehn. Die Werte könnten auf eine Droge hindeuten.« Sie trat zur Tür und schloss ab. »Zieh dich bitte aus.«
Wenige Minuten später stand ich, mir meines katastrophalen Anblicks durchaus bewusst, verschämt vor ihr.
Marlies ließ ihren Zeigefinger rotieren. »Slip und BH auch. Anschließend legst du dich auf die Liege.«
Kaum hatte ich mich langgemacht, beugte sich meine Freundin über mich und rümpfte die Nase. »Du stinkst wie eine Kompanie Soldaten nach dem Manöver.«
»Tut mir leid, ich bin auf dem Weg zu dir an keiner Dusche vorbeigekommen.«
Marlies ignorierte meine Bemerkung und begann mich vom Scheitel bis zu den Fußsohlen einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen.
Während sie mich abtastete und jeden Quadratzentimeter Haut begutachtete, musterte ich sie verstohlen. Die vergangenen Jahre waren gnädig mit ihr umgegangen. Bis auf die neue Frisur hatte sich Marlies kein bisschen verändert. Ihr gefärbter Pagenschnitt hatte einer grauen Kurzhaarfrisur weichen müssen. Praktisch, vor allem, weil ihre schlanke, durchtrainierte Figur deutlich verriet, dass sie immer noch auf Laufschuhen unterwegs war.
Marlies’ Worte unterbrachen meine Beobachtungen. »Womit verdienst du inzwischen deine Brötchen?«
»Ich arbeite in einem Callcenter als Telefonistin.«
Für einen kurzen Moment vergaß sie, meinen Körper nach Hämatomen abzusuchen, und sah überrascht auf. »Du? Bei deiner Qualifikation? Konntest du nichts Besseres finden?«
Ich schenkte ihr ein leeres Lächeln. »Glaub mir, versucht habe ich es und nicht zu knapp. Im ersten halben Jahr habe ich mich ganz gezielt auf Stellen beworben, die meinem Profil entsprachen. Nur Absagen. Als mein Kontostand immer weiter schrumpfte, habe ich meine Anforderungen Stück für Stück zurückgesteckt. Fünf-, sechsmal bin ich sogar zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, die wollten mich auch einstellen, aber spätestens am nächsten Tag kam eine Absage.« Ich lachte bitter auf. »Einer der Personalchefs hat mir durch die Blume zu verstehen gegeben, dass ihm nahegelegt worden sei, mich nicht zu beschäftigen. Du kannst dir denken, welche Typen bei dem Beschiss ihre Finger im Spiel hatten.«
»Aus welchem verdammten Grund hast du mich nicht um Hilfe gebeten?«
Meine Schultern zuckten wie von selbst. »Ich fand, dass es genügt, wenn eine von uns in der Scheiße sitzt.«
Marlies wollte ärgerlich auffahren, überlegte es sich jedoch anders und bedachte mich mit einem warmen Blick. »Das Dumme ist, dass du recht haben könntest. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit gehen.«
Inzwischen war Frau Doktor fertig geworden. »Hm«, brummte sie, streifte die Handschuhe von den Fingern, warf sie in einen speziellen Müllbehälter und setzte sich zu mir. »Verletzungen oder andere Spuren äußerer Gewaltanwendung konnte ich nicht feststellen. Da hast du wohl noch mal Glück gehabt.« Sie runzelte die Stirn. »Bist du so tief gesunken, dass du mit jedem x-Beliebigen ins Bett steigst?«
Der Vorwurf traf mich bis tief in meine Seele. »Ich bin Single. Ab und zu schreien meine Hormone nach einem Kerl und da ich immer eine Packung Kondome dabeihabe, tue ich keinem weh.« Mein Tonfall war schärfer ausgefallen, als ich es beabsichtigt hatte.
Marlies nahm meine Hände und drückte sie sanft. »So habe ich es nicht gemeint, Zoe. Aber es ist immer ein Risiko, sich auf fremde Männer einzulassen. Du bist neununddreißig, wird es nicht langsam Zeit für eine feste Beziehung?«
»Hab bis jetzt nur Kerle getroffen, deren Gene lieber nicht weiterverbreitet werden sollten.«
»Schon gut. Du kannst dich wieder anziehen. Ist dir noch schwindlig?«
»Bis auf die Kopfschmerzen geht es mir ganz gut.«
»Möchtest du ein Aspirin?«
Abwehrend verzog ich das Gesicht. »Bloß nicht! Ich bin allergisch auf Acetylsalicylsäure. Wenn ich das Zeug einwerfe, schwellen meine Lippen an und in einer halben Stunde habe ich einen Schnabel wie Daisy Duck.«
Grinsend reichte Marlies mir einen Becher mit einem roten Schraubverschluss. »Du weißt ja, wo die Toilette ist. Ich brauche noch eine Urinprobe.«
»Mehr nicht?«, fragte sie wenig später, als ich den Becher vor sie auf den Schreibtisch stellte.
»Hast du schon mal versucht, aus Trockenobst Juice zu pressen?« Seufzend sank ich auf ihren Besucherstuhl, der Weg zur Toilette war anstrengend gewesen.
»Es wird schon reichen. Ich schicke die Proben umgehend ins Labor. Morgen wissen wir mehr.« Sie setzte die Lesebrille auf, suchte ein Formular aus dem Schrank und ließ ihren Blick mehrere Minuten auf mir ruhen. »Gib mir bitte die Adresse der dubiosen Wohnung, damit die Unterlagen vollständig sind.«
Ich wich ihrem bohrenden Blick aus und versuchte, unschuldig auszusehen. »Die neue Frisur steht dir gut, macht dich jünger.«
»Neu? Ich habe mir meine Haare vor einem Jahr abschneiden lassen, irgendwie muss das an dir vorbeigegangen sein.« Mit gespielter Verwunderung schüttelte sie den Kopf, dann sah sie mich vielsagend an. »Wie wäre es, wenn du endlich mit der Wahrheit rüberkommst?«
Ich hob ergeben die Hände, Marlies würde mir keine weiteren Lügen abkaufen. »Wenn du das, was ich dir jetzt erzähle, an die Polizei weitergibst, kannst du mich morgen im Knast besuchen.«
»Frühestens in drei Jahren. So, und nun leg los!«
Was blieb mir übrig? Ohne Marlies’ Hilfe würde ich niemals meine Unschuld beweisen können. Haarklein beschrieb ich ihr, was ich im Bett neben mir vorgefunden hatte.
Noch bevor ich fertig war, sprang Marlies auf und begann im Raum hin und her zu tigern. »Hat dich jemand gesehen, als du das Haus verlassen hast?«
In meinem Tran hatte ich das natürlich nicht mitgekriegt und zuckte deshalb mit den Schultern.
»Dann lerne zu beten. Weißt du, ob der Kerl eine Freundin hatte oder verheiratet war?«
Erneut hob ich meine Schultern und ließ sie mit einem kläglichen Lächeln wieder sinken.
Marlies reckte mir den Daumen entgegen. »Gut gemacht, Zoe!« Sie holte tief Luft, riss sich gerade noch zusammen und sagte gefährlich leise: »Wie dämlich muss man sein, um mit einem wildfremden Mann ins Bett zu steigen? Hast du schon mal was von Geschlechtskrankheiten oder perversen Lustmördern gehört?«
»Also gegen Ersteres habe ich Kondome und …«
Ihr Finger zeigte drohend in meine Richtung. »Sei bloß still! Ich versuche, deinen Arsch zu retten, und riskiere dabei meinen.« Sie schnaufte durch. »Hast du die Wohnungstür hinter dir ins Schloss gezogen?«
Ich nickte.
»Gut, vermutlich wird der Tote dadurch nicht sofort entdeckt. Schlecht für die Ermittlungen der Polizei, gut für dich.« Sie biss sich auf die Unterlippe und überlegte. »Warst du wenigstens so clever und hast Fotos vom Tatort sowie dem Toten gemacht?«
Kommentarlos reichte ich ihr mein Smartphone.
Ihr Finger wischte durch die Fotogalerie und sie pfiff leise. »Erwürgt mit einer Schlinge. Das ist kein gebräuchliches Vorgehen.« Sie stand auf, kam um den Tisch herum und machte eine auffordernde Handbewegung. »Deine Handflächen!«
Brav hielt ich ihr die Pfötchen hin.
»Sehr schön«, stellte sie nach eingehender Betrachtung fest. »Keinerlei Verletzungen oder Abschürfungen. Moment!« Sie hob den Finger und holte die Spiegelreflexkamera aus dem Schrank, mit der sie für gewöhnlich Leichen fotografierte.
Wie biegsam Marlies war, wurde mir erst jetzt so richtig vor Augen geführt. Sie verrenkte sich, um meine Handflächen aus allen möglichen und unmöglichen Positionen zu fotografieren. Dabei nahm sie Körperhaltungen ein, die jedem Yogi Ehre gemacht hätten. Sie fing einen meiner anerkennenden Blicke auf, lächelte und ging mit der Haltung einer Frau, die sich ihrer Attraktivität bewusst war, zurück zu ihrem Stuhl.
Sie klickte sich durch die Fotos und wirkte sehr zufrieden. »Dass deine Hände keinerlei Spuren von Einschnitten oder Abschürfungen aufweisen kann vor Gericht durchaus für dich sprechen. Natürlich gibt es auch Schlingen mit Griffen, sollte zutage kommen, dass so eine verwendet wurde, sind die Aufnahmen wertlos.« Gleich darauf richtete sie ihre Aufmerksamkeit erneut auf die Fotos, die ich gemacht hatte.
Da ich davon ausging, dass die Bilder von der Wohnung und der Straße keine weiteren Aktionen bei Marlies auslösen würden, schnappte ich mir die Wasserflasche, schenkte nach und trank. Dabei betrachte ich nachdenklich die Flasche. Irgendetwas war da noch? Erst nach mehreren Minuten machte es klick. Ich war immer noch nicht in Bestform, es würde dauern, bis mein Körper das Gift restlos abgebaut hatte. Immerhin, der Groschen war gefallen. Ich öffnete meine Tasche und holte die Wasserflasche heraus. »Kannst du bitte überprüfen, ob da irgendwelche bösen Substanzen drin sind.« Mit diesen Worten stellte ich die Flasche auf Marlies’ Tisch.
Sie hatte mir überhaupt nicht zugehört. Fassungslos starrte sie mich an. Hob kraftlos die Hand und winkte mich heran. »Wenn du mal schauen möchtest.«
Neugierig beugte ich mich über mein Smartphone. Mein Verstand weigerte sich zunächst, das Foto zu verarbeiten, als er sich schließlich dazu durchgerungen hatte, trommelte mein Herz vor Angst schneller als der Bass-Drum einer Death-Metal-Band.
5. Kapitel
Kaum hatte sich die Tür der Gerichtsmedizin hinter mir geschlossen, versengte mir die Sonne brutal das Gesicht. Eigentlich wollte ich mir auf dem Nachhauseweg die nächsten Schritte zurechtlegen, aber die Hitze erschwerte nicht nur das Atmen, sie kochte auch meine Gedanken zu Brei.
Marlies hatte mir nahegelegt, in meinem Zustand ein Taxi zu nehmen. Um sie zu beruhigen, hatte ich genickt, aber eine derartige Ausgabe war bei meinem Gehalt nicht machbar.
Bereits nach hundert Schritten quoll mir der Schweiß aus allen Poren. Ich seufzte tief, zog dabei ein ebenso leidgeprüftes Gesicht wie Maria Stuart, als sie ihren Kopf auf den Richtblock legte, und trottete zur Haltestelle. Damit man mich nicht wegen Geruchsbelästigung aus der Bahn warf, presste ich die Arme fest an den Körper, suchte mir ein abgelegenes Plätzchen und schaute gelangweilt aus dem Fenster. Müdigkeit überkam mich, immer mehr sackte ich im Sitz zusammen. Mehrmals gähnte ich so heftig, dass ich mir beinah den Unterkiefer ausrenkte. Bevor ich wegdämmerte, holte mich ein Gedanke mit Wucht in die Welt der Wachen zurück. Mist, heute war Montag. Ein Arbeitstag. Folglich musste ich meinem Job nachgehen. Ich richtete mich kerzengerade auf, wühlte hektisch das Smartphone aus meiner Tasche, öffnete die App, die meine Dienstpläne verwaltete, und seufzte vor Erleichterung laut auf, als ich las, dass ich heute Spätschicht hatte. Im Homeoffice.
Abgekämpft und klatschnass erreichte ich meine Mietwohnung in Dresden Striesen. Mir blieb noch eine reichliche Stunde bis zum Arbeitsbeginn.
In Windeseile duschte ich und fühlte mich danach halbwegs wieder als Mensch. Anschließend huschte ich nackt in die Küche und schmiss meinen MACCHIAVALLEY Kaffeevollautomat an. Liebevoll sah ich dem Teil einen kurzen Moment bei der Zubereitung meiner Lieblingsdroge zu. Die MACCHIAVALLEY weckte Erinnerungen an ein besseres Leben in mir. Sie war ein Relikt aus jener Zeit, als ich mir derart sündhaft teure Luxusgegenstände leisten konnte. Bei meinem jetzigen Einkommen war das ausgeschlossen. Die Hälfte meines mageren Gehaltes ging für die Miete drauf, die andere ermöglichte es mir, mich durchs Existenzminimum zu hungern.
Gleich als ich die Wohnung betreten hatte, war der vertraute Begrüßungslärm in meinem Wohnzimmer losgebrochen. Natürlich hatte mein kleiner blaugefiederter Freund das Einrasten des Türschlosses registriert und sich augenblicklich in einen Freudenrausch hineingesteigert. Dementsprechend herzlich fiel die Begrüßung aus. Er machte einen Satz von seiner Stange, klammerte sich an der Tür seines Bauers fest und schaute mich auffordernd an.
»Ich freue mich auch riesig dich zu sehen, Whisky. Leider kann ich dich noch nicht rauslassen. Ich muss noch ein wenig für uns beide den Lebensunterhalt verdienen, heute Abend darfst du flattern.«
Es zerriss mir das Herz, dass ich ihn nicht fliegen lassen konnte. Doch dummerweise wurde meine Schicht stets von einem Teammeeting eingeläutet. Ich hegte die leise Befürchtung, dass mein ständig griesgrämiger Chef wenig Verständnis dafür aufbringen würde, wenn Whisky während der Besprechung auf meiner Schulter hockte, fröhlich ins Mikro krähte und mir auf die Schulter schiss.
Ich schnappte mir seinen Wasserspender, spülte ihn gründlich und füllte frisches Wasser ein. »Du hast bestimmt Durst, bei dieser Hitze.« Aber Whisky hatte inzwischen geschnallt, dass die Tür geschlossen bleiben würde, und zeigte mir die kalte Schulter.
Sein Körnervorrat war ausreichend, das verschaffte mir eine Gnadenfrist, um für meine Bedürfnisse zu sorgen.
Mir blieben zehn Minuten. Zeit, Gas zu geben. Ich schaltete den Rechner an, raste ins Badezimmer, kämmte schnell durch meine Haare, schaute in den Spiegel und zuckte erschrocken zurück. Jede einzelne Minute dieses furchtbaren Vormittags war mir deutlich anzusehen.
Schaudernd wandte ich mich ab, zog mir frische Sachen an, trug einen Pott Kaffee und eine Flasche Wasser an den Arbeitsplatz, stellte die Verbindung her und sank geschafft auf den Stuhl. Noch einmal kurz durchgeschnauft, das Headset auf den Scheitel gesetzt, ein motiviertes Lächeln ins Gesicht gezaubert und auf die Sekunde genau grinste ich in die Kamera.
Marco, der Teamleiter, begann die Show mit seinem gewohnten Gesülze. Betonte die Kundenzufriedenheit bei Beratungsgesprächen und wies darauf hin, dass alle die Gelegenheit nutzen sollten, den Leuten am anderen Ende der Leitung neue – natürlich preisintensivere – Verträge aufzuschwatzen. Kurz überlegte ich, ob es sinnvoll wäre, ihn darauf hinzuweisen, dass seine Vorgaben blödsinnig waren. Kann ein Kunde zufrieden sein, nachdem man ihn übers Ohr gehauen hatte? Doch da ich diesen Job brauchte, hielt ich die Klappe.
Danach wurde jeder gezwungen einen Spruch von sich zu geben, um seine Motivation für den bevorstehenden Einsatz in Worte zu fassen. Na ja, auch diese Prüfung ging einmal zu Ende und ich wurde zu den Kunden durchgestellt, beantwortete Fragen zu Rechnungen, Kündigungsfristen, nahm Änderungswünsche entgegen und dergleichen mehr.
Nach zwei Stunden ging ich in die erste gewerkschaftlich verordnete Pause. Eine Stippvisite auf der Toilette, neuen Kaffee brühen und zwei Scheiben Knäckebrot mit Käse belegen – das alles musste flott gehen, in zehn Minuten würde ich wieder online sein.
Mein Appetit hatte sich zurückgemeldet, kauend schaute ich zu Whisky, der neugierig zu mir herübersah. Ich winkte ihm und er sah das als Aufforderung zu lärmen.
Der kleine Kerl war mir im späten Frühjahr zugeflogen. Das Bild stand so leibhaftig vor mir, als sei es gestern gewesen. Völlig verängstigt, zerzaust und verdreckt hatte er kläglich piepsend in einer Ecke meines Balkons gehockt. Ich hatte für ihn eine Übergangsbleibe aus einem Schuhkarton gebastelt, ihn hochgepäppelt und Aushänge an sämtlichen Hauseingängen des Viertels angebracht. Als sich nach einer Woche keiner gemeldet hatte, spazierte ich in eine Tierhandlung und erfragte, auf welchem Weg ich den Besitzer ausfindig machen könnte. Eventuell anhand der Daten auf dem Ring, war mir erklärt worden. Da Whisky einen derartigen Schmuck nicht trug, hatte ich ihn kurzerhand adoptiert. Hatte mein Konto geplündert und den schönsten Vogelbauer gekauft, den ich kriegen konnte. Seitdem sind wir dicke Freunde und ich war dabei ihn sprechen zu lehren. Ein paar Worte konnte er bereits, natürlich seinen Namen, schlau wie er ist, hatte er den als erstes beherrscht. Nur gute Zoe wollte er partout nicht sagen. Aber als ich einmal, wütend auf meine Unordnung, das Wort Schlampe in den Mund genommen hatte, speicherte er es auf der Stelle in seinem Sittich-Gehirn ab.
Das Verhängnis war in Gestalt meiner Eltern über mich hereingebrochen. Sie waren zu Besuch gekommen, Whisky hatte auf seiner Stange gesessen, schöngetan und seinen Namen gesäuselt. Begeistert hatte Mutter in den Käfig geschaut und nach den üblichen Lockrufen »Du bist aber ein lieber Vogel« gesagt.
Whisky hatte das Kompliment erwidert indem er ihr ein freundliches »Schlampe« entgegenkrähte. Seitdem ignoriert sie ihn.
Ein Blick zur Uhr riss mich aus meiner Tagträumerei und bis zum Schichtende widmete ich mich erneut den Problemen von Telefonkunden.
Endlich, nachdem ich mir den Mund stundenlang fusselig gequatscht hatte, war Feierabend. Erleichtert riss ich mir das Headset vom Kopf, schlüpfte in Windeseile in meine Hausklamotten und öffnete die Tür zum Vogelbauer. Völlig außer Rand und Band schoss Whisky wie ein Düsenjäger auf mich zu, landete auf meiner Schulter und knabberte an meinem Ohrläppchen.
Da ich unbedingt Ablenkung brauchte, legte ich eine CD von Chris Knight in den Player und summte mit.
Whisky war das überhaupt nicht recht. Er forderte meine gesamte Aufmerksamkeit und schimpfte so laut, dass er Chris locker übertönte. Was blieb mir, als nachzugeben? Ich schaltete den Player aus und fläzte mich in meinen bequemen Lese- und Fernsehsessel. Das Teil hatte ich in einem Möbel An- und Verkauf aufgetrieben und nachdem ich die Polster gründlich geschrubbt hatte, sah es bis auf zwei kleine Brandflecke ganz manierlich aus. Die Farbe des Bezugsstoffes war eine verwegene Komposition aus Rot- und Brauntönen. Da ich beim Lesen gern naschte und Rotwein trank, fand ich das ganz praktisch. Ein Schauder durchfuhr mich, als mir die weiße Ledergarnitur in Glücks Wohnung in den Sinn kam. Bei meinem Talent zum Kleckern würde das Teil nach wenigen Tagen wie ein altes Fensterleder aussehen.
Das Bild der Ledergarnitur spülte die Ereignisse des Tages zurück an die Oberfläche meiner Gedankenwelt. Ich rieb meine müden Augen und erzählte Whisky alles, was mir an diesem schrecklichen Tag widerfahren war. Die Erinnerung an den toten Mann im Bett färbte meine Stimme dunkel vor Verzweiflung. Mein feinfühliger kleiner Sittich spürte, dass etwas nicht in Ordnung war und rieb sein Köpfchen an meiner Wange. Die Streicheleinheiten taten mir gut und beruhigten meine geschundenen Nerven. Es gelang mir, klarer zu denken und mich dem Problem zu widmen, dass ich vor mir hergeschoben hatte, seit Marlies das Foto auf meinem Smartphone entdeckt hatte. Das Bild zeigte mich in schönster Aktion beim Hoppe-Hoppe-Reiter-Spiel mit dem unbekannten Mann, als er zu so einer Performance noch in der Lage gewesen war. Erneut überlief es mich kalt, als mir aufging, was das bedeutete: Jemand hatte uns beim Sex beobachtet, dieser Jemand hatte mit meinem Smartphone ein Foto geschossen und sowohl mein Liebhaber als auch ich mussten dermaßen neben der Spur gestanden haben, dass wir nichts davon mitbekommen hatten. Dass dieser Jemand vermutlich der Mörder war, lag auf der Hand.
All diese Überlegungen warfen eine Frage auf, eine Frage, die vermutlich den Schlüssel zur Lösung des Falls in sich barg: Warum wollte mich der Mörder das alles unbedingt wissen lassen?
Inzwischen waren Whisky meine Tiraden zu langweilig geworden, er drehte eine Ehrenrunde, flog in seinen Bauer und hielt ein Nickerchen auf der Stange. Um ihn nicht zu wecken, schlich ich zum Käfig und schloss leise das Türchen.
Endlich konnte ich die Fenster aufreißen. Die Luft in den Zimmern war zum Schneiden stickig. Danach kochte ich mir eine große Kanne Tee, mein Durst war überirdisch.
Zurück im Sessel mampfte ich Erdnussflips, um meinem Körper Energie zuzuführen und dadurch meine Denkleistung zu forcieren. Dabei kreisten meine Gedanken unentwegt um das Foto. Der Täter hatte es bewusst mit meinem Handy gemacht. Wollte er mir drohen? Steckte einfach nur die Botschaft dahinter: Halt den Mund und vergiss das alles?
Möglich war das. Der Mord sah verdächtig nach Hinrichtung aus. Eventuell hatte der Typ sich mit mächtigen Leuten angelegt und die wollten keine weitere Leiche auf dem Hals haben.
Oder war da viel mehr? Lautete die Botschaft etwa: Ich weiß, wer du bist und wo ich dich finde? Die daraus resultierende Spekulation löste ein Stöhnen in den Tiefen meiner Seele aus, meine Kehle verengte sich und fast konnte ich die mörderische Schlinge an meinem Hals spüren. Was wenn der Mord Teil einer Inszenierung war, um mich endgültig kaltzustellen?
6. Kapitel
Am frühen Morgen war ein Regenguss über der Stadt niedergegangen, die halb verdursteten Pflanzen, vom Staub reingewaschen, reckten ihre Blätter kräftig der Sonne entgegen. Auch ich war vollkommen wiederhergestellt und in meinem gewohnten Sturmschritt unterwegs. Auf dem Weg zur Haltestelle kam ich an Hecken vorbei. Es roch nach feuchter Erde, tief atmete ich die frische Luft ein. Ein Genuss nach der brütenden Hitze der letzten Tage.
Während die Straßenbahn durch die Stadt zuckelte, dachte ich über den Plan nach, der mir gestern kurz vor dem Einschlafen in den Sinn gekommen war und überlegte, ob ich nicht gerade dabei war, eine riesengroße Dummheit zu begehen. In einem Viertel herumzuschnüffeln, in dem in einer Wohnung ein Mann vor sich hin faulte, konnte leicht nach hinten losgehen. Aber blieb mir denn eine Wahl? Zu Hause sitzen, Däumchen drehen und abwarten bis die Herren in Blau an meiner Tür klingelten, war als Alternative nicht gerade verlockend.