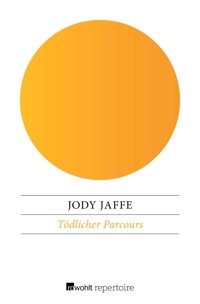
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Ruskie war das wertvollste Pferd im Stall. Und das hinterhältigste. Der Hengst trat, biß, stieg hoch und ging auf Menschen los. Aber springen konnte er wie ein Hase … Ruskie war so schön, daß bei den Turnieren alle pferdenärrischen Mädchen ihre Mütter zu seiner Box zerrten, um ihn zu streicheln.» Als die Moderedakteurin Natty Gold den Hengst und seinen Trainer tot in der Box findet, ermittelt sie auf eigene Faust, denn sie kennt die vielen kleinen schmutzigen Geheimnisse der Gegend und mindestens ein Dutzend Leute, die als Täter in Frage kommen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Jody Jaffe
Tödlicher Parcours
Aus dem Englischen von Jobst-Christian Rojahn
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Ruskie war das wertvollste Pferd im Stall. Und das hinterhältigste.
Der Hengst trat, biß, stieg hoch und ging auf Menschen los. Aber springen konnte er wie ein Hase … Ruskie war so schön, daß bei den Turnieren alle pferdenärrischen Mädchen ihre Mütter zu seiner Box zerrten, um ihn zu streicheln.»
Als die Moderedakteurin Natty Gold den Hengst und seinen Trainer tot in der Box findet, ermittelt sie auf eigene Faust, denn sie kennt die vielen kleinen schmutzigen Geheimnisse der Gegend und mindestens ein Dutzend Leute, die als Täter in Frage kommen …
Über Jody Jaffe
JODY JAFFE, eine gestandene Journalistin und turniererprobte Springreiterin, hat einen kenntnisreichen, witzigen und rasanten Pferdekrimi geschrieben.
Inhaltsübersicht
Für die Shepard-Jungen Charlie, Ben und Sam. Und zum Gedenken an Arthur Isaac, den letzten Bombenschützen.
Prolog
Möglicherweise schien draußen der Mond, aber genau ließ sich das nicht sagen. Es war, als ob die Erde schwitzte, so feucht war die Luft. Nicht einmal der kleinste Lichtsplitter vermochte die dichte Nebeldecke zu durchbohren.
Rob Stone sah durch die Stalltür hinaus. Er konnte kaum erkennen, wo die Erde aufhörte und der Himmel anfing. Das lachsfarbene Polohemd klebte ihm an der nassen, heißen Haut. Er zog es von sich weg und blies in dem Versuch, sich Kühlung zu verschaffen, Luft zwischen seine Brust und das vollgesogene Baumwollgewebe. Aber in den dampfenden Nächten Carolinas gab es kein dauerhaftes Mittel gegen die feuchte Hitze.
Die Quecksilbersäule war seit fast zwei Wochen nicht mehr unter zweiunddreißig Grad Celsius gesunken. Die Pferde schwitzten so sehr, daß es aussah, als wären sie dick mit Vaseline eingeschmiert worden. Stone ließ die Ventilatoren nicht gern die ganze Nacht laufen. Schon ein Fünkchen hätte genügt, den Stall in Brand zu setzen. Andererseits führte eine derart anhaltende Hitze leicht zu Koliken. Und bei einer schlimmen Kolik (das, was für den Menschen ganz normale Bauchschmerzen waren) konnten sich die Eingeweide eines Pferdes zu einer Brezel verschlingen, bis sie schließlich wie Wasserschläuche platzten.
Dieses Risiko wollte Stone nicht eingehen. Am folgenden Tag mußte alles tipptopp sein. Er ging also den Gang entlang, schaltete über allen Boxen die Ventilatoren ein und ließ sie mit höchster Geschwindigkeit laufen. Als er sich Ruskies Box näherte, legte das Pferd die Ohren an und versuchte auf ihn loszugehen.
«Du bescheuertes Mistvieh», sagte Stone. «Wenn du nicht eine Viertelmillion Dollar wert wärst, würde ich dich nach Camden zurückprügeln.»
Ruskie war das wertvollste Pferd im Stall. Und das hinterhältigste. Der Hengst trat, biß, stieg hoch und ging auf Menschen los. Aber springen konnte er wie ein Hase. Er hob die Vorderbeine bis an die Ohren und galoppierte so mühelos über einen Parcours mit ein Meter zwanzig hohen Hindernissen hinweg, als lägen die Stangen auf dem Boden.
Ruskie war so schön, daß bei den Turnieren alle pferdenärrischen Mädchen ihre Mütter zu seiner Box zerrten, um ihn zu streicheln. Selbst die Aufforderung, nicht so nah an ihn heranzugehen, oder der warnende Hinweis, daß er sie beißen würde, sobald er sie sähe, nützten nichts – sie standen da und starrten ihn an. Ein so herrliches Tier war Ruskie.
Das lag zum Teil an seiner Größe. Er war riesig und so muskulös wie ein olympischer Läufer. Mit einem Stockmaß von ein Meter achtundsiebzig war Ruskie größer als alle anderen Pferde, die bei den A-Turnieren an den Start gingen. Stone konnte Ruskie nicht über die Schulter schauen, obwohl er selber eins sechsundsiebzig maß.
Ruskie hatte eine perlweiße, durchgehende Blesse. Der Rest seines Fells war von tiefem Braun – so dunkel und glänzend, daß es aussah wie heißer Schokoladenguß.
Stone hatte Ruskie vor drei Jahren auf der Trainingsbahn von Camden in South Carolina entdeckt. Das Pferd war zwar bei ein paar Rennen unter die ersten drei gekommen, letztlich aber doch nicht so schnell gewesen, daß die Trainer Lust gehabt hätten, sich mit seiner Hinterhältigkeit herumzuärgern. Stone hatte den Riesengaul für ganze zweitausend Dollar gekriegt und gewußt, daß ihm da etwas ganz Besonderes in die Hände gefallen war. Im vergangenen Jahr hatte Ruskie bei den beiden größten und wichtigsten Turnieren des Landes – bei der National Horse Show und beim Washington International – den Titel des Green Conformation Hunter Champion errungen. Und im laufenden Jahr war sein Punktevorsprung bei der Pferd-des-Jahres-Wertung schon so groß, daß ihm kein anderes Pferd mehr den Rang streitig machen konnte.
Für den morgigen Tag zehn Uhr hatte sich Lucy Bladstone, die Frau von L.M. Bladstone, Chef von Bladstone Foods, Tobacco & Textiles, mit ihrem Trainer Wally Hempstead angesagt. Mrs. Bladstone wollte Ruskie noch ein letztes Mal unter die Lupe nehmen, bevor sie den Scheck ausstellte. Einen Scheck über 250000 Dollar.
Ruskie brauchte nur zweierlei zum Abschluß des Geschäfts beizutragen: Er mußte das tun, was er von Natur aus tat, nämlich hervorragend springen. Und er mußte durch die tierärztliche Untersuchung kommen.
Stone knipste das Licht aus und trat in die nächtliche Suppe hinaus. Hinter sich konnte er vierundzwanzig Ventilatoren summen hören, die alle auf Hochtouren liefen. Er ging bis zum Ende des Stallgebäudes, dann um die Ecke und stieg schnell zu seiner Wohnung hinauf. Er zog sich aus, duschte kurz und zog dann einen Calvin-Klein-Schlafanzug mit blauweißen Streifen und scharfen Bügelfalten in Ärmeln und Hosenbeinen an. Daraufhin öffnete er seinen Kleiderschrank und sah einen Stapel säuberlich zusammengelegter Polohemden durch. Er zog das aquamarinblaue mit dem magentaroten Polopferdemblem heraus – das Hemd, das seine gebräunte Haut noch brauner und seine blauen Augen noch blauer erscheinen ließ. Daneben legte er ein Paar frischgewaschene Jeans, in deren Beine genau wie bei seinem Schlafanzug scharfe Falten hineingebügelt worden waren. Morgen mußte er einfach fabelhaft aussehen, noch besser als sonst. Er wollte, daß Wally Hempstead klar wurde, was er sich entgehen ließ.
Stone stellte seine Klimaanlage auf superkühl, ging ins Bett und schlief sofort ein. Normalerweise hatte er einen so leichten Schlaf, daß er augenblicklich hörte, wenn es im Stall Probleme gab. Wenn sich ein Pferd in seiner Box festlegte, dann hörte Stone, wie es bei dem Versuch, auf die Beine zu kommen, gegen die Wände trat. Noch bevor sich das Pferd hochrappeln konnte, war er schon im Stall und half ihm.
Die Klimaanlage und die Ventilatoren jedoch ließen Stone in dieser Nacht nichts anderes hören als ein lautes Surren.
Eins
«Aufgepaßt, der Schuhverkäufer kommt», sagte Jeff Fox und versuchte dabei das ihm Unmögliche – ein Flüstern. Sein Schreibtisch steht neben dem meinen. Angeblich teilen wir uns einen PC, aber er beansprucht ihn ausschließlich für sich, was er mit dem Hinweis rechtfertigt, als Fernsehkritiker tagaus, tagein Artikel produzieren zu müssen. Das bedeutet, daß ich mir immer irgendwo in der Redaktion einen freien Computer suchen muß, was mir aber nichts ausmacht. Jeff spricht so laut, daß ich mir jedesmal, wenn er telefoniert, das ganze Gespräch einschließlich aller Kommas mit anhören muß. Vor einer Viertelstunde hörte ich ihn zu einer Anruferin sagen: «Nein, gnädige Frau, ich kenne die sexuellen Neigungen von Mr. Rogers nicht. Nein, gnädige Frau, ich weiß auch nicht, wo Sie etwas darüber in Erfahrung bringen können. Aber herzlichen Dank für Ihren Anruf.»
Höflichkeit gegenüber dem Leser ist das Hauptanliegen unseres neuen Chefredakteurs Fred Richards, auch als «Schuhverkäufer» bekannt. Das ist so ungefähr alles, was er an Grips und Integrität mitbringt. Es war Jeff gewesen, der Richards’ Spitznamen entdeckt hatte – die anderen Redakteure der Kette, zu der auch unsere Zeitung, The Charlotte Commercial Appeal, gehört, nannten ihn so. Jeff hatte sich mal bei unserem Schwesterblatt, den Miami Morning News, einem kleinen, zusammengestoppelten Revolverblatt, das Berichte über verurteilte Kindesmörder mit Titeln wie «Rübe ab!» versieht, um einen Job bemüht. Mitten beim Abschlußgespräch hatte sich der Chefredakteur mit der Frage an ihn gewandt: «Na, wie arbeitet sich’s denn so beim Schuhverkäufer?» Jeff hatte den Job zwar nicht bekommen, unser Laden dafür aber einen großartigen Spitznamen für Richards.
Fred Richards ist fixiert auf das, was er die «Zufriedenheit des Kunden» nennt. Was er in Wirklichkeit meint, das ist vor allem die Zufriedenheit des Inserenten. In den vier Monaten, in denen er nun beim Appeal das Sagen hat, haben wir bereits unseren besten Kolumnisten verloren. Richards hatte ihm einen seiner Artikel, eine wahnsinnig komische Geschichte über Gebrauchtwagenhändler, mit der Begründung gestrichen, sie strotze nur so von Stereotypen. «Wir würden ja auch keine Stories über Schwarze und Wassermelonen oder über Geld und Juden bringen», hatte Richards argumentiert. Larry, der Kolumnist, hatte Richards klarzumachen versucht, daß Gebrauchtwagenhändler weder eine religiöse Gruppierung noch eine Rasse seien, obwohl es vielleicht ganz danach aussehe. Aber Richards war hart geblieben. Larry hatte seinen Artikel zerknüllt, ihn Richards ins Gesicht geschmissen, war aus dem Haus gestürzt und gleich hinein in einen Job bei der Los Angeles Post, Heute ist er in diesem unserem Lande die Nummer eins unter den Schreibern komischer Kolumnen.
Richards’ auf die Zufriedenheit des Kunden ausgerichtetes Sinnen und Trachten bezieht aber durchaus die Leser mit ein, und zwar alle bis zum allerletzten. Wenn sich ein Reporter dabei erwischen läßt, daß er sich einem Leser gegenüber unflätig äußert, wird er sofort zum Chef zitiert und ins Gebet genommen. Und dann hat er (Richards bedrohlich dicht neben sich) die beleidigte Person anzurufen. Egal, wie beleidigend sich diese ihm gegenüber verhalten hat, der Reporter muß zu Kreuze kriechen und um Vergebung bitten wie ein katholisches Schulmädchen, das mit der Hand an einer Stelle ertappt worden ist, an der sie nichts zu suchen hat. Bis der Boß endlich zu verstehen gibt, daß es genug sei.
«Uh, oh, Nattie», sagte Jeff und versuchte noch angestrengter zu flüstern, was aber immer noch lauter war, als ein normaler Mensch spricht. «Er steuert direkt auf dich zu und hat diesen entschlossenen Männerblick im Auge. Du mußt ja jemandem voll auf alle Zehen getreten sein.»
Wahrscheinlich hatte Jeff recht. Es ist unglaublich, wie viele Leute täglich bei der Zeitung anrufen. Einsame Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als Reportern solche Fragen zu stellen wie die nach den sexuellen Neigungen von Mr. Rogers. Und mich trifft das noch ärger als alle anderen. Da ich über Mode schreibe, umfaßt mein Gebiet auch die universale, alles entscheidende Frage: Wie sehe ich aus? Dauernd rufen mich Leute an und wollen wissen, was sie anziehen sollen. Ich bin dann immer versucht zu sagen, sie sollten sich doch mal mit etwas Wichtigem wie dem Hunger auf der Welt oder den politischen Ambitionen Arnold Schwarzeneggers befassen. Statt dessen versichere ich ihnen, daß ihr weißes Chiffonkleid von 1974 geradezu ideal ist für die Gartenhochzeit ihrer Großnichte.
Die Menschen wollen gar nicht die Wahrheit wissen, sondern nur Munition geliefert bekommen. «Also, die Moderedakteurin des Commercial Appeal hat gesagt, daß ich dieses Kleid anziehen kann.» Ich bin zwar eigentlich nur Reporterin, aber die Leser haben das Bedürfnis, meine Autorität dadurch zu vergrößern, daß sie mir den Status der Redakteurin zuerkennen. Sie würden mich auf der Stelle zur Hausmeisterin degradieren, wenn sie wüßten, wie ich mich anziehe. Ich habe die Übersicht verloren und weiß nicht mehr, wie oft mich Richards schon darauf hingewiesen hat, daß ich in unpassender Kleidung zur Arbeit erscheine, also in Minis, Jeans und uralten Klamotten. Bei uns hier im Süden ist eigentlich alles außer Khaki, Oxford und den so treffend Add-a-Beads genannten Halsketten unpassend.
Heute bin ich allerdings mal fast vorschriftsmäßig gekleidet. Eine ruhig geblümte Bluse, dazu ein geschmackvoller, knielanger roter Rock. Lediglich meine blauen wildledernen Halbschuhe und die limonengrünen Socken passen nicht ganz ins Bild, aber sie sind ja auch unter dem Tisch versteckt. Weshalb marschiert also Richards auf meinen Schreibtisch los, als hätte ich Miss Chitlin, der Queen von Rocky Mount, geraten, oben ohne zum Sonntagsgottesdienst zu gehen? Was konnte er von mir wollen, wenn er ein solches Gesicht machte?
«Nattie», sagte Fred, «Sie verstehen doch was von Pferden?»
Mehr, als er hoffentlich je erfahren würde, dachte ich. Manchmal ließ ich für eine Stunde meine Arbeit ruhen, um mein Pferd zu bewegen.
«Ein bißchen», antwortete ich. «Was gibt’s denn, Fred?»
Er zog einen Stuhl heran, legte seine Hand darauf und ließ erst dann seinen großen Hintern niedersinken. Ich fragte mich, ob er wohl Hämorrhoiden hatte.
«Außerhalb von Charlotte, in der Nähe von Waxham, gibt es eine Farm», sagte Fred. «Offenbar stehen dort ein paar recht teure Springpferde. Ich meine ziemlich teure. Sechsstellig. Wie jemand soviel für einen Gaul ausgeben kann, übersteigt mein Fassungsvermögen. Wie auch immer, da ist in der vergangenen Nacht was ganz Fürchterliches passiert. In einer der Boxen haben sie einen toten Mann gefunden. Der hatte ’ne blutige Brechstange in der Hand und allem Anschein nach ein Pferd attackiert. Das war schon halb tot, als sie es fanden. Gebrochene Beine, alles blutverschmiert. Jede Hilfe kam wohl zu spät. Deshalb mußten sie es …»
Fred hob den Zeigefinger an die Stirn, richtete den Daumen auf, als spanne er einen Revolver, und sagte: «Peng.»
«Das alles ist auf der February Farm passiert. Schon mal was von der gehört?»
February Farm. Mein Herz hämmerte gegen die Rippen, und ich muß noch blasser geworden sein, als ich es so schon bin, also ganz schön käsig. Wo ich doch eine hellhäutige Jüdin mit roten Haaren bin, deren Haut in der Sonne sofort verbrennt und Blasen bekommt! Ich hatte mein Pferd auf der February Farm stehen.
«Alles in Ordnung, Nattie? Ist Ihnen nicht gut?» fragte Fred.
«Wissen Sie, welches Pferd getötet wurde?» fragte ich so leise zurück, daß sich Fred vorbeugen mußte, um mich verstehen zu können.
«Ich habe nur gehört, daß es ein außergewöhnlich teures Pferd war, das heute an jemanden von den Bladstones aus Camden verkauft werden sollte», antwortete Fred.
Puhhh! Mein Pferd war ein vergleichsweise billiges und stand nicht zum Verkauf. Trotzdem, da war in meinem Stall ein Pferd angegriffen worden, und ich hatte die Nacht durchgeschlafen, ohne daß es mir kalt den Rücken hinuntergelaufen war? Üblicherweise kriege ich mit, wenn im Stall etwas nicht stimmt. Obwohl es schon peinlich oft zu falschem Alarm gekommen ist und ich mitten in der Nacht rausgerast bin, nur um dort einen Stall voller Pferde vorzufinden, die verschlafen dreinblickten und durch die plötzliche Störung ganz verschreckt waren. Ich bin jemand, der sich dauernd Sorgen macht, und es fällt mir schwer zu erkennen, wo die Grenze zwischen eingebildeter und echter Besorgnis verläuft. Trotzdem war ich öfter im Recht als im Unrecht. Wie zum Beispiel damals, als ein hübsches schwarzes Fohlen mit seinem Halfter an einem Nagel hängengeblieben war. Es war drei Uhr morgens, und ich wußte einfach nicht, ob ich die Besitzerin anrufen sollte. Schließlich tat ich’s dann doch, und sie wollte mir anfangs nicht glauben. Ich sagte ihr mit allem Nachdruck, daß ich mich diesmal nicht irre. Und ich hatte wirklich recht. Nur kam die Frau zu spät, das Fohlen hatte sich bereits erhängt.
Solche Sachen sind mir in meinem Leben immer wieder passiert. Ich habe das nie jemandem erzählt, nur der Großmutter meiner besten Freundin. Und das auch nur, weil sie zuerst auf dieses Thema zu sprechen gekommen war. Das ist fünfundzwanzig Jahre her. Ich war elf, sie schrubbte Möhren, um zimes für Rosch ha-Schana zu machen. «Rothaarige Juden und grünäugige Mulatten», sagte sie und sah mich so gerade an, als sehe sie in mich hinein, «die sind aus einem Holz geschnitzt. Ihr seid nicht an die Erde gefesselt wie wir. Ihr wißt Dinge. Gott hat euch was extra gegeben, weil er all das Böse, das er euren Vorfahren widerfahren ließ, wettmachen wollte.»
Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. Ich konnte nur erwidern: «Mach keinen gefüllten Kohl.» Da sah sie mich eine Sekunde lang komisch an und sagte dann: «Nattie, mein Schätzchen, was geschehen soll, das geschieht.»
Zwei Wochen später war sie gestorben, und das hätte niemand vorhersehen können, denn sie war kerngesund. Man fand sie mit dem Gesicht in einem Teller voll gedünstetem Kohl, die Finger einer Hand fest um ein Bällchen aus Gehacktem und Reis geschlossen. Ich wußte es, bevor mich meine beste Freundin davon unterrichtete.
Ich weiß auch nicht, warum ich diese Dinge weiß. Es ist einfach so. Der Guru meines Vaters meint, meine unmittelbare Beziehung zu Pferden rühre daher, daß ich karmamäßig mit allen Pferdeartigen verbunden sei. Offensichtlich war ich in einem früheren Leben Katharina die Große.
Was ich aber weiß, ist, daß es in der vergangenen Nacht zu heiß war, um überhaupt noch leben zu können – von karmagesteuerten Signalen eines Pferdes in Not konnte jedenfalls keine Rede sein. Ich hatte den Kopf aus dem Fenster gereckt und versucht, so viel Kühle in mich hineinzusaugen, wie ich kriegen konnte. Es war dunkel, feucht und so stickig gewesen, daß ich mich schon gefragt hatte, ob ich vielleicht umsonst bekommen würde, wofür mein Vater gerade fünfhundert Dollar hingeblättert hatte. Er hatte nämlich das Wochenende mit einer Erdgöttin aus Cincinnati namens Celestial Wild-Wombmyn, geborene Shirley Moscowitz, verbracht. Diese hatte versprochen, das Kind meines Vaters von innen her zurückzuholen, indem sie ihn in einer indianischen Schwitzhütte wiedergebar. Sollte ihm wirklich nach einer indianischen Schwitzhütte zumute gewesen sein, hätte er genausogut auch mich besuchen können.
Ich hatte mein Bett an die gegenüberliegende Wand schieben müssen, um mit dem Kopf am offenen Fenster schlafen zu können. Das ist die einzige Möglichkeit, in meiner Wohnung Schlaf zu finden. Sie hat keine Klimaanlage. Das war mir ganz in Ordnung erschienen, als ich vor zweieinhalb Jahren meinen Wohnsitz nach North Carolina verlegt hatte. Ich war aus dem Norden das Staates New York gekommen, wo ich von September bis Juni gefroren hatte. Ich hatte keinen Schimmer, wie ein Sommer im Süden aussehen konnte.
Die Miete war billig – zweihundert Dollar. Mehr konnte und kann ich mir nicht leisten, weil mich der Unterhalt meines Pferdes dreihundertfünfzig Dollar kostet und ich noch ungefähr einhundertfünfundzwanzig Jahre lang Studiendarlehen zurückzahlen muß, die mein Vater auf meinen Namen aufgenommen und zurückzuzahlen vergessen hat. Außerdem zahle ich noch fünfzig Dollar monatlich für das Gnadenbrot meines ersten Pferdes – es verbringt nun schon mehr Jahre im Ruhestand, als es gearbeitet hat, und nähert sich schnell einem guinnessbuchverdächtigen Langlebigkeitsrekord. Es ist schon verrückt, wenn man mehr Miete für sein Pferd als für sich selbst bezahlt. Immerhin habe ich im Laufe der Jahre gelernt, mich ein wenig besser um mich selbst zu kümmern. Nur wenn es um Pferde geht, ist alles aus.
Ich war eines dieser pferdevernarrten Mädchen gewesen, aus denen eines Tages pferdevernarrte Frauen werden. Solange ich denken kann, habe ich Pferde im Kopf gehabt. Schon als ich noch klein war, dachte ich nur an sie, vom Aufstehen bis zum Zubettgehen – und dann auch noch im Traum. Wenn ich das Bild eines Pferdes sah, küßte ich es zehnmal und wünschte mir dabei, bald ein eigenes zu haben.
Wenn mir meine Mutter Barbiepuppen schenkte, dann schnitt ich ihnen ihre flachsblonden Haare ab und machte aus ihnen Mannweiber mit kahlgeschorenem Kopf, oder ich nahm mir ihre Kleider vor und zog die Püppchen so an, daß sie wie Stadtstreicherinnen aussahen. «Ich will keine Puppen», sagte ich zu meiner Mutter. «Kauf mir ein Pferd.»
«Ein so kleines Scheißerchen und so große Träume», pflegte meine Mutter dann zu sagen. «Wo hast du die her? Von deinem Vater? Sag diesem nichtsnutzigen Ganoven, er soll lieber mal den Unterhalt zahlen, statt dir solche Flausen in den Kopf zu setzen. Ist dir jemand bekannt, der in einem Reihenhaus wohnt und ein Pferd hat? Was glaubst du, wer wir sind? Die Rockefellers?»
Sie kaufte mir aber Plastikpferdchen. Cremefarbene, golden schimmernde Palominos mit hochgebogenen Hälsen und schwarze Hengste, auf den kräftigen Hinterbeinen aufgerichtet und mit den Vorderbeinen nach imaginären Feinden schlagend. Ich spielte stundenlang mit meinen Plastikpferden.
Als mein Körper anfing, sich zu verändern, und meine Gedanken dem Verbotenen zustrebten, waren es Pferde, die mich dorthin brachten. Ich und die anderen pferdevernarrten Mädchen – es gab genug davon – spielten Hengst und Stute, manchmal mit unseren Plastikpferden, manchmal mit uns selbst. «Du bist die Stute, ich bin der Hengst», sagte eine von uns, und dann kletterten wir aufeinander und taten so, als paarten wir uns.
Black Beauty ist das erste Buch, an das ich mich erinnere, und ich las es fünfzehn- oder zwanzigmal, wobei ich bei jeder Seite, die ich umblätterte, betete, daß ich am Morgen meines nächsten Geburtstages aufwachen und hinter unserem Haus ein dickes graues Pferd wie Merrylegs finden würde. Das geschah aber nie, weshalb ich die Sache schließlich selbst in die Hand nahm. Als ich zehn geworden war, eröffnete ich bei der Filiale Overbrook Park der Philadelphia Fidelity Savings Bank ein Sparkonto. Zehn Cent pro Woche. Als ich siebzehn wurde, hatte ich vierhundert Dollar zusammen. In dem Jahr kam ich aufs College, das heißt, ich wechselte zur University of Colorado, und kaufte mir dort von dem ersparten Geld ein Pferd. Homer. Sein voller Name war Homely Homer, weil er den größten Schädel im ganzen Stall hatte. Für mich war er der Schwarze Hengst, mein Freund Flicka, National Velvet. Ich mistete Ställe aus und bezahlte davon seinen Unterhalt. Ich schwänzte Seminare, um Homer reiten und striegeln zu können.
Dann schmiß ich das Studium. Ein Pferdefreak. Ich wohnte in einem Keller mit Lehmboden, Monatsmiete fünfundzwanzig Dollar. Mein Trinkwasser kam aus dem unteren Teil des Heißwasserspeichers, und wenn ich das Bad benutzen wollte, dann mußte ich raus und um das Haus rum zum Seiteneingang gehen. Homer stand derweil in einem geheizten Stall mit Selbsttränke und Warmwasserwaschanlage.
Ich backte in einem International House of Pancakes bei der zweiten Nachtschicht Pfannkuchen und kam wöchentlich auf hundertfünfzig Dollar. Das reichte kaum aus, um Homer und mich durchzubringen. Ich hatte nicht das Talent zur Berufsreiterin und nicht die richtigen Beziehungen, um die Tierärztliche Hochschule absolvieren zu können. Ein noch nicht angekränkelter Teil meines Hirns wußte, daß ich ein Leben brauchte, in dem Pferde keine Rolle spielten. Schließlich kannte ich meine Stärken – ich war eine begabte Wichtigtuerin und konnte alles aus jedem herausfragen, was stets damit endete, daß mir die Leute ihre ganze Lebensgeschichte erzählten. Und ich hatte schon immer gern geschrieben. Es war an der Zeit, das Studium abzuschließen, um an einen richtigen Job zu kommen.
Meine Eltern, die schon seit zehn Jahren außerhalb von Gerichtssälen kein Wort mehr miteinander gewechselt hatten, entwickelten doch tatsächlich gemeinsam einen Plan. Sie wollten das Geld für meine Rückkehr in den Osten vorschießen. Mein Vater sagte, er würde sich um die Studiengebühren kümmern, während ich die Kohle zusammenkratzen mußte, um mit Homer durchs ganze Land bis nach Hause zu reiten.
Ich schaffte es auch. Alles verlief nach Plan. Ich schloß mein Studium der Publizistik erfolgreich ab und wurde bei der Zeitung, was ich heute bin – Modereporterin des Charlotte Commercial Appeal.
Ich hatte mich nie sonderlich um Kleidung gekümmert und verstand auch nicht viel davon, aber ich hätte auch über die Müllabfuhr geschrieben, um einen Job beim Commercial Appeal zu bekommen. Wenn man hier arbeitet, mag man das kaum glauben, aber für die Experten gehört der Commercial Appeal zu den Top Ten der amerikanischen Zeitungen. Dafür dürfte allerdings nicht so sehr die Qualität des Blattes ausschlaggebend sein, sondern eher die Tatsache, daß die anderen so schlecht sind.
Schon seit anderthalb Jahren liege ich den Redakteuren in den Ohren, mich von der Mode wegzuholen und in die Feature-Abteilung zu versetzen. Aber ich bekomme immer wieder nur «bald» oder «sobald es der Etat möglich macht» zu hören. Im Augenblick soll’s mir jedoch recht sein. Ich bin kein Phantast, und meine jetzige Tätigkeit hat den Vorteil, daß ich mitten am hellichten Tag mal kurz abhauen und mein Pferd bewegen kann, ohne daß es meine Bosse mitkriegen. Die sitzen dauernd in ihren Konferenzen – Planungen, Entwürfe, Ermittlung der Bedürfnisse zukünftiger Leser. Aber das Beste an allem ist, daß mein Pferd, eine sanftmütige Fuchsstute namens Brenda Starr, in meinem Traumstall steht.
Die February Farm ist ein wahres Pferdeparadies. Die Boxen sind riesig, drei sechzig mal drei sechzig, mit einer knietiefen Einstreu frischer Sägespäne. Dort draußen gibt es kilometerlange Reitwege, die schönsten, die ich je geritten bin, eine Bahn von Olympiagröße und den Trainer Rob Stone, der bei Pferden Wunder wirkt, auch wenn er Menschen gegenüber gehemmt ist und seinen Reitern gegenüber sehr ausfällig werden kann. Während der ganzen zurückliegenden zweieinhalb Jahre hat er mich nur angebrüllt. Trotzdem verdanke ich es ihm, daß ich mich von vierten und fünften Plätzen bei lokalen, als B-Turniere eingestuften Springen zu dritten und gelegentlich sogar zu zweiten und ersten Plätzen bei den wichtigsten A-Turnieren der Südstaaten verbessern konnte. Was immer man über Rob sagen mag, von Pferden versteht er was. Er kann aus einem Zweitausend-Dollar-Klepper einen Star machen, der das Vielfache wert ist.
Wie ihm das ja auch bei Ruskie gelungen war. Es mußte das Pferd sein, von dem Fred gesprochen hatte. Ruskie war der schönste Gaul, den ich je gesehen hatte. Bei den Turnieren lief er unter dem Namen Russian Caviar. Mir war bekannt, daß Lucy Bladstone heute zum Stall hatte rausfahren wollen, um ihn zu kaufen. Ich wußte aber auch, daß Ruskie ohne seinen B&B-Cocktail keine einzige Runde mehr schaffte. Das sind Butazolidin und Banamin, zwei Schmerzmittel, die zusammengemixt und dann in den Hals oder in die Kruppe injiziert werden, damit ein überarbeitetes, überstrapaziertes Pferd fehlerfrei funktioniert. Und wenn das die Wehwehchen nicht heilt, dann werden ihm zehn oder zwanzig Kubikzentimeter Finadyne verpaßt, ein bislang noch nicht untersagtes Mittel, von dem Trainer behaupten, daß man damit praktisch auch einen Gaul springen lassen kann, der ein gebrochenes Bein hat.
Erst gestern hatte Rob Ruskies leichte Aluminiumeisen vom Schmied gegen stählerne auswechseln lassen, weil er hoffte, daß das Tier mit dem verstärkten Schutz seiner Hufe leichter durch die tierärztliche Ankaufuntersuchung kommen würde.
«Überlassen Sie mir diese Story, Fred», sagte ich. «Ich kenne die Welt der Pferde. Und das Pferd, das getötet wurde. Ich verfüge über Quellen, die nicht einmal Henry zugänglich wären.»
Henry war Henry Goode, der Enthüllungsreporter des Commercial Appeal und King der allgemeinen Nachrichten. Während alle anderen pausenlos Artikel raushauen mußten, um ihr Soll zu erfüllen, durfte Henry in aller Muße an der Skandalgeschichte seiner Wahl arbeiten. Er hatte dem Commercial Appeal seinen ersten goldenen, den Dienst an der Öffentlichkeit honorierenden Pulitzer-Preis geholt, als er die Story von Jim und Tammy Bakker rausgebracht und die PTL gekippt hatte, eine millionenschwere christliche Fernsehkirche, zu deren Imperium auch ein Themenpark vor den Toren Charlottes gehörte.
«Da läuft nichts, Nattie», sagte Fred. «Das ist nun mal ’ne Geschichte für den Nachrichtenteil. Vielleicht können Sie einen Hintergrundartikel liefern, sagen wir eine Dreißig-Zentimeter-Randkolumne über das, was die Leute so zu Turnieren anziehen. Ich hab Henry die Sache schon erzählt, er ist ganz scharf auf diesen Ritt. Ha, schön gesagt, was? Warum berichten Sie ihm nicht mal, was Sie wissen, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergeben sollte?»
«Hintergrundartikel? Du kannst mich mal!» murmelte ich unhörbar vor mich hin. Einmal mehr fiel die Feature-Abteilung hinten runter. Immer, wenn wir eine richtig saftige Story an der Angel hatten, schaffte es einer von den Nachrichtenleuten, sie für seine Abteilung an Land zu ziehen. Diesmal nicht! Ich lächelte Fred an und sagte: «Ich werd mal mit Henry reden.»
Das Komische war, daß Henry eine auffällige Ähnlichkeit mit Ruskie hatte. Er war groß, prachtvoll gebaut und, soviel ich gehört hatte, ein Mann, der niemals aufgab, wie es der arme Ruskie ja offenbar auch nicht getan hatte. Henry überragte alle. Er war eins neunzig groß oder noch größer. Sein Gesicht war das vollendete Internatsschülergesicht – breite Wangenknochen, die sich gerade im richtigen Winkel nach außen und oben bogen, eine Nase, für die die Hälfte meiner Mitschülerinnen der 9. Klasse dem Dr. Diamond fünftausend Dollar gezahlt hatten, und Augen, so kristallklar und blau wie das Meer, auf welches das Sommerhaus hinausblickte, das seine Familie zweifellos irgendwo auf Cape Cod stehen hatte.
Henry war auf eine hochgradige, den ganz feinen Pinkeln eigene Weise gutaussehend.
«He, Henry», sagte ich, «wie ich höre, schreiben Sie jetzt auch über Pferde.»
Henry sah zu mir auf und lächelte. Ich habe ganz vergessen, sein Lächeln zu erwähnen. Vollkommenes Gebiß, natürlich, alle Zähne säuberlich aufgereiht wie Soldaten bei einer Parade. Und weißer als ein Kaubonbon mit Pfefferminzgeschmack.
«Nattie, ich wollte mich gerade mit Ihnen unterhalten. Ja, über Pferde. Erzählen Sie mir mal, was Sie über die February Farm wissen.»
Zwei
Henry Goode war berühmt dafür, daß er Menschen dazu bringen konnte, ihr Innerstes nach außen zu kehren, bevor sie noch so richtig begriffen hatten, daß er ihnen, ritscheratsche, den Bauch aufgeschlitzt hatte. Er sprach auf eine ruhige, ermutigend nüchterne Art, die einen glauben ließ, man unterhalte sich mit dem alten, erfahrenen Hausarzt der Familie – und alles werde wieder gut, auch dann, wenn man unter inoperablem Gehirnkrebs litt. Die Leute gelangten unausweichlich an den Punkt, wo sie ihm die erstaunlichsten Dinge anvertrauten. So hatte er auch den Jugendfreund Jim Bakkers zum Reden gebracht. Bevor es der Kerl richtig mitgekriegt hatte, war er schon ins Schwatzen gekommen und hatte von den Tagen erzählt, als Bakker noch Theologiestudent gewesen war. Und davon, daß Jim bei seinen Techtelmechteln mit Tammy nie Unterwäsche getragen hatte – das hatte ihm zu einem intensiveren Hochgefühl verholfen, wenn er sich an ihr schubberte. Henry hatte auch den Chef der First Carolina dazu gebracht, über Geschäfte seiner Bank mit südafrikanischen Firmen zu plaudern, die die Apartheid unterstützten. Als das in der Zeitung erschienen war, hatte der Bankchef öffentlich erklärt, er habe alle Verbindungen zu diesen Firmen gekappt, und in privatem Kreis geschworen, nie wieder mit einem Zeitungsreporter reden zu wollen.
Wo blieben denn aber nun die magischen Fähigkeiten Henrys? Fragte er mich schlicht und einfach nur aus? Vielleicht hatte ich ihn ein bißchen zuviel angeschaut und er war jetzt der Meinung, ich verzehrte mich geradezu danach, dem großen Henry Goode alles ausplaudern zu dürfen? Was er dabei nicht bedacht hatte, war folgendes: Ich mag zwar im Vergleich zu großen Blondinen mit herrlichen Körpern nur eine armselige Nudel sein, ja, meine Lebensgeschichte könnte den Titel tragen Natalie Gold – auf der Suche nach der heidnischen Lichtgestalt, aber ich weiß sehr genau, wo Schluß ist, wenn es darum geht, einem Mannsbild zuliebe törichte Dinge zu tun. Die Arbeit markiert die Grenze, und in den zwölf Jahren, die ich nun als Reporterin tätig bin, habe ich sie noch nicht ein einziges Mal überschritten.
Auf gar keinen Fall würde ich einen Hintergrundartikel über die neueste Reitermode schreiben, jedenfalls nicht, solange es nur zwanzig Minuten von meinem Schreibtisch entfernt einen blutigen Leichnam und ein totes 250000-Dollar-Pferd gab. Unter allen Berichten von der February Farm würden zwei Verfassernamen stehen: Henry Goode und Natalie Gold.
«Unterhalten wir uns unterwegs darüber», sagte ich und ging Richtung Tür.
«Unterwegs wohin?» Henry war von seinem Stuhl aufgestanden und hatte mich ohne große Mühe eingeholt. Seine Beine waren gut dreißig Zentimeter länger als meine. Wenn ich neben ihm ging, fühlte ich mich wie ein Shetlandpony, das mit einem Jagdpferd Schritt zu halten versucht.
«February Farm», antwortete ich. «Wohin sonst? Da ich die Polizeistation von Waxham kenne, gehe ich jede Wette ein, daß der Tote noch im Stall liegt und ihm dort eine Menge Fliegen um den Kopf rumbrummen.»
Wir liefen auf der Rolltreppe vier Stockwerke nach unten in die Eingangshalle. Auf dem Weg abwärts sah ich meine Freundin Kathy Powell, die bekannte Musikkritikerin, nach oben fahren – als lächelnden, purpurroten Farbklecks. Sie wirkte so verschwommen, weil wir uns sehr schnell bewegten – Henry mit seinen Daddy-Longlegs-Beinen und ich getrieben von dem Wunsch, den Stall noch vor dem ärztlichen Leichenbeschauer zu erreichen. Und sie lächelte, weil wir erst gestern eine Liste aller netten Jungs in der Redaktion angefertigt hatten, wobei sich die Reihenfolge danach richtete, wie gut im Bett sie unserer Vorstellung nach waren. Henry hatte die höchste Punktzahl erhalten. «Ich hab ihn mal bei einer Party tanzen sehen», hatte Kathy zu berichten gewußt. «Da war er ganz anders. Die Band spielte Reggae, frühen Bob Marley, und er hatte Wendy – du weißt sicher noch, daß die beiden mal zusammen gegangen sind – fest an die Wand gedrückt, schlängelte sich zum Rhythmus der Musik hin und her, rein und raus. Ich dachte glatt, sie würde auf der Stelle kommen. Und wenn sie nicht, dann ich.»
Er kann also tanzen. Aber wie ich schon sagte, wo es um die Arbeit geht, überschreite ich die Grenzen zum trickreichen Ranschmeißen niemals. Ich kann Arbeit und Vergnügen sehr gut auseinanderhalten.
«Sehn Sie sich bloß mal diese Halle an», sagte ich zu Henry. «Hier könnte wirklich jeder durchgedrehte Christenmensch reinmarschiert kommen und einen umlegen.»
«Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich», erwiderte Henry.
Nach der Veröffentlichung der Bakker-Story waren derart viele Morddrohungen gekränkter Sektenleute eingegangen, die alle glaubten, Henry sei der Laufbursche Satans, daß die Zeitung ihn erst einmal aus der Stadt geschickt hatte. Mit Einwilligung des Verlegers war ein bewaffneter Wachmann engagiert worden. Das alles hatte aber nur eine Woche gedauert. Jetzt war man in der Lobby nicht mehr sicher. Jeder Verrückte konnte hereinkommen und tat es für gewöhnlich auch. Erst in der vergangenen Woche war bei uns in der Redaktion ein Mann erschienen, der Baupläne für ein Parkhaus bei sich hatte, in dem die Autos wie Kleidungsstücke in einer chemischen Reinigung hintereinander aufgehängt werden konnten. Wenn man sein Auto wiederhaben wollte, gab man dem Parkwächter seinen Schein, der drückte auf einen Knopf, und schon kam das Auto in seiner mit einem Zahlencode versehenen Box an einer Zahnradschiene herabgeschwebt. Der gute Mann war der Ansicht, dies sei das ideale Parkhaus für den Commercial Appeal, und der Schuhverkäufer/Chefredakteur Fred, der einem Angehörigen der Leserschaft gegenüber nicht unhöflich werden wollte, mußte sich eine geschlagene Stunde mit ihm unterhalten, bevor er ihn schließlich dem Wirtschaftsredakteur zuschieben konnte.
«Lassen Sie uns mit Ihrem Auto fahren», schlug ich Henry vor, denn sein Wagen mußte einfach besser sein als meiner, ein alter Golf Diesel ohne Klimaanlage. Wir gingen über den Parkplatz, eine pottflache Betongeschichte mit ausgebleichten gelben Linien. Ich folgte Henry zu seinem Auto, einem silbermetallicfarbenen Accord – natürlich funkelnagelneu. Ich fragte mich allerdings, wie er sich da reinquetschen wollte.
Er schloß erst meine Tür auf. Ich setzte mich auf eine Wasserpistole, und die verspritzte so viel Flüssigkeit, daß es aussah, als wäre mir ein kleines Malheur passiert.
«Tut mir leid», sagte Henry. «Ich predige Chet immer wieder, er soll seine Spielsachen nicht im Auto liegenlassen. Er ist erst acht, aber die Vorpubertät scheint früh eingesetzt zu haben, denn er beantwortet alle meine Bitten mit einem verächtlichen Feixen. Trotzdem ist er ein toller Junge. Wollen Sie mal ein Foto von ihm sehen?»
Bevor ich noch mit meinem bejahenden Kopfnicken fertig war, hatte Henry schon eine Brieftasche hervorgezogen und bei einem Bild aufklappen lassen, das zwei blonde Buben zeigte. Sie sahen aus wie Miniaturausgaben Henrys.
«Großartige Jungs», sagte ich – die Standardantwort auf Kinderbilder. Diesmal aber meinte ich es ehrlich. Es war zwar ein Klischee, aber Henry strahlte wie ein Honigkuchenpferd.
Ich hatte schon gehört, daß er ein teilweise alleinerziehender Vater und seinen beiden Söhnen mit Haut und Haaren verfallen war. Man erzählte sich, daß Henrys einstige Frau, die er während des Studiums (er Harvard, sie Radcliffe) kennengelernt hatte und die als Expertin für Arbeitsorganisation arbeitet, von der neuen Trucker-Gewerkschaft angeheuert worden war, um bei der alten in Newark aufzuräumen. Henry hatte sich geweigert mitzugehen, weil er nicht wollte, daß seine Kinder die Luft New Jerseys zu atmen bekamen – was wohl so ist, als rauchte man stündlich fünfzehn Schachteln Lucky Strike. Man einigte sich deshalb auf eine Teilung der elterlichen Fürsorgepflicht – Henry kümmerte sich während der Schulzeit um die Kinder, und seine jetzige Exfrau bekam sie im Sommer und in den Ferien, solange sie nicht in Newark blieb, sondern mit ihnen irgendwo hinfuhr.
Ich reichte Henry die orangefarbene Wasserpistole. Er steckte sie in seine Brusttasche und ging dann um den Wagen herum zu seiner Tür. Trotz seiner beachtlichen Größe brachte er sich recht schnell auf dem Fahrersitz unter.
«Okay, jetzt sitzen wir also im Auto», sagte er. «Nun erzählen Sie mir mal was über die February Farm, und erklären Sie mir, wieso ein Pferd, das gar keine Rennen läuft, 250000 Dollar wert sein kann.»
«Drücken Sie erst mal auf die Tube», gab ich zurück. «Die Polizei mag ja langsam sein, aber tot ist sie nicht. Fahren Sie die Providence Road runter, bis zur Bundesstraße 16, und auf der immer weiter, bis Sie keine Backsteinhäuser mehr sehen.»
Ich redete, während draußen Charlotte, die «Queen City of the Carolinas», an uns vorbeiglitt. Eine neue Ziegelsteinparzelle mit Azaleenkübeln nach der anderen. Wir kamen nur selten an Häusern vorbei, die älter waren als zwanzig oder dreißig Jahre. Alles, was alt oder historisch gewesen war, hatte man abgerissen, um Platz für Gebäude mit glitzernden Glasfassaden zu gewinnen, die Namen trugen wie Nations-Bank Towers (nach dem napoleonischen Chef dieser Megabank, Hugh McColl, auch Taj McColl genannt). Was Charlotte an architektonischem Glanz fehlte, das glich es durch einen herrlichen Baumbestand aus. Groß, anmutig, zu Halbbögen aufragend, sind die Bäume die Kronjuwelen dieser Stadt und der Stolz ihrer Bewohner. Als der Hurrikan «Hugo» zweihundertfünfzig Meilen landeinwärts gezogen und durch Charlotte hindurchgebraust war, hatte die Stadt die umgestürzten Bäume so heftig betrauert, als wäre ein ganzer Bus voller Kinder verunglückt und keines mit dem Leben davongekommen.
Die höchsten und majestätischsten Bäume stehen an den vielen Queens Roads. Es gibt ein ganzes Labyrinth von Straßen, die alle diesen Namen tragen. Sie durchziehen den Myers Park, eines der ältesten und feinsten Viertel der Stadt. Niemand hat je zu erklären vermocht, warum fünf oder sechs Straßen den gleichen Namen haben. Ich kann mir nur vorstellen, daß sich in der Queens Road von alters her das Geld angesiedelt hat, weshalb die Stadtentwickler immer mehr Straßen Queens Road nannten, um reiche Leute anzulocken, die der Stadt etwas einbrachten. Weil es so viele Straßen gibt, die Queens Road heißen, kann man sich in diesem Dschungel leicht verlaufen, was so übel gar nicht ist, wenn man es nicht gerade sehr eilig hat. Dort stehen Weidenbäume, die so hoch sind wie Bürohäuser und deren oberste Äste sich zu einem Baldachin aus fiedrigem Grün verschränken, so daß man meinen könnte, man glitte durch einen Märchentunnel.
Während wir aus der Stadt hinausfuhren, erzählte ich Henry ein bißchen was von der Welt der Reitturniere und davon, daß 250000 Dollar kein Geld für Leute sind, die zwei Millionen Dollar teure Wochenendsitze im Jagdland Virginia bar bezahlen können und deren Familiennamen – Dodge, Maytag, Johnson, Bladstone, Du Pont – in jedem amerikanischen Haus zu finden sind.
«Man muß es gesehen haben, um es glauben zu können», sagte ich. «Stellen Sie sich eine schnatternde Schar zehnjähriger kleiner Mädchen vor, die mit ihren extra für sie gefertigten Honda-Dreirädern über das Turniergelände fahren, während ihre Pferdepfleger die 100000-Dollar-Ponies fertigmachen. Man hilft ihnen aufs Pferd, sie galoppieren über die Bahn und werden von ihren Müttern und Trainern angeschrien, wenn sie vor einem Hindernis den Absprung verpatzen, also zehn Zentimeter zu dicht ranreiten oder fünfzehn Zentimeter zu weit weg sind. Und wenn die Kleinen am Ende kein blaues Band bekommen, dann kriegen sie einen Wutanfall, und Daddy kauft ihnen ein neues, noch teureres Pferd. Das allerschlimmste aber ist … kein Mensch lächelt. Da ist ein Sport, der Spaß machen soll, und niemand lächelt.»
«Wozu ihn also ausüben?» fragte Henry.
«Das frage ich mich auch immer wieder. Pferde geben mir das Gefühl, im Gleichgewicht zu sein. Ich weiß, ich höre mich an wie mein Vater, der ein staatlich geprüfter New-Age-Spinner ist, aber es stimmt. Wenn ich eine Woche nicht mehr geritten bin, dann ist mir, als verlöre ich den Halt. ‹Angespannt› wäre eine höfliche Beschreibung meines Zustands, ‹zickig› eine zutreffende. Es gibt nichts Schöneres für mich, als mit meinem Pferd eine Bahn zu reiten, und alles stimmt. Aber wenn Rob bei Turnieren anfängt, mich anzubrüllen, dann, das muß ich zugeben, lächle ich auch nicht gerade viel.»
«Wer ist Rob?»
Wir waren in den weiß geschotterten Zufahrtsweg zur February Farm eingebogen, der von zwei gigantischen Ahornbäumen flankiert wurde.
«Das ist Rob», sagte ich und zeigte auf einen Mann in türkisfarbenem Polohemd und frisch gebügelten Jeans. Er saß zusammengekrümmt in einem marineblauen Regisseursstuhl, auf dessen Rückenlehne in jagdgrüner Farbe die Buchstaben FF aufgemalt waren, neben der Stalltür. Er hielt ein Papierhandtuch vor den Mund, hatte einen Eimer vor sich stehen, und seine Augen waren röter als der knallrot gestrichene Stall. Gerade als Henry dorthin blickte, wohin ich zeigte, übergab sich Rob in den Eimer – es war ein jagdgrüner Eimer mit marineblauem FF-Monogramm.
«Rob ist mein Trainer», sagte ich und sah in die entgegengesetzte Richtung. «Er leitet den Stall für Cameron Clarke.»
«Clarke wie Clarke-Crackers?» fragte Henry.
«Sie haben das Wesentliche der Sache schon recht gut kapiert», antwortete ich. Alle möglichen Automaten auf Gottes weiter Welt bieten Clarkes Crackers feil. Die Clarkes gehörten zum ältesten Geldadel von Charlotte, und ihr Name stand unter der Hälfte der Schätze des Kunstmuseums. Alle weiblichen Nachkommen hießen Maryclarke, Sarahclarke, Kimclarke oder einfach Clarke.
Henry hielt am Stall, neben einem Polizeiwagen. Einer der beiden Beamten war draußen und tat so, als nähme er den Schauplatz genauer in Augenschein, aß in Wirklichkeit aber Maulbeeren von einem knorrigen Baum, der wie die arthritische, nach dem Himmel grapschende Hand eines Riesen aussah. Da Polizisten immer zu zweit auftreten, nahm ich an, daß der andere bei den Toten im Stall war.
Als Rob aufsah und mitbekam, was ich neben mir sitzen hatte, beförderte er den Eimer mit einem Tritt hinter seinen Stuhl und wischte sich mit – wie ich angesichts der Umstände zugeben muß – großer Anmut den Mund ab. Henry und ich stiegen aus. Rob richtete sich auf und sagte tatsächlich «Hallo» zu mir, sah dabei jedoch Henry an. In den zweieinhalb Jahren, die Rob jetzt mein Trainer war, hatten wir noch nicht ein einziges normales Gespräch geführt. Er hatte noch nie «Tag, Nattie, wie geht’s denn so?» oder irgend etwas geäußert, was einer zivilisierten Plauderei nahegekommen wäre. Zumeist saß ich auf meinem Pferd und wärmte mich für eine Reitstunde auf, während er in die Bahn kam, jedem Wetter und selbst allem Matsch zum Trotz wie aus dem Ei gepellt aussah und murmelte: «Wie geht’s?», womit er aber mein Pferd meinte. Ich setzte ihm daraufhin auseinander, daß das Tier entweder zu schnell oder zu langsam ginge, aber er unterbrach mich stets und sagte nur: «Traben Sie einfach mal los.» Dann kam zumeist das Springen, und wenn ich so richtig Scheiße gebaut hatte, stemmte er einen Arm in die Hüfte und schrie: «He, Schätzchen, Sie glauben wohl, Sie fahren einen Lastwagen!»
Im allgemeinen bin ich nicht auf die Zustimmung von Autoritätspersonen aus, eher im Gegenteil. Am Lob von Trainern aber war mir seit jeher ungeheuer viel gelegen. Sie ließen aus mir ein schwanzwedelndes, herrchenabschleckendes kleines Hündchen werden. Und das war heute nicht anders.
«He, Rob, das ist Henry Goode. Wir arbeiten zusammen beim Commercial Appeal.»
Rob lächelte. Selbst mit geröteten Augen und grünlicher Blässe sah er verdammt gut aus. Noch so ein Blondschopf mit herrlichem Körper! Rob war allerdings so säuberlich manikürt und frisiert, war so sorgfältig – und künstlich – zurechtgemacht, daß er eher aussah wie ein frisch gestutzter Zierstrauch.
Falls Henry mitbekam, daß er von Rob taxiert wurde, so ließ er sich das nicht anmerken.
«Mein Gott, Sie glauben ja gar nicht, was heute morgen hier passiert ist», sagte Rob. «Das war der schlimmste Tag meines Lebens, wo es doch eigentlich der schönste werden sollte. Zunächst einmal wachte ich auf und mußte …»
Rob war für seine Verhältnisse geradezu geschwätzig. Er brauchte wohl keine Was-würde-ich-nicht-alles-für-einennetten-Kerl-tun-Linie zu überschreiten. Dann wurde er aber wieder grün im Gesicht, und ich fragte mich, was wohl mehr Macht über den menschlichen Körper hatte – die Hormone oder die Eingeweide.
«Es war Wally», sagte Rob. «Ich fand ihn tot in Ruskies Box. Er hat versucht, Ruskie zu erschlagen.»
Drei
Ich ließ Henry bei Rob zurück. Teilweise Rob, teilweise mir zuliebe. Ohne Henry konnte ich an dem Polizisten vorbeikommen, der tatsächlich im Stall umhergeisterte.
Als ich in den Stall hineinging, hörte ich, wie der Beamte draußen – der Maulbeerenesser – zu Rob und Henry trat. «Was dagegen, wenn ich mir mal den Heuschober ansehe?» fragte er Rob.
«Mir wär’s lieber, Sie täten das nicht», antwortete dieser. «Das Heu ist in Ballen aufgestapelt, und ich möchte nicht, daß da etwas in Unordnung gerät.»
«Hören Sie mal, guter Mann», sagte der Polizist, «ich kann auch mit einem Durchsuchungsbefehl wiederkommen und dann für echte Unordnung sorgen. Oder ich seh mir alles jetzt gleich an, und nichts gerät durcheinander. Ganz wie Sie wünschen.»
«Machen Sie, was Sie für richtig halten», sagte Rob. Mir entging das Knurrige in seiner Stimme nicht – es war derselbe Ton, den er immer anschlägt, wenn ich mein Pferd zum drittenmal vor einem Hindernis zurückreiße, weil ich Angst davor habe. «Da oben ist es wahnsinnig heiß. Aber wenn Sie darauf bestehen. Der Aufgang ist dort drüben, auf der linken Seite.»
Ich schlich an der Rückwand entlang bis zu Ruskies Box. Beide waren dort. Ruskie und Wally. Beide blutiger als eine Portion Gehacktes. Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenkrampfte und wie mein Verstand jede Tätigkeit einstellte. Ich griff nach der Seitenwand und verlor das Bewußtsein. Es dauerte nur ein paar Sekunden, aber als ich wieder zu mir kam, sah ich, daß Henry neben mir stand.
«Netter Versuch, Gold», sagte er. «Das nächste Mal sagen Sie mir bitte, wohin Sie gehen. Rob hat mir ein paar interessante Dinge erzählt.»
«Das bezweifle ich nicht», gab ich zurück. «Ich bin sicher, daß er nur so darauf brennt, Ihnen später noch mehr zu erzählen, unter vier Augen.»
Henry lachte und legte mir eine Hand auf die Schulter. «Nein danke. Alles in Ordnung?»
«Mir ist ein bißchen schummrig, aber sehen wir uns lieber den Burschen da mal an, bevor der Bulle spitzkriegt, daß wir hier drin sind.»
Ich holte tief Luft und sammelte mich – genau so, wie ich es tue, wenn ich mit meinem Pferd ein hohes Hindernis angehe. «Wirf erst dein Herz hinüber und spring dann hinterher, um es wieder aufzufangen», hat mir mal ein Trainer gesagt. Genau das tat ich jetzt und beugte mich zu Wally hinab, um ihn mir etwas genauer anzusehen.
Er hatte am ganzen Körper Schwellungen und war grün und blau von den Tritten, mit denen ihm Ruskie die Scheiße aus dem Leib getreten hatte.
«Der hat einiges einstecken müssen», meinte Henry. «Ich wußte gar nicht, daß Pferde so gewalttätig sein können.»
«Sie haben Ruskie nicht gekannt», sagte ich. «Wally hat sich mit dem falschen Pferd eingelassen.»
Ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Da lag Ruskie, das Gehirn quoll ihm aus dem Schädel, und seine schönen langen Beine waren gekrümmt, gebrochen und blutüberströmt. Wenn Wally nicht tot gewesen wäre, hätte ich ihm einen Schlag ins Gesicht versetzt.
«Sie weinen um ein Pferd?» fragte Henry.
«Ja, das tue ich. Was dagegen?» Ich wandte mich Wally zu. Er war an der Seitenwand der Box zu Boden gesackt, und sein Kopf hing in einer Weise zur Seite, wie man das nur bei Toten und bei Kleinkindern, die in ihrem Autositz schlafen, sehen kann. Sein Körper war mit Hufabdrücken übersät.
«He, was um alles in der Welt machen Sie denn hier drin? Ein Mann ist tot, da können wir nicht zulassen, daß alles durcheinandergeschmissen wird.»
Ich blickte auf und sah, daß der Mann von der Polizei auf mich herabstarrte. Er war ungefähr fünfunddreißig Jahre alt, hatte dunkles, gewelltes Haar und die dunkelolivfarbene Haut der Mittelmeeranwohner, also nicht gerade die für das Hinterland Carolinas typische Färbung.
«Oh, hallo», sagte ich und versuchte, mir den Anschein zu geben, als wäre ich nur mal eben zum Stall herausgekommen, um nach meinem Pferd zu sehen. «Mir gehört das Pferd in der Box da drüben. Die Fuchsstute mit der weißen Blesse.»
«Ihnen gehört was?» fragte der Beamte zurück.
«Dieses Pferd dort, da, es streckt gerade den Kopf aus der Box. Es gehört mir. Ich wollte es meinem Freund hier zeigen, der als Kind geritten ist und jetzt daran denkt, wieder damit anzufangen. Dann erzählte mir Rob von dem armen Ruskie, und ich wollte nur mal sehen, was passiert ist. Können Sie glauben, daß jemand so grausam sein kann?»
«Sieht so aus, als hätte der Mann gekriegt, was er verdient hat. Sie kommen besser aus der Box raus, bevor der Leichenbeschauer auftaucht. Der hält sich für Quincy höchstselbst und mag’s gar nicht, wenn in dem Beweismaterial rumgewühlt wird, auch dann nicht, wenn ein Pferd das Verbrechen begangen hat.»
Ich zog Henry aus der Box. «Na, ich hoffe, man holt Ruskie und den Toten bald hier raus. Wenn die noch ein Weilchen länger liegenbleiben, werden sie so stark riechen, daß man eine Gasmaske braucht. Also kommen Sie, Henry, schauen wir mal, ob Sie zu groß für Brenda sind.»
Ich öffnete die Tür zur Box meines Pferdes und bedeutete Henry, mir hineinzufolgen. Da er gesehen hatte, was Ruskie Wally angetan hatte, war er allerdings nicht allzu scharf darauf, die Box zu betreten.
«Nun mal los, ich lasse sogar die Kinder meiner Freunde auf ihr reiten. Sie tut Ihnen nichts, beschnuppert Sie höchstens.»
Brenda hob die Nüstern zu Henrys Gesicht und atmete schnaufend aus. So überprüfen Pferde Menschen, die ihnen fremd sind. Henry tätschelte Brendas Hals.
«Schau an, ein Naturtalent», sagte ich
«Wem gehört eigentlich Ruskie? Und braucht er oder sie so dringend Geld, daß er oder sie das Pferd umbringen lassen mußte?» fragte Henry. «Denn darum geht’s doch, oder nicht? Um die Versicherungssumme, wenn ich das richtig sehe?»
Henry war auf dem laufenden. Das Töten von Pferden pflegte das schmutzige kleine Geheimnis der Turnierreiterkreise zu sein – bis zum 27. Juli 1994, als der amerikanische Justizminister gegen dreiundzwanzig der bekanntesten Vertreter dieser Industrie Anklage erheben ließ.
«Sie haben’s erfaßt», sagte ich. «Es mag zwar ekelhaft sein, aber das Töten eines Pferdes verstößt nicht gegen das Gesetz. Es ist Sache der Versicherungsgesellschaft, einen Betrug nachzuweisen. Selbst wenn die Polizei rausfinden sollte, warum Wally mit einer Brechstange auf Ruskie losgegangen ist, wird sie das nicht allzusehr interessieren. Ich will Ihnen aber mal etwas verraten, was die Polizei allem Anschein nach noch nicht weiß: Ruskie hat Wally gar nicht umgebracht. Wally ist von jemandem ermordet worden, der wollte, daß es so aussähe, als wär’s Ruskie gewesen.»
«Und woher wollen Sie das wissen?» fragte Henry.
«Schschsch», machte ich. «Sagen Sie jetzt nichts. Sehen Sie mal.»
Der Polizist ging – oder besser, schlenderte – den Gang entlang in Richtung Stalltür. Vor der Box meines Pferdes blieb er stehen und schaute herein.
«Es fängt schon zu riechen an», sagte er. «Ich warte lieber draußen auf den Medizinmann. Wenn Ihnen später noch irgendwas zu der Frage einfällt, warum der Bursche da auf dieses große Pferd eingedroschen haben könnte, dann rufen Sie mich an, ja? Mein Name ist Odom, Detective Tony Odom. Hier ist meine Nummer.»
Er schrieb sie auf die Rückseite des Pappschildchens einer chemischen Reinigung.
«Ich werde darüber nachdenken und Sie anrufen, falls mir irgend etwas einfällt», sagte ich.
«Aber tun Sie’s wirklich, ja?» Er sah ein paar Sekunden länger als erforderlich zu mir herüber. Ich war es, der seinem Glotzen ein Ende machte.
«Selbstverständlich», sagte ich. «Passen Sie nur auf, daß Sie da draußen keinen Sonnenstich kriegen.»
Er drehte sich um und setzte sich wieder in Bewegung, blieb dann aber noch einmal stehen. Er zeigte auf Henrys Hemd und sagte: «He, Sie, haben Sie eigentlich die Genehmigung, eine verdeckte Waffe zu tragen?»
Henry wurde kurz blaß und schlug dann, sich an die Wasserpistole seines Sohnes erinnernd, auf die Brusttasche seines Hemdes. Odom lachte und ging nun endgültig fort.
Er blieb vor der Schiebetür an der Stirnseite des Stalls stehen. Zu beiden Seiten der Tür hingen Farbvergrößerungen in Rahmen mit spiegelfreiem Glas. Einige zeigten Melissa Mayfield, deren Vater so gut wie die Hälfte von ganz Charlotte gebaut hatte, bis seine Firma dann pleite gegangen war. Rob hatte das Mädchen von ihrem achten Lebensjahr an trainiert und aus der kleinen Ponyreiterin eine erfolgreiche Teilnehmerin an der National Horse Show gemacht. Sie war drei Jahre hintereinander in der Klasse der Junioren Hunterchampion geworden. Die meisten Fotos aber zeigten Ruskie – entweder übersprang er gerade Hindernisse, oder er trug das dreifarbige Band des Champions um den Hals.
Odom besah sich die Bilder, und ich fragte mich, ob er wohl den Reiter auf Ruskies Rücken erkannte. Es war Wally Hempstead.
Ich drehte mich zu Henry um. «Ich denke, wir sollten hier verschwinden, bevor der Detective neugieriger wird.»
«Ich glaube, dem ist das Pferd völlig Wurscht», sagte Henry. «Der hat lediglich versucht dahinterzukommen, wer ich bin und in welcher Beziehung ich zu Ihnen stehe. Ich glaube, er ist an Ihnen interessiert. Vielleicht möchte er gern rauskriegen, ob es wirklich stimmt, was man sich über die Yankeefrauen erzählt.»
«Und was erzählt man sich über sie?» wollte ich wissen.
«Ein andermal, fahren wir erst einmal zurück», erwiderte er. «Mir wird der Geruch hier drin allmählich auch etwas zu streng.»
Rob saß noch immer draußen vor dem Stall und war noch immer so grün im Gesicht, daß es sich mit seinem türkisfarbenen Hemd biß. Tony Odom hatte den Stall verlassen und war zum Auslauf gegangen. Er tätschelte dort Allie – mit vollem Namen All Dressed Up –, einen wunderschönen Schweißfuchswallach, der Gail, meiner besten Freundin, gehörte. Dabei ließ uns Odom aber nicht aus den Augen, als wir auf Henrys Auto zugingen.
Ich winkte ihm einen Abschiedsgruß zu, wobei mir ein bißchen unbehaglich zumute war. Ich hatte keinen BH an. Nicht, daß ich einen gebraucht hätte. Da gab’s nicht viel, was hätte wackeln können, auch nicht bei gestrecktem Galopp. Aber ich fragte mich, ob Odom es sehen konnte und seinen Vorurteilen über Yankeefrauen ein weiteres hinzufügen würde.
Henry ging noch kurz bei Rob vorbei und legte ihm die Hand auf die Schulter. «Vielen Dank für Ihre Hilfe, Rob. Ich hoffe, es geht Ihnen inzwischen wieder besser. Sollte Ihnen noch etwas zu Wally einfallen oder dazu, wieso er das getan hat, dann rufen Sie mich doch beim Appeal an.»
Meine Fresse, der schmiß sich aber ran!
Wir stiegen in Henrys Honda, und er ließ die Klimaanlage auf vollen Touren laufen. Als wir den Zufahrtsweg hinunterfuhren, knirschte der Kies unter den Reifen.
«Jetzt mal raus mit der Sprache, Nattie», sagte Henry. «Der Polyp meint, das Pferd habe Wally getötet, Sie aber glauben, Wally sei ermordet worden. Wie kommen Sie darauf?»
«Das glaube ich nicht», antwortete ich, «sondern ich weiß es.»
«Also schön, und woher?»
«Lassen Sie uns zunächst mal eines klären», sagte ich. «Ich habe die Verbindungen, ich kenne die Pferdewelt. Arbeiten wir also bei dieser Story zusammen?»
«Klar doch, Sie können mir sagen, ob alle die Farben richtig aufeinander abgestimmt haben.» Henry lächelte, und deshalb wußte ich, daß es ein Scherz sein sollte. Ich lachte aber nicht darüber.
«Sie, ich habe bei dem Blatt, bei dem ich vorher war, über Atomenergie geschrieben, also hören Sie auf damit, ja?» sagte ich.
«Nattie Gold, die in der ganzen Redaktion wegen ihrer rasiermesserscharfen Zunge gefürchtet ist, kann Hiebe austeilen, aber nicht einstecken. Ist es so?»
«Okay, okay, ich gebe ja zu, daß ich bei diesem Thema sehr empfindlich bin. Es klingt platt, ich weiß, aber ich nehme den Journalismus nun mal ernst und ich will nicht, daß alle Leute meinen, ich hätte nix im Kopp, bloß weil ich über Mode schreibe.»
«Glauben Sie mir, Nattie, niemand hält Sie für blöd. Aber würden Sie mir jetzt bitte mal sagen, woher Sie wissen wollen, daß das da im Stall ein Mord ist?»





























