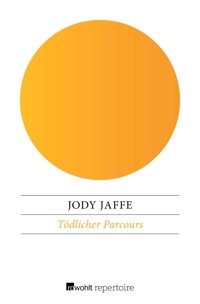9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nattie Gold, Modereporterin und Pferdenärrin, sitzt in der Redaktion ihrer Zeitung und soll sich eine sentimentale Weihnachtsgeschichte ausdenken, als sie von merkwürdigen Drohbriefen und einer Todesliste erfährt. Sie kennt die Namen auf der Liste. Es sind Pferdenarren wie sie. Als die beiden ersten Personen auf der Liste tatsächlich ermordet werden, macht sie sich auf den Weg, die anderen zu warnen. Damit gerät sie selbst ins Visier des Mörders.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Jody Jaffe
Wie der Teufel
Aus dem Englischen von Jobst-Christian Rojahn
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Nattie Gold, Modereporterin und Pferdenärrin, sitzt in der Redaktion ihrer Zeitung und soll sich eine sentimentale Weihnachtsgeschichte ausdenken, als sie von merkwürdigen Drohbriefen und einer Todesliste erfährt. Sie kennt die Namen auf der Liste. Es sind Pferdenarren wie sie. Als die beiden ersten Personen auf der Liste tatsächlich ermordet werden, macht sie sich auf den Weg, die anderen zu warnen. Damit gerät sie selbst ins Visier des Mörders.
Über Jody Jaffe
JODY JAFFE, selbst Journalistin und turniererprobte Springreiterin, hat nach «Tödlicher Parcours» wieder einen kenntnisreichen, witzigen und rasanten Pferdekrimi mit ihrer Heldin Nattie Gold geschrieben.
Inhaltsübersicht
Meiner Mutter Anne Isaac und meinem Vater Phil Jaffe zugeeignet.
«Wie kommt es eigentlich, daß eine Frau gern bereit ist, einem Pferd auch noch das mörderischste Verhalten zu verzeihen, einem Mann jedoch verübelt, wenn er den Toilettensitz nicht wieder runterklappt?»
DAVE BARRY
Prolog
Vor Fuchsstuten muß man sich hüten! So sagt man in der Pferdewelt. Und Nobody’s Fool bildete da keine Ausnahme.
Sie hatte ein Fell von der Farbe der Kupferrohre. Es war glänzend, glatt und zeigte vierzehn verschiedene Schattierungen von Braun, Gelb und Orange, die je nach Einfall des Sonnenlichts miteinander wechselten. Der Körper der Stute war sehnig und geschmeidig, die Biegung ihres Halses von vollendeter Schönheit. Im Stall nannten sie sie Rita – nach Rita Hayworth.
Dieses Pferd konnte einen ängstlichen Zehnjährigen über einen Parcours mit Hindernissen hinwegtragen, die über einen Meter hoch waren, und das mit spielerischer Leichtigkeit. Wenn es wollte. Was allerdings nicht allzuoft der Fall war. Weil es sich um eine Fuchsstute handelte.
Vor Fuchsstuten muß man sich hüten. So sagt man in der Pferdewelt.
Aber Josane Leigh Ashmore hatte nicht darauf gehört. Und das hätte sie tun sollen.
«Okay, Josane, galoppieren Sie mit ihr die Gerade runter. Leicht und locker. Denken Sie dran, dieses Pferd hat einen starken Vorwärtsdrang, und Sie brauchen keine Angst zu haben, daß Sie nicht rechtzeitig zum Absprung kommen. Seien Sie auf sanfte Weise bestimmt …» Was dann folgte, murmelte Charlie Laconte nur noch leise vor sich hin: «… und beten Sie zu Gott, daß Rita nicht ausbricht und Sie mit Ihrem Ärschchen in die äußere Slowakei fliegen.»
Laconte sah zu, wie Josane Ashmore mit dem großen braunen Pferd in jeweils sechs gleichmäßigen Galoppsprüngen an die beiden Hindernisse auf der Außenbahn heranritt und über sie hinwegsetzte, als gelte es, die National Horse Show zu gewinnen.
«Jetzt die Diagonale. Und wenn das klappt, dann die gegenüberliegende Außenbahn runter, über die Diagonale zurück und zum Schluß über das einzelne Hindernis.»
Es war deutlich zu sehen, daß Rita gut drauf war. Sie war es eigentlich schon seit zwei Wochen. Laconte hatte sie täglich geritten und sie vorwärts geprügelt, wenn sie auch nur ans Verweigern dachte. Bei diesem Pferd hielt das Training manchmal einen Monat lang vor, manchmal aber auch kaum eine Stunde. Man konnte nie sagen, was Rita zu tun gedachte, weshalb sie ja auch in Lacontes Stall (es war der fünfte in ebenso vielen Monaten) gelandet war, um verkauft zu werden.
Das Pferd absolvierte den Springkurs mit einer solchen Leichtigkeit, daß der besorgte Laconte schon nach der Hälfte aufhörte, den Atem anzuhalten. Das ist es, dachte er bei sich. Man muß nur einen Grünschnabel auf dieses Pferd setzen, das schon drei Profis ins Krankenhaus geschickt hat, und schon geht’s!
Laconte hatte Josane die Fuchsstute gar nicht zeigen wollen. Er hatte ihr einen alten grauen Wallach vorgeführt, aber sie war eisern geblieben und hatte darauf bestanden, Rita zu reiten. Und nach den zwei Jahren, die er Josane Leigh Ashmore nun schon unterrichtete, hatte er gewußt, daß der Versuch, sie in den Sattel des Grauen zu kriegen, reine Zeitverschwendung gewesen wäre.
Josane Ashmore lernte schnell – sie war zielstrebig, konzentriert, selbstsicher und hartnäckig.
Sie hatte nur einen flüchtigen Blick auf den Grauen geworfen und war an seiner Box vorbei direkt zu der Ritas weitergegangen. «Charlie, Schätzchen, Gott weiß, daß ich keine Margie Goldstein bin, aber ich möchte nun mal dieses Pferd ausprobieren und kein anderes. Es ist der schönste Gaul, den ich je gesehen habe. Hören Sie endlich mit Ihrer Sorgenmacherei auf, und lassen Sie uns die Stute satteln, ja?»
Er hatte es getan, aber widerstrebend.
«Und jetzt nehmen Sie diesen kummervollen Blick aus Ihrem herrlichen Gesicht, und helfen Sie mir in den Sattel.»
Laconte hatte seine verschränkten Hände unter die linke Stiefelsohle der jungen Frau gehalten. «Okay, also los. Eins, zwei, drei … Ich hoffe nur, daß Sie wenigstens ein bißchen was von Margies Kleister in sich haben.» Margie Goldstein, das eins sechzig große Phänomen aus Florida. Seit Rodney Jenkins hatte es keinen Reiter und keine Reiterin mehr gegeben, die die Zuschauer so begeistern konnten wie sie. Wenn sie auf ein Pferd stieg, dann schien es Flügel zu bekommen und davonzufliegen.
«… Sagen Sie, wenn Sie doch lieber den Grauen probieren möchten.»
«Also Charlie, Schätzchen, jetzt haben Sie doch mal ein ganz klein bißchen Zutrauen.»
Aber er hatte nur Fracksausen gehabt. Was ihm jetzt gerade noch fehlte, war ein weiterer Unfall in seinem Stall! Ihm graute, wenn er nur an den Vater dachte, der ihm die Schuld am Tod seiner kleinen Tochter gab, nur weil er, Charlie, ihm ebenjenes Pferd verkauft hatte, von dem das Kind später heruntergefallen war. Noch ein Unfall, und er würde einen ganzen Stall voller Pferde verkaufen müssen, um die Versicherungsrechnungen bezahlen zu können. Aber gleichzeitig war er auch nicht geneigt, eine potentielle Kundin mit dickem Bankkonto abzuweisen. Und ein solches schien Josane Ashmore zu haben. Sie war vor zwei Jahren als blutige Anfängerin zu ihm gekommen, und die Reitausrüstung, die sie mitgebracht hatte, war annähernd viertausend Dollar wert gewesen.
«Wie ich höre, sind Sie der beste Trainer weit und breit, und ich möchte an dem großen Turnier teilnehmen, das immer dort in Washington stattfindet», hatte sie zu ihm gesagt.
Er hatte gelacht, und sie auch. Aber dann hatte sie noch hinzugefügt: «Genug gelacht, ich weiß, daß Sie mich für ein bißchen komisch halten. Mir ist es jedoch so ernst wie ein Herzinfarkt. Ich kann sehr hart arbeiten. Wie lange braucht’s?»
Zwei Jahre später konnte sie mit einem Pferd über einen Parcours galoppieren, dessen Hindernisse bis zu einem Meter acht hoch waren. Das vielleicht nicht gerade mit einem sehr komplizierten Pferd, aber ein strapazierfähiges Lasttier konnte sie hingelangen lassen, wo immer sie hingelangen wollte. Das Problem war jetzt nur noch, das richtige Lasttier für sie zu finden. Sie hatte schon einen ganzen Stall durchprobiert und keines der Pferde gemocht. Da es nun offensichtlich Rita sein sollte, sagte er sich schließlich: Warum nicht?
«Das war großartig, Josane», sagte Laconte, als sie das Pferd an langem Zügel im Schritt zu ihm zurückbrachte. «Sie und Margie müssen siamesische Zwillinge gewesen sein.»
«Wohl kaum. Es ist allein dieses Pferd, das es mir so leicht macht.» Sie klopfte Ritas Hals und lächelte. Sie hatte ein hinreißendes Schönheitsköniginnenlächeln, bei dem eine Menge ebenmäßiger Zähne sichtbar wurden.
«Da haben Sie’s, Charlie. Ihre Besorgnis war ganz umsonst. Ich wußte, daß Rita und ich füreinander bestimmt sind.»
Rein physisch gesehen, war das gar keine Frage. Seine Schülerin war, was das betraf, so bemerkenswert wie das Pferd. Josane maß nahezu eins achtzig und hatte die langen, schlanken Beine der vollkommenen Reiterin. Obwohl ihre Gesichtszüge im einzelnen durchaus Mängel aufwiesen (ihre Nase war am Ansatz ein wenig zu stark gebogen, und ihre Augen lagen sehr tief), harmonierten sie insgesamt doch so gut, daß sich auf der Straße fast jeder Mann nach ihr umdrehte.
Sie glitt vom Pferd und lockerte den Sattelgurt. «Wenn wir jetzt mit der Turnierreiterei anfangen, können wir uns dann noch für die Hallensaison qualifizieren?»
«Jetzt wollen wir mal nicht total abheben», erwiderte Laconte. «Es liegt im Bereich des Möglichen.» Vorausgesetzt, dieses Pferd bringt dich bis dahin nicht um, hätte er gern hinzugesetzt, wäre da nicht ein Scheck mit fünfstelliger Zahl vor seinem inneren Auge erschienen. An Rita hing ein Preisschildchen, auf dem 75000 Dollar stand. Das war der Traumpreis der Besitzer und all der Trainer in der Nahrungskette, die einen Gewinnanteil von zehn Prozent einzustecken gedachten. Wohl ein bißchen realitätsfern.
«Ich denke, die Besitzer sind auch mit sechzig zufrieden.»
«Ich zahle ihnen vierzig. Der Tierarzt kommt in einer Stunde zur Ankaufuntersuchung. Sagen Sie mir nur noch, auf wen ich den Scheck ausstellen soll.»
«Sie möchten es tatsächlich tun? Sie haben Rita doch an ihren schlechten Tagen erlebt und wissen, wie schwierig sie sein kann. Der Graue, der hat drei Jahre hintereinander das Junior Hunter Championat von Virginia gewon …»
«Charlie, der Graue ist älter als Mrs. Alma May Cummins, die Dame, die in der Kirche meiner Mutter die Orgel spielt. Ich müßte mir ja einen ganzen Arzneimittelkonzern dazukaufen, um das Pferd auf den Beinen zu halten. Außerdem haben Sie doch selbst gesehen, wie gut Rita gerade eben war. Und Sie haben mir immer wieder gesagt, daß Pferde keine Maschinen sind. Ich weiß, daß sie schwierig sein kann.»
«Ich hoffe nur, der Herrgott segnet diese Verbindung, denn bei dieser Stute könnte es gut sein, daß Sie einen brauchen, der über Sie wacht.»
Sie gab ihm die Zügel und lachte. «Über uns alle wacht einer, Charlie. Nur wissen wir das manchmal nicht. Bin gleich wieder da. Ich hole nur meine Handtasche.»
Laconte deutete ein Lächeln an. Er besah sich die Fuchsstute, die er am Zügel hielt. «Ach Gottchen, was habe ich mir da bloß eingebrockt! Ich werde Glück haben, wenn diese Frau im nächsten Frühling noch am Leben ist.»
Laconte war vieles, aber ein Glückspilz war er nicht.
1
Ich hackte gerade den letzten Teil meiner Sonntagskolumne, die ich diesmal einer ausführlichen Darlegung der Geschichte des BHs mit Bügel, des Korsetts und des Hüftgürtels gewidmet hatte, in den Computer, als oben auf dem Bildschirm die kleinen grünen Buchstaben aufleuchteten:
NATTIE, IN MEIN BÜRO, SOFORT – CANDACE
Der Erfinder der E-Mail sollte gezwungen werden, dauernd alle oben genannten Kleidungsstücke und dazu noch Pfennigabsätze zu tragen.
Ich tippte zurück: BIN GLEICH DA, MACHE NUR SCHNELL NOCH KOLUMNE FERTIG – NATTIE. Aber ich hatte noch nicht wieder ausgeatmet, da explodierte auf dem Bildschirm schon ein JETZT!
«Okay, okay», murmelte ich, «immer mit der Ruhe, sonst schreie ich laut los.»
Ich fuhr in meine Schuhe und eilte zum Büro der Chefin. Ich klopfte an die Tür – knapp unterhalb des roten Plastikschildchens, das auf ihren Herrschaftsbereich hinwies:
CANDACE FITZGERALD
FEATURE-REDAKTION
THE CHARLOTTE COMMERCIAL APPEAL
Alle anderen Manager im Haus hatten ein schwarzes Schild mit weißen Buchstaben. Nicht so Candace. Sie mußte ein rotes haben. Sie hatte ihrer Kundenberaterin bei Dillards (die es mir gar nicht schnell genug weitererzählen konnte) anvertraut, daß Rot die Farbe der Autorität sei. Was erklärt, warum sie mindestens sieben Jacken in unterschiedlichen Autoritätstönen besitzt. Heute war ihr Preiselbeeren-Bolero dran.
«Was gibt’s denn?» erkundigte ich mich.
Candace lächelte. Sie hatte so ein hintergründiges Lächeln.
«Haben Sie gestern abend meine Nachricht nicht bekommen?»
«Nachricht?» sagte ich. «Mein Anrufbeantworter zeichnet nur auf, wenn ihm danach zumute ist. Als ich gestern vom Reiten zurückkam, war nichts drauf.»
«Dann kaufen Sie sich einen neuen», schlug sie vor. «Was ich Ihnen sagen wollte: Ich habe da eine große Story für Sie.»
Ich war Candace in den zurückliegenden Monaten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert gewesen – es war die Strafe dafür, daß sie mich freigestellt hatte, damit ich zusammen mit einem Kollegen von der Nachrichtenredaktion in einem Mordfall ermitteln konnte. Obwohl unser Bericht darüber gute Aussichten hatte, den Pulitzer zu kriegen, spuckte Candace immer noch Gift und Galle, weil alle vier Folgen auf Seite eins erschienen waren – und nicht auf den Seiten 14 C, 11 B oder 8 A oder welche Seite an dem jeweiligen Tag halt für Features vorgesehen gewesen war.
«Wie Sie wissen», fing Candace an, «hat uns der Sparetat daran gehindert, offene Stellen wieder zu besetzen. Dadurch sind wir bei Features nur noch sehr wenige, und da Sie so lange im Untergrund gesteckt haben, mußten wir viel zuviel Agenturzeug bringen. Jetzt, wo Sie wieder da sind, rechne ich mit Ihnen als mit einer wertvollen Beiträgerin zum Erfolg von Features.»
Ich nickte. Sie dachte, mein Nicken bedeute Zustimmung, aber ich nickte eigentlich nur, weil ich wußte, daß das Managergerede war und nichts anderes bedeutete als: Sie werden sich die Finger wund schreiben – und das ohne Überstundenausgleich! North Carolina ist ein Recht-auf-Arbeit-Staat – ein verhüllendes Wort für nackte Ausbeutung.
«Und wie Sie auch wissen, ist dies für unser Blatt die beste Zeit des Jahres. Weihnachten, viele Anzeigen, mehr Seiten und für uns vielleicht täglich eine Titelseite im Themen-Teil. Ich wünsche mir für Features eine starke Präsenz. Ich möchte, daß Sie mich dabei unterstützen, Nattie.»
Oje, noch mehr Ärger. In dem Augenblick, in dem ein Redakteur des Appeal das Wort «unterstützen» benutzt und den Namen des Reporters anhängt, weiß man, daß der Redakteur in seinem Kopf den erwarteten Artikel des Reporters bereits fest eingeplant, geschrieben, redigiert und schon bei der gestrigen Redaktionskonferenz für die heutige Ausgabe zugesagt hat. Da ich die – nicht sehr begeisterte – Modeberichterstattung der Zeitung verkörperte, ging es wahrscheinlich um die Wiederbelebung der Seidenturbane, abzuliefern in zwanzig Minuten.
«Gern, Candace. Ich habe eine ganze Liste toller Themen. Erinnern Sie sich noch, daß ich Ihnen mal von diesem Pflegeheim berichtet habe, wo …»
Candace schnitt mir mit einer schwungvollen Handbewegung das Wort ab. «Ein andermal, Nattie. Notieren Sie’s und legen Sie’s mir hin, dann können wir uns in der nächsten Woche darüber unterhalten. Ich habe etwas anderes im Sinn und denke, Sie werden es mögen … es geht dabei nicht um Mode.»
Das ließ mich aufhorchen. Ich schrieb nun schon seit fast drei Jahren für den Appeal über Mode, von denen ich zwei auf den Versuch verwandt hatte, davon wieder los und zu der für Allgemeines zuständigen Redaktion zu kommen. «Wirklich? Worüber soll ich denn berichten?»
«Was verkauft Zeitungen, Nattie?»
«Kinder und Hunde, vorzugsweise beides», antwortete ich.
«Richtig», sagte sie. «Aber das sind olle Kamellen. Wir brauchen etwas Neues. Etwas Frisches. Etwas, dem die Leser entnehmen können, daß Features die Hand am Puls des Geschehens hat. Und da kam mir eine Idee. Es ist die Weihnachtszeit, die Zeit der Familie, des guten Willens, der lieben Erinnerungen. Kinder und liebe Erinnerungen.»
O nein! Abgesehen von Berichten über Bürgerpark-Festivals oder öde, leider jährlich wiederkehrende Kunsthandwerksmärkte waren Artikel zum Thema Festtagsglück die schlimmsten. «Ich soll eine neue Weihnachtswundergeschichte suchen? Im vergangenen Jahr war es das Baby, das nur ein Pfund wog.»
Candace blies die Backen auf. «Toll, wirklich. Außer von der Mutter keinerlei Reaktion. In diesem Jahr brauchen wir einen echten Knüller. Ich hab drüber nachgedacht, und da ist’s mir gekommen. Tote Kinder. Das ist es!»
Ich blickte zu dem Foto auf ihrem Schreibtisch hin. Ein vierjähriges Mädchen mit Hab-mich-lieb-Blick. Ihre Tochter Christie, die täglich dreizehn Stunden im Myers Park Childhood Development Center zubrachte. Candace ließ sich niemals durch persönliche Gefühle – so sie überhaupt welche hatte – beirren.
Ich holte tief Luft, denn jetzt wußte ich, was ihr vorschwebte, worauf ich mich aber nicht einlassen wollte. Nicht schon wieder das! Ich hatte es schon einmal gemacht, und da hatte es mich ziemlich schwer mitgenommen.
Damals hatte ich Candace die Erlaubnis abgetrotzt, den Bericht schreiben zu dürfen, und hinterher hatten wir körbeweise Post und so viele Anrufe bekommen, daß die Leitungen total überlastet waren. Ich hatte ein paar Tage zuvor im hinteren Teil der Zeitung eine kleine Notiz gelesen: «Die Compassionate Friends, die allen Eltern Beistand leisten, welche Kinder verloren haben, treffen sich an jedem ersten Donnerstag des Monats um 19 Uhr …»
Candace hatte mich da zunächst nicht ranlassen wollen, weil es mit der großen Schau von Bill Bass bei Dillard kollidierte, aber ich hatte sie davon zu überzeugen versucht, daß es besser sei, den Designer telefonisch zu interviewen und dann den Artikel gleich am Tag der Show zu bringen (wodurch ich an jenem speziellen Donnerstagabend freie Hand gehabt hätte). Und Candace war darauf eingegangen. Ich hatte das Telefoninterview mit Bass gemacht, der Artikel war erschienen, und dann hatte ich die Compassionate Friends besucht. Mich hat während meiner zwölfjährigen journalistischen Tätigkeit noch nichts so mitgenommen wie dieser Abend. Ich hatte in einem Raum voller hohläugiger Menschen gesessen, die sich gegenseitig ihr Leid klagten. Als ich am folgenden Tag meinen Artikel geschrieben hatte, hatte ich wegen der Tränen den Monitor kaum sehen können.
«Die Compassionate Friends?» fragte ich zurück. «Aber die Geschichte habe ich doch schon geschrieben.»
«Genau. Und was für eine Reaktion! Rutger sagt, beim Lunch im Queen City Crown Club würde mindestens einmal in der Woche über die Story gesprochen.»
Rutger ist Rutger Pearson, der weißhaarige Herausgeber des Appeal Er sieht aus wie ein alternder griechischer Gott und führt sich meistens auch so auf. Der Privatklub, kurz Crown Club genannt, hat sich erst vor drei Jahren entschließen können, auch Mitglieder aufzunehmen, die nicht weiß, protestantisch und männlichen Geschlechts sind.
«Das war vor neun Monaten», sagte Candace. «Und wir bekommen immer noch Post dazu. Außerdem hat Fred mir gesagt, daß Miami den Artikel als Musterbeispiel eines vorbildlichen Dienstes an der Gesellschaft im Jahresbericht nachdrucken wird.»
Da wurde alles so klar wie die Glaswände der Redaktionsbüros. Fred. Fred Richards, der Chefredakteur des Appeal, den sowohl die Reporter dieses Blattes als auch ihre Kollegen von den anderen Blättern des Konzerns den Schuhverkäufer nennen. In Ermangelung jeglicher eigener origineller Einfälle mußte Fred Candace geraten haben, sie solle mich damit beauftragen, einen weiteren Bericht über die Compassionate Friends zu schreiben – weil Miami den ersten zur Kenntnis genommen hatte. Und es war nun mal das Herzensanliegen aller aufstrebenden Redakteure, um die Aufmerksamkeit Miamis, der Zentrale unserer Kette, zu buhlen.
«Ich weiß nicht, Candace», sagte ich. «Wie oft kann ich die Höllenqualen beschreiben, die diese Leute Tag für Tag durchleiden müssen? Was kann ich noch mehr schreiben, als ich schon geschrieben habe?»
«‹Jingle Bells›.»
«Wie bitte?»
«‹Jingle Bells›, ‹O Tannenbaum›, ‹Stille Nacht, heilige Nacht›, ‹Little Drummer Boy›. Ich muß Sie wohl nicht daran erinnern, daß Weihnachten ist. Und die Friends veranstalten eine Weihnachtsfeier. Sehen Sie mal hier.»
Sie nahm einen Bogen Papier von einem Stapel saisonal bedingt roter und grüner Prospekte und schob ihn mir zu.
In todernster, schnörkelloser Schrift stand darauf zu lesen: «Die Festtage sind für uns die bitterste Zeit … wir wollen uns treffen und gegenseitig über sie hinweghelfen … am 24. Dezember um 16 Uhr.»
«Das ist nicht gerade eine Weihnachtsfeier», bemerkte ich.
«Was auch immer», erwiderte Candace, «ich will, daß Sie hingehen und der Artikel am folgenden Tag erscheint. Nehmen Sie Torkesquist mit. Sagen Sie ihm, er soll Nahaufnahmen machen, wenn die Leute zu weinen anfangen.»
«Es ist der Heilige Abend.»
«Na und? Sie sind doch Jüdin.»
«Ich wollte meine Mutter in Greensboro besuchen.»
«Ja was, die ist doch auch Jüdin, oder etwa nicht?»
«Natürlich ist sie Jüdin, aber diese Festtage sind auch für sie hart. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, aber mein Stiefvater ist Anfang des Jahres gestorben, und es war für sie nicht ganz leicht …»
«Wie war das doch gleich, Nattie, haben Sie nicht immer wieder darum gebeten, auch Stories schreiben zu dürfen, bei denen es nicht um Mode geht? Wenn Sie in Allgemeines reinkommen wollen, dann scheint es mir das Sinnvollste zu sein, Artikel für die Sparte Allgemeines zu schreiben. Zeigen Sie uns, was Sie draufhaben.»
«Ich dachte, das hätte ich mit der Serie über die Reitturniermorde schon getan?»
«Das war im Juli, jetzt haben wir Dezember. Nattie, ich muß in fünf Minuten zu einer Besprechung bei Fred. Kann ich ihm sagen, daß wir mit Ihnen rechnen können? Ich brauche Ihnen wohl nicht ins Gedächtnis zu rufen, daß in Ihrer letzten Beurteilung in puncto Teamgeist Schwächen vermerkt wor …»
Teamgeist! Was, zum Teufel, war diese Zeitung ihrer Meinung nach eigentlich? Ein Footballteam wie die Boston Red Sox? Wir wußten beide, daß ich nicht ablehnen konnte, jedenfalls dann nicht, wenn ich noch in diesem Jahrhundert von der Modeberichterstattung wegkommen wollte.
«Ich werde gehen, vor Freude singend», sagte ich zu Candaces Rücken, denn sie hatte sich schon auf ihrem Bürostuhl dem Aktenschrank und etwas Neuem zugedreht.
Als ich ihr Büro verließ, hätte ich nur zu gern die Tür laut zugeschlagen oder – noch besser – ihr vorher eins auf die Rübe gegeben. Aber ich versuche nach wie vor, an die friedliche Lösung von Problemen zu glauben, und deshalb ging ich in die Cafeteria, um mir eine Schachtel Twizzlers zu holen.
Ich warf zwei Münzen in den Automaten, aber der ignorierte sie. Bevor ich mich noch an meine Entschlossenheit hatte erinnern können, friedliche Lösungen anzustreben, hatte ich schon der silberglänzenden Vorderfront der Maschine einen kräftigen Tritt versetzt. Mit meinem rechten Fuß! Ein scharfer Schmerz fuhr durch meinen Knöchel, wo Tibia und Fibula durch eine lange Aluminiumschraube zusammengehalten wurden.
«Scheiße!» schrie ich auf.
«Nattie, hältst du es für eine gute Idee, mit einem erst kürzlich gebrochenen Bein gegen Metall zu treten?»
Der das sagte, war Henry. Henry Goode, der investigative Reporter, mit dem ich bei der Reitturniermordgeschichte zusammengearbeitet hatte.
«Ja, Dr. Schicksal hat mir gesagt, das gehöre zu meinem Therapieplan. Ich soll dreimal täglich Süßwarenautomaten treten und zum Abschluß dann noch einen weit über eins achtzig großen Reporter.»
«Nattie, ich erkundige mich doch nur nach dem Bein, das du dir, wenn ich dich daran erinnern darf, in zwei Wochen zweimal gebrochen hast. Was ist denn heute mit dir los? Stimmt irgendwas nicht?»
«Candace! Was ist wohl mit mir los, he? Candace. Dieser Roboter, den sie Redakteurin nennen. Tut mir leid, Henry, ich wollte dir nicht an die Gurgel. Es ist bloß Candace mit ihren bescheuerten Miami-wird-das-mögen-Ideen.»
«Laß mich raten», sagte Henry. «Eine Modenschau in Gastonia.» Und dann tänzelte er wie ein New Yorker Topmodel an dem streitlustigen Süßigkeitenautomaten vorbei.
«Okay, Vendella, das reicht», sagte ich. «Mir ist gar nicht nach Lachen zumute, dazu bin ich zu sauer. Es ist was viel Schlimmeres als eine Modenschau, und ich hätte nie gedacht, daß ich so etwas je sagen könnte. Aber ich mag jetzt nicht darüber reden. Gibt’s bei dir was Neues? Vielleicht ein neuer Knaller, der dir den dritten Pulitzer einbringt, vorausgesetzt natürlich, daß wir für unsere Serie einen kriegen?»
Henry lächelte. Er war ein gutaussehender Mann, perfektes Endresultat eines Zuchtprogramms, das Generationen von Uramerikanern bis zur Makellosigkeit weiterentwickelt hatten. Ich konnte nicht anders als sein Aussehen bewundern – natürlich nur in seiner Eigenschaft als Muster ohne Wert. Wenn wir zusammentrafen, endete das immer mit Streit. Zumeist war es irgend etwas absolut Törichtes – wie etwa die Frage, wo wir parken sollten.
Aber Henry sah nicht nur gut aus. Bei ihm verband sich in ungewöhnlicher Weise jungenhafte Unbeholfenheit mit einem soliden Kern aus Verantwortungsbewußtsein und Integrität sowie gelegentlichen Anflügen von Schusseligkeit. Henry war der Ansicht, das Leben sollte fair sein, Pfarrer sollten ihre Gemeinden nicht bestehlen und Kongreßabgeordnete keine Frauen belästigen. Und er schien es sich zur Lebensaufgabe gemacht zu haben, dafür Sorge zu tragen, daß sich die Welt der Vorstellung, die er von ihr hatte, annäherte.
«Ich überblicke das noch nicht so ganz, aber ich arbeite da an etwas, was interessant sein könnte», sagte Henry. Zielgerichtet, präzise und genau heißt es in den Durchführungsbestimmungen, die für Henrys Handeln maßgeblich sind, sein Sprechen eingeschlossen. Für alle Welt ist «interessant» ein Wort mit drei Silben, aber für Henry sind es vier. «Ich bekomme seit etwa zwei Wochen Kopien ziemlich bizarrer Drohbriefe, was an sich noch nichts Neues ist. Aber was diese Briefe so interessant macht, das ist die jedem Umschlag erneut beigefügte Kopie einer alphabetischen Namensliste. Der Brief scheint an alle zu gehen, die in den beiden Carolinas und in Virginia Rang und Namen haben, angefangen bei A und durch bis zum Z.»
Er zog ein Stück Papier aus seiner zerknitterten Joppe. Henrys Sorgfalt endete bei seiner Garderobe. Obwohl ebenfalls zerknittert, war der Brief ordentlich dreifach gefaltet. Er enthielt keine Unterschrift, kein Datum – es waren einfach Wörter, die irgendwo an einem unbekannten Ort in irgendeinen Computer eingegeben worden waren. Das Schreiben lautete:
ERST HUSTEST DU. DANN STIRBST DU, ABER NICHT SOFORT. DAS WÄRE ZU BARMHERZIG. ES WÄRE EIN GÖTTLICHER GNADENAKT. ABER GOTT SIND DIE HÄNDE GEBUNDEN. VON DIR UND DEINESGLEICHEN.
UND DU WIRST BEZAHLEN.
2
Henry und ich wählten einen Tisch hinter der großen, schlierigen Fensterscheibe, durch die man auf den Firestone-Reifendienst an der Stonewall Street hinausblickte. Schlierig, weil die Fensterputzer wegen unbefriedigender Gewinnentwicklung gestoppt worden waren, bis sich unsere Lage wieder verbessert haben würde. Da der Appeal die Milchkuh der gesamten Kette war, wurden die Bosse in Miami geradezu hysterisch, als kürzlich unser Gewinn auf 29,5 Prozent absackte, und sie hatten unseren Gürtel so eng gezogen, daß wir schon fast erstickten. Wobei die anderen Blätter nicht mal an fünfzehn Prozent herankamen.
«Das ist ja ein nettes Briefchen», sagte ich. «Mit alphabetischer Abschußliste, wirklich toll durchorganisiert. Wie gut, daß da draußen kein Mangel an Bekloppten herrscht, denn sonst würden wir arbeitslos. Ist einer der Leute auf dieser Liste schon handfest bedroht worden?»
«Nein, und niemand nimmt die Sache sonderlich ernst. Die anderen Briefe sind ähnlich, alle Variationen zum Thema ‹Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen›. Ich habe mal mit Duffy Ritter, dem IBM-Chef von North und South Carolina, gesprochen. Er meint, so etwas gehöre nun mal zum Alltag der Führungskräfte größerer Konzerne. Er hat den Brief einfach an die Sicherheitsleute weitergeleitet. Bisher gibt es außer den Briefen keine weitere Kontaktaufnahme.»
«Jedenfalls noch nicht», sagte ich. «Ich weiß, daß du mir eine Schwäche fürs Dramatische unterstellst, aber wenn mein Familienname mit A anfinge und auf dieser Liste stünde, dann wäre ich sehr wohl beunruhigt.»
«Wie war denn das», meinte Henry, «warst du es nicht, die mir mal gesagt hat, das sei für sie der Normalzustand?»
«Es gibt so eine Beunruhigung und so eine. Die erstere ist nur eine allgemeine Besorgnis, daß die Welt in Stücke gehen könnte, daß all deine Lieben vom Blitz getroffen, überfahren und/oder Opfer übler Terrorakte werden könnten. Mit der muß man als Jude leben. Die andere Beunruhigung ist eine echte, weil begründete. So, wenn einem jemand Drohbriefe schickt. Dieser Brief hat irgendwas an sich … ich bin nicht sicher, was es ist, aber ich wette, daß die Leute die Sache irgendwann sehr viel ernster nehmen werden. Vielleicht bin ich aber auch nur so erregt über Candace …»
Oder ich war eifersüchtig auf Henry. Der Glückliche! Er durfte Morddrohungen bearbeiten, während ich Gelegenheit haben würde, mich durch den Weihnachtsabend hindurchzuschluchzen.
«Ich muß los, Henry, und Mutter Bescheid sagen, daß sie sich, Candace sei’s gedankt, in diesem Jahr Das Wunder der 34. Straße allein ansehen muß.»
Ich trank meinen Kaffee aus und wollte zur Rolltreppe gehen. Nach drei gehumpelten Schritten (mein Knöchel schmerzte noch von der Attacke gegen den Süßwarenautomaten) drehte ich um und kehrte an unseren Tisch zurück.
«Henry», sagte ich, «worin liegt das Verbindende? Was ist allen von Mr. A bis Mr. Z gemeinsam? Bist du Mr. G?»
Er nahm seinen Notizblock auf und begleitete mich auf meinem Weg zur Redaktion.
«Nein, das G der Liste gehört Booker Greene, einem New Yorker Kongreßabgeordneten, der im östlichen North Carolina in der Gegend von Fuquay Varina zur Welt gekommen und aufgewachsen ist. Ich werde nicht bedroht. Wer immer diese Briefe abschickt, erhofft sich Publicity, und da komme ich ins Spiel. Ich habe gerade erst begonnen, mich intensiver mit der Sache zu befassen, und weiß deshalb noch nicht viel. Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, daß alle Angeschriebenen ziemlich wohlhabend sind. Ich werde Nachforschungen anstellen, um mehr über sie herauszufinden und festzustellen, was außer dem Geld sonst noch gemeinsamer Nenner sein könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es dem Briefeschreiber nur um Reichtum geht.»
«Vielleicht hast du recht», sagte ich. «Aber Geld läßt die Leute durchdrehen. Erinnerst du dich noch an Wally, unseren toten Pferdetrainerfreund, der all diese Gäule nur wegen der Versicherungsgelder getötet hat? Und er steht mit so etwas ja nicht allein. Geld ist das Fürchterlichste, was wir Menschen je erfunden haben. Also, halt mich auf dem laufenden. Da fällt mir noch ein: Wo kommen die Briefe eigentlich her?»
Henry hielt mir die schwere Feuertür zwischen Cafeteria und Treppenhaus auf. «Ich habe in der linken oberen Ecke der Briefe keinen Absender finden können», sagte er.
Ich schob mich unter dem Bogen seines Arms hindurch und knuffte ihn dabei leicht in den Bauch. «Sehr komisch», sagte ich. «Aber du weißt schon, was ich meine. Was sagen die Poststempel?»
«Eine investigative Story geschrieben, und schon fragt sie nach den Poststempeln. Beachtlich! Als nächstes wirst du darum ersuchen, von der Damenwäsche wegversetzt zu werden, was, Gold?» So nannten die Nachrichtenfritzen die Feature-Abteilung.
«Und wenn ich Glück habe, lassen mich die Großkopfeten im Glasbüro den Carl Bernstein an deiner Seite spielen, du Bob Woodward. Also sag schon, wo wurden die Briefe abgestempelt?»
«Der erste in Greensboro, die anderen kamen aus verschiedenen Orten des Bundesstaats. Er oder sie stammt wahrscheinlich aus North Carolina, aber wissen kann man es nicht.»
«Nein», sagte ich, «wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat der Verrückte was gegen die Tarheels. Wie auch immer, kann ich irgendwie behilflich sein?»
«Natürlich, vier Augen sehen mehr als zwei. Die Liste liegt auf meinem Schreibtisch, komm mal vorbei und sieh sie dir an. Oder noch besser, ich mache dir eine Kopie. Du kennst wahrscheinlich ein paar der Namen, sag mir, was du über diese Leute weißt. Danke.»
«Mong pläsör», sagte ich in absichtlich verhunztem Französisch, das Henry nach zwölf Jahren Unterricht perfekt beherrschte, während ich die Sprache nur wahlfrei und erst ab der 9. Klasse gelernt hatte.
«Erinnere mich daran, daß ich nie mit dir nach Frankreich reise, ohne dir vorher den Mund zugeklebt zu haben», sagte Henry.
Ich lachte und legte ihm den Arm um die Taille, denn höher hinauf reichte ich nicht. Aber ich war sicher, er würde mich nicht wegen sexueller Belästigung anzeigen. Er seinerseits legte gerade den Arm um meine Schulter, als uns Kathy Powel, die Popmusik-Kritikerin, auf der Rolltreppe entgegengeschwebt kam.
«Nattie, Henry … was habt ihr denn vor, ihr zwei beiden?» rief sie uns mit ihrem mir nur allzu bekannten Hab-ich’s-nicht-gesagt-Grinsen zu. Kathy und ich sichteten ständig das Männermaterial der Nachrichtenabteilung, und sie war fest davon überzeugt, daß Henry mehr als geeignet für mich sei.
«Ich würde mich auch selber an ihn ranmachen, wenn ich nicht gerade mit Jim ginge», hatte sie mir versichert.
«Henry und ich haben just eine Frankreichreise geplant», rief ich zurück, als Kathy an uns vorbeiglitt.
Ihre Worte folgten ihr abwärts: «Hab ich’s nicht gesagt.»
Henry sah mich einmal mehr verwirrt an. «Worum ging’s da eben eigentlich?» Da wurde mir blitzartig der Unterschied zwischen den Geschlechtern klar. Es waren nicht «Die Golden Girls», die die Jungen mochten und die Mädchen nicht, sondern es war die Begriffsstutzigkeit.
«Ach, um nichts», sagte ich.
Wir betraten die Redaktion und gingen unserer Wege – Henry an seinen Schreibtisch und ich zurück in die Katakomben von Features. Unsere Abteilung war – wie die getragene Wäsche vom Vortag – in eine entlegene Ecke verbannt worden. Aus den Augen und damit auch (sehr zu Candaces Empörung) aus dem Sinn.
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch, und bevor noch mein Hintern auf der Sitzfläche des Stuhls gelandet war, drehte Allison, Jungredakteurin und meine Schreibtischpartnerin, schon den Computer zu mir herüber.
«Da, Nattie, ich ziehe an einen anderen Tisch um. Ich kann mir in der Sportredaktion einen freien Computer suchen.»
«Gemach, gemach, Allison. Sie können den Computer benutzen, solange Sie wollen. Ich muß einige Telefonate erledigen.»
Sie zog den Computer zu sich zurück. Zögernd. Leg das unter «Bedenke, worum du die Götter bittest» ab. Mein voriger Schreibtischpartner Jeff hatte das Gerät dauernd mit Beschlag belegt. Ich durfte in den zweieinhalb Jahren, in denen wir uns den Computer geteilt hatten, wahrscheinlich nicht öfter als sechsmal darauf schreiben. Seit Allison eingezogen war, hatte ich keinen Vorwand mehr, auf der Suche nach einem freien Terminal durch die Redaktionen zu streifen. Dabei hätte ich alles dafür gegeben, wenn ich noch dazu in der Lage, Jeff noch am Leben gewesen wäre.
Das Telefon klingelte und unterbrach dankenswerterweise meine Träumerei.
«Kommen Sie nun raus oder nicht?»
Das war Rob, mein Reitlehrer. Selbst nachdem wir ihn mit unserer Serie «Mord im Turnierzirkus» von dem Verdacht reingewaschen hatten, ein Mörder zu sein, war er nicht imstande gewesen, mehr zu mir zu sagen als: «Wann wollen Sie wieder zum Reiten kommen?»
«Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe», sagte ich. «Ich muß noch eine Kolumne zu Ende schreiben, ein paar Telefongespräche führen, dann muß ich mit der Fotoredak …»
«Ich bin um sechs in der Bahn. Ich muß um sieben bei Mrs. Pritchard sein und mich um ihren Baum kümmern. Die Sache mit dem Kurs bei George Morris ist in der kommenden Woche fällig.»
Klick. Wenn ich wollte, daß er mein Pferd zu dem George-Morris-Kurs oder sonstwohin brachte, dann erschien ich wohl besser um sechs auf dem Übungsplatz. Daß Rob zu spät zu Mrs. Pritchard kam, da sei Gott vor! Denn wer außer ihm konnte ihren Weihnachtsbaum schmücken? Als Jüdin war mir Robs ganze Baumschmückerei nach wie vor unverständlich, aber Jahr für Jahr verbrachte er den ganzen Dezember damit, wie ein Verrückter von Haus zu Haus zu hetzen und den Leuten ihre Bäume zurechtzumachen. Ich hatte immer gedacht, Sinn und Zweck des Weihnachtsbaums sei es, die Familie um sich zu versammeln, Bing Crosby zu hören, heiter gestimmt schön ordentlich bunten Schmuck zu verteilen und dabei möglicherweise auch des Mannes zu gedenken, der die ganze Sache ins Rollen gebracht hatte. Seltsam.
Ich rief zunächst bei meiner Mutter an und teilte ihrer besten Freundin Nora, einer forschen Dame, die sich Mutters nach dem Tod meines Stiefvaters angenommen hatte, die traurige Nachricht mit, daß ich nicht kommen werde.
«Ihre Mutter ist im Gericht», sagte Nora. «Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben Ihre Arbeit, die muß getan werden. Ich werde Ihre Mutter aus dem Haus lotsen und sehen, daß sie zum Essen zu uns kommt, und wenn ich sie hinschleifen muß. Wir haben genug geweint. Jetzt ist es an der Zeit, wieder zu leben.»
Nora und mein Stiefvater David waren eng befreundet gewesen, weshalb sein Verlust für sie ebenso schmerzlich war wie für uns.
Während ich noch mit Nora sprach, sah ich auf meinem Bildschirm eine E-Mail erscheinen. Ich bemerkte den Namen CANDACE am Ende und vermied es deshalb, den Anfang zu lesen. Was wollte sie wohl jetzt von mir? Vielleicht eine Neujahrsstory über die armen kleinen, überaus fotogenen Hundchen, die im Tierheim eingeschläfert wurden?
Ich rief bei den Compassionate Friends an, erreichte jedoch niemanden. Ich mußte aber auch noch eine ganze Reihe telefonischer Anfragen beantworten – die meisten von Lesern, die zu wissen verlangten, was sie Weihnachten anziehen sollten. Ich stimmte grundsätzlich immer allem zu, was sie sich selbst ausgedacht hatten, denn meine die Mode betreffende Maxime ist eine einfache: Wenn’s dir gefällt, dann zieh’s an.
Ich mußte Torkesquist per E-Mail von dem morgigen Fototermin verständigen, was bedeutete, daß es erst einmal Candaces Botschaft zu lesen galt. MÖCHTE SIE SPRECHEN, BEVOR SIE GEHEN. Nicht, wenn sich das irgendwie umgehen ließ!
Ich setzte mich auf elektronischem Wege mit Torkesquist in Verbindung, und wie erwartet, stand er schon wenig später leibhaftig vor mir. «Wieder die toten Kids? Grundgütiger Himmel. Wie wär’s, wenn ich ein paar von den alten Fotos rauskrame und wir zusammen zum Reiten gehen? Na los, Wesley kann ein bißchen Bewegung gebrauchen. Ich nehme Hap.»
«Und wo nehme ich meine Story her? Und außerdem setze ich mich nie wieder in einen von euren Western-Sätteln. Nach dem letzten Mal hat’s zwei Wochen gedauert, bis ich meine Beine wieder zusammenbekam.»
«Das ist nur, weil du rumphantasiert hast, wie’s mit mir sein würde, das ist alles. Na los, gib’s schon zu. Ich geh dir einfach nicht aus dem Sinn.»
Torkesquist war ein Kerl, der an einen Hydranten erinnerte. Klein und breit. Ein leuchtender Blondschopf, der aussah, als hätte ihm ein total Besoffener einen Pott über den Kopf gestülpt und dann die Haare abgesäbelt. Den größten Teil seines übrigen, frisch-rosigen Gesichts bedeckten große klare Plastikbrillengläser. Aus Minnesota stammend, sprach er mit so dickem Akzent, daß ein Stock drin stehen blieb. Es klang, als umgingen die Wörter seinen Mund und kämen direkt aus der Nase.
Ich wußte, daß Torkesquist nicht in der angesprochenen Weise an mir interessiert war. Obwohl die Gene auf dem Weg zu ihm einigermaßen verpfuscht worden waren, teilte er, was die Frauen anging, doch noch den Geschmack seiner Vikinger-Vorfahren. Er mochte sie groß und blond. Je größer und blonder, desto besser.
«Klaro, Torkesquist, so ist es. Du bist der Mann meiner Träume. Eine Hochzeit hoch zu Roß, und dann reiten wir in den Sonnenuntergang davon. Sehr viel mehr bringt dein alter Klepper Wesley wohl auch kaum zustande.»
«Also jetzt sei mal ein bißchen netter. Auch du wirst eines Tages alt sein.»
Torkesquist und ich bildeten die reiterliche Komponente des Commercial Appeal. Er hatte einen Tork’s Turph genannten Hof bei Waxham, Richtung Charlotte, das heißt nicht weit von dem Stall entfernt, in dem ich mein Pferd stehen hatte. Er teilte seinen Herrschaftsbereich mit zwei lieben alten Gäulen, die ihm überallhin folgten, manchmal auch durch die Haustür. Und er hatte Hap, einen garstigen braunen Appaloosahengst, der als Kind mißbraucht worden sein mußte. Ein so übles Temperament war nicht anders zu erklären – allenfalls noch dadurch, daß er von Dämonen besessen war. Die Fairneß gebietet zuzugeben, daß dieses Pferd trotz all seiner Macken ein sehr guter und ausdauernder Läufer war.
Ich reichte Torkesquist den Fotoauftrag. «Morgen um vier, und voll auf die Tränen halten», sagte ich. «Soll übermorgen gebracht werden, also verfahr dich auf dem Rückweg nicht.»
Was das Talent anbetraf, war Torkesquist der beste Fotograf des Appeal. Das heißt, er war es, wenn er nicht einen Film einzulegen und sein Auto aufzutanken vergessen hatte, wenn er überhaupt, dann pünktlich zu einem Fototermin erschien und nicht so blöde rumquatschte, daß er rausgeschmissen wurde.
«Halt dich morgen ein bißchen zurück, Torkesquist, ja? Diese Leute haben ein schweres Schicksal.»
«Was ist dir denn unter den Sattel geraten? ‹Halt dich ein bißchen zurück.› Von was denn? Was habe ich getan, um mir …» Er stopfte den Auftrag in die Tasche und stürzte davon.
Wenn ich dieser Spur weiter hätte folgen wollen, dann hätte ich ihn daran erinnert, wie er einmal Barbara Bush den Stumpf seines linken Ringfingers unter die Nase gehalten und der First Lady erklärt hatte, er habe den Finger bei einem Streit mit seiner Ex-Frau eingebüßt. Dann hatte er die Oma der Nation mit dem Ellbogen angebufft und hinzugefügt: «Hätte schlimmer ausgesehen, wenn sie tiefer gegangen wäre.»
Aber ich hatte anderem nachzugehen – so meiner Sonntagskolumne, die der Geschichte des Folterinstruments namens Damenunterwäsche gewidmet war.
«BHs mit Bügel, Korsetts und Hüftgürtel, also all das, was die wohlentkleidete Frau nach dem Willen aller Marquis de Sades trägt …»
3
Ich kriegte meine Kolumne schließlich fertig und sah mich nach einem unbeschäftigten Redakteur um, der meinen Text verstümmeln würde. Der Appeal litt keinen Mangel an mittelmäßigen Vertretern dieser Spezies, die sich selbst für große Schriftsteller hielten.
Beim Appeal sind diese Textbesprechungen nicht viel anders als ein Gang zum Zahnarzt, nur daß man keine Spritze bekommt. Ich fand endlich Jean, die am sanftesten arbeitende Zahnärztin, eine Frau in den Fünfzigern, die vor dreißig Jahren beim Appeal als Redaktionsassistentin angefangen hatte. Sie erhob nicht den Anspruch, Schriftstellerin zu sein, wurde von niemandem bedroht, der einer war, und hegte eine tiefe Liebe zu Zeitungen – so, wie sie ausgesehen hatten, als die Herren im Nadelstreifen noch die bösen Buben und nicht die Eigner gewesen waren.
Jean kannte sich beim Appeal gut aus. Sie wußte, welche Regeln man umgehen durfte und welche nicht. Kundenentfremdung gehörte zu den letzteren. Sie las meinen Artikel, lachte an den richtigen Stellen, merzte unter Entschuldigungen die umstritteneren Begriffe aus und ersetzte sie durch Euphemismen – so etwa «qualvoll» durch «unbequem», wo ich darlegte, wie das so ist, wenn der Bügel eines BHs seiner Nylonhülle entkommt und in weiches Fleisch schneidet.
Sie lehnte sich in ihrem ergonomisch korrekten Stuhl zurück und streckte sich. «Sie wissen so gut wie ich, wie die in den Glasbüros sind. ‹Es kann uns nicht daran gelegen sein, uns die Hersteller von Damenunterwäsche zu entfremden …›»
Wir lachten beide. Das ist der Appeal – er bringt nur, was keinen Unwillen erregt.
Jean schickte meine Kolumne auf ihre glückliche Reise – zuerst zu Candace, dann zu Fred, der sicherstellen wollte, daß ich «keinen weiteren Schaden anrichtete», und dann in die Setzerei.
«Wir sehen uns morgen abend», sagte Jean. «Ich bringe Papiertaschentücher mit.»
Endlich mal ein Glückstreffer. Jean hatte Dienst und würde für den Artikel über die Compassionate Friends zuständig sein! Ich hatte schon gefürchtet, bei Candaces wuseligem kleinem Stellvertreter Ron Riley zu landen, einem gefährlich ehrgeizigen Mann, der so klein war, daß er mit der inoffiziell für Bewerber geltenden, von unserem napoleonischen Lokalredakteur festgelegten Höchstkörpergröße keinerlei Schwierigkeiten gehabt hatte. Das Problem bei Rileys Ehrgeiz bestand darin, daß er gerade noch schlau genug war, die Tatsache zu verbergen, daß seine Schlauheit eigentlich nicht sehr weit reichte, womit er beim Appeal schon auf der Überholspur saß.
Für diese Woche war ich mit der Mode fertig (das einzig Gute an der Arbeit für Candace) und schon fast raus aus der Tür. Mich trennte jetzt nur noch eine kurze Autofahrt vom schönsten Teil des Tages, nämlich von Brenda Starr, meiner gutmütigen Fuchsstute. Ich mußte nur noch einmal versuchen, die Compassionate Friends davon zu verständigen, daß Torkesquist und ich zu ihrem Treffen kommen wollten. Ich rief die Frau an, die vor fünf Jahren die Gruppe für den Bezirk Cabarrus organisiert hatte. Sie hatte ihren sechzehnjährigen Sohn bei einem Autounfall verloren und sich danach schon halb tot gesoffen, als jemand sie zu einem Treffen mitschleppte. Sie sagte, das habe ihr das Leben gerettet, weshalb sie jetzt andere retten wolle, die den Weg zurück ins Leben nicht finden könnten. Auf diese Weise sei der Tod ihres Jungen nicht ganz sinnlos gewesen.
Ich bin in meinem Leben nur wenigen Heldinnen begegnet. Sie ist eine davon.
Ich war sicher, daß es keinerlei Schwierigkeiten machen würde, einen zweiten Bericht zu schreiben. Der erste hatte der Gruppe zu annähernd tausend Dollar verholfen, die gerührte Leser spendeten – und auch Autoren. Ich hatte einen Scheck über hundert Dollar hingeschickt.
Gerade als ich gehen wollte, erschien eine neue Botschaft auf meinem Bildschirm. NATTIE, KÖNNTEST DU BITTE BEI MIR VORBEIKOMMEN UND DIR DIE LISTE ABHOLEN, ÜBER DIE WIR GESPROCHEN HABEN? HG
HENRY, O HENRY, ICH BIN GLEICH DA, antwortete ich, schob meine Aufzeichnungen in eine Schreibtischschublade und verschloß sie. Dann schob ich den Computer zu Allisons Platz hinüber. Sie saß in der Sportabteilung und hatte einen Riesenstapel Hochzeitsanzeigen vor sich.
«Er gehört jetzt ganz Ihnen», sagte ich im Vorbeigehen.
«Wirklich? Es macht mir nichts aus, hier zu arbeiten.»
«Allison, nehmen Sie um Gottes willen Ihr Leben endlich mal in die eigene Hand. Sie können den Computer jetzt benutzen. Sie können ihn selbst dann benutzen, wenn ich anwesend bin!»
Henry klebte mit dem Ohr am Telefonhörer, und seine Finger tippten auf dem Keyboard herum. Er sah auf einen Stapel Papiere und nickte mit dem Kopf in meine Richtung, ohne auch nur einen Buchstaben auszulassen. Seine Lippen formten ein «Danke».
Als ich auf der niemals anhaltenden Rolltreppe nach unten fuhr, überflog ich die Liste. Ich kannte den zweiten Namen – B wie Benson, Jim Benson. Ich trat bei Turnieren gegen ihn an, wenn man denn gegen jemanden antreten kann, der nicht arbeitet, jede Menge Kohle und einen Trainer ganz für sich allein hat. Er war irgendein großer Erbe, der sich selbst gern als Kälberzüchter bezeichnete. Es entsprach seiner Vorstellung von Rinderzucht, einen Verwalter zu beschäftigen und selbst einmal im Monat die Kälber zu betätscheln. Meistens ritt er – in der Gruppe der Amateure und sehr gut. Ein klassischer Scheinamateur. Die Klassifizierung ausgenommen, war er in jeder Beziehung ein Profi. Wenn er außer Gefecht gesetzt würde, konnte mir das eigentlich nur lieb sein, denn dann gewann ich bei einem Turnier in Virginia vielleicht auch mal ein blaues Band.
C kannte ich ebenfalls, beziehungsweise war mir der Name schon begegnet. Man hätte auch tot sein müssen, um nicht schon mal von Christopher Carey gehört zu haben – er war die Antwort der neunziger Jahre auf Charles Bronson. Aber was mochte so ein He-man aus Hollywood mit einem Haufen steinreicher feiner Pinkel zu tun haben? Um das herauszufinden, würde Henry wohl noch einiges an kreativer Ermittlungsarbeit leisten müssen.
Auch den nächsten kannte ich, wußte aber nicht, woher. D wie Duncan. Outerbridge Duncan. Mir tat der arme Kerl mit seinem Vornamen, der wie ein Nachname klang, leid. Da war wohl wieder eine übereifrige Südstaatenmama diesem ganzen Traditionspflegetrara zum Opfer gefallen. Outerbridge Duncan. Irgendwoher kannte ich den Namen, aber woher? Wer konnte das bei einem solchen Namen vergessen? Offensichtlich ich.
Mein Blick glitt das Alphabet hinab, verweilte hier und da. Ein paar der Namen waren mir von den Gesellschaften der High-Society bekannt, über die ich berichten muß. Ein paar andere waren mir – wie Benson – vom Turnierzirkus her geläufig. Alles superreiche Daddys, die ihren Kleinen immer wieder neue 200000-Dollar-Pferde kauften. Wie etwa auch Mr. Santee Mundell, ein unermeßlich reicher Industrieller und Unternehmer. Seine Tochter Topping Mundell war Kollegin von Benson, das heißt Amateurreiterin, und hatte nichts anderes zu tun, als mit teuren Pferden über Hindernisse hinwegzusetzen. An ihrer Ausschaltung lag mir aber nichts, denn sie hatte im Unterschied zu Benson so viel reiterliches Talent wie ein Zaunpfahl. Selbst als ihr Vater 250000 Dollar hingeblättert und für sechs Monate Rox-Dene, das gewinnträchtigste Pferd in der Geschichte des Springsports, geleast hatte, hatte sie die Absprünge nicht finden können. Die Sache war dann auch nicht allzu lange gutgegangen. Topping hatte dem Pferd einen Galoppsprung zuwenig zugebilligt, woraufhin es durch einen großen Oxer gekracht war. Alle waren zu dem armen Pferd gestürzt, während Topping allein, verwirrt und am Boden zerstört dagestanden hatte. Während Rox-Dene mit dem Vergrößerungsglas untersucht worden war, hatte sich keine Menschenseele um die Reiterin gekümmert, die schließlich vor Schmerzen zusammengebrochen war – sie hatte sich die Schulter gebrochen. Das war das Ende der Partnerschaft von Topping und Rox-Dene gewesen. Die Besitzer hatten ihr untersagt, das Pferd noch einmal zu reiten.
Ich versuchte mir vorzustellen, wie das wohl wäre, so ein Jahrhundertpferd zu reiten, und sah dabei weiter die Liste durch. Die Stockwerke glitten vorbei, und ich ritt immer noch Rox-Dene, als mein Blick bei O wie Osborne hängenblieb. John Knights Osborne, der Mann, der mir einmal das Herz gebrochen hatte. Mein Körper mochte sich ja noch auf der Rolltreppe befinden, aber mein Geist war jetzt in New Paltz, New York, genauer im Restaurant Northern Lights, wo ich über meiner Fischsuppe weinte, während John Abschied von mir nahm. Aber kurz bevor er zu dem Der-Kickist-weg-Teil seiner Rede kam, wurde ich ruckartig nach Charlotte zum Appeal und auf die Rolltreppe zurückgeholt, deren Ende ich erreicht hatte. Buchstäblich ruckartig, denn meine Füße stießen an die Kante, und weil ich nicht darauf vorbereitet war, fiel ich auf den Hintern. Und ausgerechnet an diesem Tag hatte ich meine alten Breeches an, also Reithosen jener Art, bei der meterweise Stoff für extragroße seitliche Ballons vernäht wird. Es war jedenfalls zu meinen beiden Seiten so viel Köperstoff vorhanden, daß die Zähne des Laufbandes keine Mühe hatten, sich was davon zu schnappen.
«Aaah!» schrie ich los. «Hilfe! Schnell, oder ich werde gleich zu Isadora Duncan.»
Der Wachmann (endlich gab es welche) stand glücklicherweise gerade neben dem kleinen roten Knopf, mit dem sich die Treppe im Notfall stoppen läßt. Sie blieb stehen. Meine Breeches waren hoffnungslos zerkaut. Ich zerrte heftig daran, bekam sie aber nicht frei. Der Wachmann trat mit einer Schere zu mir, aber mein Wohlergehen kümmerte ihn wenig. Ich war fast von der Treppe aufgefressen worden, und alles, woran ihm lag, war, das blöde Ding wieder in Gang zu kriegen. Das hieß die Sache mit dem Teamgeist wirklich ein bißchen zu weit treiben!
Ich entriß dem Mann die Schere, knurrte ein kurzes «Danke!» und befreite mich per chirurgischem Eingriff von der Treppe. Ich besah mir meine Reithose beziehungsweise das, was von ihr noch da war. Scheiße, fünfundsechzig Dollar im Eimer! Das Gute daran war lediglich, daß mir damit eines jener Kleidungsstücke genommen war, an denen Candace und Fred ständig herumgemäkelt hatten, weil sie nicht ihrer Vorstellung von der einer Modeberichterstatterin angemessenen Kleidung entsprachen.
Ich schritt mit so viel Würde davon, wie es mit einer derart zerfetzten Hose möglich ist. Dieser verdammte John hatte ein Loch in mein Herz gerissen – und jetzt die Treppe eins in meine Hose! Was für ein Tag. Und wie kam dieser John Osborne eigentlich auf die Liste? Er war schließlich Künstler. Damals hatte er sich gerade angeschickt, der nächste Dennis Hopper zu werden – und ich, einen Präsidenten oder wenigstens einen Senator zu stürzen. Und was tue ich jetzt? Ich schreibe Kolumnen über Damenunterwäsche. So weit war er wohl kaum vom Weg abgekommen.
Ich verscheuchte John aus meinen Gedanken und konzentrierte mich wieder auf die Liste. Fünfundzwanzig Namen insgesamt – kein Mr. X, ich sah extra noch einmal nach. ERST HUSTEST DU. DANN STIRBST DU … was macht, daß man hustet und stirbt? Arbeit im Kohlebergbau, Asbest, Tabak, Baumwollstaub … DU WIRST BEZAHLEN. Für was bezahlen?
4
«Lieber Gott, Nattie, Brenda war heute abend ja wirklich großartig! Immer richtig am Absprung, kein Verweigern, der arme Rob konnte dich überhaupt nicht anbrüllen.»
Das war Gail, meine beste Freundin und die Managerin des Stalls, in dem wir beide unsere Pferde stehen hatten. Sie besaß einen schönen großen Schweißfuchs mit Namen Allie, das Kürzel für «All Dressed Up».
Gail hatte recht. Brenda war großartig gegangen, fast schon wie eine Springmaschine. Wir waren viermal in absolutem Gleichklang über einen Parcours mit eins acht hohen Hindernissen hinweggesegelt. Wenn ich doch nur mit Männern – oder Redakteuren – auch so gut zurechtkäme!
Lief es mit meinem Pferd gut, was häufig der Fall war, weil es sich um ein Wunderpferd handelte, dann hatte ich ein Gefühl, als drückte mein Inneres mit Macht gegen mein Äußeres. Größer, weiter, mehr. Es war besser als all die Hochgefühle, die ich in meiner Jugend mit chemischen Mitteln zu erzeugen versucht hatte. Schade, daß so viele Gehirnzellen hatten draufgehen müssen, bis ich dahintergekommen war.
Ich glitt aus dem Sattel und führte Brenda zur Waschbox. Die Vorzüge des Lebens in den Südstaaten: Es war kurz vor Weihnachten, und ich konnte mein Pferd mit dem Schlauch absprühen, ohne es damit in ein Eis am Stiel zu verwandeln.
«Was soll ich sagen, Gail? Ich bin von den Reitergöttern mit einem Wunder gesegnet worden, und sein Name ist Brenda Starr. Sag mal, wollen wir zusammen zu Abend essen?»
«Geht leider nicht, ich habe eine Sitzung.»
«Ich dachte, die war gestern?»
«Ja, stimmt. Und wahrscheinlich habe ich morgen wieder eine. An Feiertagen möchte ich immer trinken.»
Ich legte den Arm um sie. «Ich möchte ja nicht sentimental werden, Gail, aber ich bin, wenn das was zu besagen hat, stolz auf dich. Ich weiß, wie hart das alles für dich gewesen ist.»
«Es hätte noch schlimmer kommen können, Nat. Ich meine mit Allie. Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre er jetzt nicht mehr da, und wenn ihm etwas zustieße …»
Ich drückte sie fest an mich und war froh, eine Frau zu sein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß sich zwei Männer auch so verhalten können, Pferdetrainer vielleicht ausgenommen.
Gail reichte mir ein Schweißmesser, und ich zog das Waschwasser von Brendas Fell ab.
«Sie könnte gar nicht sauberer sein», sagte Gail schließlich. «Du läßt sie am besten bis zu dem großen Tag bei George so.»
Sie meinte den Schulungskurs, zu dem ich mich unter Ablieferung eines ganzen Monatsgehalts angemeldet hatte. Aber wie oft kriegt man schon die Gelegenheit, bei dem Menschen in die Lehre zu gehen, der das Standardwerk über ebenjene Leidenschaft geschrieben hat, der man verfallen ist, in meinem Falle über den Springsport? Ich hatte meine gesamten Ersparnisse bereitwilligst an George Morris hingegeben, damit er mich geschlagene vier Stunden anbrüllen und demütigen konnte.
Gail zeigte auf ein Fleckchen angetrockneter Erde an einem von Brendas Beinen. Ich hatte es übersehen.
«Bring sie so hin», sagte sie, «und du bist innerhalb von fünf Minuten wieder draußen. Ich habe gehört, daß er mal eine Reiterin rausgeschmissen hat, weil ihr Pferd ein Fleckchen Scheiße am Hintern hatte. Dabei soll er laut geschrien haben: ‹Ist das ein Grauschimmel unter all dem Dreck, oder was? Erst wenn Sie gelernt haben, wie man ein Pferd ordentlich sauberhält, können Sie wieder herkommen und bei mir reiten. Das ist kein Hausfrauensport.› Die Frau kam nie wieder. Du hast es noch gut, Nat, weil Brenda dieselbe Farbe hat wie dieser häßliche Lehmboden von Carolina. Du willst doch noch hin, oder nicht?»
«Ich möchte den Kurs um nichts in der Welt versäumen», erwiderte ich. «Ich kann vor Saisonbeginn durchaus noch ein bißchen Folter vertragen. Einmal pro Woche von Rob zur Sau gemacht zu werden, das reicht nicht aus.»
«Mach nur ordentlich Notizen, damit du mir alles berichten kannst.»
«Ich werde dir aber auch alles erzählen. Bis zum letzten Anpfiff.»
Ich rieb Brendas frisch gewaschenen Rücken ab und brachte sie ins Bett, nicht ohne sie noch mit drei Bündeln Luzerne versorgt zu haben, die so süß dufteten, daß ich mir wünschte, ein Pferd zu sein.
«Versuch nur, dir das morgen nicht zu nahegehen zu lassen, Nat», sagte Gail, als wir uns zu meinem Auto aufmachten.
Gail hatte mich nach dem Tod meines Stiefvaters umsorgt und auch miterlebt, wie ich nach meinem ersten Besuch bei den Compassionate Friends gelitten hatte.
«Das ist, als wolltest du von mir verlangen, keine roten Haare mehr zu haben.»
Wir lachten, und dann trat ich hinaus ins Dunkle. Dort blieb ich noch ein paar Sekunden stehen und atmete tief ein. Nach zwanzig Jahren als Pferdebesitzerin war für mich der Geruch eines Stalles noch immer unwiderstehlich und vermittelte mir ein tiefes Glücksgefühl. Heute abend war er besonders berauschend. Ich schloß die Augen und sah alles vor mir – dunkelrotbraune, langsam und leicht wogende Wellen mit weißen und haselnußbraunen Kämmen. Ich habe Gerüche schon immer gesehen.
Ich atmete noch einmal tief durch, gleichsam als Reiseproviant, und fuhr dann los. Die Heimfahrt verlief ereignislos, obwohl ich eigentlich daran gedacht hatte, noch bei meinem Polizistenfreund Tony vorbeizuschauen. Ich fing an, mich ein bißchen bedrückt zu fühlen – die Festtage, mein Stiefvater, die Compassionate Friends, das alles machte mich traurig. Tony brachte mich mit seinem langsamen Sprechen und seiner umgangssprachlichen Ausdrucksweise immer in eine bessere Stimmung. Die Tatsache, daß ich mit einem Bullen befreundet war, und das auch noch eng, ließ mich nach wie vor über mich selbst lachen. Vor zwanzig Jahren, als meine gesamte Garderobe ganz aus buntbedruckten indischen Bettüchern und fransenbesetzten Lederwesten bestanden hatte, war jeder Mann in blauer Uniform und mit Revolver der Feind gewesen. Tony war alles andere als das – Teufel auch, er hätte mich fast erkannt, ich meine im biblischen Sinne des Wortes. Wenn da nicht seine mal bei ihm, mal getrennt von ihm lebende Frau Sharon gewesen wäre, wäre es möglicherweise wirklich dazu gekommen. Aber ehrlich gesagt war es mir lieber, mit Tony nur befreundet und damit frei von all jenen Komplikationen zu sein, die der Sex mit sich bringt, auch wenn dies bedeutete, daß ich des knackigsten Pos diesseits von Lake Norman verlustig ging.
Aber mir war unbekannt, wie Sharon in der laufenden Woche gerade dachte, und ich wollte das Risiko nicht eingehen, in eine innige Versöhnung hineinzuplatzen. Deshalb bog ich, zur Route 16 gelangt, statt nach links nach rechts ab. Zu Hause fand ich dann einen apoplektischen Anrufbeantworter vor, der zugleich stotterte und piepte. Es brachte nichts, die Nachrichten abzuspielen, aber es war auch egal, denn ich konnte die bruchstückhaft zu hörende Stimme erkennen – es war die meiner Mutter. Ich wollte das verwurschtelte Band gerade herausnehmen und in den Mülleimer werfen, als ich noch eine weitere Stimme hörte, die mir aber unbekannt war. Die Stimme einer Frau. Entweder weinte sie, oder der Anrufbeantworter hatte der Aufnahme nicht nur eine redaktionelle Bearbeitung angedeihen lassen, sondern sie auch noch um Klangeffekte bereichert. Ich konnte die Worte kaum zusammenstückeln: «Ist da … tie Gold hier ist … nie … shmore … sanes … utter sie erinnern si … miss … ticut sie ist to … sie wur … ordet … und niema … ntwortet meine fra … te helf … sie mir.»
5
Die verstümmelte Nachricht beschäftigte mich von dem Augenblick an, wo ich erwachte, und das war gut, denn da brauchte ich nicht an meinen bevorstehenden Einsatz zu denken. Ich fragte meinen Anrufbeantworter im Büro ab, weil ich hoffte, die mysteriöse Anruferin hätte sich vielleicht sicherheitshalber auch dort gemeldet. Das war aber nicht der Fall.
Dafür hatte Henry sich gemeldet. Er bedauerte, meinen Anruf am gestrigen Abend verpaßt zu haben, und meinte, was ich zu den Namen auf der Liste gesagt habe, sei sehr interessant. Die Geschichte mit Jim Osborne und dem gebrochenen Herzen hatte ich ihm verschwiegen und es bei dem Künstlerfreund belassen.
Und es lag eine Nachricht von Candace vor. Sie erklärte mir, warum sie am Vorabend noch mit mir hatte sprechen wollen. Ihre Schwester Diane wollte einen Teil ihrer psychiatrischen Assistenzzeit in Charlotte absolvieren und mich dazu befragen, wo man ein Pferd unterstellen könne. Candace hatte eine Schwester? Ich hatte gar nicht gewußt, daß dieses Modell auch in Serie gegangen war.
Ich mußte Candace sowieso anrufen. Ein Einsatz um vier Uhr nachmittags bedeutete, daß ich erst gegen Mitternacht wieder zu Hause sein würde, also erst nachdem die letzte Ausgabe in den Druck gegangen war. Für mich bedeutete das einen freien Vormittag, aber wer wußte schon, wie Candace das sah. Statt das gleich zu klären, wartete ich, bis sie und ihr verkürzter Schatten Ron Riley bei ihrer täglichen Übung im Schöntun waren. Das war die Redaktionskonferenz um zehn, bei der die Zeitung des folgenden Tages geplant wurde und bei der alle Redakteure der mittleren Ebene versuchten, Fred mit der Produktivität ihrer Reporter zu beeindrucken und gute Plätze zu ergattern. Ich hinterließ Candace die Nachricht, daß ich mich gern mit ihrer Schwester unterhalten wolle und nach Rückkehr von den Compassionate Friends im Büro zu erreichen sei. Dann strebte ich auf geradem Weg zur Tür.
Ich fuhr auf der Providence Road nach Süden und schaltete meinen Autopiloten im Kopf ein. Wenn man drei Jahre lang tagaus, tagein immer dieselbe Strecke gefahren ist, dann kennt man die Kurven der Straße so gut wie die des eigenen Körpers. Leider verändern sich beide. Die Entwicklung drang langsam, aber sicher nach Süden vor und hatte mich ebenso wie Charlotte erfaßt. Vor zehn Jahren war ich noch mit Reithosen der Größe 26 gut ausgekommen. Und von der Queen City hatte man mir berichtet, daß zu jener Zeit rechts und links der südlichen Providence Road nichts als grüne Flächen gewesen waren. Heute stehen dort dicht an dicht Wohnhäuser aus rotem Backstein, und ich darf mich glücklich schätzen, wenn ich noch in Hosen der Größe 28 hineinkomme. Eine aggressivere Entwicklungspolitik war angesagt – das galt sowohl für die Stadt als auch für mich.
Wenigstens mußte ich mich nicht mit dem Berufsverkehr herumschlagen und war im Nu draußen auf der kiesbestreuten Zufahrt zur February Farm. Ich fand Gail mit Allie auf der Übungsbahn.
«Ich arbeite an den Handwechseln, bis du soweit bist und wir ins Gelände reiten können», sagte sie.
«Bin gleich da», rief ich zurück – und war es auch. Ich sattelte Brenda in Rekordzeit. Zum Glück war Rob nicht da und sah das alles nicht. Aber Brenda war sauber genug, und ich mußte dringend raus, um mich weniger bedrückt zu fühlen. Ich saß auf, und es war ein herrliches Gefühl. Das Wunder konnte geschehen.