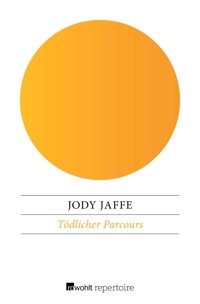9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mord auf dem Reiterhof Und wieder steckt Reporterin Natalie Gold ihre neugierige Nase in den Nobel-Reitställen von North Carolina in die etwas schmutzigeren Ecken. Diesmal findet Natty eine allseits unbeliebte Stallbesitzerin ermordet im Misthaufen. Verdächtig ist gleich die angebliche «Pferdeflüsterin» Sarah, die gerne faule Schecks ausstellt, eine Affäre mit dem Gatten der Verstorbenen pflegte und nun ausgerechnet mit Natalies Vater durchgebrannt ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Jody Jaffe
Um jeden Preis
Aus dem Englischen von Jobst-Christian Rojahn
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Mord auf dem Reiterhof
Und wieder steckt Reporterin Natalie Gold ihre neugierige Nase in den Nobel-Reitställen von North Carolina in die etwas schmutzigeren Ecken. Diesmal findet Natty eine allseits unbeliebte Stallbesitzerin ermordet im Misthaufen. Verdächtig ist gleich die angebliche «Pferdeflüsterin» Sarah, die gerne faule Schecks ausstellt, eine Affäre mit dem Gatten der Verstorbenen pflegte und nun ausgerechnet mit Natalies Vater durchgebrannt ist …
Über Jody Jaffe
Jody Jaffe ist eine turniererprobte Springreiterin. Zehn Jahre lang schrieb sie für den Charlotte Observer. Heute lebt die zweifache Mutter in Washington D.C.
Inhaltsübersicht
Wenn man Glück hat, kommt man einmal in seinem Leben an ein außergewöhnliches Pferd.
In Erinnerung an Brenda Starr
21.4.75–28.4.97
Während meines Studiums kam ich schon früh zu dem Schluss, dass ich wegen meiner Launenhaftigkeit etwas unternehmen musste. Schnell zeichneten sich zwei Möglichkeiten ab – entweder suchte ich einen Psychiater auf oder ich kaufte mir ein Pferd … Natürlich kaufte ich das Pferd.
Kay Redfield Jamison, Ein unruhiger Geist
Prolog
Als sich Fuzzy McMahon langsam in Dünger verwandelte, war sie am Ende doch noch zu etwas gut. Pech, dass es eines eingeschlagenen Schädels bedurft hatte, um ihrem Leben noch einen Sinn zu geben.
Und sie hätte diese ihre allergrößte Leistung, nämlich das Gras grüner zu machen, in vollkommener Weise vollbringen können, wenn da nicht ein dickes, graues Pony namens Blue By You zur falschen Zeit für einen so großen Wirbel gesorgt hätte.
«Grundgütiger Himmel, was ist heute Morgen eigentlich mit Blue los?», fragte Ebert Darnell, ein großer, spindeldürrer Mann, der auf der Anyday Farm die Morgenfütterung und das Ausmisten der Ställe besorgte. «Sehen Sie sich den mal an! Was hat der bloß? Rast herum, als wenn sein Schwanz Feuer gefangen hätte.»
Die Frau, die neben Darnell stand, schüttelte den Kopf. «So glatt, wie das Gras dort ist, und bei dem Glück, das ich in letzter Zeit hatte, bringt sich dieses Pony glatt selbst um oder zerrt sich die Sehnen wie dieses Fohlen im Stall. Das hätte mir heute Morgen gerade noch gefehlt. Kaufen die sich ein Pony, das nicht aufhört zu bocken, wenn es nicht täglich mindestens neunundzwanzig Stunden rausgelassen wird. Schnell, fangen Sie es ein, bevor Sie-wissen-schon-wer ihren traurigen Arsch hochkriegt und herkommt.»
Darnell hätte einwenden können, dass Sie-wissen-schon-wer ihren traurigen Arsch immer erst aus dem Bett hievte, wenn die Morgengewitter in ihrem Kopf abgezogen waren – und dass das Einzige, was diese Gewitter vertreiben konnte, noch mehr Johnny Walker war. Aber Ebert Darnell gehörte nicht zu jenen, die Einwände erheben oder auch nur Unfreundliches über diejenigen denken, die vom Glück weniger begünstigt worden sind.
«Soll ich ihn abspritzen?»
Cathy Sullivan schüttelte den Kopf.«Lieber nicht, dieses Märzwetter kann verrückt sein. Es kommt mir jetzt schon wieder kälter vor als noch vor einer Stunde. Sorgen Sie nur für Entspannung und Abkühlung. Und vergessen Sie nicht, das Pferdchen zu striegeln und die Schweißspuren zu entfernen. Wir wollen doch nicht, dass unser kleines Prinzesschen ein schmutziges Pferd vorfindet.»
Es grenzte für Darnell an ein Wunder, dass Cathy Sullivan es derart lange bei ihnen ausgehalten hatte – so wie sie über die Farm und deren Besitzerin sprach. Nicht dass nicht jedes Wort mehr als zutreffend gewesen wäre. In den vierzehn Jahren, die er nun schon auf der Anyday Farm Ställe ausmistete, Pferde fütterte und Zäune reparierte, hatten die meisten Stallmeister oder Stallmeisterinnen kaum von einer Heulieferung bis zur nächsten überlebt. Die augenblickliche Managerin kannten die Heuleute sogar schon mit Namen.
«Hallo, Cathy», riefen sie ihr etwa zu, wenn die hellgrünen Rechtecke aus süßer Luzerne auf dem Förderband klickediklack hinauf in den Heuschober fuhren. «Nicht zu fassen, dass Sie denen noch nicht den Stinkefinger gezeigt haben. Muss an dem Frostschutzmittel liegen, das Sie in den Adern haben, Mädchen.»
Es war gar keine Frage, dass es eines besonderen Menschentyps bedurfte, um mit den Besitzern der Anyday Farm zurechtzukommen. Das lag nicht allein daran, dass die Chefin eine Säuferin war. Manche Trinker werden zwischendurch immer wieder mal ganz schön trocken, fühlen sich dann vielleicht sogar wegen ihres miesen Verhaltens ein bisschen schuldig. Nicht so diese Dame. Sie war in nüchternem Zustand noch fieser als in besoffenem.
Sie kam im Allgemeinen schwankend in den Stall runter und schrie, als wäre ihr Gewalt angetan worden, wenn sie eine Longe falsch an einer Boxentür hängen sah. Oder Heu im Gang oder Pferdeäpfel in den Boxen.
«Wofür, zum Henker, bezahle ich euch eigentlich?», begann sie regelmäßig ihr Toben.
Auch wenn es kaum zu glauben war, die Frau tat Darnell Leid. Vor allem aber war er, was sie betraf, zu Vergebung fähig, und deshalb hatte er es auch so lange in ihren Diensten ausgehalten. Die Vergebung war in seinen Augen sein Job als Christenmensch. Es bekümmerte ihn aufrichtig, was aus diesem Leben geworden war. Er mochte jedoch noch so viel für sie beten, es wurde ständig schlimmer mit ihr.
Als er auf der Farm angefangen hatte, war sie noch eine ganz normale verzogene, wohlhabende Dame gewesen. Sie hatte ihren Willen durchsetzen wollen, aber welcher reiche Mensch wollte das nicht? Sie war zwar fordernd gewesen, hatte ihre Forderungen aber immerhin noch in freundliche Worte kleiden können. Im Laufe der Jahre schien ihr dieser Teil ihres Vokabulars dann gänzlich abhanden gekommen zu sein, so als wäre Johnny Walker höchstselbst in ihren Kopf hineinmarschiert und hätte alle «Bitte» und «Danke» und «Wären Sie wohl so nett» herausgeholt.
Sie sah inzwischen auch anders aus. Es war nicht die übliche Form des Alterns mit Falten hier und Falten da, sondern eine drastischere – ihr Gesicht war irgendwie eingesackt, als wäre alles Stützende zu Staub zerbröselt. Sie war nie das gewesen, was man als eine Autos anhaltende Schönheit hätte bezeichnen können – das verhinderten schon ihr etwas zu rundes Gesicht und ihre ein wenig zu kleinen Augen. Aber als Darnell vor Jahren bei ihr angefangen hatte, hatte ihr Erscheinungsbild noch eine Frische gehabt, die an jene der Pfingstrosen kurz nach dem Erblühen erinnerte.
Ihre Blume war bei all dem Alkohol, der an ihren Eingeweiden fraß, und der Niedertracht, die ihre Seele verzehrte, schnell gewelkt. Was zu Beginn noch ein einigermaßen erfreulich aussehendes Gesicht gewesen war, verwandelte sich allmählich in die verschrumpelte Halloween-Maske von Porgy Pigs Schwester. Darnell konnte nicht anders, als sich fragen, ob das wohl Gottes Plan entsprochen hatte.
Darnell wusste nicht mehr, wann die Niedertracht das Ruder übernommen hatte. Noch nicht, als er auf der Anyday Farm angefangen hatte. Damals hatte er noch viele Anwandlungen von Freundlichkeit erleben können, vor allem den jungen Mädchen gegenüber, die ihre Ponys im Stall stehen hatten. Die Mütter hatten die schweren Wagenschläge ihrer Mercedesse, Volvos und BMWs geöffnet, und aus jedem der Wagen war ein kleines, pferdeschwänziges Mädchen herausgehüpft und hatte zum Abschied gewinkt, wenn das Auto der Mama über die enge, kiesbestreute Auffahrt zur Bundesstraße 16 zurückgefahren war. Dann war sie hingegangen und hatte für alle diese kleinen Pferdenärrinnen die Ersatzmutter gespielt, hatte ihnen die langen, widerspenstigen Schnürsenkel gebunden und beim Satteln der Ponys geholfen, die nur zu genau gewusst hatten, um wie vieles sie größer waren als die Mädchen. Und wenn eines von ihnen mal gestürzt war, dann hatte sie es aufgehoben, ihm den Schmutz abgeklopft, es mit einem «Aber, aber, ist ja schon gut» bedacht und ihm im Nu wieder in den Sattel geholfen.
Das bedeutet nicht, dass sie nicht ihre schwachen Momente gehabt hätte. Aber damals hatte sie noch einen Ausweg aus ihren düsteren Stimmungen gekannt: Sie hatte eines ihrer Pferde gesattelt, war tief in den Wald hineingeritten und völlig erschöpft wieder zurückgekehrt.
Wenn Darnell genau darüber nachdachte, dann hatten sich die Veränderungen wahrscheinlich in der Zeit kurz vor der Geburt des Kindes eingestellt. Sie hatte die Schwangerschaft verabscheut, zumindest verabscheut, wie diese sie aus- und ihren Mann andere Frauen anschauen ließ. Obwohl Darnell ihr hätte sagen können, dass es nicht ihr geschwollener Bauch war, der die Blicke ihres Mannes dort hingleiten ließ, wo sie nicht hätten sein sollen. Der Mann hatte schon bewegliche Augen gehabt, als Darnell ihm zum ersten Mal begegnet war, und ganz zweifellos auch schon lange davor. Darnell dachte zwar nicht gerne Unfreundliches, aber es war so klar wie ein kalter Sonnentag, dass dieser gut aussehende Mann mit seinem braunen Kraushaar und seinem Ich-weiß-schon-was-du-willst-Lächeln jede Frau hätte haben können, die er haben wollte.
Darnell war sicher, dass sie sich in den vielen einsamen Nächten dort in dem großen Haus so viel Schönheit gewünscht hatte wie Geld, das ihr reichlichst zur Verfügung stand. Er war nie in dem Kunstmuseum im vornehmen Teil von Charlotte gewesen, hatte aber gehört, dass es dort einen Flügel gab, wo der Familienname ihres Daddys unter so gut wie allen gestifteten Gemälden stand. Sie fuhr den dicksten Mercedes, den er je gesehen hatte, und der Stall der Anyday Farm war in einem jener Hochglanzmagazine vorgestellt worden, die sonst Aufnahmen von Chers Haus brachten. Und doch war sie, das wusste Darnell, trotz ihrer großen Autos und schicken Häuser bei Nacht allein gewesen, hatte nur die Gesellschaft Johnny Walkers gehabt. Ihr Vermögen mochte ihr zwar einen Mann verschafft haben, war jedoch ganz und gar nicht in der Lage gewesen, ihn auch zu halten.
Es waren ja nicht nur die Blicke des Mannes, die wanderten. Er war im Ganzen bald kaum mehr da, fuhr nur noch gelegentlich mit seinem Lastwagen durch die weit entlegenen Weidegründe, um nach seinen Kühen zu schauen. Vielleicht tauchte er auch mal im Stall auf, um ein Pferd zu beschlagen, das aber nur, wenn seine Besitzerin jung, hübsch und schlank war, oder um sich anzuschauen, wie die neueste Stallmeisterin aussah. Das hatte die Chefin jedoch nach einer Weile spitzgekriegt und war dazu übergegangen, dicke Frauen mit großen Nasen einzustellen.
Da waren also nur sie und das Baby gewesen, ein Mädchen, das mit dem Aussehen seines Vaters und dem Naturell seiner Mutter gesegnet war. Es wäre schwer gewesen zu entscheiden, welche von beiden schlimmer war, die Mutter oder die Tochter. Nur dass die Tochter zwei Entschuldigungen hatte: Erstens war sie noch ein Kind, erst dreizehn Jahre alt und mit Hormonen gesegnet, die sie stießen und herumwirbelten, als wäre sie ein Ästchen, das auf den Wogen des Chattooga, dort, wo er am wildesten war, hinunterschwamm. Und zweitens musste man sich die Frau ansehen, die ihre Mutter war – eine Frau, die die Schuld an ihrer Gemeinheit nur der Tatsache anlasten konnte, dass sie zu viel Geld und zu wenig zu tun hatte.
Darnell schüttelte den Kopf und bat Jesus, die beiden zu behüten – es war das Einzige, was er tun konnte, wenn er an diese traurige Familie dachte. Er setzte sich in Richtung Koppel in Bewegung, um das Pony einzufangen, das immer noch herumraste, als nagten Raubkatzen an seinen Fesseln.
«Ebert», rief Cathy Sullivan, «nehmen Sie eine Dose Futter mit, für den Fall, dass er sich gar nicht fangen lassen will.»
Er kehrte deshalb in den Stall zurück und ging in die Futterkammer, wo er ein paar Hand voll kleiner, grüner Pellets in eine alte Maxwell-Dose tat. Als er wieder nach draußen auf die Koppel kam, hatte sich das Pony noch immer nicht beruhigt. Es galoppierte gerade am Zaun entlang und dann – noch schneller – wieder zurück, um schließlich, am Ende der Koppel und in der Nähe des Misthaufens angelangt, abrupt stehen zu bleiben, sich aufzubäumen und wiederholt mit den Vorderhufen hart auf den Boden zu schlagen.
Was Darnell auch versuchte, das Pferd wollte sich nicht einfangen lassen.
«Warten Sie einen Augenblick, ich komme Ihnen helfen», rief Cathy Sullivan. Sie lief, ebenfalls eine alte Kaffeedose in der Hand, zu Darnell.
«Da haben Sie Ihr Problem, Ebert», sagte sie, in seine Kaffeedose schauend. «Sie haben Pellets dabei. Haben Sie vergessen, dass dieses Pferd mal gesagt hat, es mag keine Pellets? Mal sehen, ob ich es richtig gemacht habe. Es hat, meine ich, gesagt, es wolle von jetzt an nur noch richtiges Futter fressen, weil ihm das Fertigfutter immer an den Zähnen kleben bleibe und es dann von den andern Pferden ausgelacht werde.»
Cathy Sullivan prustete los und Ebert Darnell lachte mit.
«Das war vielleicht was», sagte er. «Wie viel bezahlen Sie der Frau eigentlich? Der Dame, die behauptet, sie könne mit Pferden reden? Wie nannte sich die gleich? Eine Pferdeirgendwas?»
«Pferdekommunikatorin. Sie behauptet, sie könne so mit Pferden sprechen wie wir beide jetzt miteinander. Verlangt für ein Schwätzchen hundert Dollar. Natürlich gibt’s hinterher eine Massage gratis dazu, weil die Pferde, wie sie sagt, die Entspannung brauchen. Muss aber doch was dran sein, denn sie hat schon alle Ställe in Weddington, Matthews und Waxham beehrt, und die Besitzer schwören auf sie. Ich dachte, ein paar von unsern Mietern würden ihren Spaß mit ihr haben. Ich hätte mich da raushalten sollen. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen hellsichtiger gewesen, hätte sie nie hergeholt. Und um diesen so schon schrecklichen Tag noch schrecklicher zu machen, kommt sie heute Vormittag wieder, zu ein paar von unseren Mietern. Ich hoffe nur, Sie-wissen-schon-wer kommt nicht während einer dieser Séancen herein. O Mann, ich kann pro Woche nicht mehr als einen ihrer Ausbrüche verkraften! Und außerdem, woher hätte ich es denn wissen sollen?»
«Nein, das konnten Sie wirklich nicht», sagte Darnell. «Machen Sie sich keine Gedanken, es geht vorbei. Ich habe sie schon schlimmer wüten sehen und weitaus üblere Dinge von sich geben hören als vorgestern, und nach ein paar Tagen ist sie in den Stall gekommen, als wenn nichts gewesen wäre. So ist sie halt. Sie braucht eben zwei oder ein paar mehr Tage, um sich wieder zu beruhigen, das ist alles.»
«Ich hätte nichts dagegen, wenn sie zwei oder ein paar mehr Jahre wegbliebe.»
Während die beiden so miteinander sprachen, gingen sie zum unteren Ende der Koppel, wo das Pony immer noch auskeilte, laut wieherte und nach dem Boden schlug.
«Jetzt könnten wir diese Pferdekommunikatorin ganz gut gebrauchen», meinte Cathy Sullivan. «Was schreit der bloß so rum? So habe ich den Gaul ja noch nie erlebt.»
Blue By You schenkte weder der einen noch der anderen Kaffeedose Beachtung, aber es hätte auch keines Mediums bedurft, um zu erkennen, dass dieses Pony andres im Kopf hatte als Zähne verklebendes Futter. Seine dicken Adern pochten hart gegen das Fell, dessen Farbe durch den Schweiß zu Stahlgrau verdunkelt worden war. Seine Nüstern waren weit aufgesperrt, und es schnaubte kurz und heftig. Aber es waren seine Augen, seine weit aufgerissenen, unruhig flackernden Augen, die Darnell sagten, dass da etwas nicht stimmte.
Er roch es zunächst nur. Roch es stärker als am Morgen im Stall, als er noch gedacht hatte, es sei ein altes Murmeltier, das im Wald verwese, oder ein überfahrenes Opossum auf der Straße. Je näher er aber jetzt der Quelle kam, desto sicherer war er, dass der Duft nicht von einem kleinen Tier ausging.
«Muss ein verendetes Reh sein, das das Pferd derart in Unruhe versetzt», sagte Darnell und betete, dass er Recht hatte, wobei er gleichzeitig nur zu genau wusste, dass dem nicht so war. Kein vierbeiniges Tier verströmte einen solchen Geruch.
«Puh, das stinkt vielleicht», sagte Cathy Sullivan. «Fangen wir das Pferd ein, und machen wir, dass wir hier wegkommen. Ich werde gleich mein Frühstück los.»
Ebert Darnell ging auf den Misthaufen zu. Dort baumelte ein blutiger Arm. Mit zitternden Fingern grub er sich durch schmutzige Holzspäne, verrottenden Pferdemist und verfilztes Heu, bis er zu Haaren gelangte, blonden Haaren, die durch dunkle Klumpen getrockneten Blutes schwarz gestreift waren und auf diese Weise stark wie der Marmorkuchen aussahen, den seine Frau am Vorabend zum Nachtisch serviert hatte, dass er sich bei dem krampfhaften Versuch ertappte, sein Frühstück bei sich zu behalten. Er grub noch tiefer, so tief, dass er seine Hand unter eine Schulter schieben, den Körper vorziehen und umdrehen konnte. Nicht, dass es erforderlich gewesen wäre. Er wusste schon, wer das war. Das Einzige, was ihn überraschte, waren ihre Augen.
Traurige Augen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren blickte Fuzzy McMahon nicht so drein, als wollte sie jemanden umbringen.
1
Ich sitze in einem weißen Korbstuhl Margie gegenüber, die Herrin der Cafeteria ist und immer die Mohrrübenenden für mein Pferd Brenda Starr aufhebt. Nur dass sie jetzt sagt, sie sei meine Therapeutin, und ich hätte um diese eilige Sondersitzung gebeten, weil Brenda am heutigen Tage zu mir zu sprechen begonnen habe.
«Ich glaube, ich werde verrückt», sage ich zu Margie. «Erinnern Sie sich noch, dass ich Ihnen mal anvertraut habe, die ganze Familie meines Vaters sei irre? Sein Bruder hat Selbstmord begangen, seine Schwester hätte ihre Finger auch gleich in eine Steckdose stecken können, so oft hat sie eine Schockbehandlung über sich ergehen lassen müssen, drei weitere Schwestern haben so viel Lithium geschluckt, dass es gereicht hätte, den Hunnenkönig Attlia zu stabilisieren, und mein Vater selbst ist auch nicht gerade ein Muster ausgeglichenen Verhaltens. Und jetzt glaube ich, dass mein Pferd, als ich schneller reiten wollte, ‹Wozu das denn?› gefragt hat.»
«Und erinnern Sie sich noch daran, dass ich Ihnen einmal gesagt habe», erwidert Margie, die Cafeteria-Herrin und Therapeutin, liebevoll, besänftigend und fürsorglich, «dass jede genetische Anomalie inzwischen längst offen zutage getreten wäre? Und außerdem: Woher wollen Sie denn wissen, dass Ihr Pferd nicht tatsächlich mit Ihnen gesprochen hat?»
Ich sehe sie an, als spräche sie Russisch. Ich verstehe sie nicht. Wo ist mein alter Therapeut, dieser Freudianer mit dem schlechten Toupet, der mir Sitzung für Sitzung aus seinen psychiatrischen Schriften vorliest und die Wörter verstümmelt, die er nicht kennt? Und wo ist mein Rock? Wieso sitze ich in Unterrock und Strumpfhose da? Margie meint, ich sei zu ihr, der Expertin für den nicht ortsgebundenen Geist und für Tomatenschnittchen, gewechselt, weil ich auf der Couch des Freudianers immer eingeschlafen sei. Ich weiß jetzt wieder, dass ich immer fünfundvierzig der fünfzig Minuten verschlafen habe und er dann zu mir gesagt hat: «Gute Sitzung, Sie arbeiten sich durch Ihren Widerstand hindurch.» Was meinen fehlenden Rock angeht, so sagt Margie, wir würden zu meinen Unordnungs- und Verletzbarkeitsproblemen beim nächsten Mal kommen.
«Apropos sprechende Pferde», sage ich zu Margie. «Ich habe aufgehört, an eine solche Möglichkeit zu glauben, nachdem mein Bruder mich darauf hingewiesen hat, dass die Lippenbewegungen des sprechenden Fernsehpferdes Mr. Ed überhaupt nicht zu seinen Worten passten.»
Sie sieht mich an und lächelt heiter, erdmütterlich, kosmisch bewusst. «Ein Mann hat Ihre Offenheit gegenüber den Wundern des Universums kaputtgemacht? Das hätte ich mir denken können.» Sie seufzt tief und lächelt noch heiterer. «Wir gehen alle so verschiedene Wege. Die Männer werden am Ende auch noch dorthin gelangen, es ist wichtig, das im Gedächtnis zu behalten. Aber erzählen Sie mir von der Zeit, in der Sie Ihre Träume hatten, in der Sie mit den Augen eines Kindes sehen konnten, bevor Ihr Bruder Sie geblendet hat.»
Alles, was mir dazu einfällt, sind die geschwisterlichen Kämpfe mit meinem Bruder. «Maaaaa», hatte ich gebrüllt, «Larry hat mir die Unschuld geraubt, er hat mir meine Träume weggenommen und mich geblendet!»
Meine Mutter hatte nur den letzten Teil gehört und hysterisch zurückgeschrien: «Was ist das mit deinen Augen? Hat er dich wieder am Kopf geschlagen? Ich bring den Buben nochmal um!»
«Nattie», sagt Margie, «die Träume. Was haben Sie geträumt?»
Ich erzähle ihr von dem toten Mann, den ich auf dem Rücksitz eines Autos gesehen hatte, als ich neun war. Und dass ich nicht weiß, ob es ein Traum war oder nicht. Sie sagt mir, dass diese Leiche in dem Cadillac eine rote Decke gewesen sei und dass ich sie an dem Tag gesehen hätte, an dem mein Vater gegangen sei.
«Nicht deine schlechten Träume, sondern die guten, mein Kind», sagt sie. «Erzähl mir von denen.»
Meine guten Träume? Die sind immer auf vier Beinen und mit einem Samtmaul dahergekommen, sage ich zu ihr. Pferde. In meinen guten Träumen ist es immer um Pferde gegangen. Ich war eines jener pferdevernarrten Mädchen, die die Psychiater so gerne analysieren: großes Pferd gleich großer Penis, sie tut ihn sich zwischen die Beine und hat nun selbst einen.
Ich sage ihr, dass ich mich manchmal frage, ob meine Pferdeobsession vielleicht genetisch bedingt sei. Mein Vater liebte Pferde ebenso wie all jene, die vor ihm kamen. In der alten Heimat, in Litauen, hatte der Vater meines Vaters einen großen Apfelschimmel gehabt, der am Tag seine Hausiererkarre zog. Bei Nacht hatte er sich auf das Pferd geworfen und war über die Felder galoppiert.
«Gut, gut», sagt Margie. Ihr Haar hat die Farbe der Mähne meines Pferdes, ist kupferfarben hell und ganz gerade. Ich möchte es zu kleinen Zöpfchen einflechten, wie ich das bei Brenda tue, ehe ich mit ihr bei einem Turnier antrete. «Mehr, mehr Träume.»
«Also, als ich noch sehr klein war und bevor Larry mich sehen ließ, dass Mr. Ed gar nicht richtig spricht, habe ich geglaubt, dass Pferde sprechen könnten, wenn sie es nur wollten. Zu den Menschen, die sie wirklich mögen. Davon habe ich geträumt: von einem Pferd, von meinem Pferd, das zu mir sprechen würde.»
Margie lächelt noch immer selig, und ich frage mich, ob ihr davon nicht bald der Kiefer wehtut.
«Geh zurück in den Stall und schau, ob sie wieder zu dir spricht. Unsre Zeit ist um. Ruf an, sobald du etwas hörst. Und denk dran, den Wundern des Universums gegenüber offen zu sein.»
Brenda reibt ihr Maul an meiner Hand, und ich spüre, wie sich ihre Lippen bewegen – wie es die von Mr. Ed zu tun pflegten. Adrenalin schießt durch meine Arme bis hin zum Herzen. Ich halte den Atem an und lausche aufmerksam. Sie ist ein leise sprechendes Pferd.
Ich bringe mein Ohr dicht an ihr Maul und warte. Und warte. Nichts. Dann fühle ich, wie ihre Zunge meine Hand leckt. Ich komme mir blöd vor und bin froh, dass außer mir und den Pferden niemand im Stall ist. Es muss eine krächzende Krähe gewesen sein, als ich gedacht hatte, Brenda spräche zu mir.
Ich sattle sie und führe sie nach draußen. Gehen, traben, leichter Galopp rechts herum. Dasselbe links herum. Die Sprünge sind tief gelegt, deshalb will ich Brenda über ein paar hinüberflitzen lassen. Ich richte sie auf ein Gatter aus. Gerade, als wir zum Absprung kommen, höre ich: «Ich fühle mich heute wirklich nicht danach, mein Rücken tut weh.» Ich schaue mich um. Da ist niemand – nichts – außer mir und Brenda. Keine krächzenden Krähen, keine kläffenden Hunde. Niemand außer uns.
«Was ist?», frage ich.
«Ich sagte, mir ist heute nicht nach Springen. Ich hab mir gestern Abend den Rücken verrenkt.»
Heiliger Strohsack, denke ich. Ich kann es nicht laut sagen, weil ich meinen Mund nicht zu bewegen vermag.
«Hör mal», sagt Brenda, «ich möchte ja deswegen keinen Trouble machen, aber könnten wir das nicht auf einen andern Tag verschieben?»
Ich kriege mein Mundwerk wieder in Gang und sage: «Sicher doch, Brenda, was immer du wünschst.» Ich springe von ihr herunter und stelle mir eine Million Fragen – all die Fragen, die ich für ein sprechendes Pferd zusammengetragen habe. Aber sie will mir keine einzige davon beantworten. Sie sieht mich nur mit ihren großen, braunen Augen an und reibt den Kopf an meiner Hand.
Ich rufe Margie an. «Keine Panik», sagt sie. «Du bist okay. Sieh zu, was sich offenbart, und dem folge dann.»
Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich wieder im Stall bin. Während ich Brenda sattle, sagt sie kein Wort. Ich reite tief in den Wald hinein, wo es dunkel und kühl ist. Das letzte Tageslicht tanzt durch die Blätter. Alle Gedanken an meine bevorstehende geistige Umnachtung sind fort, vergessen. Ich bin wieder in meinem Paradies, bin der alten Pferdemagie einmal mehr erlegen.
«Ich möchte nicht gern nasse Füße kriegen.»
Ich falle fast aus dem Sattel.
«Ich sagte, ich möchte nicht gern nasse Füße kriegen, weil ich dann eine Erkältung bekomme. Könnten wir nicht einen anderen Weg nehmen, damit ich nicht durch diesen Bach muss?»
Ich blicke nach vorn und tatsächlich ist dort ein Bach. Und Brenda spricht wieder zu mir. Und wieder weigert sie sich, Fragen zu beantworten, ihre Bitte genauer zu erläutern oder sich einfach so mit mir zu unterhalten. Was ich auch sage, sie sagt nichts mehr. Deshalb drehen wir vor dem Bach um und reiten heim.
Das läuft wiederholt so ab. Im Stall ist sie stumm wie ein Fisch, aber wenn ich auf ihrem Rücken sitze, kommt es zu einer regelrechten – und einseitigen – Quasselei. Erst heißt es: «Könntest du mir bitte die Box beim Eingang verschaffen, das Pferd neben mir frisst so laut.» Dann: «Ich mag meinen Namen Brenda Starr nicht, ich möchte ihn in Seabreeze geändert haben, okay?» Schließlich folgt eine lange Rede darüber, dass sie eigentlich schon immer lieber ein Parade- als ein Turnierpferd gewesen wäre, das über Hindernisse springen und sich die Mähne einflechten lassen muss.»
«Ich sehe mit diesen Zöpfchen einfach lächerlich aus und im Übrigen zwacken sie mich auch am Hals.»
Als ob das noch nicht genug wäre, zieht sie auch noch über meine reiterlichen Fähigkeiten her. «Wie soll ich wissen, was ich tun soll, wenn du derart auf dem Sattel herumzappelst. Sitz mal still, ja? Und nimm um Himmels willen diese Sporen endlich ab. Und wo wir schon dabei sind, lang beim Nachtisch nicht immer so zu. Schließlich bin ich es, die die Extrapfunde herumschleppen muss. Und noch etwas: Geh doch mit dem Zügel etwas sanfter um. Lass du dir mal ein Metallstück ins Maul stecken und dann jemanden daran rumreißen, wie du das tust. Probier mal aus, wie sich das anfühlt, ja?»
Brenda wusste überhaupt nichts Nettes zu sagen, beschwerte sich nur. Ich zahle monatlich 375 Dollar für ihre Unterbringung – und das offensichtlich nur, um sie über den Stall, meinen dicken Hintern und ihr verfehltes Leben meckern zu hören.
Ich sitze wieder bei Margie, erzähle ihr alles, sage ihr, dass Brenda nie meine Fragen beantwortet, sich nicht im Geringsten für mein Leben interessiert. Und jetzt habe ich nicht einmal mehr einen Unterrock an. Nur noch abgetragene Unterwäsche.
Margie sieht sehr interessiert aus, und ihr Gesicht zeigt jenen Heureka!-Ausdruck, den der Freudianer immer dann bekam, wenn ich davon sprach, dass ich meinen Vater unter der Dusche gesehen hatte. «Hat sich ihr Verhalten, mal abgesehen vom Sprechen, verändert?»
«Ich weiß nicht», sage ich. «Ich habe solche Angst, wieder etwas zu tun, was sie ärgert, dass ich mich nur noch darauf konzentrieren kann. Sie wirft mich nicht ab oder beißt mich, wenn Sie das meinen. Es ist alles gut, bis sie den Mund aufmacht.»
Margie schaut sehr ernst drein. Wir sitzen schweigend da, denken nach. Ich bin sicher, sie denkt darüber nach, wo sie mich einweisen lassen kann. Endlich breche ich das Schweigen. «Ich mag schon gar nicht mehr zum Stall gehen.»
Das Lächeln, dieses selige, süße Lächeln, kehrt auf ihr Gesicht zurück. Sie steht auf, kommt zu mir und bringt ihr Gesicht ganz nahe an meins heran. Sie wischt die Tränen fort, die mir über die Wangen laufen.
«Konfuzius hat es als Erster gesagt, aber Meryl Streep hat den Ausspruch berühmt gemacht», sagt sie so leise, dass ich mich anstrengen muss, sie zu verstehen.
«Meryl Streep?», sage ich laut und ärgerlich, habe schließlich genug von allem. «Was weiß denn Meryl Streep schon groß über sprechende Pferde und verkorkste Leben? Pferde sind seit jeher meine Rettung gewesen. Ohne sie fühle ich mich unvollständig. Und jetzt kann ich nicht mehr zum Stall gehen, weil ich ein Pferd habe, das ein Plappermaul ist. Sie beschwert sich ja mehr als meine Redakteurin. Ich wünschte, sie würde einfach das Maul halten und wieder ein stummes Tier werden. Erzählen Sie mir keinen Blödsinn über Meryl Streep. Ich habe genug von Ihrem Geh-mit-dem-Universum-Gequatsche, das für ein Leben reicht, vielleicht sogar für drei. Ich bin raus.»
Ich stürze aus der Tür und Margie sitzt einfach nur da und lächelt verständnisvoll.
Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich wieder im Stall bin. Brenda steht in ihrer Box und frisst Heu. Ich sage kein einziges Wort zu ihr. Nichts. Schweigend bürste und sattle ich sie. Ich nehme die Zügel in die Hand, sanft, denn ich möchte sie nicht mehr im Maul reißen, wo sie mir doch unzählige Male gesagt hat, wie unangenehm das ist. Ich treibe sie sanft mit den Absätzen vorwärts (ich habe die Sporen weggeschmissen, weil auch die ihr unangenehm sind), und wir reiten Richtung Wald.
Ich höre, sehe und rieche nichts Wunderbares. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, schön still zu sitzen. Wir biegen in einen Weg ein, den ich nicht kenne, und vor uns fließt ein kleiner Bach. Ich mache mich auf einen Einspruch gefasst, aber Brenda geht ohne zu zögern hindurch. Sagt kein Wort. Ich reite, reite immer weiter. Schließlich kehre ich mit ihr zum Stall zurück und bringe sie mitsamt einem Bündel Heu in ihre Box. Sie reibt ihren Kopf an meiner Hand.
Ich fahre in meine Wohnung zurück und dort finde ich meinen Vater Lou vor.
«Nattie», fragt er, «hast du meditiert? Ich hab dich schon lange nicht mehr so entspannt gesehen. Ich hab mir diesen Film aus dem Video-Laden geholt, ist fast vorbei. Möchtest du mit mir zusammen das Ende ansehen?»
Ich sitze auf dem zusammengeklappten Futon und schaue auf den Bildschirm. Meryl Streep in frühem Banana-Republic-Outfit. Robert Redford ebenfalls. Beide sehen sehr schön aus und sehr zerquält. Sie unterdrückt Tränen. Er auch. Sie sprechen über ihre gescheiterte Beziehung. Langsamer Schwenk auf ihr Gesicht, auf ihre gepeinigt, aber stark blickenden Augen, ihre stolz gebogene Nase, ihren festen, entschlossenen Mund.
«Gib Acht, worum du die Götter bittest», sagt sie und schaut an Redford vorbei, vorbei an den sienaüberhauchten Horizonten Kenias, vorbei an den dahinziehenden Herden von Antilopen, Zebras, Giraffen. Sie blickt aus Afrika hinaus und in ihre Zukunft. Sie schweigt filmgerecht, dramatisch, viel sagend. Dann fügt sie hinzu: «Sie könnten so grausam sein und dir deinen Wunsch erfüllen.»
2
Ich spürte eine Hand auf meiner Schulter, die mich rüttelte. «Margie», murmelte ich, «Meryl hatte Recht …» Die Hand rüttelte mich stärker. Eine Stimme, die ganz entschieden nicht die Margies war, drang zu mir durch.
«Nattie, es ist zehn vor neun. Musst du nicht zur Arbeit?»
Ich schob mein rechtes Auge auf. Meryl, Robert und ihr khakifarbenes Safarizeug waren weg. Es war Lou, mein Vater, der in schmuddeligem, weißem T-Shirt und noch schmuddeligeren Trainingshosen neben meinem Bett stand.
«Was ist?»
«Arbeit, Nattie. Die Redakteurin … Candace, stimmt’s? … hat vor so zehn Minuten angerufen. Ich hab ihr gesagt, du wärst unter der Dusche. Ich glaube, der könnte ein bisschen Meditation nichts schaden. Sie klang sehr unausgeglichen. Zu viel Yang.»
«Das Erstere stimmt», sagte ich, zwang mich, beide Augen zu öffnen und versuchte, mich in die Wirklichkeit zu wälzen.
«O Mann, Lou, ich nehme nie wieder was von deinem kolloidalen Melatonin! Ich dachte, die Warnung auf dem Fläschchen, dass das Zeug seltsame Träume auslösen kann, sei nichts als heiße Luft. So wild habe ich ja noch nie geträumt. Nein danke, Lou, von jetzt an renne ich lieber in der Wohnung auf und ab, als an meinem Serotoninspiegel rumzumachen.»
Lou sprang auf seinem Minitrampolin herum und schlug sich dabei mit den Fäusten an den Kopf. «Setzt das Chi in Gang», rief er. «Weißt du, wenn du das zwanzig Minuten am Tag machtest, dann würdest du prima schlafen. Ich hab da keine Probleme.»
«Das liegt nur daran, dass du schlafsüchtig bist. Du hast meine ganze Studienzeit verschlafen.»
Lou hüpfte weiter auf und ab. Bei jeder Landung sagte er ein Wort. «Ich … hab … nur … meine … Augen … ausruhen … lassen.»
«Was du nicht sagst, Lou.»
Ich sah ihm weiter zu und fragte mich, was für ein New-Age-Spielzeug er wohl als Nächstes anschleppen würde. Vor einer Woche war es ein Bestrahlungsgerät aus China gewesen – 650 Dollar für eine auf ein Stück graues Metall montierte Glühbirne. Er ließ mich fünfundzwanzig Minuten davor sitzen und schwor, dass es alle meine Leiden kurieren werde. Das Ergebnis waren lediglich Hitzepickel.
Lou war mit allen seinen Vitaminflaschen vor ein paar Monaten bei mir eingezogen. Es hatte nur diese Lösung gegeben – andernfalls hätte ich ihn weiter von Aschram zu Aschram ziehen oder seine Tage in Pater Devines Heim für die Obdachlosen und Müden verbringen sehen müssen. Aber mal abgesehen von seiner Schnarcherei, war es nicht allzu schlimm. Ja, eigentlich mochte ich die Akupunktur-Antischwerkraft-Schuhe sogar, die er vor der chinesischen Lampe mit nach Hause gebracht hatte.
«Ich gehe duschen. Sollte Candace nochmal anrufen, sag ihr, ich wäre ertrunken.»
Ich schlüpfte unter die heißen Wassernadeln und versuchte, mich an meinen Traum zu erinnern. Wenn ich ihn jetzt sich verflüchtigen ließ, dann war er für immer dahin. Etwas von einem sprechenden Pferd. Meinem sprechenden Pferd – und dann wurde mir schlagartig klar, warum ich diesen Traum gehabt hatte: Candace wollte eine Trend-Story haben, und das pronto. Als ob wir hier was Brandheißes, Superaktuelles entdeckt hätten! Obwohl es auch schlimmer hätte sein können. Viel schlimmer. Candace hätte mich, die widerstrebende Modeberichterstatterin des Charlotte Commercial Appeal, zu Gott weiß welchen gesellschaftlichen Ereignissen schicken können, und ich wäre genötigt gewesen, mit lächelndem Gesicht darüber zu schreiben. Andernfalls hätte ich in meiner Jahresbeurteilung Entsprechendes zu lesen bekommen.
Candace hatte ausnahmsweise mal an was anderes als an mich und Rocklängen gedacht. Dem Himmel sei für kleine Wunder Dank!
Dieses kleine Wunder war in Gestalt einer Seite der New York Times Book Review dahergekommen. Nach 343 Wochen auf der Bestsellerliste und einer erfolgreichen Verfilmung hatte Der Pferdeflüsterer endlich auch Candaces Aufmerksamkeit erregt und sie mich daraufhin gestern zu sich beordert. Auf der Bestsellerliste in ihrer Hand sah ich den Buchtitel rot angestrichen.
«Nattie», sagte Candace, «über dieses Buch wird viel gesprochen und jetzt der Film! Kennen Sie’s?»
Ich schüttelte den Kopf. Ich wollte den Teil nicht lesen, wo ein Pferd in einem Transporter zerquetscht wird, und meine Freunde, die das Buch gelesen hatten, meinten, es sei so, als müsste man einen ganzen Tag in einem Laden mit Hallmark-Glückwunschkarten verbringen.
«Macht nichts», sagte sie. «Schauen Sie sich mal an, worum es geht. Es ist ungemein erfolgreich, die Leute lesen es. Müssen sich doch fragen, ob es hier nicht auch Pferdeflüsterer gibt. Lassen Sie uns das mal rausfinden. Wir bringen es am Sonntag.»
Nach vielen Jahren Therapie und einem mein Schlappmaul betreffenden Handel mit Gott gelang es mir allmählich, meine Zunge und mein Temperament im Zaum zu halten. Statt darauf hinzuweisen, dass sie mich hatte abblitzen lassen, als ich vor drei Jahren eine solche Scheißstory vorschlug, sagte ich: «Candace, das ist wirklich eine großartige Idee. Ich werde noch heute jemanden suchen.»
Sie versah den roten Kringel um Der Pferdeflüsterer mit einem Häkchen und ich war entlassen. Als ich schon an der Tür war, sagte Candace noch: «Nattie, die Liste der Fragen e-maile ich Ihnen noch, wenn ich mit den Teamleitern gesprochen habe.»
Ich packte den Türknauf und stellte mir dabei vor, es sei ihr Schädel. Teamleiter, ging es noch bescheuerter? Aber dann dachte ich daran, wer inzwischen beim Charlotte Commercial Appeal das Sagen hatte, nämlich die Oberbosse der Kette, deren Zentrale sich in Miami befand. Die Sache mit den Teams stammte direkt von ihnen und bildete die Grundlage der jüngsten Umstrukturierung, der dritten in ebenso vielen Jahren. Sicher war es ein Ergebnis ihrer pausenlosen Leserbefragungen, dass sie all die alten Abteilungsnamen wie «Reportage», «Sport» oder «Lokales» ausgelöscht und durch alberne Bezeichnungen wie «Wie-wir-leben-Team», «Ran-an-die-Zukunft-Team» und «Tu-das-nicht-Team» ersetzt hatten.
Nach dieser letzten Inkarnation waren auch die Redakteure des Commercial Appeal keine Redakteure mehr, sondern Teamleiter. Und jetzt kamen alle Teamleiter und deren Teamleiter täglich zusammen, um «Richtlinien für alle geplanten Storys zu skizzieren». Das bedeutete, dass die jeweilige Geschichte von den Redakteuren, Verzeihung: den Teamleitern, die noch nie in ihrem Leben eine Story geschrieben, geschweige denn erarbeitet hatten, bereits geplant, geschrieben und redigiert worden war, ehe sich der Reporter daran hatte versuchen können.
Ich knirschte mit den Zähnen. «Prima», sagte ich. «Ich kann’s gar nicht abwarten zu erfahren, was ich fragen soll.»
Candace sah mich argwöhnisch an. Ich wusste, dass sie mich nicht wegen Sarkasmus nageln konnte. Ich hatte meiner Stimme alle Schärfe genommen. Meine Freundin Mickey-Turner Burnett, für die Buchrezensionen zuständig, hatte mir mal Unterricht gegeben und mich gelehrt, durch die wilden Redaktionsgewässer des Commercial Appeal hindurchzukommen, ohne den Haien, sprich: den Teamleitern, zum Opfer zu fallen.
Mickey-Turner, die in Sewing Circle, Georgia, aufgewachsen war, hat mich dazu gebracht, meine Ansichten über die Frau des Südens zu überdenken. «Bloß weil wir langsam sprechen und viel lächeln, meinen die Leute, wir seien doof», hatte sie in der ersten Unterrichtsstunde gesagt. Doof wie der Kerl, der Microsoft gegründet hat – das war mir klar geworden, als ich sie in Aktion sah. Mickey-Turner schreibt genau die Storys, die sie schreiben will, und auch so, wie sie es für richtig hält. Während wir andern von den Teamleitern gegängelt werden, fasst man sie mit Samthandschuhen an.
Ich lächelte mein schönstes Mickey-Turner-Lächeln und wünschte dabei, es würde ein Blitz vom Himmel herabfahren und alle Teamleiter zerschmettern. Dann verließ ich Candaces Büro.
3
Es brauchte nicht lange, um ein Interview mit einem lokalen Pferdeflüsterer zu arrangieren. Wie ich Candace schon vor drei Jahren gesagt hatte, ist das Sprechen mit Tieren ein wachsendes – und augenblicklich von zu viel Medienrummel begleitetes – Geschäft. Gott bewahre, dass wir vom Commercial Appeal, der größten Zeitung beider Carolinas, uns auf gefährliche journalistische Abenteuer einlassen und über etwas schreiben, von dem der Rest der Welt vielleicht noch gar nichts gehört hat.
Alle Pferdezeitschriften, die ich kenne, haben schon einen Artikel über die Tierkommunikatoren gebracht. So nennen sich diese Leute, die Ihrem Pferd für jede Summe zwischen dreißig und fünfhundert Dollar all die Fragen stellen, die Sie sich schon immer selbst stellen wollten. Wo die Antworten herkommen, ist eine ganz andere Frage. Für mich eine noch ungeklärte. Ein Teil von mir möchte glauben, dass jemand, der diese Gabe hat, zu eruieren vermag, was im Kopf eines Pferdes vor sich geht, aber der größere Teil von mir sagt: «Bleib auf dem Teppich, Nattie.»
Ich wusste genau, wen ich anrufen musste. Sarah Jane Lowell. Ich hatte sie vor ein paar Monaten in dem Stall kennen gelernt, in dem ich mein Pferd stehen habe. Sie «sprach» dort mit einem schmollenden Wallach namens Rip Tide, dessen Besitzerin um jeden Preis im Herbst an den großen Hallenturnieren teilnehmen will. Zum Unglück für sie will das jeder, der über das nötige Kleingeld verfügt – und davon gibt es unglaublicherweise genug. Überall im Land lassen Scharen von Bewerbern fünf- oder zehntausend Dollar pro Monat springen und ziehen von einem Turnier zum andern, um die begehrten Schleifen und Punkte zu erringen, welche sie für das große Finale qualifizieren – das Washington International, das Pennsylvania, das National.
Rip Tide war nicht immer so widerspenstig gewesen. Aber dann hatte er aus irgendeinem Grund nicht mehr über den Parcours gehen wollen, ohne die Ohren angewidert nach hinten zu stellen und vor den Hindernissen voll auf die Bremse zu steigen. Die Besitzerin musste zigtausend Dollar ausgegeben haben, um jedes einzelne Körperteil des Gauls genauestens untersuchen zu lassen. Als sich die Tierärzte schließlich geschlagen gegeben hatten, hatte meine beste Freundin Gail, Stallmeisterin der February Farm, die Besitzerin gefragt, ob sie die Zone des Zwielichts betreten und eine Frau kontaktieren wolle, die behaupte, mit Pferden sprechen zu können.
«Was habe ich schon zu verlieren?», hatte die Besitzerin gefragt. Und Gail hatte geantwortet: «Ungefähr hundert Dollar. Aber eine Freundin von mir glaubt, sie sei Dr. Dolittle. Das Pferd dieser Frau hat ihr angeblich mal von einer uralten Hufverletzung erzählt, die ihm noch immer zu schaffen mache, und siehe da, der Tierarzt hat sie beim Röntgen exakt an der vom Pferd genannten Stelle gefunden.»
So war also Sarah Jane gekommen und hatte mit Rip Tide gesprochen. Und hier ist, was der Wallach – unter anderem – zu sagen gehabt hatte: «Ich mag nicht an Turnieren teilnehmen. Ich habe dort das Gefühl, andauernd beurteilt zu werden.»
Auch wenn ich wünschte, so etwas wäre möglich, musste ich doch, als ich diese Geschichte hörte, in meine Box abtauchen, um nicht vor Gail in schallendes Gelächter auszubrechen.
Mein Vater dagegen, der den Gedanken an sprechende Pferde so natürlich findet wie den an Aliens, die Stonehenge besuchen, hatte nicht die geringsten Zweifel. Unabhängig davon, dass Sarah Jane all das verkörperte, worauf er immer scharf gewesen war, bevor er sich vom Sex losgesagt und zum Brahmanen gewandelt hatte. Sarah Jane war eine erwachsen gewordene Heidi – blondes, an Glasgespinst erinnerndes Haar, starke, durchsetzungsfähige Gliedmaßen und strahlend blaue Augen. Sie war nicht groß und schlank wie die meisten blonden Reiterinnen, sondern maß nur einsfünfundsechzig, und ihr Körper sah so aus, als könnte sie den ganzen Tag lang schwer auf dem Acker arbeiten, ohne je ins Schwitzen zu geraten. Kurz, sie sah gut aus und hatte zudem eine unheimliche Ähnlichkeit mit Lous zweiter Frau Hilde, der Tochter eines Nazis.
Lou hatte tatsächlich mal eine Frau geheiratet, die meine Schwester hätte sein können und deren Vater in ebenjenem Krieg gefallen war, in dem auch der meine gekämpft hatte. Unglücklicherweise hatte mein zukünftiger Schwiegervater auf jener Seite gestanden, welche auf die Vernichtung meiner Rasse und Religion aus gewesen war. Nun ja, diese Ehe konnte getrost den leicht verderblichen Waren zugeordnet werden – ihr Regalleben war kürzer als das einer Dose Tomaten im Supermarkt.
Nicht dass Lou auf die nämliche Art und Weise hinter Sarah Jane her gewesen wäre – oder sie hinter ihm. Sie war schließlich dreißig und mehr Jährchen jünger als Lou. Aber sie waren an dem Tag Freunde geworden, an dem ich Lou mit zum Stall genommen und er sie dort in Aktion gesehen hatte. Seitdem waren sie fast unzertrennlich und gingen zusammen zu Sai-Baba-Treffen, Engelsversammlungen, Botschaftskreisen, planetarischen Heilungen, in Schwitzhütten und Ähnliches. Sie kam regelmäßig zu uns zum Essen und betete über jedem Happen Tofu, der in ihren Mund wanderte. Es wurde so viel über weißes Licht, gute Energie und göttliche Wege geredet, dass ich immer versucht war, die beiden zu schütteln und dazu zu zwingen, alle Flüche herauszuschreien, die sie kannten.
Auch auf die Gefahr hin, zynisch zu erscheinen: Sarah Jane hatte Lou bislang noch nie wegen Knete angehauen. Sie schien tatsächlich so zu sein, wie sie war. Allerdings bin ich nicht für meine Fähigkeiten auf dem Gebiet der Menschenbeurteilung berühmt. Das kann im Nachrichtengeschäft, wo man tagein, tagaus mit professionellen Lügnern zu tun hat, sehr von Nachteil sein. Aber deshalb schreibe ich ja auch nicht über Politik.
Wenn ich nicht gerade an die Modeberichterstattung gekettet bin, schreibe ich Reportagen, das heißt Storys, die den Leuten meist weniger Grund zum Lügen geben. Was nicht bedeutet, dass ich nicht schon ein paarmal böse reingefallen wäre. Wie auch mein Vater. Dieses Glauben an das, was die Leute sagen, muss genetisch bedingt sein.
«Nattie», hatte Sarah Jane gemeint, als ich sie gestern anrief, «ich habe grad an dich gedacht. Mein Engel muss in deinen verknallt sein und hat ihn am Ohr gekitzelt, damit du mich anrufst. Wie geht’s deinem süßen Pferdchen? Willst du, dass ich ihm mal ein paar Fragen stelle?»
Das hatten wir schon durchexerziert. Sarah Jane zufolge liebte mein Pferd mich und sein eigenes Leben, würde aber lieber Annie als Brenda Starr heißen. Und sie mochte meinen Trainer Rob nicht, mochte ihn ganz und gar nicht, wenn er sich darüber erregte, wie schmutzig sie war. Und nein, sie war nicht der Meinung, ich sei zu fett, um von ihr herumgetragen zu werden.
«Diesmal nicht», sagte ich und erklärte ihr, worüber ich schreiben wollte und dass ich deshalb gern ein bisschen mit ihr umherziehen würde.
Für gewöhnlich stürzen sich die Leute auf jede Gelegenheit, zu ihrer Fünfzehn-Minuten-Berühmtheit zu kommen. Bei Sarah Jane war das anders. Sie lehnte zunächst einmal glattweg ab.
«Nimm’s nicht persönlich, Nattie», hatte sie gesagt, «aber die Mainstreamblätter bringen immer alles so, dass Leute wie ich als totale Spinner dastehen. Entweder wird man falsch zitiert oder sie nehmen einen durch eine dieser komischen Fischaugenlinsen auf. Tut mir Leid, aber danke, nein.»
Ich habe mich nicht umsonst dieser Art von Arbeit zugewandt. Ich bin nämlich einigermaßen beharrlich. Nachdem ich fünf Minuten lang geschworen hatte, alle Zitate korrekt zu bringen, die Story nicht aufzubauschen und die Linse des Fotografen zu überprüfen, stimmte sie endlich zu.
«Du hast mich kleingekriegt, Nattie. Ja, okay, aber hör auf, mich zu bitten», hatte Sarah Jane gesagt. «Morgen Vormittag habe ich drei Klienten auf der Anyday Farm in Weddington. Wie sieht’s aus?»
«Ist das die von Fuzzy McMahon? An der Bundesstraße 16?»
Tote Luft füllte das Telefon, und ich dachte schon, sie wäre mir abhanden gekommen. «Sarah Jane, bist du noch dran?»
Nach einer Sekunde sagte sie: «Ich bin noch da.» Aber ihre Stimme klang jetzt anders – unruhig oder verängstigt oder so.
«Ist alles in Ordnung, Sarah Jane?»
Wieder eine Pause.
«Sarah Jane?»
«Oh, tut mir Leid, Nattie, war in Gedanken kurz abwesend. Tut mir wirklich Leid. In irgendwas, was ich gestern gegessen hab, müssen Eier drin gewesen sein, das bekommt mir nie. Stimmt, es ist die McMahonsche Farm. Ich müsste so gegen zehn dort sein.»
«Dann bis dann», sagte ich. Eier machten Sarah Jane zu schaffen? Mir war eher so, als hätte sie die Erwähnung Fuzzy McMahons und nicht der Verzehr unidentifizierter Nebenprodukte eines Huhns geistig wegtreten lassen.
4
Ein Interview um zehn – deshalb war ich an diesem Morgen nicht in die Redaktion geeilt! Nach meiner Schätzung würde meine Verabredung mit Sarah Jane etwa drei oder vier Stunden in Anspruch nehmen. Candace wollte die Story am Sonntag bringen, deshalb musste ich sie morgen Vormittag fertig haben, was auf eine lange Nacht an meinem Computer beim Commercial Appeal hinauslief.
«Lou», brüllte ich ins Wohnzimmer, «ich fahre in fünf Minuten! Wenn du mit willst, ziehst du dich besser mal an.»
In meiner Familie war die Rollenverteilung zwischen Eltern und Kindern schon immer etwas unklar gewesen.
Es dauerte fünfundzwanzig Minuten, bis wir endlich loskamen. Erst konnten wir seine Schuhe, dann sein Hörgerät nicht finden. Als er fragte, ob ich wisse, wo seine Brille sei, rauschte ich aus der Tür.
«Ich fahre, Lou», schrie ich, weil er sein Hörgerät nie finden konnte. «Ich habe um zehn ein Interview und verspäte mich nicht, bloß weil du deinen Kopf nicht finden kannst.»
Er kam die Treppe heruntergehetzt und stieg zu mir ins Auto, wo ich ihm seine Brille reichte – gefunden unter dem Beifahrersitz, neben zwei versteinerten Möhren.
Obwohl ich Tag für Tag dieselbe Strecke zum Stall hinausfahre, verblüfft mich die Entwicklung entlang der Bundesstraße 16 noch immer. Ich weiß, dass ich mich allmählich wie einer dieser verknöcherten alten Knacker anhöre, deren Stimmen zittern, wenn sie sagen: «Ja, ja, ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als der Liter Benzin vierzig Pfennig gekostet hat.» Aber ich kann mich tatsächlich noch an die Zeiten erinnern, als da draußen nichts als endlose Baumwollfelder waren und man lange Strecken atemlos dahingaloppieren konnte, um sich dann auf langsamen, leichten Wegen wieder abzukühlen. Heute galoppieren dort nur noch unzählige Kinder, die dicht bei dicht in den Neubaugebieten hausen, auf ihren Holzpferdchen umher.
Während der Fahrt versuchte mein Vater mich dazu zu überreden, am Abend mit ihm und Sarah Jane zu einem berühmten Prediger zu gehen, der Botschaften des Erzengels Michael empfing und weiterleitete. Wenn ich die Story nicht hätte schreiben müssen, hätte ich Ja gesagt. Aber es fehlte die Zeit.
Mein Vater redete und redete über diesen Prediger, redete ohne Punkt und Komma und zu laut, weil er sein Hörgerät nicht finden und folglich sich selbst nicht hören konnte. Es war so nervig, dass ich die Abzweigung zur Anyday Farm verpasste.
«Lou», sagte ich, nach einer Wendemöglichkeit Ausschau haltend, «wie wär’s mit einem Abkommen? Du bist mal ruhig und ich bringe uns lebendig hin?»
«Klar, Nat, nur noch eins –»
Meine flache Hand durchschnitt die Luft, und ich warf ihm DEN Blick zu. Endlich war er still. Ich fand eine Einfahrt, wendete und fuhr auf der Bundesstraße 16 zurück – diesmal sah ich das grün-weiße Schild, das zur ANYDAY FARM wies.
Den Eingang bildete ein langes, graues Band aus knirschendem Kies. Zu beiden Seiten standen Birnbäume in der herrlichen Pracht ihrer Blüte. Als ob ich einen weiteren Hinweis darauf nötig gehabt hätte, dass ich schon zu lange auf der Modeschiene saß, fiel mir dabei als erstes der gepunktete Stoff Schweizer Ursprungs ein, in den Geoffrey Beanes Models, die die Frühjahrs- und Sommerkollektion vorführten, gehüllt waren.
Die Auffahrt gabelte sich an ihrem Ende, und hier wies ein Schild zum Stall, das andere zum Haus. Wir fuhren nach rechts zum Stall, einem Pferdepalast, der in der Reiterwelt allgemein als Ashlee-ville bekannt war – Ashlee war Fuzzy McMahons Tochter, die Königin der im Springsport aktiven Kinder und Junioren. Ihre Mutter steht praktisch immer beim Zugang zu den Turnierplätzen und stellt für alle Pferde, die mit einer blauen Schleife herauskommen, einen Scheck aus.
Ich war schon ein paarmal zu Pferdeschauen hier gewesen – es war einfach ein phantastischer Stall. Die Gänge zwischen den Boxen wären weit genug für eine Revuenummer gewesen, die Boxen waren knietief mit frischen Holzspänen gefüllt, und vor ihnen hingen blank polierte, messingne Sattelhalter und dazu passende Kästen für Putz- und Sattelzeug. Das alles zeigte die Farben des Stalls – Grün und Weiß – sowie sein Logo. In der Sattelkammer gab es eine Wasch- und Trockenanlage und dazu genug Sattelhalter, weshalb niemand je auf einen freien zu warten brauchte. Die klimatisierte Lounge für die Reiter und Reiterinnen war mit einem bequemen, gestreiften Sofa, dazu passenden Klubsesseln, Fernsehen, Video, Nebenräumen mit Dusche, Toilette, Herd, Spüle und Kühlschrank versehen.
Ich hätte auch ohne Wandleuchter und die entsprechenden Lüster auskommen können, aber die stadiongroße Reithalle wäre mir an all den furchtbaren, eiskalten Wintertagen, an denen Rob darauf bestand, dass ich ritt (oder andernfalls die Turnierreiterei ein für alle Mal vergaß), schon recht gewesen.
Geld, Geld, Geld, rief die ganze Anlage. Und warum auch nicht? Fuzzy McMahon, geborene Feldman (die Feldmans, denen die Family Value Stores gehörten), stammte schließlich aus einem sehr betuchten Haus (offensichtlich kamen die Family Value Stores, was den Gewinn anging, gleich nach Wal-Mart).