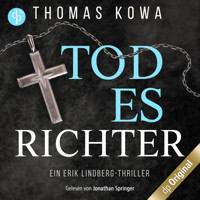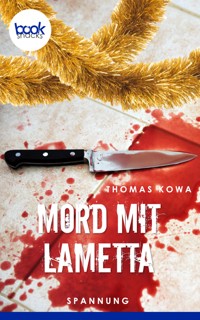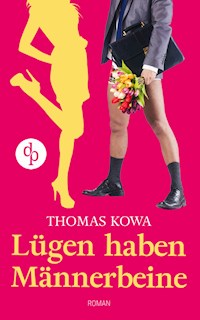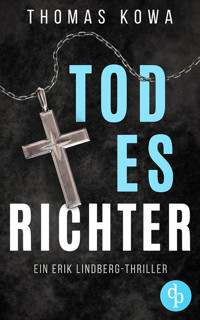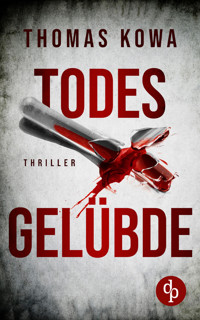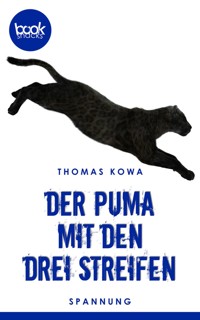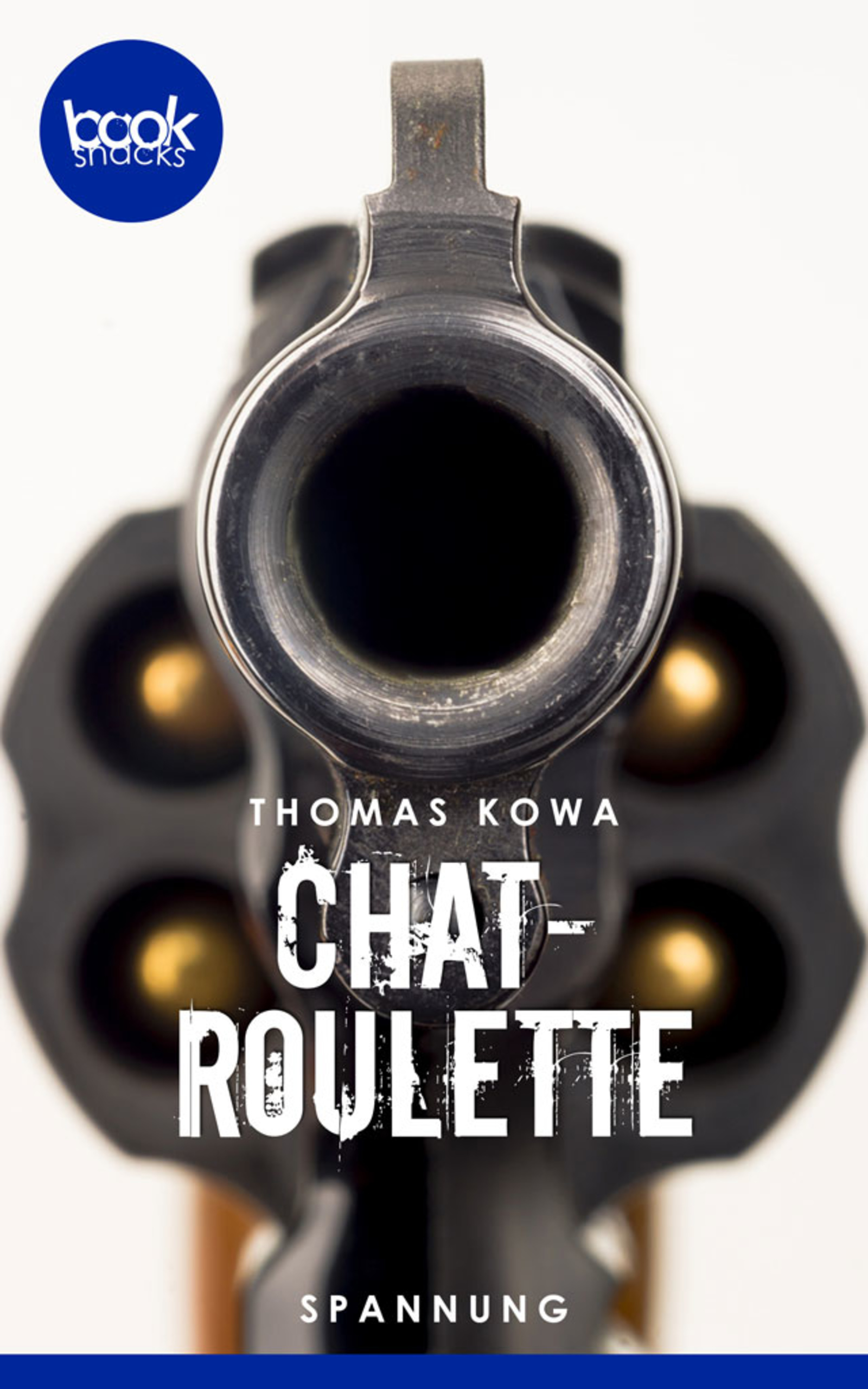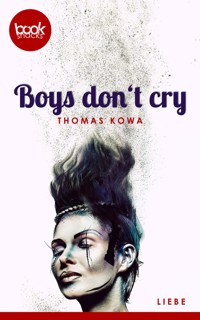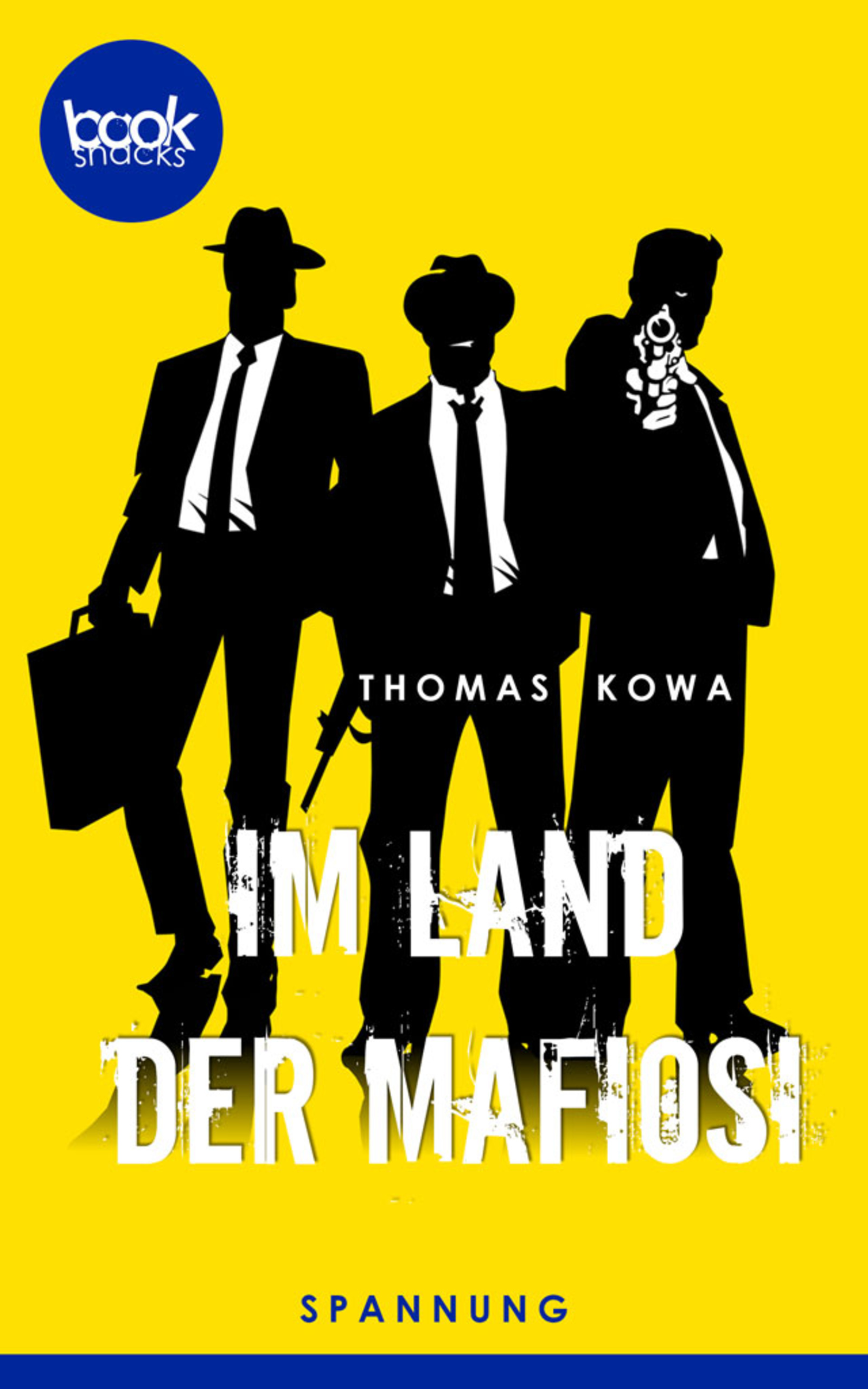5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Erik Lindberg-Thriller
- Sprache: Deutsch
Ein revolutionäres Medikament und ein Killer, der vor nichts zurückschreckt …
Der fesselnde Auftakt zur Ein Erik Lindberg Thriller-Reihe
Kommissar Erik Lindberg versucht sich noch von seinem letzten traumatischen Fall zu erholen, bei dem seine Freundin Paula so schwer verletzt wurde, dass sie seither im Koma liegt. Doch der Ermittlungsalltag kennt keine Pause. Der brutale Mord am ehemaligen CEO des Pharmakonzerns GENEKOV wirft zu viele Fragen auf. Bekannt war das Unternehmen vor allem für das revolutionäre, aber umstrittene Schlafmedikament „Remexan“, das den Schlafbedarf auf eine Stunde verkürzt. Auf der Suche nach Ablenkung vertieft Lindberg sich in die Ermittlungen. Zunächst führen die Spuren zu militanten Tierschützern, doch als eine weitere Leiche auftaucht, wird deutlich, dass die Verwicklungen weit tiefer reichen als angenommen. Der Druck im privaten als auch im beruflichen Umfeld wird immer stärker, sodass Lindberg keinen anderen Ausweg mehr sieht: Er muss das Medikament selbst nehmen, um den Täter noch rechtzeitig zu stoppen …
Dies ist eine Neuausgabe des bereits erschienenen Titels Seelenschlaf.
Erste Leser:innenstimmen
„Abgründiger Thriller, der einem wortwörtlich den Schlaf raubt!“
„Ein Pharma-Thriller, den ich nicht mehr aus der Hand legen konnte.“
„Düster und stimmungsvoll geschrieben!“
„Faszinierender Psychothriller mit Tiefgang.“
„Fans von Medizin-Thrillern sollten hier unbedingt zugreifen und sich fesseln lassen.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kurz vorab
Willkommen zu deinem nächsten großen Leseabenteuer!
Wir freuen uns, dass du dieses Buch ausgewählt hast und hoffen, dass es dich auf eine wunderbare Reise mitnimmt.
Hast du Lust auf mehr? Trage dich in unseren Newsletter ein, um Updates zu neuen Veröffentlichungen und GRATIS Kindle-Angeboten zu erhalten!
[Klicke hier, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!]
Über dieses E-Book
Kommissar Erik Lindberg versucht sich noch von seinem letzten traumatischen Fall zu erholen, bei dem seine Freundin Paula so schwer verletzt wurde, dass sie seither im Koma liegt. Doch der Ermittlungsalltag kennt keine Pause. Der brutale Mord am ehemaligen CEO des Pharmakonzerns GENEKOV wirft zu viele Fragen auf. Bekannt war das Unternehmen vor allem für das revolutionäre, aber umstrittene Schlafmedikament „Remexan“, das den Schlafbedarf auf eine Stunde verkürzt. Auf der Suche nach Ablenkung vertieft Lindberg sich in die Ermittlungen. Zunächst führen die Spuren zu militanten Tierschützern, doch als eine weitere Leiche auftaucht, wird deutlich, dass die Verwicklungen weit tiefer reichen als angenommen. Der Druck im privaten als auch im beruflichen Umfeld wird immer stärker, sodass Lindberg keinen anderen Ausweg mehr sieht: Er muss das Medikament selbst nehmen, um den Täter noch rechtzeitig zu stoppen …
Dies ist eine Neuausgabe des bereits erschienenen Titels Seelenschlaf.
Impressum
Überarbeitete Neuausgabe April 2024
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-98778-890-1 Hörbuch-ISBN: 978-3-98778-815-4 Taschenbuch-ISBN: 978-3-98778-864-2
Dies ist eine Neuausgabe des bereits 2021 beim dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH erschienenen Titels Seelenschlaf (ISBN: 978-3-96817-825-7).
Dies ist eine Neuausgabe des bereits 2019 beim dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH erschienenen Titels Schlafe tief (ISBN: 978-3-96087-567-3).
Copyright © 2016, dp DIGITAL PUBLISHERS Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2016 bei dp DIGITAL PUBLISHERS erschienenen Titels Remexan – Der Mann ohne Schlaf (ISBN: 978-3-94529-880-0).
Covergestaltung: Nadine Most unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © Vasilius, © MD SAJJAD MOLLAH Lektorat: Daniela Höhne
E-Book-Version 16.04.2025, 00:13:14.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Tödlicher Schlaf
Jetzt auch als Hörbuch verfügbar!
Ein revolutionäres Medikament und ein Killer, der vor nichts zurückschreckt … Der fesselnde Auftakt zur Ein Erik Lindberg Thriller-Reihe
Vorwort
Von einer Katze sagt man, sie habe sieben Leben und dieser Roman hatte ebenso viele. Es war der erste, den ich überhaupt geschrieben habe und so hat er gleichzeitig mich als Autoren zum Leben erweckt.
Alles begann, als ich im Jahr 2004 von dem Medikament Remexan geträumt habe und daraufhin angefangen habe, diese Idee als Thriller niederzuschreiben. Ohne Ahnung, wie das eigentlich geht. So war die erste Version des Buches von 2005 weit von der entfernt, die später veröffentlicht wurde. Und das nicht nur, weil ich damals alle handwerklichen Fehler darin vereint habe, die man als beginnender Autor machen kann.
Nach mehreren Seminaren hatte ich dann den Roman so weit, dass die gröbsten Fehler beseitigt waren. Das war sein zweites Leben, doch einen Verlag konnte ich immer noch nicht dafür begeistern. 2012 hatte ich meinen Debütroman „Das letzte Sakrament“ bei Lübbe veröffentlicht, ein Vatikanthriller, der kürzlich in überarbeitetet Form unter dem Titel „Todesgelübde“ erneut erschienen ist. Als der Verlagsvertrag unterschrieben war, habe ich mir noch einmal „Remexan“ vorgenommen und den Roman so überarbeitet, dass er die Fortsetzung von „Das letzte Sakrament“ hätte sein können. Doch Lübbe wollte erneut einen Vatikanthriller von mir, also war das dritte Leben aufgebraucht, erneut ohne Veröffentlichung.
Ich las viele Romane, ging weiter auf Seminare, entwickelte die Hauptcharaktere neu, und weil andere Charaktere nach einer anderen Story verlangen, schrieb ich fast alles neu. Endlich fand ich mit dem dp Verlag einen Herausgeber, der von dem Roman so begeistert war wie ich. Um ehrlich zu sein, war das Buch jetzt erst reif für eine Veröffentlichung. 2016 erschien dann mein eigentlicher Debütroman unter dem Titel „Remexan“, das vierte und endlich ein echtes Leben.
Es kamen mit „Redux“ und „Reaktor“ zwei weitere Romane hinzu und die Erik-Lindberg-Trilogie entstand. Nun fand der Roman zwar begeisterte Leser, aber weil „Remexan“ als Titel zu technisch war, wurde er 2019 unter dem Titel „Schlafe tief“ erneut veröffentlicht. Das war das fünfte Leben und weil auch das gut verlief, wurde die Erik-Lindberg-Trilogie lizenziert und als Hörbuch herausgebracht, was mit der Zeit sehr erfolgreich wurde. Allein bei Spotify kam die Serie auf über 12 Millionen Streams der einzelnen Hörbuchtracks.
2021 begann dann das sechste Leben von „Remexan“. Dieses Mal unter dem Titel „Seelenschlaf“, weil mein Verlag fand, man könne das Werk durchaus noch einmal beleben, schließlich sei der Stoff zeitgemäßer denn je.
Und nun beginnt wohl das letzte Leben. Denn 2024 erscheint der Roman erneut, als Taschenbuch, E-Book und mit einem wirklich gelungenen neu vertonten Hörbuch – genau 20 Jahre nach der ursprünglichen Idee zu „Remexan“ als „Tödlicher Schlaf“.
Manchmal muss man vielleicht einfach nur einen langen Atem haben …
Und nun viel Spannung und auch Spaß beim Lesen oder Hören.
Thomas Kowa
Remexan®
<Kunstwort> das, –s, Warenzeichen der Firma GENEKNOV. Personalisiertes Psychopharmakon zur künstlichen Schlafverkürzung. Durch Einnahme des Arzneimittels wird die durchschnittliche Schlafdauer von acht Stunden auf ca. 60 Minuten reduziert.
1
Noch war Leben in ihr. Still lag sie da, ihre Augen geschlossen, ihr Körper regungslos, nur der Brustkorb senkte und hob sich mechanisch.
Doch sie schlief nicht.
Erik Lindberg beugte sich über sie, ging ganz nah an ihre Lippen heran, aber er spürte ihren Atem nicht.
Mechanisches Surren erfüllte den Raum. Lindberg hasste dieses Geräusch. Obwohl die Ärzte sagten, dass die Apparate, die es verursachten, lebensnotwendig waren. Dabei konservierten sie das Leben nur, bis es gleich dem Sterben war.
Im Karton, den er mitgebracht hatte, maunzte es. Lindberg sprach ein paar beruhigende Worte und schob ein Leckerli hinein.
Paula hatte ihm immer gesagt, dass sie lieber tot wäre, als an einer Maschine angeschlossen.
Doch das sagte sich leicht, wenn man jung und gesund war. Moralisieren war immer einfach, wenn es um Fragen ging, die einen gar nicht betrafen.
Er hatte Paula sogar versprechen müssen, nie zuzulassen, dass ihr Leben an Geräten hing. Auch für ihn war das damals nur eine hypothetische Frage gewesen.
Bis es wirklich geschehen war. Bis der Arzt ihm nur mit seinem Blick mehr über die Diagnose gesagt hatte, als mit allen Worten, die folgten.
Dieser verzweifelte Blick, den kannte Lindberg gut genug. Wenn er vor den Angehörigen stehen und ihnen die bittere Nachricht überbringen musste. Er hatte geglaubt, er wüsste, wie es sich auf der anderen Seite anfühlte.
Erik Lindberg strich sich durch das schwarze Haar. Er musste eine Entscheidung treffen. Hätte Paula eine Patientenverfügung gemacht, wäre ihm diese Last abgenommen worden. Doch sie hatte sich auf ihn verlassen wollen, nicht auf den Staat oder die Ärzte. Vielleicht hatte Paula aber auch der eigenen Entscheidung nicht getraut und sie daher ihm in die Hand gelegt.
Zärtlich streichelte er Paulas Gesicht, jedenfalls soweit es diese verdammte Beatmungsmaske zuließ. Manchmal kam es ihm vor, als sauge dieses hässliche Ding aus Plastik alle Kraft aus ihr, so ausgemergelt wie Paula inzwischen dalag. Wie ein Parasit hatte die Maske sich ausgebreitet, bedeckte Nase wie Mund und hielt Wache, sodass er ihr nicht mal einen Kuss geben konnte.
Nichts von dem war geblieben, was das Leben für sie lebenswert gemacht hatte.
Alle Versuche, sie zurückzuholen, waren gescheitert. Die Blicke der Ärzte waren zwar routinierter geworden, aber nicht zuversichtlicher.
In der Charité in Berlin hatte man ihr das Etikett austherapiert verpasst – nach nur vier Monaten.
Also hatte er Paula in ihre alte Heimat nach Basel verlegen lassen, in der Hoffnung, dass es dort besser wurde.
Doch es hatte sich nur die Klinik geändert und der Dialekt der Pflegerinnen.
Die Ärzte hatten alles versucht. Und er ebenso. Jeden Tag eine andere Idee. Begonnen hatte er damals mit ihrem Lieblingssong, Enjoy the Silence von Depeche Mode, den er ihr mittels iPod auf Ohrhörern vorgespielt hatte, verschiedene Filme waren gefolgt, er hatte die Straße vor ihrem Haus aufgenommen, die Durchsage in dem Zug, mit dem sie immer gependelt war, vor einer Woche hatte er sogar einen Meister für chinesische Akupunktur ins Krankenhaus gebracht, doch Paula hatte jedes Mal dagelegen wie schon gestorben.
Einmal hatte er in Berlin trotz des ausdrücklichen Verbots sogar versucht, Dr. Watson, Paulas Kater, in einer mit Löchern versehenen Kartonbox ins Krankenhaus zu schmuggeln.
Natürlich war er erwischt worden, bevor er Paulas Zimmer überhaupt erreicht hatte.
In der Basler Klinik waren Tiere auch verboten, doch er hatte dazugelernt und die Kartonbox mit dünner Seide umwickelt, als sei es ein Geschenk. Außerdem hatte es einige Übungseinheiten und noch mehr Leckerli gebraucht, bis Dr. Watson sich im Karton endlich still verhielt.
Die Schwester sollte erst in einer halben Stunde wieder auf Visite in Paulas Zimmer kommen, also löste Lindberg das Seidentuch und lupfte den Kartondeckel, begleitet vom leisen Scharren Dr. Watsons.
Der Kater steckte neugierig sein schwarzes Köpfchen aus dem Karton, sprang heraus, ignorierte das Leckerli in Lindbergs Hand, lief über die Bettdecke auf sein Frauchen zu und schleckte ihr die Backen ab.
Paula reagierte nicht.
Dr. Watson stupste sie am Ohr, blickte zu Lindberg, rieb sich an ihrem Kinn und stieg dann über Paula, um sich in ihre Armbeuge zu legen.
Lindberg packte Paulas Hand und streichelte sie, eine Träne fiel auf ihren Oberarm. Er hatte Paula von Anfang an geliebt, abgöttisch, sie waren erst zwei Jahre zusammen gewesen, doch er hatte nie daran gezweifelt, dass sie heiraten würden, Kinder bekommen und irgendwann Enkel.
Er war sich so sicher gewesen.
Doch das Leben hielt sich nicht an Pläne. Jedenfalls nicht, wenn man Kriminalkommissar war. Der Mann, der ihr das angetan hatte, saß im Gefängnis, das wenigstens hatte Lindberg erreicht. Doch das klärte nicht die Schuldfrage, klärte nicht, wie es soweit hatte kommen können.
Musste er seiner Freundin daher nicht wenigstens ihren letzten Wunsch erfüllen?
Erik Lindberg hatte die Entscheidung immer weggedrückt, doch jetzt, während Dr. Watson neben seinem Frauchen lag, spürte Lindberg, dass er nicht länger warten durfte.
Welches Recht nahm er sich heraus, ihren Willen zu ignorieren?
Lindberg hörte vom Flur Schritte. Er flüsterte dem Kater zu, er solle zu ihm kommen, winkte mit dem Leckerli, doch der blieb einfach neben Paula liegen und schien sich mal wieder zu wundern, wie kompliziert die Menschen waren.
Lindberg packte ihn, legte ihn in den Karton, das Leckerli dazu, doch Dr. Watson maunzte trotzdem.
Die Schritte stoppten und schienen sich wieder zu entfernen.
Lindberg kraulte den Kater noch ein wenig, dann schloss er den Karton und wickelte das Seidentuch darum.
Vor Enttäuschung zitternd, strich er mit den Fingern über Paulas Maske und auf einmal wusste er, was sie wollte.
Er schob seine Finger unter die Gummi-Arretierung der Atemmaske und hob sie leicht an.
Das mechanische Atemgeräusch wurde lauter, jetzt, da das Plastik nicht mehr auf das Gesicht drückte. Paula rührte sich nicht und Lindberg hob die Maske stärker an.
Er schob das verhasste Plastikteil nach oben, Zentimeter für Zentimeter.
Und dann sah er mit seinen von Tränen gefüllten Augen, dass die Maske auf dem Kopfkissen lag, doch er fühlte sich, als habe er nichts getan.
Er hörte ein Piepsen, irgendeinen Alarm, doch in seiner Welt war das nur ein Hintergrundgeräusch.
Paula zuckte wie eine Ertrinkende, die keine Luft mehr bekam.
Lindberg wusste, es war nur ein Reflex.
Er strich Paula zur Beruhigung über die Stirn, nahm ihre Hand in die seine, beugte sich über sie und gab ihr einen langen, endlosen Kuss.
2
Nadja Trokovski stand in der Tür und lächelte ein falsches Lächeln, weil es für ihr echtes nicht mehr reichte. Drei fettbäuchige Männer kamen die Treppe hoch, zwei mit Glatze, dafür der dritte mit ungewaschenem Haar. Einer mindestens fünfzig, die anderen nahe dran. Zehn, fünfzehn Jahre älter als sie, einer roch nach Schweiß.
Nadja lächelte trotzdem.
Die jüngeren Freier, die Gepflegten, die Gutaussehenden, die mit Manieren, die Nüchternen, das war alles nicht mehr ihre Klientel. Dabei war sie erst siebenunddreißig, bestes Heiratsalter heutzutage. Doch das Leben hatte seine Spuren hinterlassen.
Die drei Männer scannten mit ihren glubschigen Augen jede Frau, doch ihr schenkten sie nicht mal eine Sekunde.
„Alle viel zu alt“, sagte einer noch, dann gingen sie in die nächste Etage.
Irgendeine Kollegin fluchte auf Rumänisch, die anderen tuschelten miteinander, doch Nadja Trokovski lief schweigend zurück in ihr Zimmer.
Sie öffnete das Fenster und atmete die kalte Luft des Winters. Der Rauch ihrer Zigarette kräuselte sich im Wind und verschwand nach ein paar Umdrehungen in der Dunkelheit. Der Nachthimmel hing voller Wolken und so sehr Nadja auch suchte, sie fand nicht einen Stern.
Früher hatten die Sterne immer für sie geleuchtet. Oder war es ihr nur so vorgekommen, wegen dem Zeug, das sie sich damals durch die Adern geschossen hatte? Wenigstens diese Zeiten waren vorbei. Endgültig.
Sie blickte auf die Gasse vor dem Magico. Der schmutzige Schnee der Stadt lag vor der Tür wie nicht abgeholter Müll. Reste bunten Konfettis erinnerten an die gerade zu Ende gegangene Fasnacht. Nadja atmete tief aus, schnippte die Kippe auf die Gasse und schloss das Fenster.
Fröstelnd zog sie ein Wolljäckchen über ihre Berufsbekleidung, die aus nicht viel mehr als einem schwarzen Tanga, halterlosen Strümpfen und einem BH bestand. Ihre roten High Heels lagen einsam auf dem Parkettboden. Nadja war um jeden Moment froh, in dem sie diese Folterwerkzeuge nicht tragen musste.
Falsche Freunde, abgebrochene Schule, das schnelle Geld, ein Leben ohne Grenzen. Wie hatte sie nur glauben können, es würde immer so weitergehen? Wenn man jung war, wollte man nicht auf das hören, was die Alten sagen, und wenn man alt war, nützte es einem nichts mehr.
Im letzten Monat hatte ihr Geld nicht mal gereicht, um das Zimmer zu zahlen, von der Wohnung ganz zu schweigen. Je verzweifelter sie wurde, desto mehr wandten sich die Freier ab. Klar, die wollten ja auch ihr eigenes Leben für einen Moment vergessen, was sollten sie dann mit den Problemen der anderen?
Also hatte Nadja Trokovski sich selbst um ihre Probleme gekümmert. Obwohl sie aus dieser Zeit nur noch einen Namen kannte, von ihr im Delirium hingekritzelt auf ein Stück Papier.
Aber sie wusste, was geschehen war.
Und mit diesem Wissen würde sie das alles hinter sich lassen.
Sie wollte nichts anderes, als ein stinknormales, stinklangweiliges Leben führen.
Mit ein wenig Luxus.
Nadja Trokovski schob eine rote Haarsträhne aus ihrem Gesicht und schaute auf die Uhr. Zwei Uhr nachts. Die Konkurrenz lichtete sich, also gab sie sich noch eine Stunde, schminkte sich nach, tauschte das Wolljäckchen mit einem durchsichtigen Negligé und zog die High Heels an.
Sie hörte Schritte von unten, ein Mann kam die Treppe hoch, offener Wintermantel, seidig glänzender Anzug, viel zu attraktiv, nicht nur für sie, sondern für den ganzen Laden hier. Und doch ging er mit schnellen Schritten auf sie zu.
Nadja atmete tief ein. „Hallo, Darling“, hauchte sie. „Ficken, Blasen achtzig, von hinten hundert.“
Er reichte ihr zwei Hunderter. „Eine Stunde.“ Er schien es eilig zu haben in ihr Zimmer zu kommen, ging direkt an ihr vorbei. Ihr Blick streifte sein Gesicht. Er kam ihr irgendwie bekannt vor. Hatte sie ihn schon einmal gesehen?
Ein Blick in seine Augen ließ sie den Gedanken vergessen. An diesem Ort war er sicher noch nie gewesen. Sie nahm seine Hand. Es war nicht die Hand eines Arbeiters. Seine Fingernägel waren so akkurat gerundet, als seien sie gefeilt und seine Haut war weich wie nach einem Peeling.
„Hast du Champagner?“, fragte er.
Sie nickte. „Kostet fünfzig.“
Er steckte ihr den Schein zu.
Sie öffnete den Kühlschrank, holte eine Flasche Prosecco heraus, schloss die Tür hinter sich ab, zog den Vorhang zu und startete eine CD mit Chill-out. „Mach ruhig lauter“, sagte er.
Und sie tat es, weil fast alle Frauen schon in den eigenen Betten schliefen. Sie öffnete die Flasche und füllte zwei Gläser. Er nippte nur an dem seinen.
Sie stellte sich vor ihn und er zog sich langsam das Jackett aus. „Tanz!“, befahl er.
Der Unbekannte setzte sich auf das Bett und betrachtete sie; er regte sich kaum, sprach kein weiteres Wort, bis alle Hüllen gefallen waren.
Sie setzte sich neben ihn. „Ich möchte, dass du dir die Augen verbindest und dich auf das Bett setzt“, flüsterte er und ging zum Waschbecken in der anderen Ecke des Zimmers.
„Gerne, mein Darling“, hauchte sie. Nadja band sich einen schwarzen Seidenschal über die Augen und wartete auf das, was kommen würde. So hatte sie sich diesen Beruf früher vorgestellt, hübsch und naiv wie sie gewesen war. Damals, vor zwanzig Jahren.
Doch in Wirklichkeit ging es nur um das alte Rein-Raus-Spiel. Und darum, dass die Männer sich potent und attraktiv fühlen konnten, egal wie beschissen sie aussahen.
Sie hörte seine nahenden Schritte und spürte seine warme Hand in ihrem Nacken. Er streichelte ihren Oberkörper, ihr Gesicht und zog sanft die Binde fester. Nadja legte ihren Kopf zurück und seufzte gespielt lasziv. Etwas Kaltes berührte ihre Lippen. „Trink!“, sagte er.
Der Prosecco prickelte in ihrem Mund, auch wenn er ein wenig bitter schmeckte. Wahrscheinlich hatte die Flasche schon ewig im Kühlschrank gestanden. Der Unbekannte drehte die Musik noch ein wenig lauter, fuhr mit seinen Händen langsam um ihren Hals. Er schien sich Zeit zu lassen. Immerhin besser als die Jungs, die eine Stunde buchten, aber schon nach fünf Minuten fertig waren. Und sie durfte sich dann fünfundfünfzig endlose Minuten abmühen, bis das Ding endlich wieder stand und der Typ kam, oder bis er aufstand und ging.
Sie schob ihren Kopf zur Seite, fast schien es, als würde das Bett sich bewegen, Schwindel überkam sie.
Um sich abzulenken, stellte sie sich vor, sie läge an einem endlosen Strand. Ja, sah sie nicht sogar das blaue Meer in der Sonne glitzern?
Doch es war nicht das Meer, das durch den Stoff des Schals funkelte, sondern scharfes, kaltes hartes Metall.
Brennender Schmerz erfasst sie. Sie versuchte dagegen anzukämpfen, wollte schreien, doch es gelang ihr nicht. Es war, als gleite sie davon, als wäre ein Teil ihres Körpers betäubt. Etwas Warmes, Flüssiges lief ihre nackte Brust entlang. Sie versucht sich damit zu beruhigen, dass es Angstschweiß war.
Doch warum war ihr dann auf einmal so kalt?
Sie konnte nicht einmal ihren Kopf bewegen. Oder die Binde vor ihren Augen. Ihre Hände gehorchten ihr nicht mehr. Obwohl sie nichts sehen konnte, schien sich alles um sie herum zu drehen.
Sollte sie es nicht einfach geschehen lassen?
Nein! Etwas tief in ihr sträubte sich dagegen. Sie wollte sich aufbäumen, um Hilfe rufen, den Unbekannten stoppen! Egal wie!
Doch sie konnte nicht einmal ihren Mund öffnen. Sie hatte die Kontrolle über ihren Körper verloren.
Alles war auf einmal so weit, weit weg.
Ihr Leben. Oder wie immer man das nennen sollte.
Langsam kam die Wärme zurück, erst zögerlich und stockend, doch schließlich durchströmte sie auch die letzte Faser ihres Körpers.
Jetzt sah Nadja auch das glitzernde Meer wieder. Sie stand erneut am Strand, dieses Mal ganz nah am Wasser. Sie blickte in den blauen Horizont, keine Wolke störte die Sonne. Sie spürte, wie die Gischt zwischen ihren Zehen kitzelte und den Sand mitriss. Grelle Lichtpunkte tänzelten auf den Wellen, so hypnotisch, dass sie kaum ihren Blick davon abwenden konnte. Sie ging weiter in das Meer hinein, das warme Wasser umschmeichelte ihre Knöchel.
Der Unbekannte kam aus den Wellen gestiegen, und obwohl er hätte nass sein müssen, strahlte er hell wie die Sonne und trug ein trockenes, weißes Sommergewand. Er strich Nadja durch ihr rotes Haar. „Komm“, flüsterte er.
Erst jetzt erkannte sie ihn. Und auf einmal wusste sie, warum der Prosecco so bitter geschmeckt hatte.
Sie wollte flüchten, drehte sich um, doch sie stand schon zu weit im Meer. Die Wellen, die plötzlich vom Ufer zurückflossen, schlugen ihr ins Gesicht. Die Strömung zerrte an ihr und riss ihre Beine vom Boden. Sie verlor den Halt und fiel nach hinten. In die Arme des Mannes, der inmitten der Brandung stand wie ein Fels. Er lächelte diabolisch und zog sie mit festem Griff näher zu sich.
Nadja bäumte sich noch einmal auf, doch das Wasser schlug an ihr hoch wie loderndes Feuer. Der Mann nahm ihre Hand in die seine und das Meer wurde still. Das Wenige, was in ihr noch lebte, ließ es geschehen.
Dann führte er sie tiefer ins Meer und geleitete sie aus dieser in eine andere Welt.
3
Die Tür zum Zimmer wurde aufgerissen und eine Krankenschwester stürmte an Paulas Bett. „Was soll denn das?!“, rief sie. „Wollen Sie Ihre Freundin umbringen?“
Die Pflegerin schob ihn beiseite, nahm die Maske und setzte sie Paula wieder auf. „Der Chefarzt hat Ihnen doch ausführlich erklärt, dass sie die Maske tragen muss, weil es Probleme mit dem Tubus gab!“
Lindberg blickte sie mit ausdruckslosen Augen an. „Ich wollte sie küssen“, sagte er kraftlos. „Ich dachte, das hilft ihr.“
Die Schwester atmete tief aus. Sie hatte anscheinend jeglichen Sinn für Romantik verloren, jedenfalls wenn es um ihren Beruf ging. „Was Ihrer Freundin hilft, und was nicht, das wissen wir am besten!“
Auch wenn er anderer Meinung war, nickte Lindberg. „Ich muss ohnehin los“, sagte er, blickte noch einmal auf Paula, die so ruhig atmend dalag wie zuvor, dann nahm er den Karton und stand auf.
Die Schwester baute sich vor ihm auf. „Was ist das eigentlich für ein Geschenk?“
Und als habe er die Frage gehört, miaute Dr. Watson.
„Herr Lindberg!“ Die Schwester stemmte ihre Arme in die Hüfte. „Von einem Polizisten kann man doch eigentlich erwarten, dass er die Vorschriften einhält, oder?“
„Es geht um Leben oder Tod, nicht um Vorschriften.“ Er nahm den Karton und ging an ihr vorbei.
„Sie hätten wenigstens mal fragen können.“
„Und was wäre Ihre Antwort gewesen?“
Die Pflegerin kratzte sich an der Nase. „Sie reden nicht viel, oder?“
„In Schweden gelte ich als extrovertiert.“
Sie lächelte. „Also gut, wenn Sie versprechen, dass Sie das nächste Mal fragen, und zwar mich, dann habe ich nichts gesehen.“
Lindberg versprach es, verabschiedete sich, setzte sich in seinen Volvo und fuhr nach Hause.
Er hätte am liebsten mit keiner Menschenseele mehr geredet, sich einfach ins Bett gelegt und auf den Schlaf gewartet.
Doch so lief das nicht. Nicht mehr. Noch bevor Lindberg seine eigene Tür öffnete, ging er zum Nachbarhaus. Wenn er es nicht tat, würde Isabel in fünf Minuten bei ihm klingeln und wissen wollen, wie es gelaufen war. Denn sie kümmerte sich um Dr. Watson, wenn Lindberg im Krankenhaus übernachtete oder auf der Arbeit war.
Isabel war überzeugt gewesen, dass Dr. Watson Paula helfen würde aufzuwachen.
Gerade mal zehn Wochen alt war der Kater gewesen, als Paula ihn aus einem Tierheim geholt hatte. Lindberg wusste es noch genau, es war an ihrem ersten Jahrestag gewesen. „Du, der Kommissar und Watson, der Assistent“, so hatte sie im Scherz begründet, warum der Kater nicht Felix hieß, Blacky oder wenigstens Napoleon. Denn wie der benahm er sich.
Im Grunde kam Dr. Watson nur noch zum Schlafen und Essen nach Hause, die Zärtlichkeiten holte er sich woanders, als wäre er ein Mann in der Midlife-Crisis.
Das Problem war, das sich auch Isabel nach Zärtlichkeiten sehnte, seit ihr Mann vor zwei Jahren bei einem Tauchunfall ums Leben gekommen war. Und nun saß sie allein daheim, mit dem fünfjährigen Leon und der sechsjährigen Nina und wartete darauf, zum zweiten Mal den Mann ihres Lebens zu finden.
Sie war wie Lindberg einunddreißig, attraktiv, fast schon zu attraktiv und wirkte daher ein wenig künstlich auf ihn. Lindberg hatte zu spät gemerkt, was sich da anbahnte. Weil er in Berlin mit all dem Mitleid, den Ratschlägen und der Tuschelei der Kollegen und Freunde nicht mehr klargekommen war, hatte er in der Schweiz niemandem von Paulas Schicksal erzählt.
Bis auf Isabel.
Er hatte gehofft, ihr damit klarzumachen, dass er vergeben war, und sie hatte es wohl auch verstanden. Aber Verstand und Herz waren nun einmal zwei getrennte Dinge.
Und jetzt konnte er ihr Dr. Watson schlecht wieder wegnehmen. Doch da war noch mehr. Er mochte Leon, ihren Sohn, weil er ihn daran erinnerte, wie es Lindberg in dem Alter gegangen war. Weil er ihm helfen wollte. Und weil der Junge ihn auch mochte.
Lindberg klingelte an der Nachbarstür, die wie immer innerhalb von wenigen Sekunden geöffnet wurde. Isabel strahlte ihn an, die brünetten Haare offensichtlich frisch auf Schulterlänge gekürzt, es stand ihr gut. Obwohl es schon zehn Uhr abends war, hatte sie das Make-up noch nicht abgelegt. „Und, wie war es?“, fragte sie, ein Glas Wein in der Hand.
Er schüttelte nur den Kopf.
„Leon liegt schon im Bett.“ Sie deutete nach oben zu den Schlafzimmern der Kinder. „Er war zu müde.“
„Du bist bestimmt auch müde“, antwortete er, anstatt ein Kompliment zu ihrem neuen Haarschnitt zu machen. Doch auch der Anti-Flirt-Modus half nicht mehr, im Gegenteil, er schien sie noch mehr zu befeuern.
„Möchtest du auch noch einen Wein?“ Sie schwenkte ihr Glas. „Ein 98er Shiraz. Wäre schade um die angebrochene Flasche.“
Die letzten drei Einladungen hatte Lindberg schon abgelehnt, sich Dr. Watson geschnappt und war gegangen. Außerdem konnte er jetzt ohnehin noch nicht schlafen. Also nickte er und ließ Dr. Watson aus dem Karton.
„Ich hätte übrigens einen Wunsch“, sagte Isabel, kaum hatte er sich auf den Wohnzimmersesseln gesetzt. „Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ich habe Angst vor meinem Geburtstag.“ Sie blickte ihn mit Verzweiflung in den Augen an. „Festtage erinnern mich daran, dass ich allein bin.“
„Das verstehe ich“, sagte er, obwohl er noch keinen Festtag ohne Paula hatte durchstehen müssen. Er wollte gar nicht daran denken. „Wie kann ich dir helfen?“
„Ich würde gerne mit dir essen gehen, in einem speziellen Restaurant. Wo wir hingehen, ist ein Geheimnis.“
Lindberg blickte sie gespannt an.
„Ich verrate nichts, aber es wird ein tolles Erlebnis“, sagte sie. „Es wäre super, wenn du dir den Dienstagabend freihalten könntest.“
Er nickte. „Danke, dass du auch immer für mich da bist.“
Sie strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und nahm einen Schluck Wein. „Es wäre schön gewesen. Wenn wir uns mit unseren Partnern kennengelernt hätten.“
„Ja, es wäre schön gewesen“, sagte er und das meinte er ernst. Er mochte Isabel, aber wenn er nicht bald die Beziehung zwischen ihnen klärte, würde er Paula nicht mehr in die Augen schauen können, wenn sie diese jemals öffnete.
Und darauf wartete er doch so sehr.
Isabel legte ihre Hand auf seine Schulter. „Ich weiß, wie du dich fühlst.“
Nein, das weißt du nicht, dachte er. Dein Mann ist tot, aber Paula lebt noch.
Er nahm das Weinglas, leerte es in gerade noch angemessener Zeit, rief Dr. Watson und verabschiedete sich.
Daheim angekommen, reichte seine Kraft nur noch, sich zu entkleiden, ins Bad zu gehen und dann ins Bett zu fallen.
Dort wartete er auf den Schlaf.
4
Er schlug die Augen auf und sah nichts. Sein Kopf schmerzte, sein Gehirn war in einem Nebel gefangen, und bevor er feststellen konnte, wo er sich befand, nickte er wieder weg.
Nach einer Weile kam sein Bewusstsein wieder, kämpfte sich durch den dichten Nebel, orientierungslos. Schmerz war die einzige Empfindung. Sein Kopf, die Schulter, mehr spürte er nicht.
Er atmete ein, auch das tat weh. Etwas drang in seine Nase. Ein Geruch. Es roch nach Treibstoff. Diesel.
Hastig schnappte er nach Luft, er hustete, alles schien in Diesel getränkt. Es war stockdunkel, er spürte, dass er auf einem gepolsterten Sitz saß, dass seine Kleider an ihm klebten und nass waren.
Alles stank nach Treibstoff.
Hektisch blickte er sich um, doch er konnte immer noch nichts sehen, obwohl seine Augen geöffnet waren, obwohl sie brannten von den stechenden Ausdünstungen des Diesels. Er spürte einen handbreiten Gurt auf seine Brust drücken. Saß er in einem Auto?
Er schob seine Hände nach vorn, befühlte das nasse Leder eines Lenkrads. Er suchte rechts an der Lenksäule nach dem Schlüssel, doch der steckte nicht. Er wollte das Licht anschalten, vorne an der Konsole, drückte ein paar Knöpfe, nichts tat sich.
Er langte an den Dachhimmel, fand den Schalter für das Innenlicht, betätigte ihn, doch die Batterie des Autos schien leer. Alles war tot.
Der Dieselgeruch stach ihm wieder in die Nase. Er musste hier raus. Mit der Linken suchte er nach dem Türgriff, fand ihn, rüttelte daran, doch die Tür blieb geschlossen.
Er spannte den Gurt los, beugte sich nach rechts, um den Türgriff an der Beifahrerseite zu greifen und dann erst bemerkte er, dass jemand neben ihm saß.
5
Daniel C. Meyer jagte, weil er sich auf dieser Weise der Natur nahe fühlte. Die Natur brauchte Führung, brauchte eine ordnende Hand, so wie alles im Leben. Wer wollte schon, dass die ganze Welt nur aus Urwald bestand? Klar, es gab noch das Meer und ein paar Gletscher und Berge, aber dort lebte ja niemand.
Was der Mensch schön fand, war überwiegend Kulturlandschaft: Weinberge, Teeplantagen, Wiesen, Olivenhaine, bewirtete Wälder. Natürlich, manche fanden auch den Urwald schön, aber wie wollten sie ihn sehen, wenn nicht jemand wenigstens einen Pfad hindurch schlug?
Und wie sollte ein Wald überleben, wenn sich das Wild planlos vermehrte und alles an Rinde verspeiste, was in seiner Reichweite lag?
Klar, die Natur kontrollierte sich selbst, manches Mal in ein paar Jahrzehnten, doch oft erst in Hunderten oder Tausenden von Jahren.
Doch der Mensch lebte jetzt und konnte nicht warten, bis die Natur eingriff. Deswegen war er gerne Jäger und hatte nicht den Ansatz eines schlechten Gewissens, wenn er einen Rehbock schoss, einen Hasen oder eine Gämse.
Fachmännisch, ohne unnötige Schmerzen für das Tier.
Trotzdem hatte die Jagd viele Feinde. Feinde, die er auch von seinem Beruf kannte. Bei der Führung eines Pharmaunternehmens lernte man schnell, wer für einen und wer gegen einen war.
Wer seine Argumente verstand, und wer sie nicht verstehen wollte.
Doch sollte er sich deswegen selbst beschränken, weil andere zu beschränkt waren? Nein, es war richtig was er tat, davon war Daniel C. Meyer überzeugt.
Trotz der Anfeindungen in letzter Zeit. Es ging ihm nicht um Geld, er hatte wahrlich genug verdient. Es ging ihm darum, etwas zu verändern. Und das konnte er jetzt noch mehr als zuvor.
Denn er war jetzt nicht mehr CEO eines One-Trick-Pony-Pharmaunternehmens, sondern Forschungschef bei Novartis, einem der größten Pharmakonzerne weltweit.
Wer hätte das gedacht, er, der damals in der siebten Klasse in Biologie mit einem Ungenügend abgespeist worden war. Dann hatte der Lehrer gewechselt und er seine Einstellung und endlich hatte er verstanden, wie das funktionierte mit der Natur und dem Menschen.
Meyer hörte ein Geräusch, legte sich flach auf den Boden, nahm sein Jagdgewehr, schaute durch das Zielfernrohr und scannte den Bereich vor sich. Zentimeter für Zentimeter.
Nichts bewegte sich, selbst die Luft schien stillzustehen.
Plötzlich raschelte es im vom Schnee bedeckten Laub, so als habe jemand einen kleinen Ast geworfen, nur ein paar Meter hinter ihm. Meyer blickte sich um, immer noch auf dem Boden liegend.
Da, vor ihm wieder ein Geräusch.
Er drehte den Kopf, schaute nach vorn; etwas bewegte sich, an mehreren Stellen, jetzt kam es wieder von hinten, er hob den Oberkörper, um besser sehen zu können und dann erst entdeckte er das Gewehr, das auf seine Brust gerichtet war.
Im nächsten Moment fiel ein Schuss.
6
Wieder der unerträgliche Dieselgestank, die Dunkelheit. Jemand saß neben ihm; er wollte etwas sagen, doch sein Mund gehorchte ihm nicht.
Er hustete, der Treibstoff brannte in den Augen.
Er strich über den Arm der Person auf dem Beifahrersitz, sie reagierte nicht. Ihre Haut war weich, nass vom Diesel, aber sie fühlte sich vertraut an.
Es war eine Frau. Er spürte ihre Haare, sie klebten unnatürlich, er führte die Hand zu ihrem Hals, befühlte die Kette, die sie angelegt hatte.
Etwas hing daran.
Ein Stein? Ein Amulett? Eine Figur?
Seine Hände zitterten zu sehr, um es zu erkennen.
Wieder versuchte er, etwas zu sagen, doch es fühlte sich an, als hätte er das Sprechen nie gelernt.
Wie lange brauchte man, um einen Wagen samt Insassen mit Diesel zu überschütten und diesen anzuzünden?
Drei, vier Minuten?
Auch wenn er nicht wusste, wann er aufgewacht war und wie lange er hier schon saß, es konnte nicht mehr lange dauern.
Vielleicht nur noch Sekunden.
Er rüttelte am Türgriff, suchte einen Türknopf, fand keinen. War die Doppelverriegelung aktiv? Man konnte diese Funktion von außen per Schlüssel aktivieren, um zu verhindern, dass jemand in das Auto eindringen konnte. Dazu gehörte auch, die Türgriffe zu deaktivieren, damit man an diesen durch einen Fensterspalt nicht per Draht ziehen konnte. Er lehnte sich zur Beifahrertür, auch diese war verschlossen. Und dann, plötzlich, als er über der Frau lehnte, die neben ihm saß, spürte er ihren Anhänger an seiner Schulter. Er fühlte sich vertraut an, die runde Form, der kalte Stein.
Es konnte keinen Zweifel mehr geben, wer neben ihm saß: Paula.
7
Natürlich hätte er Meyer einfach erschießen können, doch das wäre viel zu human gewesen. Nein, er musste sterben, wie auch die Tiere starben. Denn sonst würde seine Botschaft nicht verstanden werden.
Also hatte er Meyer nur betäubt, mit einem gezielten Schuss, so wie man es bei Großwild tat. Schnell, effizient. Meyer hatte nicht mal mehr röcheln können, oder gar etwas sagen.
Aber was hätte er auch sagen sollen, außer die üblichen haltlosen Beschuldigungen, Ausflüchte und Rechthabereien von sich zu geben?
Daniel C. Meyer war der Prototyp eines Managers, dessen Interessen seine Moral bestimmten.
Entweder man war seiner Meinung, oder man lag falsch. Etwas dazwischen gab es nicht.
So hatte Meyer immer geglaubt, Tierschützer wären wie Hunde, die nicht beißen, sondern nur bellen.
Allem Anschein nach hatte er sich getäuscht.
Er lehnte Meyer mit dem Rücken an einen Holzstumpf, holte die Knochensäge aus seiner Tasche und setzte sie am Kopf des Bewusstlosen an, ein paar Zentimeter über den Augen.
Es knirschte ein wenig, als er in den Schädelknochen eindrang.
Kurz darauf hob er die Schädeldecke ab und blickte auf das freigelegte Gehirn seines Opfers. Meyer lebte noch, sein Puls schwach, aber vorhanden. Natürlich wäre es realistischer gewesen, dem Manager bei vollem Bewusstsein den Schädel aufzuschneiden, aber wer ließ das schon freiwillig mit sich machen? Und fixieren konnte er den Mann hier nicht. Das Leben war eben ein einziger Kompromiss.
Und das Sterben auch.
Er wusste grob, welche Bereiche im Hirn für welche Funktionen standen, schaltete erst das Sprachzentrum aus, dann den Teil für die Emotionen sowie das Lustzentrum und schließlich das ganze verdammte Ding.
Meyer hörte auf zu atmen.
Jetzt fehlte nur noch ein Detail, um den Plan perfekt zu machen.
Ein paar Minuten später trat er einen Schritt zurück und betrachtete sein Werk.
Es war perfekt.
Jetzt kann ich mich wohl Serienkiller nennen, dachte er. Zwei Morde in zwei Tagen. Und niemand wird je erkennen, dass sie zusammengehören. Schließlich habe ich nicht im Affekt getötet, oder aus Mordlust.
Sondern aus purer Notwendigkeit.
Er spürte, wie sich seine Haare aufstellten. Okay, ein wenig Mordlust war schon dabei gewesen. Doch ich habe immer die Kontrolle behalten, meinen Plan strikt verfolgt.
Zwei verschiedene Modi Operandi, zwei verschiedene Täter, die nichts gemein hatten.
Jeder würde das glauben. Denn die Menschen glaubten immer, was sie sahen.
Ob es nun die Realität war, oder eine Illusion.
8
„Schach“, sagte der Mann, den man Gehirnklitschko nannte.
Lindberg blickte auf die Figuren vor sich. Nur mit der Dame und ein paar Bauern konnte er den König nicht befreien. „Das muss ich wohl kämpferisch lösen“, sagte er.
Gehirnklitschko lächelte generös. „In drei Zügen du Schachmatt.“
Lindberg stand auf. „Wenn du nicht in der nächsten Runde auf die Bretter gehst.“
„Mich hat noch niemand k.o. gemacht.“
„Das heißt: k.o. geschlagen“, sagte Lindberg und zog sich die Boxhandschuhe über.
„Ist nur kein Literaturwettbewerb“, antwortete Gehirnklitschko, legte Handschuhe und Mundschutz an und stieg in den Ring. „Aber gib mir zwei Jahre, dann ich gewinne auch.“
Eigentlich war Reden während eines Kampfes verboten und mit dem Mundschutz nicht so einfach, aber Gehirnklitschko konnte einfach nicht still sein. Außerdem trafen sie sich ohnehin nur zum Sparring. „Ich versteh das nicht“, sagte Lindberg und legte seinen Arm um Gehirnklitschkos Schulter. „Du bist hyperintelligent und arbeitest immer noch bei der Müllabfuhr?“
„Ich entschiede zwische Abgabe Doktorarbeit und Lebe von Familie. Und ohne Abschluss du nix wert in Schweiz.“ Er lächelte. „Außerdem ich verdiene gutes Geld hier. Mehr als Professor in Aserbaidschan.“
Kremer vom Tisch nebenan räusperte sich. Er war der uneingeschränkte König im Basler Schachboxclub gewesen, bis Gehirnklitschko aufgekreuzt war. Und ihn nach drei Runden k.o. geschlagen hatte. „Wollt ihr reden oder boxen?“
Inzwischen hatte Gehirnklitschko auch das mit dem Schach gelernt und jetzt war er unbesiegbar. Lindberg mochte ihn, obwohl er über dessen Vergangenheit nicht viel mehr von ihm wusste, als dass er eigentlich Erdin Kourlaev hieß und aus Aserbaidschan geflüchtet war.
Doch die Kämpfe mit ihm waren Lindbergs einziger Ausgleich zwischen den einsamen Nächten an Paulas Bett und der Arbeit. Hier konnte er nachdenken, ohne gleich zu verzweifeln und er konnte seine Aggressionen abbauen, ja zuschlagen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Dank Gehirnklitschko konnte er sogar ab und an lachen.
Und seine Alpträume vergessen, die ihn jede Nacht quälten, wenn ihn der Schlaf endlich holte.
Kaum hatte auch Lindberg seinen Mundschutz angezogen, tänzelte Gehirnklitschko vor ihm herum, als sei er Muhammed Ali. „Aber was du arbeite, ich auch nix verstehe.“ Gehirnklitschko deutete mit dem Boxhandschuh an seinen Kopf. „Bist bei höchste Polizei, Bundespolizei und ihr versucht verlorene Urne wiederzufinde?“
„So ähnlich.“ Lindberg setzte eine Rechts-Links-Kombination, doch Gehirnklitschkos Deckung stand. „Wir übermitteln bei grenz- oder kantonsüberschreitenden Verbrechen“, sagte Lindberg und wehrte einen Aufwärtshaken ab. „Außerdem sind wir bei Terrorismus zuständig, bei Entführungen und wenn die Sicherheit der Schweiz bedroht ist.“
„Aber es geht bei deine aktuelle Fall um Pharmaindustrie“, entgegnete Gehirnklitschko. „Nicht um Schweiz.“
„Für manche ist es dasselbe.“ Lindberg machte einen Ausfallschritt, um einen weiteren Angriff abzuwehren. „Und einige Manager werden eben von Tierschützern bedroht. Da werden Wände beschmiert, Urnen von Angehörigen gestohlen, Drohbriefe geschrieben und Versuchstiere befreit. Also wurden wir eingeschaltet. Damit die Manager sich wieder sicher fühlen.“
„Aber Tierschützer würde doch nicht umbringen Mensch“, widersprach Gehirnklitschko und tänzelte um Lindberg herum. Er war nicht mal außer Atem. „Mensch ist doch auch nur Tier, was glaubt intelligent zu sein, oder?“
Lindberg lächelte. „Das sehe ich auch so. Aber auch ich musste in die Schweiz und nehmen, was ich kriegen konnte.“
Er täuschte einen Aufwärtshaken an, gefolgt von einem rechten Schwinger.
Gehirnklitschko parierte. „Aber du hier gebore“, sagte Gehirnklitschko.
„Deswegen bin ich mir auch zu fein für die Müllabfuhr.“
„Aber dein Vater Schwede?“
Lindberg nickte. „Nur meine Mutter kam von hier.“
Gehirnklitschko tänzelte vor Lindberg auf und ab, blickte kurz in dessen Augen. „Manchmal auch in reiche Land nicht einfach, oder?“
„Vielleicht machen wir es uns auch nur selbst schwer.“
„Was ich letzte Mal schon wollte frage, was das für eine Narbe?“ Er deutete auf den Oberkörper Lindbergs wo sich rechts auf Höhe der Niere eine fingerbreite Narbe befand. „Ist von Kriminelle?“
„Ja, stammt von einem Brand.“
„Ich werde nicht dahin schlage, okay?“
„Du wirst keine Gelegenheit dazu haben.“
Gehirnklitschko grinste. „Aber weswegen du arbeite in Bern und wohne in Basel?“
„Damit ich gegen dich boxen kann.“ Lindberg sah die Lücke in der Deckung, schlug zu und traf sein Gegenüber mit einem rechten Haken am Kinn.
Gehirnklitschko wankte. „Du besser geworde in Boxe. Tut schon fast weh.“ Er ging ein wenig auf Abstand. „Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du sehe aus wie Jude Law, als der noch hatte alle Haare?“
Lindberg senkte verdutzt seine Deckung, und genau in dem Moment schlug Gehirnklitschko eine Rechts-Links-Kombination und der Kommissar ging zu Boden.
9
Der Videowecker projizierte eine dunkle Seenlandschaft auf die Wand. Der Mond lugte blass hinter einer Wolke hervor und spiegelt sich im Wasser des Sees. Leise rauschte ein Bach, ein angeblich beruhigender Effekt, den Lindberg schon häufiger hatte deaktivieren wollen. In der unteren Ecke der Seenlandschaft leuchtete die Uhrzeit: 6:03. Der Sonnenaufgang würde noch eine Stunde auf sich warten lassen, man konnte ihn auf die Minute genau einstellen. Meist kam er jedoch dann, wenn der Kommissar gerade eingeschlafen war.
Lindberg schlief, unruhig, aber wenigstens schlief er.
Bis sich ein Klingeln dazwischen drängte, laut und fies. Er blickte auf den Videowecker, erkannte die Landschaft und seine Augen wanderten zu seinem Diensthandy. Er traf blind die Taste für die Rufannahme. Das Klingeln stoppte.
„Erik, wir haben einen Mord in der Pharma-Geschichte“, dröhnte die raue Stimme Carla Freys aus dem Lautsprecher des Mobiltelefons.
„Einen Mord?“ Lindberg richtete sich auf. Seine rechte Backe schmerzte, Gehirnklitschkos Siegtreffer von gestern Abend.
„Daniel C. Meyer, der neue Forschungschef von Novartis.“
„Und es ist wirklich Mord?“, fragte Lindberg.
Carla Frey seufzte. „Die Details kenne ich auch noch nicht, muss aber eindeutig sein.“
„Scheiße.“
„Allerdings. Er war beim Jagen im Bettinger Wald bei Riehen. Die Kollegen von der Basler Kantonspolizei sind schon vor Ort, aber ich glaube, wir sollten uns den Tatort auch anschauen.“
Bei fedpol, der Schweizer Bundespolizei, für die Lindberg arbeitete, überließ man häufig die Ermittlungsarbeit den Kollegen vor Ort und delegierte nur. Nicht jedoch wenn es ein Fall von Carla Frey war. Sie war seit vierzig Jahren bei der Polizei und immer noch – oder gerade deshalb – härter im Nehmen, als die meisten Kollegen.
Sie hatte ihren Aufstieg geschafft, als noch niemand über Frauenquoten diskutierte, ja, sie war schon bei der Polizei gewesen, da hatte in der ganzen Schweiz noch nicht einmal das Frauenwahlrecht gegolten.
Und doch war Carla Frey keine Feministin, sie war einfach nur sie selbst. Authentisch, geradeheraus und immer noch ein Stück weit rebellisch. Ihre graue Stoppelfrisur passte jedenfalls wunderbar zu den Kakteen auf ihrem Schreibtisch.
Lindberg ließ sich den Leichenfundort beschreiben und versprach, in einer Stunde in der Zentrale zu sein. Er fühlte sich erschlagen, kein Wunder, wenn er die Nächte entweder im Krankenhaus verbrachte oder von Alpträumen heimgesucht wurde.
Als er letzte Woche ohne Vorankündigung vom Polizeiarzt zu einer Routineuntersuchung gebeten wurde, hatte der über Lindbergs Alpträume nur gesagt, diese würden bald von allein verschwinden. Stattdessen wurden sie immer schlimmer! Natürlich, der Arzt hatte seine Meinung auch durch nichts begründen können, nur Lindbergs Blut auf ein Ding geträufelt, das aussah wie ein Computerchip und irgendetwas von einer Metabolisierungsrate gefaselt.
Als ob ihm die helfen würde!
Damit er wenigstens einigermaßen wach wurde, stellte Lindberg sich unter die Dusche und drehte sie so heiß auf, dass sein Bad bald einer Sauna glich.
Anschließend zog er einen Anzug an und schob sich zwei Scheiben Knäckebrot in den Mund. Als er die Haustür öffnete, ließ ihn der eisige Wind frösteln. Er zog den Mantelkragen höher.
Schnee türmte sich auf seinem Volvo, er wischte ihn mit blanken Händen von der Scheibe, seine Handschuhe lagen daheim im Warmen. Natürlich befand sich unter dem Schnee eine Eisschicht, die einem Schweizer Winter würdig war.
Obwohl Lindberg halb Schwede und halb Schweizer war, hasste er den Winter.
Aber was konnte man von einem Schweden schon erwarten, der nicht mal blond war? Und einem Schweizer, der nicht mal Ski fuhr? Und sogar noch Höhenangst hatte?
Wahrscheinlich hab ich genau die falschen Eigenschaften angenommen, und trotzdem bin ich bisher gut durchs Leben gekommen.
Bis Paula ins Koma gefallen war.
Er schloss die Augen für einen Moment, nahm dann den Eisschaber aus dem Wagen, kratzte vorne und hinten ein Guckloch frei und setzte sich in den kalten Wagen. Lindberg hatte nie wieder im Auto eingesperrt sein wollen, also hatte es ein Cabrio sein müssen.
Gebraucht, schließlich war er nur Polizist.
Lindberg fuhr mit der Handfläche über das Gebläse und hoffte, dass die Heizung dieses Mal zu arbeiten begann, bevor er ankam.
Kaum hatte er beschleunigt, pfiff der Wind durch das Verdeck. Von der Hochstraße blickte er auf die erwachende Stadt. Der graue Schnee hatte Basel ein gleichförmiges Gesicht gegeben. Nur die Schornsteine der Industrie stachen heraus und zogen vorbei wie Strichmännchen in einem Daumenkino. Er war hier geboren, doch nach all den Jahren im Ausland fühlte er sich in der alten Heimat wie ein Fremder.
Von seiner Wohnung in Basel hätte er in einer Viertelstunde in Riehen sein können, doch die Regularien sahen vor, das man nur mit dem Dienstwagen an den Tatort fuhr. Versicherungstechnischer Unsinn. Andererseits liefen die Toten nicht weg, wie Carla Frey immer sagte.
Also musste Lindberg nach Bern, dort mit den Kollegen in den Dienstwagen steigen und dann wieder nach Basel. Klar hätten die Kollegen ihn unterwegs aufpicken können, aber nicht mal das war ihnen offiziell gestattet.
Die Schweizer hatten die Bürokratie zwar nicht erfunden, aber sie hatten sie definitiv perfektioniert.
Die Zentrale der Bundespolizei fedpol befand sich in Bern direkt neben der Autobahn E25, die in den Niederlanden begann und in Palermo endete. Lief man zufällig an der Zentrale vorbei, konnte man nur erkennen, dass es sich um ein Verwaltungsgebäude handelte, selbst die Briefkästen hatte man abmontiert, aus Angst vor Anschlägen.
Als er in die fedpol-Tiefgarage einbog, stand Carla Frey schon vor dem Einsatzwagen. Neben ihr eine Frau mit langen, schwarzen Haaren, schlank, ganz in schwarz gekleidet. Sie schien um die vierzig, Lindberg kannte sie nicht. Er stieg aus dem Wagen, begrüßte Carla.
„Erster Tag nach dem Urlaub und dann so eine Scheiße“, sagte die Schwarzhaarige und rieb sich das Piercing an ihrer rechten Augenbraue. „Ich bin übrigens Katharina Zach.“ Sie gab Lindberg die Hand, ihre Jacke rutschte dabei leicht nach oben und Lindberg blickte auf eine Tätowierung in Form eines umgedrehten Kreuzes. „Ich bin die Chefin der Spurensicherung“, sagte sie. „Und du bist der neue Hahn im Korb?“
Das klang, als hätte es schon einige gegeben, doch Lindberg nickte. „Bin seit einem Monat hier, hab vorher in Berlin beim LKA gearbeitet.“
„Tolle Stadt, wenn nur die Berliner nicht wären“, sagte sie. Und dann erst lächelte sie. „Bin dort geboren. Und warum bist du nach Bern gekommen?“
Lindberg stockte. „Wollte zurück in die Schweiz.“
„Da kann nur eine Frau dahinterstecken, oder?“
„Ich pflege meine Eltern.“ Lindberg hasste es zu lügen, aber in dem Fall war es das Beste. Niemand stellte weitere Fragen, er hatte einen Grund übernächtigt zu sein und es erklärte, warum er in Basel wohnte. Damit vermied er all das, was Berlin am Ende unerträglich gemacht hatte.
Selbst bei seiner Bewerbung in Bern hatte er die Pflege seiner Eltern vorgeschoben, wer würde schon einen Kommissar anstellen, dessen Freundin im Koma lag? Der Job war schon hart genug.
Genau wie er erwartet hatte, sagte auch Katharina nichts mehr zu dem Thema, sondern sie stiegen schweigend in den Dienstwagen. Carla setzte sich hinter das Steuer, wie immer. Sie gab Dinge eben ungern aus der Hand.
Eine Stunde später kamen sie in Riehen an und bogen auf eine Nebenstraße ab, die der städtische Winterdienst offensichtlich schon länger aufgegeben hatte.
Als sie schon ein paar Hundert Meter in den Bettinger Wald hineingefahren waren, sahen sie endlich die Autos der Kantonspolizei.
Die drei stiegen aus, zogen sich ihre Overalls an und liefen den plattgetretenen Schneespuren der Kollegen nach.
Lindberg spürte ein dumpfes Bauchgrimmen. Obwohl er schon einige Tatorte in seinem Leben gesehen hatte, war er jedes Mal angespannt wie beim ersten Mal. Er konnte sich an vieles gewöhnen, aber nicht an den Tod.
Sie kamen auf eine kleine Lichtung, die mit Polizeiband abgesperrt war, Lindberg zählte mehr als zehn Männer in Schutzkleidung, am Rand standen verloren ein paar Sanitäter. Offensichtlich hatten sie nichts mehr zu tun.
Dann erst sah er den Toten.
Ihm wurde augenblicklich schlecht.
10
Lindberg hatte bisher angenommen, seine Kollegin Carla Frey könne nichts schockieren, doch jetzt, da er sie anblickte, verriet der Ausdruck in ihren Augen das Gegenteil. Für gewöhnlich blinzelten sie flink und aufgeweckt unter Freys grauen Stoppeln hervor, doch jetzt schienen sie leer und starr. „Das ist mal eindeutig“, sagte sie.
Lindberg musste sich zwingen, nicht wegzuschauen. Der Tote war in Jägermontur gekleidet, er lehnte mit dem Rücken an einem Holzstumpf; jemand hatte ihm die Schädeldecke abgetrennt und zwei Elektroden, die man für gewöhnlich an Affenhirnen verwendete, in die blutige Hirnmasse gesteckt.
„Nette Show“, sagte Zach. „Aber nur vom Abtrennen des Schädels stirbt man nicht. Die Versuchsaffen leben ja auch weiter.“
Lindberg blickte sie überrascht an. Katharina Zach war anscheinend aus ähnlich hartem Holz geschnitzt wie Carla.
Der Kommissar der Basler Kantonspolizei kam zu ihnen und stellte sich vor, doch Lindberg hörte kaum hin und vergaß den Namen schon wieder nach wenigen Sekunden. Er hatte bisher nicht glauben mögen, das Tierschützer, die im Grunde das Leben bewahren wollten, zu so einer Tat fähig waren.
Drohung, Sachbeschädigung, ja, aber Mord?
2009 hatten sich militante Tierschützer den damaligen Novartis CEO Vasella als Zielscheibe ausgesucht, die Urne aus dem Grab seiner Mutter gestohlen, sein Jagdhaus in Brand gesetzt und zwei Kreuze mit seinem Namen und dem seiner Frau auf dem Friedhof seines Heimatdorfs aufgestellt. Schon damals hatte die Bundespolizei ermittelt.
Inzwischen war eine neue Generation Tierschützer nachgefolgt, die härter, brutaler und kompromissloser war.
Sie hatten an Forscher angeblich mit AIDS kontaminierte Handtücher versendet, anhand gefälschter Beweisfotos behauptet, diese Forscher wären pädophil, hatten deren Autos in Brand gesteckt, ja sie hatten sogar den CEO einer deutschen Pharmafirma entführt und ihn über Nacht in der firmeneigenen Tierversuchsstation angekettet, aber gemordet hatten sie noch nicht.
Doch was tat man, wenn all die Provokation nichts nützte?
Wenn Drohungen nicht mehr ausreichten?
„War Meyer nicht erst seit Kurzem bei Novartis?“, fragte Lindberg.
Carla Frey nickte. „Er kam von einer kleineren Pharmafirma, war der neueste Shooting-Star der Branche. Es gab einen offenen Brief der FAA an ihn zu seinem Amtsantritt. Er solle alle Tierversuche unverzüglich stoppen, sonst werde man ihn, na ja stoppen.“ Die FAA, ,Free All Animals‘ war jene militante Tierrechtsorganisation, die den Kampf gegen Tierversuche in der Schweiz vor einem Jahr wieder intensiviert hatte.
„Hatte er Familie?“, fragte Lindberg.
Frey nickte. „Frau und zwei Kinder.“
„Wie wurde er gefunden?“
„Fragen wir mal die Kollegen.“ Frey ging zu dem Basler Kommissar. „Gibt es irgendwelche Zweifel an der Identität des Toten?“
Der Kommissar schüttelte den Kopf. „Natürlich ist er noch nicht von den Angehörigen identifiziert worden, aber er hatte sein Portemonnaie samt Ausweis und Kreditkarten bei sich. Und optisch passt das. Außerdem hatte er eine Erlaubnis, in dem Revier zu jagen.“
„Wer hat ihn gefunden?“
„Eine Joggerin, läuft jeden Morgen hier lang. Die ist drüben beim Psychologen. Hat nichts weiter beobachtet.“
„Gibt es andere Zeugen?“
„Ende Februar sind nicht viele hier unterwegs. Und dann ist noch die Woche nach Fasnacht.“
„Das wird ganz schön Wellen machen“, sagte Frey. „Ich will auf keinen Fall, dass Bilder von ihm in die Öffentlichkeit kommen. Auch die Abtrennung der Schädeldecke, der ganze Zirkus, das ist Täterwissen und darf nicht in die Presse.“
„Klar“, antwortete der Basler Kommissar. „Und Sie leiten die Ermittlungen?“
Carla Frey nickte. „Wir sind schon eine Weile an den Tierschützern dran. Die machen nicht vor Kantonsgrenzen oder Staatsgrenzen halt. Nur das hat jetzt ein neues Ausmaß angenommen.“
„Ist gut, wenn wir da entlastet werden“, sagte der Kommissar. „Gab gestern nämlich noch einen anderen Mord in Basel.“
Lindberg schaute ihn überrascht an, das hatte er noch gar nicht mitbekommen. „Ein ähnlicher Fall?“
Der Kommissar schüttelte den Kopf. „Völlig anders, geht um eine erstochene Prostituierte in Klein-Basel. Wahrscheinlich Raubmord.“
„Haben Sie den Täter schon?“
„Nicht mal einen Verdächtigen. Gab Unmengen von Spuren, aber das ist in einem Puff ja kein Wunder. Wir sind noch am Auswerten.“
„Kommt mal!“, rief einer der Spurensicherer. „Hier ist was in seinem Mund.“
Lindberg ging näher an den Toten heran. Jetzt erst fiel ihm die bläuliche Färbung von dessen Hirn auf. Der Spurensicherer hatte eine Pinzette in den Mund des Ermordeten gesteckt und zog vorsichtig an etwas Weißem.
Ein kleines Papierkügelchen, nicht viel größer als eine Botschaft aus einem Glückskeks. Er trug es zu einem Tisch und faltete es vorsichtig mit der Pinzette auseinander. Das Papier war bedruckt, so viel konnte Lindberg sehen.
Nachdem der Spurensicherer das Beweisstück in einem Plastiksäckchen abgelegt hatte, ließ Lindberg sich das Teil geben. Die Schrift auf dem Papier war zwar durch den Speichel ausgefasert, aber immer noch lesbar:
Wenn du Tiere tötest, dann töten wir dich!
11
Lindberg rief Carla Frey zu sich. „Kennst du den Spruch?“
Frey schüttelte den Kopf. „Inhaltlich passt das aber zu unseren Freunden von der FAA. Und eine Visitenkarte wird kaum jemand am Tatort hinterlassen. Nicht bei einem Mord.“
„Und was machen wir?“
„Jetzt, da die Drohungen wahr geworden sind, sollte das für einen Durchsuchungsbefehl ausreichen. Ich rede mit dem Bundesanwalt und dann statten wir denen mal einen Besuch ab.“
Sie blieben noch eine Weile am Tatort, ließen Katharina Zach zurück, die anscheinend gar nicht mehr gehen wollte und bezogen ein temporäres Büro im Basler Waaghof, der Zentrale der Basler Kantonspolizei. Lindberg kannte das Gebäude von früher, jedes Mal, wenn er den Waaghof betrat, fühlte er sich, als sei er im Gefängnis gelandet.
Kein Wunder, denn es war auch eines. In einem Teil des Gebäudes saßen Verbrecher ihre Zeit ab, im anderen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Böse Zungen behaupteten, es sei die perfekte Symbiose. Und noch bösere, es gäbe einen geheimen Durchgang, der es den Verbrechern ermöglichen würde, tagsüber einer geregelten Arbeit nachzugehen. Meist behaupteten das Personen, die selbst mit dem Gesetz im Konflikt standen, was die Überzeugungskraft dieses Arguments doch beträchtlich schmälerte.
Nachdem sie Meyers Frau und die jugendlichen Kinder informiert hatten – die Frau hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten – waren sie der Parole ,Wenn du Tiere tötest, dann töten wir dich!‘ nachgegangen. Weder in der Polizeidatenbank noch im Internet ließen sich Hinweise dazu finden.
Trotzdem erhielten sie am Nachmittag Durchsuchungsbefehle für die Wohnungen von mutmaßlichen FAA-Mitgliedern, samt Haftbefehlen.
Lindberg hatte gehofft, erst mit den Tierschützern reden zu können, doch es kam anders. Der neue Chef der Bundespolizei, Beat Graf, der sein Amt eigentlich erst in ein paar Tagen am 01. März antrat, hatte schon ein Wörtchen mitgeredet und für ein hartes Durchgreifen plädiert. Lindberg kannte seinen neuen Vorgesetzten noch nicht und er war sich nicht sicher, ob er ihn überhaupt kennenlernen wollte. Morgen schon stellte sich Graf der versammelten Mannschaft vor, zwei Tage vor Amtsantritt.
Bundesanwalt Schiller war einer Meinung mit dem Chef der Bundespolizei und entschied sich, die Aktivisten die volle Härte des Staates spüren zu lassen.
Und so stürmte ein Sonderkommando die Wohnungen der mutmaßlichen FAA-Mitglieder, verhaftete dreizehn Personen und durchsuchte neun Objekte.
Von den Verhafteten war niemand bereit, ohne Anwalt auch nur seinen Namen zu nennen.
„So läuft das immer“, sagte Carla Frey. „Und wir dürfen dann hinterher die Scherben zusammenkehren und irgendwie versuchen, mit den Verdächtigen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.“
Man fand Propagandamaterial, Hanf unterhalb der Bagatellgrenze und detaillierte Pläne eines Versuchslabors in Italien. Aber Hinweise auf den Mordfall fand man nicht.
Sie hatten nicht einmal herausfinden können, ob einer der Verdächtigen etwas vom Tod Daniel C. Meyers gewusst hatte, und jetzt, da sie alle gewarnt waren, konnte man den Überraschungseffekt abschreiben.
Doch die Öffentlichkeit hatte die ersten Schuldigen präsentiert bekommen und der Druck war für den Moment vom Bundesanwalt genommen.
Politik eben.
Das hatte nur nichts mit echter Polizeiarbeit zu tun. Lindberg fragte sich, wie Carla Frey das solange ausgehalten hatte. War sie eigene Wege gegangen, um dann doch zum Ziel zu kommen? Oder hatte sie irgendwann resigniert?
Carla Frey hatte Lindberg beauftragt, alles über Daniel C. Meyer zu erfahren, seine Familie, Freunde, Feinde, mit wem er telefoniert hatte, welche Termine angestanden waren.
Ein riesiger Wulst an Daten, die irgendjemand sichten musste.
Lindberg blieb bis zehn Uhr abends im Waaghof, entschied sich dann, das Auto in Bern stehen zu lassen und lief die wenigen Hundert Meter in Richtung Basler Bahnhof.
Die Tage, an denen er noch Hoffnung gehabt hatte, tagsüber mit einer positiven Nachricht von der Rehaklinik angerufen zu werden, waren schon lange vorbei.
Seitdem Paula im Koma lag, schlief Lindberg schlecht, er, der früher zu jeder Tageszeit und an jedem Ort ein Nickerchen hatte einlegen können. Einerseits war er völlig übermüdet, andererseits hätte er gerne mehr Zeit an Paulas Seite verbracht und jetzt kam noch ein Fall dazu, der ihm alles abfordern würde.
Dennoch, manche Dinge dürfte er nicht aufgeben. Bei jedem Besuch in der Klinik versuchte er, etwas Neues auszuprobieren, etwas, das Paula vielleicht dazu bringen würde, ihren Zustand zu verlassen.
Irgendwann, hoffte er, würde er damit Erfolg haben.
Er besorgte beim Floristen am Bahnhof Winterjasmin, der früher bei ihnen im Garten immer als erster geblüht hatte und fuhr dann mit der Straßenbahn zur Rehaklinik Neuro-Re.
Wenigstens hatte er eine Vereinbarung mit dem Personal treffen können, das für ihn die normalen Besuchszeiten nicht galten.
Er ging in Paulas Zimmer, schaltete das Licht ein und sah sofort, dass alles unverändert war. Er setzte sich zu ihr aufs Bett, nahm ihre Hand und legte den Winterjasmin auf das Kopfkissen.
Aufgrund der Maske konnte sie die Blumen natürlich nicht riechen, laut der Ärzte war ihr Geruchssinn ohnehin nicht aktiv, genauso wenig wie das Schmerzempfinden. Er hob die Maske trotzdem leicht an, achtete darauf, den Alarm nicht auszulösen und schob die Blumen näher an ihr Gesicht.
Lindberg achtete auf Paulas Mundwinkel, ihre Nase, ihre geschlossenen Augen. Er konnte den Jasmin deutlich riechen, ein angenehmer Duft, der an den beginnenden Frühling erinnerte, an Leben, an Aufbruch.
Doch Paula reagierte nicht.
Er ließ die Maske los und legte sich enttäuscht neben sie, ihre Hand immer noch in seiner.