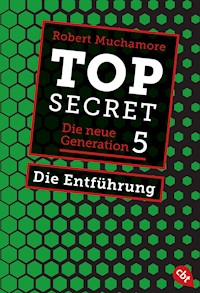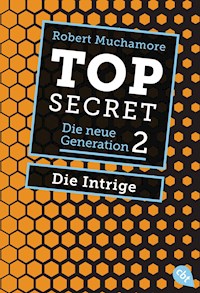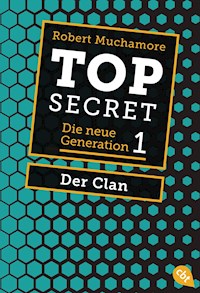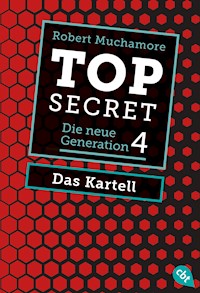
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Top Secret - Die neue Generation (Serie)
- Sprache: Deutsch
Ein skrupelloser Dealer. Zwei junge Agenten. Eine brandheiße Mission.
Drogen und Diebstahl sind Alltag für die dreizehnjährige Fay – bis ihre Mutter und ihre Tante dem skrupellosen Dealer Hagar zum Opfer fallen. Achtzehn Monate später sollen die CHERUB-Agenten Ryan und Ning den Drogenboss endlich zur Strecke bringen. Mithilfe von Fay unterlaufen sie Hagars Netzwerk. Doch Fay hat jede Menge Feinde in der Szene und verfolgt ihr ganz eigenes Ziel. Denn sie hat noch eine Rechnung offen – mit niemand Geringerem als Hagar. Eine hochexplosive Mission, bei der den CHERUBs die Zeit davonläuft ...
Knallharte Action, spannend bis zur letzten Seite!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Robert Muchamore
Top Secret – Die neue Generation
Das Kartell
Aus dem Englischen von Tanja Ohlsen
Kinder und Jugendbuchverlagin der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage 2015
© 2014 by Robert Muchamore
Die englische Originalausgabe erschien
unter dem Titel »Cherub. Lone Wolf«
bei Hodder Children’s Books, London.
© 2014 für die deutschsprachige Ausgabe by cbt Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Tanja Ohlsen
Lektorat: Ulrike Hauswaldt
Umschlagkonzeption: muellerfrey Werbeagentur GmbH, München
he · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-13711-3
www.cbt-buecher.de
Was ist CHERUB?
CHERUB ist Teil des britischen Geheimdienstes. Die Agenten sind zwischen zehn und siebzehn Jahre alt. Meist handelt es sich bei den CHERUB-Agenten um Waisen aus Kinderheimen, die für die Undercover-Arbeit ausgebildet wurden. Sie leben auf dem Campus von CHERUB, einer geheimen Einrichtung irgendwo auf dem Land in England.
Warum Kinder?
Kinder können sehr hilfreich sein. Niemand rechnet damit, dass Kinder Undercover-Aktionen durchführen, daher kommen sie mit vielem durch, was Erwachsenen nicht gelingt.
Die wichtigsten Eigenschaften eines CHERUB-Agenten sind überdurchschnittliche Intelligenz und physische Belastbarkeit sowie die Fähigkeit, unter Stress zu arbeiten und selbstständig zu denken.
Die 300 Kinder, die auf dem CHERUB-Campus wohnen, werden im Alter von sechs bis zwölf Jahren rekrutiert. Ab zehn Jahren können sie undercover arbeiten, vorausgesetzt, sie überstehen die hunderttägige Grundausbildung.
Die CHERUB T-Shirts
Den Rang eines CHERUB-Agenten erkennt man an der Farbe des T-Shirts, das er oder sie auf dem Campus trägt. ORANGE tragen Besucher. ROT tragen Kinder, die auf dem Campus leben, aber zu jung sind, um schon als Agenten zu arbeiten. BLAU ist die Farbe während ihrer 100-tägigen Grundausbildung. Ein GRAUES T-Shirt heißt, dass man auf Missionen geschickt werden darf. DUNKELBLAU tragen diejenigen, die sich bei einem Einsatz besonders hervorgetan haben. Ein SCHWARZES T-Shirt ist die höchste Anerkennung für hervorragende Leistungen bei vielen Einsätzen. Wenn man CHERUB verlässt, bekommt man ein WEISSES T-Shirt, wie es auch das Personal trägt.
Teil 1Dezember 2012
1
Kentish Town, Nordlondon
Nach dem Schneefall vor ein paar Tagen war der Gehweg vereist, und der Wind war so kalt, dass Craig Willow sich seinen Schal über die Ohren zog. Er war ein großer Mann mit einer platten Boxernase, aber seine Glanzzeiten im Ring lagen bereits zwei Jahrzehnte hinter ihm.
Die Straße war von viktorianischen Häusern gesäumt. Die meisten waren von irgendwelchen Neureichen saniert worden, aber Nummer sechzehn war schäbig, die Garage baufällig, und die alten Schiebefenster waren zu einem stumpfen Grün verblasst, das an das erinnerte, was man bei einer Grippe von sich gab.
Craig nahm einen Schlüssel aus der Tasche seiner schmutzigen Trainingshose. Bis vor ein paar Jahren war das Haus ein Studentenwohnheim gewesen. Im Flur gab es Münzautomaten für Gas und Stromzähler, Briefkästen und ein seit Langem abgeschaltetes Münztelefon.
Es gab keine Heizung, doch es war immerhin wärmer als draußen. Craig zog die Lederhandschuhe aus und rieb sich die gefühllosen Finger, bevor er mit der Faust an eine Metalltür schlug. Auf der anderen Seite rannte jemand die Treppe hinunter und fragte mit starkem walisischem Akzent:
»Bist du das, Craig?«
»Nein, es ist der dämliche Weihnachtsmann, der eine Woche zu früh kommt«, erwiderte Craig gereizt. »Du siehst mich doch auf dem Monitor!«
»Hagar sagt, du musst das Passwort sagen. Ohne Passwort kommt niemand rein oder raus.«
»Na gut«, meinte Craig, holte tief Luft und ballte die Fäuste. »Das Passwort lautet: Mach die Tür auf, du kleiner Idiot, sonst schlage ich dir den Schädel ein!«
Nach einer kleinen Pause wurden schwere Riegel hinter der verstärkten Tür geöffnet. Als sie aufging, trat Craig drei Schritte vor und versetzte dem mageren Teenager auf der anderen Seite einen sanften Stoß.
»Passwort!«, schnaubte er. »Du bist wohl scharf auf ’ne Ohrfeige.«
Doch die Drohung konnte Jake nicht ernst nehmen.
»Ich bin der Sohn vom Boss«, neckte er Craig, während er die mit einem ausgefransten Teppich belegte Treppe hinaufging. »Du musst mich wahrscheinlich eines Tages mit ›Sir‹ anreden.«
»Du bist Hagars Stiefsohn«, verbesserte ihn Craig. »Wenn er das Interesse an deiner Mutter verliert, lässt er dich fallen wie eine heiße Kartoffel.«
Das Gespräch verstummte, weil sie am Ende der Treppe angekommen waren und einen großen Raum betraten. Vor allen Fenstern hingen blickdichte Gardinen, an einem Ende des Raumes standen lange Tische und ein Geldzählautomat, am anderen war eine Sitzecke mit kaputten Sofas und einem großen Fernseher eingerichtet, auf dem ohne Ton der Sportkanal lief.
Die beiden anwesenden Männer waren um die fünfzig und schienen von Craigs massiger Gestalt eingeschüchtert.
»Was war denn los?«, erkundigte er sich.
»Dreihundertsechzehntausend«, erzählte der größere der beiden Männer und deutete auf einen großen Safe. »Alles vakuumverpackt in Paketen zu je zehntausend. Im anderen Safe sind zweihundertzwölftausend. Und achtzehn Kilo Kokain in der Sporttasche.«
Craig zog eine Augenbraue hoch, woraufhin einer der Männer erschrocken einen halben Schritt rückwärts machte.
»Wollt ihr mich verarschen?«, stieß Craig zornig hervor. »Wer hat denn gesagt, dass Drogen ins Zählhaus gebracht werden? Warum hat mir keiner Bescheid gesagt?«
»Da ist etwas schiefgelaufen bei einem Geschäft«, erklärte Jake. »Es war sozusagen ein Notfall. Hagar hat gesagt, es sei ein Haufen Ware und hier sei der sicherste Ort dafür.«
Craig schüttelte verächtlich den Kopf. Von den millionenschweren Bossen bis zu den Kids, die Tütchen für zehn Pfund auf der Straße verkauften, galt im Drogenhandel eine goldene Regel: Geld und Ware immer getrennt halten.
»Sind Lieferungen vereinbart?«, fragte er.
»Ihr sollt nur Wache halten, du und Jake, es sei denn, es ändert sich etwas.«
»Na gut«, meinte Craig und betrachtete die Geldzähler. »Dann macht euch heim zu euren Frauen, und keinen Ton über die achtzehn Pakete mit Stoff zu irgendwem.«
»Ein paar der Crews konnten nicht zahlen«, erklärte einer der Männer und deutete auf ein Notizbuch auf dem Tisch. »Archway, wie üblich. Steht alles im Register.«
»Ein paar Schläge mit meinem alten Baseballschläger bringen sie meist dazu, die Taschen aufzumachen«, meinte Craig voller Vorfreude auf ein wenig Gewalt.
Albern ahmte Jake einen Schlag mit einem Baseballschläger nach, als die beiden Geldzähler nach Hause gingen. Nachdem sie durch die Stahltür verschwunden waren, beobachtete Craig sie auf dem Überwachungsmonitor, bis sie aus dem Gebäude waren, bevor er hinunterging und die Riegel wieder vor die Tür schob.
Als er wieder nach oben kam, ärgerte er sich erneut über die mit achtzehn Kilo Kokain prall gefüllte Sporttasche unter einem der Tische. Abgesehen von ein paar Anklagen wegen tätlichen Angriffs hatte Craig Ärger mit dem Gesetz immer vermieden und war nie im Gefängnis gewesen. Mit einem Haufen illegalen Geldes in einem Haus erwischt zu werden, würde ihm eine drei- bis fünfjährige Gefängnisstrafe eintragen. Ein Haus voller Drogen und Geld würde diese Strafe auf zehn Jahre erhöhen, und der Gedanke beschäftigte ihn unangenehm, während er seine Jacke auf das Sofa fallen ließ.
Aus der Küche rief Jake: »Gleich kommt auf Sky ein Fußballspiel. Ich war vorhin bei Sainsbury. Was willst du haben? Es gibt Curry aus der Mikrowelle oder Hot Dogs oder ich könnte uns Eier mit Schinken und Pommes machen.«
Craig grunzte und erwiderte: »Ich sehe gleich selbst in den Kühlschrank. Aber erst muss ich nach oben und kacken.«
»Ich könnte schon mal anfangen zu kochen«, schlug Jake vor.
»Wir haben hier zwölf Stunden lang Wache«, meinte Craig kopfschüttelnd. »Da macht es doch nichts aus, wenn du wartest, bis ich mich ausgeschissen habe, oder?«
Er griff sich die Sun vom Couchtisch und ging ins Bad, das sich im Obergeschoss befand. Auf der Toilette stank es, und das einzige Putzmittel bestand aus einer leeren Flasche WC-Reiniger, die er frustriert in die Badewanne warf.
»Ich bin es leid, dass ihr Drecksäcke hier nie sauber macht!«, brüllte er, zog sich die Hose herunter und ließ sich auf der Toilette nieder.
»Hast du was gesagt, Boss?«, rief Jake von unten.
»Ach, vergiss es!« Kopfschüttelnd murrte Craig vor sich hin: »Zwölf Stunden hier zusammen mit diesem Schwachkopf …«
Es war ein normales Bad, wenn man einmal von dem LED-Bildschirm absah, auf dem abwechselnd die Bilder aus acht verschiedenen Überwachungskameras auftauchten. Sie zeigten alles vom Zählraum und der Treppe über die unbewohnten Räume im unteren Stockwerk und den hinteren Garten bis zur Straße vor dem Haus. Mithilfe einer Fernbedienung konnte man den Bildausschnitt der einzelnen Kameras steuern.
Als Craig einen enormen Furz in die Schüssel krachen ließ, hörte er hinter seinem Kopf ein Knacken. Da er glaubte, es handle sich um eine Maus oder eine Kakerlake, rollte er die Zeitung zusammen, um danach zu schlagen. Doch anstatt eines Insekts sah er eine behandschuhte Faust, die die Gipskartonwand hinter ihm durchschlagen hatte.
Noch bevor Craig sich auch nur umdrehen konnte, stach ihn eine Nadel zwischen die Schulterblätter, und die Hand verabreichte ihm eine Spritze mit einem schnell wirkenden Beruhigungsmittel. Als er mit der Hose um die Knöchel auf der Toilette zusammensackte, begann eine Frau mit einer Hockeymaske schnell und effizient Teile aus der Gipskartonwand zu schlagen.
Nach einer Minute war das Loch groß genug, dass die Frau hindurchklettern konnte. Dazu musste sie Craigs massigen, bewusstlosen Körper von der Toilette schubsen. Sie kniete sich nieder und legte zwei Finger an seinen Hals, um seinen Puls zu fühlen, als ihre dreizehnjährige Nichte Fay durch das Loch stieg.
»Ist er in Ordnung, Kirsten?«, erkundigte sie sich.
Kirsten und ihre Nichte waren etwa gleich groß und trugen beide Hockeymasken, schwarze Jeans, Kapuzenshirts und schwarze Turnschuhe. Ihre Ausrüstung war mit Staub bedeckt.
»In ein paar Stunden wacht er mit ekligen Kopfschmerzen auf und hat bestimmt eine Menge zu erklären«, erwiderte Kirsten. »Vergiss die Taschen nicht.«
Fay kniete sich auf den Toilettendeckel und griff durch das Loch ins Nachbarhaus. Kirsten nahm die Pistole aus dem Hüfthalfter und entriegelte die Tür.
»Wenn etwas schiefgeht, rennst du wie der Teufel«, sagte Kirsten. »Auch wenn ich nicht glaube, dass uns Jake viele Schwierigkeiten machen wird.«
Fay nickte, während ihre Tante die Tür aufmachte und nach unten schlich, und sah von oben zu, wie sie Jake in der Küche überraschte.
»Auf die Knie oder ich puste dir den Kopf weg!«, drohte sie.
Fay schnappte sich die Rucksäcke und rannte nach unten, wo Kirsten Jake bereits in den Zählraum gebracht hatte und ihn mit den Händen auf dem Kopf niederknien ließ.
»Hol die Handschellen«, befahl Kirsten und hielt die Waffe auf Jakes Kopf gerichtet. »Wie macht man die Safes auf?«, fragte sie ihn.
»Die haben ein Zeitschloss«, erwiderte Jake und schüttelte panisch den Kopf. »Die gehen erst morgen früh um zehn Uhr wieder auf.«
»Sehr witzig«, lachte Kirsten. »Wir haben uns nämlich in eure Überwachungskameras eingehackt und den Raum hier zwei Wochen lang überwacht. Ich habe gesehen, wie du die Safes jederzeit geöffnet hast. Tag und Nacht.«
Jakes selbstsichere Haltung fiel in sich zusammen und Fay nahm einen merkwürdigen Satz Unterwäsche aus ihrem Rucksack.
»Warst du schon mal in Texas, Jake?«, fragte Kirsten.
»Nein«, erwiderte Jake misstrauisch.
»Die Leute dort werden übermütig«, erzählte Kirsten. »Mein Mädchen hat da elektrische Unterwäsche, die von der Gefängnisbehörde entwickelt wurde. Wenn sie einen echt großmäuligen Hundertfünfzig-Kilo-Mann unter Kontrolle halten müssen, lassen sie ihn so was tragen. Man schaltet es ein paar Sekunden lang ein, und er bekommt eine Stromladung ab, die ihn schluchzen lässt wie ein Kleinkind.«
»Wann kommt die Morgenschicht?«, fragte Fay nach dem Drehbuch, das sie mit ihrer Tante zusammen einstudiert hatte.
»In elfeinhalb Stunden«, antwortete Kirsten. »Mit diesen Anzügen bricht man die größten und fiesesten Männer der Welt nach ein oder zwei Stromstößen. Nun, Jake, ich kann dir jetzt ein Beruhigungsmittel spritzen und dann wachst du in dieser Unterwäsche auf. Dann habe ich die ganze Nacht Zeit, um deine winzigen kleinen Eier zu malträtieren. Du kannst aber auch ein vernünftiger kleiner Junge sein und die Safes gleich aufmachen.«
Jake hob einen Finger und schnippte nach Kirsten.
»Vor ein paar Mädchen habe ich keine Angst«, stieß er hervor.
Augenblicklich zog Fay einen ausziehbaren Schlagstock hervor und hieb ihn Jake ins Genick. Als er bäuchlings auf den schmierigen Teppich fiel, setzte sie ihm die Hacke ihres Turnschuhs zwischen die Schulterblätter, packte dann mit geübtem Griff seinen Arm und bog ihn nach hinten.
»Oh Mann, neiiin!«, schrie Jake.
»Elf Stunden«, erinnerte ihn Kirsten. Die Augen hinter ihrer Hockeymaske waren nur schmale Schlitze. »Wir sind vielleicht Mädchen, aber nicht zimperlich.«
»Hört auf!«, verlangte Jake atemlos.
»Machst du die Safes auf?«, fragte Fay.
»Wenn du meinen Arm loslässt.«
Fay ließ ihn los und erlaubte es Jake, zu den Safes zu kriechen. Sobald der erste offen war, begann Fay die eingeschweißten Geldpakete in eine Nylontasche zu packen.
»Fünfhundertachtundzwanzig Riesen in bar«, sagte Kirsten. »Plus achtzehn Kilo Kokain, das wir für weitere achthundert verscherbeln können.«
»Eins Komma drei Millionen«, rechnete Fay und begann zu grinsen. »Nicht schlecht für einen Abend Arbeit.«
Sobald die Taschen gepackt waren, verpasste Kirsten Jake genügend Beruhigungsmittel, um ihn für ein paar Stunden offline gehen zu lassen.
Dann fuhren sie in Jakes Opel Astra fort, den sie hinter dem Bahnhof St. Pancras stehen ließen. Sie entledigten sich ihrer schwarzen Kleidung, nahmen sich am Bahnhof ein Taxi und fuhren ein kurzes Stück bis zu einer Wohnung in St. John’s Wood.
2
Als Fay den äußeren Weg um den Regent’s Park herumrannte, dessen Rasenflächen noch vom Morgenfrost bedeckt waren, bot sie einen hübschen Anblick. Sie war schlank, ohne mager zu sein, hatte haselnussbraunes Haar und leuchtend grüne Augen. Die Dreizehnjährige hatte ein gutes Tempo in ihren Laufschuhen, die diese Strecke wohl schon hundertmal gemacht hatten. Als sie mit ihren zwei Runden fertig war, stoppte sie ihre Laufuhr. Sie lag eine Minute über ihrer Bestzeit, aber angesichts der stressigen Nacht war das auf keinen Fall schlecht.
St. John’s Wood ist eine der besten Gegenden Londons. In luxuriösen Wohnungen residieren Bankiers und reiche Künstler, während die Häuser den millionenschweren Topmanagern und Popstars vorbehalten sind. Der Ausländeranteil ist sehr hoch, was einer der Gründe dafür war, dass Fay an einem Wochentag im Park herumlaufen konnte, ohne dass sie jemand fragte, warum sie nicht in der Schule war.
Nachdem sie in einer Bäckerei Croissants und ein Walnussbrot gekauft hatte, hielt ihr ein Portier die Tür zu der eleganten Lobby des Wohnhauses auf, in dem sie seit ein paar Monaten wohnte. Die offen gestaltete Wohnung im zwölften Stock hatte große Fenster, die einen wunderbaren Blick über den Park boten.
Kirsten begrüßte ihre Nichte mit einem Lächeln, sagte aber streng: »Mach deine Dehnübungen ordentlich und geh dann duschen!«
Fay ließ das Brot auf den Küchentisch fallen und zog sich die Turnschuhe aus.
»Ich mache dir eine heiße Schokolade«, verkündete Kirsten. »Und dann beschäftigst du dich mit den Mathebüchern.«
Fay warf ihre durchgeschwitzten Trainingssachen in den Wäschekorb und stellte sich unter die heiße Dusche. Die Kälte hatte ihre Wangen und Finger ganz taub werden lassen. Ihr Körper war durchtrainiert und muskulös, trug aber ein paar blaue Flecken, die von den Kickbox-Sessions mit ihrer Tante herrührten.
»Willst du den ganzen Tag da drin bleiben?«, rief Kirsten.
Fay spähte durch die beschlagene Duschkabine, ob sie den Riegel vor die Tür geschoben hatte, und beschloss dann, sich so viel Zeit zu nehmen, wie sie wollte.
Dann zog sie T-Shirt und Trainingshose an und erwartete eigentlich einen Tadel von ihrer Tante. Stattdessen fand sie auf dem Esstisch Walnussbrot, Käse und Apfelscheiben neben einer Tasse heißer Schokolade mit Marshmallows und einem drei Zentimeter dicken Papierstapel.
»Was ist das denn, Tantchen?«, fragte Fay, obwohl sie sah, dass es ausgedruckte Schul-Websites waren.
»Wir hatten Glück, das Safe-Haus zu überfallen, als dort gerade Geld und Drogen waren«, meinte Kirsten.
Fay nickte nachdenklich und spießte mit der Gabel ein Stück Cheddar auf.
»Hagar ist paranoid und geht bestimmt davon aus, dass es ein Insider-Job war. Das sollte den Verdacht von uns ablenken.«
»Hoffentlich«, stimmte Kirsten zu. »Wir waschen das Geld auf dem üblichen Weg. Ich habe einen Kontakt in Manchester, der uns einen guten Preis für das Kokain bietet. Und damit sind wir aus dem Schneider.«
»Wieso?«
»Ein paar meiner Projekte sind bereits in der Planungsphase. Die will ich auch noch abarbeiten«, erklärte Kirsten. »Aber das kann ich auch allein.«
Fay klappte der Unterkiefer herunter. »Wir haben aber doch seit Mums Tod zusammengearbeitet!«
Kirsten tippte auf den Stapel mit den Ausdrucken.
»Das hier sind einige der besten Privatschulen des Landes. Oder zumindest die besten mit Plätzen für eine Dreizehnjährige mit einer unzulänglichen Schulkarriere.«
»Du hast mich zu Hause gut genug unterrichtet«, meinte Fay. »Ich sehe nicht ein, warum ich so eine schicke Schule brauche.«
»Süße, ich weiß, wie viel Sprengstoff man braucht, um einen Safe aufzusprengen. Ich kenne sogar ein paar Leute, die mir Dynamit verkaufen. Aber das bedeutet nicht, dass ich dir Chemie für die Abschlussprüfungen beibringen kann. Außerdem ist da noch die soziale Komponente. Du kannst nicht dein ganzes Leben mit deiner Tante verbringen. Du musst Leute in deinem eigenen Alter treffen.«
Fay griff wahllos nach einer der Seiten und betrachtete stirnrunzelnd die selbstsicheren Kinder auf dem Schulhof.
»Als ich klein war, hat Mum mich in die Schule geschickt«, erzählte sie steif, »aber die anderen Kinder haben mich genervt.«
Doch Fay hatte nur ein paar Jahre die Grundschule besucht, und auch wenn sie es nicht zugeben wollte, machte ihr die Vorstellung, in einem Raum mit anderen Kindern zu sein, Angst.
»Ich bin ein einsamer Wolf«, rief sie, stieß den Stapel Ausdrucke zu Boden und stand auf. »Als Mum gestorben ist, hast du geschworen, dich um mich zu kümmern!«
»Genau das tue ich hiermit«, behauptete Kirsten, ohne auf die Wut ihrer Nichte einzugehen, klaubte gelassen die Papiere vom Boden auf und legte sie wieder vor Fay auf den Tisch. »Deine Mum und ich waren Teenager. Wir wuchsen in Pflegeheimen auf und begannen irgendwann damit, Straßendealer für zwanzig Pfund zu überfallen. Dann wagten wir uns an größere Dealer. Und dann spionierten wir die Geldlager und großen Drogengeschäfte aus. Jetzt haben wir zwei Millionen in bar, die keiner von uns ausgeben kann, wenn wir im Gefängnis landen.«
»Was willst du denn den ganzen Tag tun?«, wollte Fay wissen. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach nur dasitzen und dir Gameshows ansehen willst?«
Kirsten zuckte mit den Achseln.
»Ich könnte ja eine Kickbox-Schule aufmachen. Ich könnte ein Café kaufen, Japanisch lernen, Golf spielen, es mit dem Banjo versuchen …«
Fay schnaubte. »Und was ist mit dem Jagdfieber?«
»Irgendwann verlässt einen das Glück, Fay. Wenn wir Glück haben, schnappen uns die Cops und wir wandern ins Gefängnis. Aber wenn uns ein Dealer in die Finger kriegt, wird er uns foltern und umbringen.«
»Oh, du bist immer so melodramatisch«, stöhnte Fay.
»Deine Mutter hat sich für unsterblich gehalten und dann hat Hagar sie gekriegt.«
»Ich verstehe nur nicht, warum ich auf so eine dumme Schule gehen soll!«, rief Fay und hielt eine der Broschüren hoch. »Sieh sie dir doch an, lauter kleine Damen in Faltenröckchen und Kniestrümpfen.«
»Wenn du dir keine aussuchst, werde ich es tun«, drohte Kirsten. »Ob es dir gefällt oder nicht, du wirst zur Schule gehen.«
»Dann falle ich eben bei der Aufnahmeprüfung durch!«
»Dann schicke ich dich auf die Gesamtschule. Wir werden darüber nicht diskutieren, Fay. Wir haben so viel Geld, wie wir brauchen, und du gehst zur Schule!«
*
Zwei Tage später lag Fay morgens in einem rosa Bademantel auf ihrem Bett. Sie hatte ihre zwei Runden um den Park bereits hinter sich, aber zusätzlich noch eine Stunde Kickboxen mit ihrer Tante trainiert. Es gab zwar genügend Einbauschränke, aber da sie alle paar Monate umzogen, lebte Fay gewohnheitsmäßig aus zwei großen Rollkoffern, deren Inhalt sich auf dem Boden ausbreitete wie ein bunter Pilzbefall.
Kirsten klopfte an und trat ein, ohne eine Antwort abzuwarten.
»Manchester«, sagte sie unvermittelt, »zieh dich an!«
»Jetzt gleich?«
»Der Käufer ist bereit. Sechzehn Kilo für fünfundvierzigtausend das Kilo.«
»Ich dachte, wir hätten achtzehn Kilo geklaut«, meinte Fay verwirrt.
»Und auf der Straße kursiert die Geschichte, dass jemand Hagar achtzehn Kilo geklaut hat, daher verkaufen wir jetzt nur sechzehn und heben uns die anderen beiden für schlechte Zeiten auf.«
Begeistert griff Fay nach ihrer Jeans und einem T-Shirt, die auf dem Boden lagen, während Kirsten befriedigt registrierte, dass der Stapel mit den ausgedruckten Schulbroschüren ziemlich zerlesen aussah. An den Rand hatte Fay sogar ein paar Kommentare wie »öde Uniform« oder »am Arsch der Welt« geschrieben, und Kirsten musste lachen, als sie das Bild eines Jungen sah, auf dessen Schulpullover mit rotem Kugelschreiber »heiß« stand.
»Die vier ganz oben sind meine Favoriten«, erklärte Fay.
»Alles gemischte Schulen, wie ich sehe«, lachte Kirsten.
»Na ja, wenn du mich schon zwingst, in die Schule zu gehen, dann will ich wenigstens in eine, wo es ein paar Jungs gibt.«
»Reine Mädchenschulen sind auch ziemlich bizarr«, stimmte ihr Kirsten zu. »Und es freut mich, zu sehen, dass du dich mit der Idee anfreundest.«
»Was passiert jetzt als Nächstes?«
»Ich rufe die Zulassungsstelle an und frage, wie es aussieht«, antwortete Kirsten. »Wenn sie freie Plätze haben, kannst du vielleicht schon nach Weihnachten anfangen.«
Fay musste schlucken.
»Das ist ja schon in drei Wochen! Ich dachte, du sprichst von September, wenn das neue Schuljahr anfängt!«
»Ich fände es besser, wenn du dich in das Schulleben eingefügt hast, bevor die Prüfungen beginnen.«
»Wenn ich gute Noten kriege, können wir in den Ferien dann jemanden überfallen?«, grinste Fay.
»Fay!« Kirsten lachte. »Du machst mir Angst!«
»Warum?«
»Ich überfalle Drogendealer wegen der Kohle«, meinte Kirsten. »Du bist genau wie deine Mutter. Du machst es aus Vergnügen.«
3
Kirsten fuhr in einer silbernen Mercedes-Limousine, die sie mit einem Führerschein und einer Kreditkarte auf den Namen Tamara Cole gemietet hatte, von London nach Manchester. Fay verbrachte die Fahrt auf dem Rücksitz und las ein Buch über einen Mann, der die Welt umsegelt hatte. Die Vorstellung, allein in einem kleinen, von den Wellen gebeutelten Boot zu sitzen, gefiel ihr.
»Ich würde gerne segeln lernen«, verkündete sie, als der Mercedes einen Bus mit Rentnern überholte.
»Wenn du dich in der neuen Schule gut machst«, erwiderte Kirsten.
Die Antwort schien Fay zu befriedigen und sie vertiefte sich wieder in ihr Buch.
Ihr Ziel war das Belfont, eines der neuesten Hotels in Manchester mit einer schicken Lobby in schwarzem Marmor, wo es leicht nach Jasmin roch und die Beleuchtung so schummrig war, dass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte.
Die sechzehn Kilo Kokain waren in einem Aluminium-Rollkoffer mitgereist, und Kirsten musste einen Portier im Zylinder verscheuchen, der sich um ihr Gepäck bemühen wollte. Sie fragte nach einem Konferenzraum namens Windermere und wurde in den neunten Stock verwiesen.
Als sie die Rezeption verließen, sah Kirsten Fay an und sagte leise: »Es wird ihnen nicht gefallen, wenn ein Kind beim Treffen anwesend ist, also warte lieber hier. Sie werden jeden Würfel auf seine Reinheit überprüfen wollen, bevor sie das Geld übergeben, deshalb werde ich wohl mindestens vierzig Minuten brauchen. Geh nicht zu weit weg.«
Fay sah nicht gerade begeistert aus. »Kann ich gegenüber zu Starbucks gehen und mir einen Frappuccino holen?«
Das grüne Starbucks-Logo war auf der Straße gegenüber der Lobby zu sehen und Kirsten nickte.
»Ja, aber geh nicht weiter weg. Wenn ich fertig bin, suchen wir uns ein nettes Lokal für ein spätes Mittagessen und gehen shoppen, okay?«
Fay war kein großer Shopping-Fan, aber sie brauchte neue Laufschuhe und wollte sich nach einem weiteren Buch übers Segeln umsehen.
Während Kirsten auf den Aufzug zum neunten Stock wartete, verließ Fay durch eine Drehtür die Hotellobby und überquerte eine Nebenstraße. Es war immer noch kalt, daher bestellte sie sich, nachdem sie kurz in der Schlange gewartet hatte, eine heiße Schokolade mit Schlagsahne. Und da die Sessel im Starbucks bequemer aussahen als die in der Hotellobby, machte sie es sich auf einem Platz in der Nähe des Tresens bequem und nahm ihr Buch aus einem kleinen Leinenbeutel.
Ihre Tante schien zwar zuversichtlich, die Drogen, die sie von Hagar gestohlen hatten, verkaufen zu können, doch mit diesen Leuten aus Manchester hatte sie noch nie Geschäfte gemacht. Solange ihre Tante gegenüber mit einem Drogendeal über siebenhundert Riesen beschäftigt war, fiel es Fay daher schwer, sich auf ihr Buch zu konzentrieren, so gut es auch war.
Sie hob gerade die Schokolade an die Lippen, als eine Frau über ihr ausgestrecktes Bein stolperte. Anstatt sich zu entschuldigen, sah sie Fay finster an.
»Kannst du nicht aufpassen, wo du deine Beine hinstellst?«
»Wie wäre es, wenn Sie aufpassen, wo Sie hintreten?«, erwiderte Fay gereizt.
Die Frau antwortete nicht, nahm nur ein Tablett mit sechs Kaffeebechern und ging zur Tür. Fay sah ihr nach und bemerkte, dass ihre Jacke um die Hüften herum ausgebeult war und dass sie schwarze Schuhe trug, wie ein Cop sie tragen würde.
Sie nahm einen weiteren Schluck Schokolade und sagte sich, dass sie paranoid war, doch dann fiel ihr noch etwas auf: Die Frau hatte Londoner Dialekt gesprochen. Da war also eine Frau aus London mit Polizistenschuhen und einer ausgebeulten Jacke, als hätte sie jede Menge Ausrüstung wie Handschellen und so weiter darunter. Und sie kaufte sechs Getränke, als müsste sie eine ganze Mannschaft versorgen …
Bilde ich mir das ein?
Wenn man nervös ist, redet man sich manchmal Dinge ein, die gar nicht da sind. Wäre Fay sicher gewesen, hätte sie sofort ihre Tante angerufen, aber sie war sich eben nicht sicher. Daher verbrannte sie sich den Mund, als sie die heiße Schokolade hinunterstürzte, steckte das Buch in die Leinentasche und ging zur Tür.
Die Frau mit den sechs Drinks hatte bereits die Straße überquert und drängte sich durch die Drehtür des Belfont. Von hinten sah Fay eindeutig das silbrige Aufblitzen von Handschellen, die unter einer schwarzen Nylonweste hervorsahen.
Augenblicklich griff Fay nach ihrem Telefon und rief ihre Tante an.
»Komm schon!«, stieß sie hervor. Der Atem stand ihr in kleinen Rauchwölkchen vor dem Gesicht, als sie die Drehtür erreichte. Sie versuchte, durch die Scheiben hindurch zu erkennen, was die Polizistin drinnen machte, doch in der Lobby war es zu dunkel. Endlich klickte es in ihrem Ohr.
»Guten Tag, dies ist der Anschluss von Tamara Cole. Ich bin im Augenblick nicht erreichbar. Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen möchten, sprechen Sie bitte nach dem Piepton.«
Fay ächzte frustriert auf und stürmte durch die Drehtür.
»Tantchen, ich habe gerade eine Polizistin ins Hotel gehen sehen. Lass alles stehen und liegen und hau ab.«
In der düsteren, ach so stilvollen Lobby sah Fay sich nach der Polizistin um, die mit ihrem Tablett in einem Aufzug verschwand. Gerade schlossen sich seine Türen. Fay rannte hinüber und drückte auf den Rufknopf. Während sie wartete, tippte sie hektisch eine Nachricht in ihr Telefon.
Überall Bullen! Sofort raus da!!!!
Mit äußerst mulmigem Gefühl betrat Fay den Aufzug. Sie überlegte, ob sie im achten Stockwerk aussteigen und von da aus die Treppe nehmen sollte, doch sie wollte ihrer Tante so viele Chancen bieten wie möglich, daher riskierte sie es, direkt in den neunten Stock zu fahren.
Durch die Aufzugstür sah sie einen breiten Korridor, an dem zu beiden Seiten Konferenzräume mit großspurigen Namen lagen. Schon nach dem ersten Schritt sah sie den Aufruhr. Windermere war ein Konferenzraum mit einer Doppeltür am Ende des Ganges. Davor standen mehrere Polizisten und Pulverdampf und Kokainpulver erfüllten die Luft. Mindestens drei Männer lagen in Handschellen am Boden, ein weiterer hing über einem langen Tisch und wurde gerade durchsucht.
Fays Telefon meldete eine SMS von ihrer Tante.
KOMM NICHT NACH OBEN!
Ein Polizist, der aussah, als hätte er das Sagen, rief: »Wie konntet ihr sie entkommen lassen? Ich will, dass alle nach ihr suchen!«
Fay trat zurück in den Aufzug und drückte auf E und auf den Knopf zum Schließen der Türen. Es schien eine Woche zu dauern, bis sie zu waren, doch dann schwebte sie wieder nach unten und tippte eine Nachricht für ihre Tante ein.
Wo bist du?
In der Lobby war alles friedlich. Fay holte tief Luft und ging schnell, aber nicht zu schnell, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Als sie auf dem Weg nach draußen in der Drehtür an einem uniformierten Beamten vorbeikam, blieb ihr fast das Herz stehen.
Sie kannte sich in der Gegend nicht aus und wusste nicht, wie sie ihrer Tante helfen sollte. Das einzig Logische schien ihr, so viel Abstand wie möglich zwischen sich und das Hotel zu bringen und sich später mit ihrer Tante zu treffen, vorausgesetzt, diese konnte entkommen. Wenn nicht, hatte sie keine Ahnung, was sie tun sollte.
Fay merkte, dass sie zitterte, als sie die Straße überquerte. Summend kam eine weitere SMS ihrer Tante auf dem Telefon in ihrer Tasche an.
SCHALT DAS TELEFON AUS. MAN KANN DICH DAMIT ORTEN!
Fay blieb stehen, weil sie gleich zurückschreiben wollte. Doch dann hatte sie plötzlich das komische Gefühl, als schleiche sich jemand an sie an, und als sie sich umsah, sah sie zwei massige Cops hinter sich.
»Du hast nichts getan«, sagte der eine. »Wir wollen dir nur ein paar Fragen über deine Tante stellen.«
»Echt jetzt?«, antwortete Fay und begann zu rennen.
Fast augenblicklich rannte sie in den Elektroscooter eines alten Mannes. Sobald sie das Gleichgewicht wiedererlangt hatte, raste sie vom Starbucks aus fünfzig Meter weiter und bog dann auf eine belebte Geschäftsstraße ab. Der Gehweg war gerammelt voll mit Menschen, die ihre Weihnachtseinkäufe machten, daher lief sie auf die Straßenbahnschienen.
Ein paar Hundert Meter weiter sah sie sich um und bemerkte, dass einer der beiden Cops über siebzig Meter zurückgefallen war, während der andere bereits komplett aufgegeben hatte. Dumm war nur, dass ihr eine Straßenbahn entgegenkam, deren Fahrer energisch klingelte, um sie zu verscheuchen.
Als sie auf den Gehweg springen wollte, kam sie ungeschickt auf einem Gleis auf und stürzte kopfüber in einen Haufen Passanten.
»Haltet sie fest!«, schrie der Cop hinter ihr.
Fay schlug sich das Knie auf dem Pflaster auf und landete neben einer schwarzen Frau in einem Haufen von Marks & Spencer- und Primark-Einkaufstüten.
»Sorry!«, stieß Fay hervor.
Die Frau war wütend, weil in ihren Tüten einige Becher zerbrochen waren.
»Haltet sie fest!«, wiederholte der Cop, dem die Menge bereitwillig Platz machte.
Ein Mann packte Fay um die Taille und versuchte, sie hochzuheben, doch sie stieß ihm den Ellbogen in die Rippen. Irgendwie schaffte sie es, weiterzulaufen. Da es in der Einkaufsstraße zu voll war, rannte sie über einen kleinen Platz mit einem Weihnachtsbaum in der Mitte.
Von Polizei war nichts mehr zu sehen, doch Fay befand sich immer noch in einer fremden Stadt und hatte keine Ahnung, ob ihre Tante verhaftet worden war. Nach einem letzten Sprint war sie auf der anderen Seite des Platzes und beschloss, dass sie weniger auffiel, wenn sie von nun an schnell weiterging, statt zu rennen.
Im Weiterlaufen griff sie in ihre Tasche und sah auf ihr Telefon, doch es waren keine weiteren Nachrichten von ihrer Tante gekommen. Sie bog in eine schäbige Gasse mit Friseuren, Kebab-Buden und Läden ein, in denen Handys entsperrt werden konnten. Sie hatte immer noch die Hand in der Tasche, als am anderen Ende der Gasse eine Polizistin auftauchte. Fay wirbelte herum, nur um zu sehen, wie der erste Cop, der ihr gefolgt war, hinter ihr herkam.
»Bleib stehen, dann passiert dir nichts«, rief die Frau und zog einen Schlagstock.
Fay suchte in ihrer Tasche nach dem Griff eines kleinen Taschenmessers. Sie rechnete sich mehr Chancen aus, wenn sie die Frau angriff, die kleiner war, klappte daher die Klinge aus und rannte los.
Da die Polizistin nur eine schlanke Dreizehnjährige vor sich sah, stellte sie sich breitbeinig hin und schwang unbeholfen den ausziehbaren Schlagstock. Fay setzte ihr Kickbox-Training ein, wich dem Schlag aus und versetzte der Frau einen nach hinten gerichteten Tritt.
Durch die Schutzkleidung der Polizistin zeigte der Tritt weniger Wirkung, als Fay gehofft hatte, doch es reichte, um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen und sie gegen die Aluminiumrollläden eines indischen Restaurants fallen zu lassen.
Mittlerweile war der andere Cop bei ihnen angekommen und zielte mit dem Schlagstock auf Fays Arm, um ihr das Messer aus der Hand zu schlagen. Doch Fay sah den Schlag kommen, wich zurück und schnellte mit dem Messer vor, als der Cop das Gleichgewicht verlor.
Die Messerspitze traf den Beamten am Hals und verpasste ihm einen Schnitt bis zur rechten Wange. Fay sprang zurück, als der Cop stolperte und Blut hustete. Wenn er starb, war sie geliefert. Wenn man ihre Tante verhaftet hatte, war sie geliefert. Es war fast so schlimm wie damals, als sie ihre Mutter gefunden hatten, von einem der Drogendealer gefesselt und gefoltert.
Aber zumindest kann ich gut rennen.
4
Ständig sah Fay das Messer und das Blut vor sich. Sie war eine halbe Ewigkeit gerannt und hatte jeden Moment damit gerechnet, über sich einen Hubschrauber zu sehen oder dass sie von Mannschaftswagen eingekesselt würde. Doch hatte sie es geschafft, sich ein paar Kilometer vom Stadtzentrum zu entfernen, in eine Gegend mit schäbigen Wohnblocks.
Fay schlüpfte zwischen die Seitenwand eines Hauses und eine überwucherte Hecke. Ihre Schuhe patschten über angefrorene Müllsäcke, bis sie bei einer kurzen Treppe ankam, die zu einer verbretterten Tür führte.