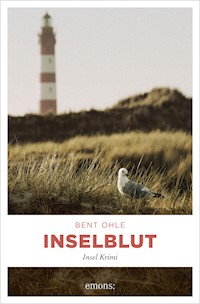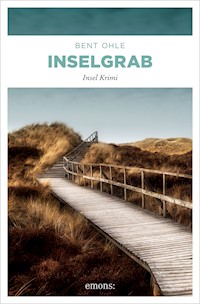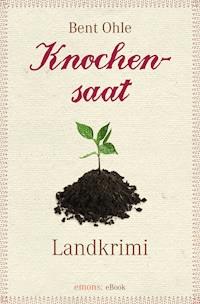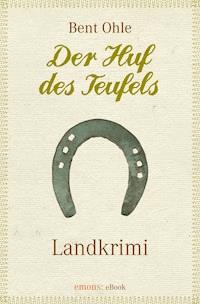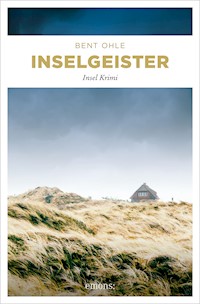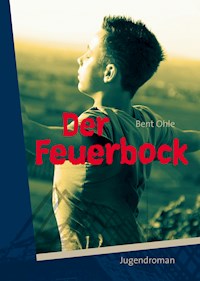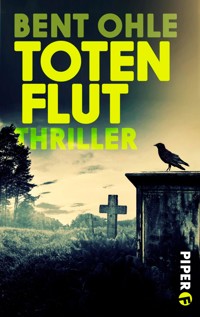
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das junge Mädchen wird das Ende dieser Nacht nicht mehr erleben. Ebenso wenig wie die anderen Mädchen vor ihr. Er hat ihr Grab schon vorbereitet und fein säuberlich mit einer Nummer versehen. Obwohl schon so viele Mädchen sterben mussten, ist sein Werk noch lange nicht vollbracht. Doch dann entdecken Jagdhunde eines der Gräber. Aus ganz Deutschland treffen Experten ein, unter anderem die ehrgeizige junge Elin. Sie macht sich auf die Suche nach dem Serienmörder. Dieser hat schon sein nächste Opfer im Visier: Elin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Für meinen Vater. Du gehst immer mit mir.
ISBN 978-3-492-98028-9
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2013 © Piper Verlag GmbH, München 2010 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Jaroslaw Grudzinski / Shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2010
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
My father’s house shines hard and bright
It stands like a beacon calling me in the night
Calling and calling, so cold and alone
Shining ’cross this dark highway
Where our sins lie unatoned
Bruce Springsteen
Teil 1
Tropfen
Kapitel 1
Nichts an dieser Nacht deutete darauf hin, dass sie grausam und blutig enden würde. Nichts deutete darauf hin, dass in dieser Nacht ein Leben gewaltsam beendet würde. Im Gegenteil. Diese Nacht war von Leben erfüllt. Ein ruhendes, friedvolles Leben, das auf dem Land zu liegen schien wie ein schlafendes Kind. Der Tod hatte hier keinen Platz. Der Tod gehörte nicht hierher. Er war ein Fremder auf dieser Erde, ein dunkler heimlicher Fremder. Er konnte gar nicht von dieser Welt sein, nein, nicht hier und nicht heute. Es sei denn, es gab noch eine zweite Welt. Eine Welt unter dieser. Eine unterirdische Zone, tief und kalt, und so dunkel, dass nie ein Lichtstrahl dorthin gelangen würde.
In der warmen Sommerluft schwebten die Gerüche der Blumen und Gräser. Grillen zirpten, die Sterne standen klar und groß an dem weit aufgespannten Nachthimmel, und der Mond warf ein angenehm kühles Licht auf die Straßen und Felder.
Auf einem kleinen Feldweg parkte ein roter VW Polo mit dem verschmutzten Rest eines abgerissenen Aufklebers auf der Heckklappe. Annette Krüger hatte den Polo einer älteren Dame abgekauft. Auf dem Aufkleber war der Name eines Kurorts zu lesen gewesen, an den sich Annette schon nicht mehr erinnern konnte. Doch damals hatte sie den Anblick dieses hässlichen Klebestreifens nicht ertragen können und ihn kurzerhand entfernt. Die Rückstände auf dem Lack waren ihr egal gewesen. Hauptsache, man konnte den albernen Sticker nicht mehr sehen.
Annette saß mit Mike im Auto. Mikes Vespa stand rechts neben dem Polo. Der Motor war noch warm, als die beiden sich wieder anzogen. Annette knöpfte ihre Bluse zu, und als sie den letzten Knopf verschlossen hatte, erstarrte sie plötzlich. Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Mike, der noch mit bloßem Oberkörper neben ihr saß, bemerkte, dass etwas nicht stimmte.
»Was ist?«, fragte er.
»Ich kann das nicht mehr.«
Mike verstand nicht. Er hatte keine Ahnung, wie die Situation, die für ihn vollkommen klar gewesen war, so unvermittelt hatte umschlagen können.
Mikes ahnungsloses Erstaunen machte Annette aggressiv. Sie musste es tatsächlich erst aussprechen, damit er es kapierte.
»Ich komm mir vor wie eine Nutte! Diese Treffen hier draußen im Auto. Eine schnelle Nummer und du fährst wieder zu ihr. Ich will das nicht mehr!«
»Aber eben war doch noch alles in Ordnung!«
»Nein, es war nie in Ordnung. Du musst es ihr endlich sagen! Oder ich werde es tun!«
»Ich mach’s ja. Es ist nur gerade …«
»… nicht der richtige Zeitpunkt«, beendete Annette den Satz für ihn. »Es wird nie der richtige Zeitpunkt sein, Mike. Nie! Weil es immer schwer sein wird. Egal wann. Aber langsam musst du dich entscheiden. Ich werde nicht länger auf einsamen Feldwegen auf dich warten. Ich bin mehr wert als das.«
Sie nahm sein T-Shirt und drückte es ihm vor die Brust. Es war so eine wunderbare Nacht gewesen, doch jetzt war alles vorbei. Annette verlangte eine Entscheidung von ihm, gegen die er sich schon lange sträubte. Er spürte so etwas wie Erniedrigung, als er sich vor ihren Augen wieder anziehen musste. Vielleicht hatte auch sie sich erniedrigt gefühlt, doch in dieser Situation war es ihm egal.
»Entweder du bist stark genug, um bei ihr zu bleiben, oder du bist stark genug, um zu mir zu kommen«, sagte sie und starrte dabei auf die schwarze Windschutzscheibe.
Im Augenwinkel sah sie ihn aussteigen, und dann krachte die Tür ins Schloss. Sie hatte nicht streiten wollen. Sie hatte auch nicht gewollt, dass er ging. Sie wollte, dass er endlich zu ihr stand.
Der Motor der Vespa röhrte auf. Es folgte die kurze Pause vor dem Abfahren, in der Mike sich immer den Helm aufsetzte. Genau in diesem Moment warf sich ein Schatten gegen ihr Seitenfenster. Als Annettes Kopf herumfuhr, war er bereits wieder verschwunden. Der Schreck fuhr ihr glühend heiß in die Knochen, und ihr Herz schlug so hart gegen ihre Brust, dass sie glaubte, es sprenge ihren Brustkorb. Es musste Mike gewesen sein, der noch einmal abgestiegen und zur Fahrertür gekommen war. Vielleicht wollte er ihr noch etwas sagen, sich entschuldigen oder ihr versichern, dass er jetzt endlich eine Entscheidung treffen würde. Doch kaum hatte sie diesen Gedanken beendet, hörte sie die Vespa auch schon losfahren.
»Mike!«, rief sie ihm hinterher und war sich nicht sicher, ob es eine Warnung oder ein Hilferuf war. Im Rückspiegel sah sie ihn nach rechts auf die Landstraße abbiegen, dann entfernte sich der Lichtkegel immer weiter und weiter, und das Motorengeräusch verstummte wie der Nachhall eines Echos. Jetzt war sie allein auf dem Feldweg, und von außen drückte die dunkle Nacht gegen die Fenster.
Annette konnte nichts sehen, aber sie fühlte sich beobachtet. Da war etwas. Etwas lauerte da draußen auf sie, da war sie sich mit einem Mal vollkommen sicher. Etwas, das sie daran hindern wollte, in ihr Leben jenseits der Dunkelheit zurückzukehren. Sie streckte ihre zitternde Hand aus und bekam den Zündschlüssel zu fassen. Ruckartig drehte sie ihn herum, schaltete das Licht ein und gab Gas. Der Motor heulte im Leerlauf auf. Annette legte mit fahrigen Bewegungen den Rückwärtsgang ein. Jetzt musste sie sich umdrehen. Annette fühlte Panik in sich aufsteigen und traute sich kaum, aus der Heckscheibe zu schauen, weil sie vor ihrem geistigen Auge dort im roten Schein des Rücklichts schon denjenigen stehen sah, der den Schatten an ihr Fenster geworfen hatte und jetzt bereit war, sie zu töten. Ein großer Mann im schwarzen Mantel, mit hängenden Armen und narbigem Gesicht. Doch als sie sich umsah, konnte sie lediglich den Grasstreifen in der Mitte des Weges erkennen. Sie gab Gas und fuhr, schneller als sie es sonst tat, rückwärts auf die Landstraße. Noch im Rollen schaltete sie in den ersten Gang und trat das Pedal durch. Mit quietschenden Reifen fuhr sie an und beschleunigte schnell auf 90 Stundenkilometer.
Erst jetzt fühlte sie sich sicher. Ihr eigenes Verhalten kam ihr plötzlich völlig kindisch und lächerlich vor. Annette sah sich im Rückspiegel an und musste laut lachen.
»Angsthase! Häsin! Bunny! Du Angstbunny!« Sie lachte über ihre neue Wortkreation und schaltete das Radio ein. Sie kannte den Song. Run to You von Bryan Adams. Und gerade als sie den Mund öffnete, um mitzusingen, sah sie ihn.
»Scheiße!«, flüsterte sie und trat auf die Bremse.
Kapitel 2
Es war 7 Uhr morgens, als Schröder den Frühstückstisch deckte. Die Kaffeemaschine gurgelte und warf Wasserdampf gegen die Scheibe des Küchenfensters. Schröder zog die Kanne heraus und schenkte sich und seinem Vater eine Tasse ein. Karl sah geduldig dabei zu und nickte, um sich zu bedanken. Er war noch zu müde zum Sprechen. Sein linker Arm lag steif und angewinkelt an seinem Körper an. Er war nach einem Schlaganfall gelähmt. Karl nahm sich ein Brot und legte es auf sein Frühstücksbrett, das mit stumpfen Nägeln versehen war, um ein Wegrutschen den Brotes zu verhindern, wenn er es schmierte. Mit der Butter klappte es ganz gut, doch die Marmelade rutschte ihm immer wieder vom Messer. Ohne ein Wort zu sagen, griff Schröder über den Tisch und half seinem Vater.
Es war ein Morgen, so wie alle anderen Morgen seit vier Jahren auch. Die Abläufe am Tisch waren immer die gleichen, und es kam selten vor, dass die beiden ein Wort miteinander wechselten, außer vielleicht an den Tagen, an denen Schröder nicht arbeiten musste. Doch diese Tage waren sehr selten.
Der Schlaganfall hatte ihrer beider Leben von Grund auf verändert. Karl und Schröder hatten bis dahin allein gelebt. Sie hatten sich vielleicht fünf oder sechs Mal im Jahr gesehen, trotzdem hatte Schröder nicht gezögert, seinen Vater bei sich aufzunehmen. Ein Heim konnte er sich bei seinem Gehalt nicht leisten. In der Anfangszeit kam zweimal pro Tag ein ambulanter Pflegedienst, bis Karl nach einem Jahr wieder in der Lage war, selbstständig zu gehen und kleinere Handgriffe im Haushalt zu erledigen. Aber er brauchte nach wie vor Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen.
Nach dem Frühstück legte sich Karl auf die Couch, und Schröder gab ihm die Fernbedienung für den Fernseher, bevor er zur Arbeit fuhr.
»Ich muss jetzt los.«
»Kannst du meinen Arm noch strecken?«
Den Spasmus im linken Arm konnte Karl nicht selber lösen. Die Physiotherapeutin hatte Schröder einen Trick gezeigt, mit dem er seinem Vater etwas Erleichterung verschaffen konnte. Schröder beugte sich über seinen Vater und griff mit einer Hand an den Oberarm und mit der anderen an Karls Handgelenk. Nachdem er leichten Zug auf den Oberarm ausgeübt hatte, konnte er nun den Unterarm strecken. Und während er das tat, öffnete sich Karls zur Faust geballte Hand von alleine, und der gesamte Arm entspannte sich.
In dem Moment fuhr plötzlich ein heißer, metallener Schmerz wie ein Schwert in Schröders Rücken. Schröder bäumte sich auf, und gleichzeitig gaben seine Beine kraftlos nach. Mit einem gepressten Schrei fiel Schröder auf die Knie und schrie abermals auf, als die Erschütterung die gleißende Klinge noch tiefer in seinen Rücken zu bohren schien. Karl versuchte mit einer Hand seinen Sohn zu stützen, während dieser nach Halt auf dem Tisch suchte. Kalter Schweiß drang Schröder aus allen Poren. Zitternd, stöhnend versuchte er, sich zu halten. Karl stand auf und griff Schröder unter die Achsel.
»Leg dich hin, du musst dich hinlegen!«
»Ich kann nicht!«
»Los, mach schon!«
Schröder nahm all seine Kraft zusammen und hievte sich mit Karls Hilfe seitlich auf die Couch. Wieder schrie er auf. Seine Augen waren weit geöffnet. Er wartete darauf, dass der Schmerz nachließ, doch es passierte einfach nicht.
»Ich ruf Dr. Petri an.«, sagte Karl besorgt und fügte leise hinzu: »Ich weiß manchmal nicht, wer von uns beiden schlechter dran ist.«
Schröder lag auf der Couch wie eine der Pompeji-Leichen, erstarrt und gefangen in einem Korsett aus Schmerz. Wie sein Vater die Nummer seines Freundes und Arztes wählte und was er zu ihm sagte, drang nur dumpf und unverständlich zu seinem Verstand durch. Alles in seinem Kopf und in seinem Körper kämpfte gegen den gleißenden Stahl in seinem Rücken an.
Kapitel 3
Annette Krügers Auto stand auf dem Grünstreifen seitlich der Landstraße. Die ersten Sonnenstrahlen fingen sich in dem Tau, der auf den Scheiben lag. Die Bäume des angrenzenden Waldes und die Heuballen auf den Feldern warfen lange, groteske Schatten. Vögel zwitscherten. Es wäre eine Idylle gewesen, wäre da nicht der verlassene Polo gewesen, der wie ein Mahnmal an der Straße stand. Oder wie ein Grabstein.
Alf Jansen war Lehrer in Belm, einem kleinen Vorort von Osnabrück. Er lebte im Haus seiner verstorbenen Eltern, war vierzig Jahre alt, ledig und war, wie nahezu jeder andere Lehrer auch, sparsam und führte ein unauffälliges Leben. Obwohl er schon fast auf dem Land lebte, besaß er kein Auto, aber ein gutes, solides Fahrrad, das ihn bei Wind und Wetter zur Schule trug und das seit nunmehr sechzehn Jahren. Das war eine stolze Lebenszeit für ein Fahrrad, das derart intensiv genutzt wurde. Es begleitete ihn auch in seine Ferien. Er hatte fast ganz Europa mit dem Rad bereist und konnte sich nicht vorstellen, jemals in einem Flugzeug zu sitzen, um an ein Urlaubsziel zu gelangen. Alf unterrichtete Sachkunde und Deutsch, und man konnte sagen, dass er ein sehr ordentlicher, ja, fast pedantischer Mensch war. Pünktlichkeit und Ordnung waren zwei tragende Säulen in seinem Leben. Vielleicht war es eben dieser Umstand, der bis jetzt verhindert hatte, dass Alf eine Frau fürs Leben hatte finden können. Er wurde von Frauen und auch von seinen männlichen Kollegen gemocht und geschätzt, aber seine Art verbreitete auch immer einen Anflug von Distanz.
Vor zwei Tagen bereits hatte Alf Jansen das Auto bemerkt. Er passierte es jeden Tag zweimal, auf seinem Weg zur Schule und zurück. Schon am ersten Tag ahnte er, dass der Fahrer nicht einfach nur zum Pinkeln ausgestiegen war. Er malte sich alle möglichen Szenarien aus, was passiert sein könnte.
Doch die Wahrheit war so viel schrecklicher, dass die Fantasie eines Alf Jansen nicht ausreichte, um auch nur annähernd ein Bild davon zu zeichnen.
Am dritten Tag verließ er sein Haus dreißig Minuten früher in der Absicht, die Polizei zu alarmieren, falls der Polo sich immer noch dort befände. Um 7 Uhr 15 rief er im Polizeibüro in Belm an und wartete dann fünf Minuten, bis Winkler, der Dorfpolizist, eingetroffen war. Winkler brachte seinen Streifenwagen ein paar Meter hinter dem Polo zum Stehen und stieg aus.
»Morgen, Alf!«
»Morgen, Torsten! Das ist der Wagen!«
Winkler schüttelte Jansen die Hand, stellte sich neben ihn und ließ seinen Blick über den Wagen schweifen.
»Sieht nicht so aus, als hätte er ein Panne gehabt.«
Jansen nickte zustimmend und blickte auf die Uhr.
Der Polizist zückte einen Block und einen Stift und begann um das Auto herumzugehen. Er notierte das Kennzeichen.
»Wann hast du das Auto das erste Mal gesehen?«
»Heute ist Donnerstag. Am Montag auf dem Weg zur Schule. Es ist ja nicht ganz ungefährlich, da dachte ich, ich ruf dich besser mal an.«
»Schon richtig. Ist auch verboten, seinen Wagen so abzustellen.«
»Aber warum macht einer so was?«
»Das wird sich rausstellen.«
Winkler blickte in den Wagen, drückte den Türknopf, und tatsächlich sprang die Tür auf.
»Hoppla!«
Jansen blickte noch einmal auf die Uhr, ging dann aber näher an das Fahrzeug heran, weil auch er neugierig war. Winkler saß bereits im Wagen und inspizierte das Handschuhfach, Mittelkonsole, Seitenfächer und die Sonnenblende. Neben diversen Quittungen, CDs, einem Eiskratzer und einem Kalender fand er auch einen Lippenstift.
»Scheint einer Frau zu gehören.«
Er stieg aus und sah sich in der Gegend um. Nirgends waren Spuren zu erkennen. Keine Fußspuren, keine Bremsspuren, keine Kleidungsstücke, gar nichts.
»Und jetzt?«, fragte Jansen in die Stille hinein.
»Lass ich das Ding abschleppen, bevor noch einer reinfährt!«
»Brauchst du mich noch? Ich würd gern …«
»Nein, vielen Dank! Fahr ruhig weiter.« Und mit einem Blick in den Himmel fügte er hinzu: »Sieht nach Regen aus.«
»Ja, und ich dachte, es wird ein schöner Tag.«, antwortete Jansen und schwang sich auf den Sattel.
»Mach’s gut!«
»Wiedersehen!«
Winkler ließ seinen Blick ein letztes Mal über das Feld schweifen und stieg wieder in seinen Streifenwagen. Kaum hatte er die Tür geschlossen, zerplatzte der erste Regentropfen auf der Windschutzscheibe.
Die Zeit des Regens begann. Es würde eine lange Regenperiode werden. Das Wasser würde endlos vom Himmel fallen. Der Himmel würde weinen, wie er noch nie geweint hatte. So viel Wasser.
Kapitel 4
Dr. Petri war Schröders einziger Freund. Schröders Beruf ließ kein Privatleben zu, und bei den Kollegen auf dem Revier war Schröder nicht unbedingt in die engere Auswahl für den beliebtesten Kollegen gekommen. Außerhalb des Reviers verbrachte er die meiste Zeit beim Arzt. Es war also nicht weiter verwunderlich, dass sein Knochendoktor irgendwann zu seinem Vertrauten geworden war.
Petri hatte Schröder bereits bei seinem ersten Besuch gemocht. Ein unbeirrbarer Sturkopf, verschroben, aber amüsant und überdies ein sehr einträglicher Patient. Die Ecken, an denen sich die meisten Leute stießen, brachten Petri zum Lachen. Schröder hatte einen staubtrockenen Humor. Wenn er eine witzige Bemerkung fallen ließ, tat er das meist mit einer todernsten Miene. Kannte man ihn nicht so gut, und das traf wohl auf jeden zu, der ihn nicht länger als ein paar Jahre erlebt hatte, konnte man leicht in Unsicherheit geraten, wann er Ernst machte und wann er einen auf den Arm nehmen wollte. Petri hatte Schröder eigentlich nie wirklich lachen sehen. Ein Lachen hätte man in Schröders Gesicht allenfalls in den Augen sehen können, doch dass sich seine Mundwinkel mal mehr als zu einem Lächeln angehoben hätten, so etwas gab es nicht. Und zu seiner eigenen Überraschung vermisste es Petri auch nicht.
Als er im Wohnzimmer die Spritze aufzog, hämmerte der Regen bereits gegen die Scheiben. Karl wendete sich ab, als Petri die Spritze in den Rücken seines Sohnes stieß. Es gab ein knirschendes Geräusch, und Schröder stöhnte durch die Nase. Langsam drückte Petri die leicht gelbliche Flüssigkeit in die Wirbelsäule, zog die Spritze heraus und wischte mit einem Tupfer einen kleinen Blutstropfen fort, der aus dem Einstichloch hervorquoll.
»Ich fürchte, allzu lange wirst du dich nicht mehr um eine Operation drücken können.«
»Hab ich keine Zeit für«, sagte Schröder harsch.
»Hör lieber auf den Doktor!«, sagte Karl.
»Du klingst langsam wie Mama, Papa!«, sagte Schröder, und in diesem Moment klingelte sein Handy. Petri reichte es ihm.
»Ja?« Schröder horchte einen Moment in den Hörer, bevor er antwortete.
»Ich will, dass ihr den Wagen untersuchen lasst! Das ganze Programm! Ich mach mich auf den Weg!«
Kaum hatte er aufgelegt, versuchte er sich aufzurappeln.
»Ich sag ja, ich hab keine Zeit!«
»Kannst du dich nicht krank melden?«, fragte sein Vater und ließ es wie einen energischen Ratschlag klingen.
»Ach, Papa …«
»Dein Vater hat recht. Lange hältst du das nicht mehr durch.«, sagte Petri.
Schröder kämpfte sich auf die Beine.
»Lasst mich zufrieden!«
Humpelnd durchquerte er die Wohnung, nahm umständlich die Jacke vom Haken an der Garderobe und war ohne ein weiteres Wort verschwunden.
Vier Kriminaltechniker in weißen Schutzanzügen untersuchten den Wagen, als Schröder die Halle betrat. Die gelangweilten Gesichter seiner beiden Kollegen Keller und Trostmann konnten seine ohnehin schon schlechte Laune nicht bessern. Im Gegenteil. Schröder hasste die beiden. Und er war sich nie sicher, ob es gut oder schlecht war, dass sie als Partner immer im Doppelpack auftraten.
Trostmann war ein stumpfsinniger, alter Kauz, dessen Intellekt gerade mal von seiner Haustür bis zur Gartenpforte reichte. Er meinte, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, und hielt nicht damit zurück, diese Erkenntnis jedem mitzuteilen. Doch er war ein enttäuschter Mann. Enttäuscht vom Leben, das ihn in einen Beruf gedrängt hatte, in dem er zwar abgesichert war, der jedoch auch ihm eine gescheiterte Ehe und eine angehende Alkoholsucht beschert hatte. Er war ein unbelehrbarer Zyniker, und Keller, zwanzig Jahre jünger, war sein Papagei, der ständig auf seiner Schulter saß und ihm jeden gequirlten Mist nachquatschte. Keller hatte mit Trostmann seine Zukunft direkt an seiner Seite. Wenn er wissen wollte, wie er kurz vor seiner Pensionierung aussehen würde, musste er nur neben sich schauen. Vielleicht hatte er eine nicht ganz so ausgeprägte zynische Ader wie Trostmann, aber er arbeitete daran.
Schröder humpelte auf die beiden zu und beobachtete dabei die Kriminaltechniker.
»Du siehst echt scheiße aus!«, freute sich Trostmann.
»Quatsch mich nicht voll, Trostmann.«
»Oh, etwas gereizt heute. Kennt man gar nicht von dir.«, sagte Keller.
»Du lernst mich gleich kennen! Also, wessen Wagen ist das?«
Schröder stemmte seine Fäuste in die Hüften und versuchte, sich gerade zu halten. Allein das kostete ihn so viel Kraft, dass ihm der Schweiß in Strömen am Körper hinablief.
»Er gehört einer gewissen Annette Krüger«, begann Trostmann, »achtzehn Jahre alt. Sie ist am Montag als vermisst gemeldet worden. Ihr Wagen stand seit Sonntagnacht an der L 87 zwischen Belm und Wulfen.«
Schröder ging um das Auto herum. Einer der Techniker nahm seine Maske ab und kam auf Schröder zu. Franke, der Chef der Kriminaltechnik, reichte ihm die Hand, nachdem er sich des Gummihandschuhs entledigt hatte. Franke war einer der wenigen, mit denen Schröder auskam. Er sah ein bisschen aus wie Monk, die Detektivfigur aus dem Fernsehen, hatte aber sonst wenig mit dem Serienhelden gemein. Das, was Schröder an ihm am meisten schätzte, war seine Kompetenz. Franke war jemand, der ohne Weiteres Karriere in einer wesentlich größeren Stadt hätte machen können, doch er war ein Mann, der auf unaufdringliche Art zufrieden wirkte mit dem, was er hatte. Schröder war sich sicher, dass er sich bewusst gegen die große Karriere entschieden hatte. Die Gründe kannte er nicht und brauchte sie auch nicht zu kennen. Franke machte hervorragende Arbeit und war dabei eine der ausgeglichensten Personen, die Schröder jemals begegnet waren.
»Habt ihr schon was?«, fragte Schröder.
»War nicht so schwierig. Es lagen zwei Taschentücher im Fußraum des Fahrers. Wir fanden Sperma darin. Fingerabdrücke massenweise, wie es sich gehört, aber kein Blut. Auch keine Kampfspuren«, antwortete Franke.
»Dann kann man eine Vergewaltigung wohl ausschließen.«
»Ich sammle nur die Fakten. Das Deuten ist deine Aufgabe.«
Keller und Trostmann näherten sich von hinten, wahrscheinlich weil sie es nicht länger aushielten, an dem Gespräch nicht beteiligt zu werden.
»Sie schläft mit ihrem Freund. Der macht Schluss mit ihr, sie ist völlig fertig und läuft heulend davon«, mutmaßte Trostmann.
Schröder drehte sich zu ihm um.
»Sie läuft einfach weg. Und der nächste Ort ist wie weit entfernt?«
»Vier Kilometer. Vielleicht ist sie ja per Anhalter gefahren.«
»Nicht zu fassen, dass sie Typen wie dich bei der Polizei arbeiten lassen«, sagte Schröder. Franke konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.
»Mann, in dem Alter ist das doch ganz normal! Die Hormone spielen verrückt, Liebeskummer, Streit mit den Eltern. Man läuft mal weg, dann kommt man wieder. Hatten wir doch oft in letzter Zeit«, fügte Keller hinzu.
Schröder hatte wenig Geduld mit derartig unqualifizierten Äußerungen. Sein Rücken plagte ihn schon genug, da wollte er seine Zeit nicht mit noch mehr solcher Kommentare verschwenden.
»Ich will, dass ihr beide den Tatort untersucht. Alles, was auffällig ist, bringt ihr mir und legt es mir auf den Schreibtisch, verstanden?«
»Tatort?«, fragte Trostmann, »wir haben keinen Tatort, Schröder. Du siehst Gespenster. Wie beim letzten Mal auch.«
Schröder war bereits im Begriff die Halle zu verlassen. Trostmann rief den letzten Satz hinter ihm her. Schröder hielt kurz inne. Es wurde ganz still in der Halle. Alle hier wussten, dass Trostmann einen wunden Punkt getroffen hatte. Aber Schröder ließ es auf sich beruhen und warf die Tür hinter sich ins Schloss.
Kapitel 5
Natürlich war es kein Tatort, dachte Schröder während er im Auto saß. Sie hatten keinen Tatort, weil sie keine Leiche hatten. Nur eine Vermisstenanzeige. Und Schröders Gefühl. Sein Gefühl sagte ihm, dass dieses Mädchen einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Doch auf sein Gefühl setzte hier niemand mehr einen Heller. Es hatte mehrere ähnliche Fälle im Kreis Osnabrück gegeben in den letzten zwei Jahren. Mädchen, die spurlos verschwunden waren. Mädchen, die man nie wieder lebend finden würde. So sah Schröder es. Und mit dieser Meinung hatte er sich isoliert innerhalb des Reviers. Keiner teilte seine Theorie von einem Serienkiller. Allein der Begriff war für die meisten Menschen hier so unreal, dass sie glaubten, Serienkiller existierten nur im Fernsehen und in Romanen. Man wurde regelrecht mit Serienkillern zugeworfen, wenn man sich das Fernsehprogramm oder den Buchmarkt anschaute. Aber in Osnabrück? Nein, hier doch nicht. Osnabrück war eine kleine, saubere, friedliche Stadt. Die Stadt kümmerte sich um seine Studenten, um den Ausbau der Innenstadt, Geschäfte schossen aus dem Boden, Häuser wurden saniert, erneuert, Fassaden poliert. Die Menschen hier sorgten sich um ihre Vorgärten, um Verkehrsberuhigungen vor Schulen, um die Preiserhöhung im öffentlichen Verkehr und im nächsten Supermarkt. Das Aufregendste, was hier passierte, waren die Bombenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg, derentwegen regelmäßig ganze Stadtteile evakuiert werden mussten. Schröder musste selbst zugeben, dass ein Serienkiller hier so etwas wie ein Wesen aus einer anderen Welt war.
Umso weniger wusste Schröder, was er Annette Krügers Eltern über ihr Verschwinden erzählen sollte. Er hielt sich für einen schlechten Lügner und glaubte, jede unehrliche Antwort auf eine ihrer Fragen stände ihm sofort ins Gesicht geschrieben. Alles in ihm wehrte sich dagegen, jetzt auszusteigen, doch er musste es tun.
Das Haus stand unter einer riesigen Kastanie, die einen Regenschatten auf das Haus und einen Teil des Vordergartens warf. Schröders Rückenschmerzen strahlten nun auch in sein rechtes Bein aus. Vor der Haustür nahm er zwei Schmerztabletten aus einem Fläschchen und schluckte sie trocken hinunter. Dann klingelte er.
Dieses war der schlimmste Moment der Polizeiarbeit. Hiervor fürchtete er sich am meisten. Nicht vor den Opfern, mit denen man sprach, und nicht vor den Leichen, die man fand. Man wusste ja nie, was einen genau erwartete, wenn man zu einem Tatort gerufen wurde. Es war ein Sprung ins kalte, aber trübe Wasser. Mit den Angehörigen eines Opfers zu sprechen, war eine Erfahrung, die man einmal machte und sich danach wünschte, es nie wieder tun zu müssen. Nie wieder. Das Leid und der Schmerz, der auf diese Menschen einstürzte, waren für ihn kaum zu ertragen. Nie hatte er sich daran gewöhnen, sich damit arrangieren oder es ausblenden können. Das Grauen der Morde wurde einem bei diesen Besuchen aufs Brutalste bewusst. Hier wurden sie erst Wirklichkeit. Es war der Sprung ins kalte Wasser, nur, dass das Wasser glasklar war und man auf den Grund sehen konnte, wo einen messerscharfe Felsen erwarteten, auf die man aufprallen würde. Trotzdem musste man springen.
Die Tür öffnete sich, und Herr Krüger zog sie so weit auf, dass er sich wie zum Schutz dahinter verstecken konnte.
»Guten Morgen. Mein Name ist Schröder. Ich bin von der Kripo Osnabrück.«
Schröder zeigte seine Marke und versuchte dem mit seiner Angst kämpfenden Vater mit einem Lächeln zu begegnen.
»Was ist passiert?«, wollte der wissen, und seine Augen versuchten die Antwort irgendwo in Schröders Gesicht abzulesen.
»Darf ich reinkommen?«
Herr Krüger nickte, und während Schröder eintrat, stellte er seine Frage ein zweites Mal.
»Ich kann ihnen noch keine Auskunft geben, wir wissen es nicht.« Kaum hatte Schröder den Satz beendet, huschte Frau Krügers Schatten von einer Glastür zurück ins Wohnzimmer. Sie musste gelauscht haben. Schröder konnte es ihr nicht verdenken. Herr Krüger meinte, sich für seine Frau entschuldigen zu müssen.
»Sie müssen verstehen, sie steht unter großem Stress, wir machen uns solche Sorgen …«
Schröder legte beruhigend seine Hand auf Krügers Schulter, und der nickte dankbar.
Sie betraten das Wohnzimmer. Die Angst war ebenso fühlbar wie die Hitze, die in dem Raum stand. Eine bleierne, erdrückende Luft. Die Terrassentür war verschlossen, die Gardinen zugezogen. Auf der Terrasse standen Gartenmöbel. Die Stühle waren gegen den Tisch gekippt. Der Regen trommelte dumpf aufs Dach. Frau Krüger saß auf einem Sessel und blickte hinaus.
»Guten Morgen«, sagte Schröder, und die Frau drehte sich nur halb zu ihm herum. Selbst im Profil war ihr von Sorge und Angst gezeichnetes Gesicht deutlich zu erkennen. Ihre Augen waren wund vom Weinen, und sie zitterte am ganzen Körper.
Schröder und Herr Krüger setzten sich zu ihr.
»Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen noch nicht mehr berichten kann.« Es kam keine Reaktion und auch keine Antwort, also sprach Schröder einfach weiter.