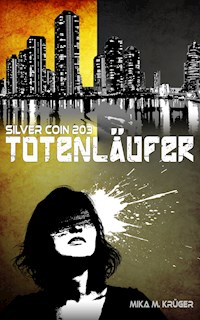
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Rina gehört zu jenen in Red-Mon-Stadt, die keinen Wert haben. Sie gilt als nutzlos, wird verfolgt und lebt in ständiger Angst um sich und die Menschen, die sie liebt. Als sie dann in die Mündung einer Waffe blickt, glaubt sie, den Kampf ums Überleben verloren zu haben. Doch der Soldat mit dem Schießbefehl lässt sie laufen, zeigt ihr sogar den Weg zu den Rebellen. Nur wieso hat er seinen Befehl missachtet? Wieso hat er sich gegen die gewandt, die ihm Sicherheit garantieren? Diese Fragen rotieren in Rinas Kopf, bis sie erfährt, wer sich hinter der Uniform verbirgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mika M. Krüger
TOTENLÄUFER
Auftakt der Reihe Silver Coin 203
»Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.«
Benjamin Franklin
Inhalt
Worte aus Red-Mon-Stadt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Danksagung
Das Buch
Die Autorin
Ausschnitt aus der Kolumne: »Der Totenläufer, ein Held der Sicherheit«. Entnommen aus der Tageszeitung Red-Mon-Aktuell vom 24.10.2075.
»[…] Die Mitglieder der REKA bezeichnen den Totenläufer als unmenschlichen Schlächter. Als Monster, das kaltblütig mordet. Doch ist es Mord, wenn wir zur Verteidigung unseres Selbst zur Waffe greifen? Gewiss nicht. Und nichts anderes tut er. Im Namen der Bewohner unserer herrlichen Stadt riskiert er täglich sein Leben, um uns vor der gefährlichsten aller Seuchen zu bewahren: der Lorcakrankheit. Er ist ein einsamer Wolf in der Uniform eines Soldaten, der die Verantwortung für jeden von uns auf den Schultern trägt. Die Stadtverwaltung unterstützt sein Vorgehen und möchte den Bürgern mitteilen: Der Totenläufer ist ein Held und kein Monster. Wir sollten ihm dankbar sein. […]«
Ausschnitt aus der Rebellenzeitschrift Kalter Sturm, die im Geheimen von der REKA veröffentlicht wird. Artikel vom 25.10.2075
»[…] Es ist wahr. In der Nacht vom 23. zum 24. Oktober sind nicht nur drei unserer treuesten Anhänger vom so genannten Totenläufer exekutiert worden, sondern mit ihnen fünf Lorca, die sich unter unserem Schutz befanden. Die Gruppe versteckte sich in einer unterirdischen Notunterkunft in Nordend. Bisher ist unklar, wie sie entdeckt werden konnten. Wir betrauern den sinnlosen Tod dieser Menschen. Es ist der schwärzeste Tag in der Geschichte unserer Organisation. Doch wir werden uns von dieser Brutalität nicht abschrecken lassen. Der Totenläufer und die Verwaltung werden für diese Taten zur Rechenschaft gezogen. […]«
Leserbrief an den Totenläufer vom 25.10.2075
»Sehr geehrter Totenläufer,
Sie haben meine Familie gerettet. Durch Ihr Zutun konnten die Lorca, die sich unter unserem Wohnhaus versteckt gehalten haben, ausfindig und unschädlich gemacht werden. Meine Familie musste sich medizinischen Tests unterziehen, aber die Lorcakrankheit konnte nicht diagnostiziert werden. Ihr Scharfsinn, Ihr Einsatz, Ihre Liebe zu Red-Mon-Stadt hat uns gezeigt, welchen Wert Treue hat. Im Namen meiner Frau, meiner Tochter, meinem Sohn und meinen zwei kleinen Enkeln möchten wir uns bei Ihnen bedanken. Wir verneigen uns in tiefer Demut.«
Antwort des Totenläufers in handschriftlicher Signatur
Es war mir eine Ehre.
Die Welt drehte sich rückwärts. Sie waren tot. So tot wie zertretenes Ungeziefer oder Ratten mit Genickbruch. Keiner von ihnen würde erneut aufstehen, den Himmel sehen, das Wasser rauschen hören, atmen. Allein Rina hatte es geschafft, so wie immer.
Doch dieses Mal war sie nicht unbemerkt entkommen, denn ein SDF-Soldat folgte ihr. Seine vagen Schritte zwischen Regen und Wind glichen der Präsenz eines Raubtiers auf der Jagd. Niemals würde er sie laufen lassen. Dabei konnte sie nicht sterben. Nicht jetzt, wo alle anderen gegangen waren. Sie musste sich an ihre Überlebensformel erinnern: Schau niemals zurück, sprinte in die Zukunft, denn alles andere hat keine Bedeutung.
Rina rannte über die hohen Metallbrücken des Wohnviertels, die über ein weit verzweigtes Netz aus Straßen und Fußwegen führten und ließ silbergraue Hochhäuser hinter sich. Sie musste zum Stadtrand. Dort gab es ein Versteck, wo sie bis zum Morgengrauen sicher war. Wenn sie schnell genug dorthin gelangte, hatte sie eine Chance.
Hastig sprang sie die Treppen zum tiefergelegenen Stadtteil herunter, überquerte den Fußgängerweg, sah einen Monorailzug an sich vorbeirauschen, hörte, wie sich ihr Atem gehetzt aus der Lunge presste. Kalter Regen peitschte ihr ins Gesicht und sie glaubte, das Salz des Meeres zu schmecken. Ganz gleich, ob das Meer noch viel zu weit entfernt war.
Sie zwängte sich an Passanten vorbei, die sich angeregt unterhielten und richtete den Blick starr auf den Boden, um nicht erkannt zu werden. Hoffentlich tat man sie als verwirrte Person ab und ging nicht von einer Bedrohung aus.
Plötzlich stieß jemand heftig gegen sie. Rina stolperte und prallte gegen eine Frau, an der sie sich festklammern musste. Etwas ging zu Boden und zerbrach scheppernd.
Vor Schreck entfuhr der Frau ein erstickter Schrei und sie stieß Rina von sich weg.
»Pass doch auf, wo du hinläufst«, schimpfte sie, doch Rina gab nichts darauf, wandte sich ab und wollte fort. Sie durfte auf keinen Fall stehen bleiben und schon gar nicht diesen Leuten zu nahe kommen. Wenn sie ihr ins Gesicht sahen, dann …
Jemand packte ihren Arm und riss sie herum. Der Soldat? Nein, er hätte sie erschossen, wäre er schon so dicht bei ihr gewesen.
»Kannst du nicht die Augen aufmachen?«, fauchte ein Mann in blauem Overall. »Das Monotab wirst du mir ers…«
Er brach ab, sah sie an, lang und ausdauernd, bis er begriff, was da vor ihm stand. Ihre schneeweiße Haut und die goldenen Fäden in ihrer Iris ließen sich nicht verbergen. Sofort löste er seinen Griff und in seine Miene schlug sich blutrote Panik.
»Ein Lorca!«, brüllte er, »Sie ist ein Lorca! Und ich habe sie angefasst!« Ungläubige Blicke streiften sie, fühlten sich an wie heißes Metall auf nackter Haut. Einem Sicherheitsrisiko wie ihr auf offener Straße zu begegnen, waren die Stadtbürger nicht gewohnt, denn normalerweise entsorgte die Verwaltung jemanden wie sie. Da gab es keine Ausnahmen.
Eine Person schrie vor Entsetzen und zeigte mit ausgestrecktem Finger auf Rina. Ihr Atmen wurde unregelmäßig, der Körper bebte. Keine Zeit, sich darauf zu konzentrieren. Augenblicklich wandte sie sich ab, kämpfte sich durch die Menschen, die sich um sie drängten und hörte nicht auf die Worte, die ihr nachgerufen wurden. Sie wusste genau, was die Leute sagten. ›Stirb Lorca, stirb!‹
Der Soldat war bedrohlich näher gekommen. Trotz schwindender Kraft beschleunigte sie ihren Schritt, passierte die Bogenstraße, rannte an länglichen Wohnkomplexen mit Glasfassade vorbei, schlug Haken, um kein zu leichtes Ziel abzugeben.
Dann endlich taten sich vor ihr die skeletthaften Neubauten auf, die den Stadtrand ankündigten. Nur noch ein paar Schritte und ihr konnte nichts mehr geschehen. Sie setzte zum Sprint an, nahm all ihre verbliebene Kraft zusammen, um schneller zu sein als ihr Verfolger.
Am Meer angelangt, blieb sie kurz stehen, sah nach rechts und links und entdeckte den Bootssteg, unter dem sich in der aus Beton gefertigten Stadtplattform ein Ablaufkanal befand. Rasch lief sie dorthin, kroch über den Rand der Stadtgrenze, stieg auf einen Vorsprung, kletterte zur Seite, erreichte den Metallsteg, sah das runde Loch unter sich, streckte das Bein aus, um es zu erreichen.
Das Klicken einer Waffe über ihrem Kopf. Sie sah auf. Der SDF-Soldat in tiefdunkelblauer Uniform hatte seine Waffe auf sie gerichtet. Regentropfen prasselten auf seinen Helm. Der Tod höchstpersönlich stand vor ihr.
Rina wollte einen seiner Gedanken greifen und dafür sorgen, dass er es sich anders überlegte, aber es gelang ihr nicht. Sein Geist war ungewöhnlich stur und schien von dichtem Nebel umgeben zu sein. Trotzdem zögerte er. Zögerte, zögerte, zögerte …
Drei kurz aufeinanderfolgende Schüsse hallten durch die Dämmerung. Rina konnte fühlen, wie die eiskalten Klauen des Todes ihren Körper packten und fortrissen. Doch er rauschte an ihr vorbei und strandete im Meer.
Der Soldat hatte neben sie gezielt. Er schulterte seine Waffe, hockte sich hin und betrachtete sie. Wollte er mit ihr spielen? War das sein Plan? Würde er seine Überlegenheit nutzen, um ihr wehzutun, so wie es andere vor ihm getan hatten?
Sie rührte sich nicht, starrte ihn an, bis er mit einer kurzen Kopfbewegung in Richtung ihres Verstecks deutete. Ihr Hals wurde trocken und alle Kraft schien aus ihrem Körper zu weichen. Das konnte er unmöglich ernst meinen.
»Jetzt versteck dich da schon«, flüsterte er, als er merkte, dass sie sich noch immer nicht bewegte. »Hier taucht gleich noch wer auf.«
Und sie tat es, setzte einen Fuß auf die untere Kante des Ablaufkanals, suchte Halt an der Wand und kletterte hinein. Entkräftet duckte sie sich in die Dunkelheit und rutschte ein Stück nach hinten, bis sie im Rücken ein Metallgitter spürte. Sicher. Für den Moment.
Sie hielt den Atem an und lauschte auf jedes Geräusch. Erst war es still, dann hörte sie schwere Schritte und jemand fragte, wo der Lorca sei. Ins Meer gestürzt, war die knappe Antwort des Soldaten und sein Gesprächspartner stieß einen lauten Fluch aus. Der Mann sprach von Versagen, einer Verantwortung der Stadt gegenüber und Pflichten. Leichen durften nicht einfach verschwinden. Seine Worte glichen einer ängstlichen Belehrung, die er wohl nur formulierte, weil er genau wusste, wie gefährlich es war, Fehler zu begehen. Bis ihn der Soldat schroff unterbrach. Er solle nicht vergessen, vor wem er stand. Wenn die Statistik mal nicht stimmte, würde sich das nicht negativ auf das Ansehen der Einheit auswirken. Selbst ihre Vorgesetzte Amanda Whitman sei leicht zu besänftigen. Es lohne sich nicht, wegen solch einer Kleinigkeit die Fassung zu verlieren. Daraufhin folgte ein unverständliches Murmeln und erneut waren Schritte zu hören. Dann wurde es still.
Rina hatte die Arme um ihre Beine geschlungen. Ihre nasse Kleidung klebte an ihrem Körper, der vor Erschöpfung schmerzte. Ihre Gedanken kreisten inhaltslos und wirr durch ihren Kopf. Überall sah sie Blut. An den Wänden, an ihrer Haut, an ihrer Kleidung.
»Komm raus, wir sind allein.« Die Stimme des SDF-Soldaten drang aus der Ferne zu ihr. Er war noch da. Nur warum? Was wollte er von ihr? Sie blieb sitzen, hoffte, dass er sich auflöste wie manche ihrer dunkelsten Erinnerungen.
»Da unten wird dich die Hygienepolizei finden. Sie kennen die typischen Lorcaverstecke. Vor mir brauchst du dich nicht mehr fürchten. Wenn ich dich hätte töten wollen, dann wärst du es bereits. Ich bin niemand, der lange zögert.«
Was sollte sie tun? Jemandem wie ihm konnte sie nicht vertrauen. Erstarrt saß sie da, blickte hinaus auf das Meer und wünschte sich Ruhe. Einfach nur Ruhe.
»Ich sag es nicht noch mal. Wenn du da nicht rauskommst, bist du tot und ich warte nicht ewig.«
Ihr blieb keine andere Wahl. Deshalb kam sie aus dem Versteck heraus und griff mit ihren eisigen Händen nach der Plattformkante, um sich hochzuziehen. Jeder Muskel kreischte, beinahe rutschte sie ab und stürzte ins Meer, doch der Soldat packte sie am Arm und zog sie nach oben. Sein fester Griff schmerzte sie. Dann stand sie vor ihm, durchweicht und zittrig atmend. Ein ungeliebter Mensch mit einem panischen Überlebensinstinkt.
Er deutete die Stadtgrenze entlang. Hochhäuser türmten sich hinauf in den Himmel. Ihre Spitzen versanken im diesigen Schleier des Regens. Weißgelbes Licht drängte sich vereinzelt durch die weiße Wand. Red-Mon-Stadt war schön und hässlich zugleich.
»Siehst du das Hochhaus mit der Lichtersichel an der Fassade?«
Sie nickte stumm.
»Wenn du dich am Stadtrand hältst, kommst du in weniger als zwanzig Minuten da hin. Versteck dich in der Nähe. Sobald die Nachtsperre beginnt, gehst du bis zur U-Bahnstation Südmarkt.«
Wieder nickte Rina, obwohl sie nicht verstand, was sie dort sollte. Die U-Bahn war eine Einbahnstraße. Die Stadtverwaltung schickte seit Jahren ihre Schergen durch die Stationen, um Lorca aufzuspüren, die sich im Untergrund versteckten.
»Hast du verstanden? Das Gebäude mit der Sichel und dann Südmarkt, wenn die Nachtsperre ist. Sie werden dir helfen, wenn du dort ankommst.«
»Sie?«, brachte Rina hervor und hatte eine dumpfe Vorahnung. Es gab nur eine Gruppe von Leuten, die einem Lorca Zuflucht gewährten.
»Die Rebellen. Sie sind dort. Die Stadtverwaltung hält es geheim, aber sie haben die Kontrolle über das Gebiet. Also, findest du den Weg?«
»Ich finde ihn«, sagte sie.
»Und nicht vergessen: Kommt dir ein Mensch entgegen, siehst du nach unten. Von den Wohngegenden hältst du dich fern und mach einen Bogen um jeden, der zu offiziell aussieht.« Er pausierte. »Aber das muss ich dir wohl nicht erklären.«
Als sie in die Blende seines Helms sah, entdeckte sie dahinter ein paar Augen in Blattgrün. Sie wirkten ehrlich und ungewohnt vertraut. Wer war er? Ein Soldat? Ein Mörder? Ein Lorcafreund?
»Ich muss verrückt sein«, flüsterte er und innerlich stimmte sie ihm zu. Wer einem Lorca half, musste mit dem Tod rechnen.
›Danke‹, wollte sie sagen, aber das Wort steckte in ihrer Kehle fest. Diese eine Geste des guten Willens wog die unzähligen schlechten Taten nicht auf, die er im Namen der Stadtverwaltung begangen haben musste.
Gerade als er gehen wollte, zögerte er erneut.
»Wenn du den Rebellen begegnest, dann sag ihnen: Im kalten Sturm wird Blut vergossen.«
Dann lief er los. Seine Gestalt wurde schon nach kurzer Zeit vom Regenschleier verschluckt.
Rina war allein, durchnässt, verwirrt, aber entkommen. Sie war wirklich das Glückskind, von dem Viktor immer gesprochen hatte. Warum sonst sollte ein Soldat ihr Leben verschonen? Es war pures Glück. Nur manchmal fragte sie sich, ob es überhaupt noch eine Rolle spielte, wenn sie als Einzige zurückblieb. Ihr traten Tränen in die Augen. Die Welt drehte sich rückwärts.
X
Das stete Rauschen des Meeres war Rinas einziger Begleiter auf ihrem Weg in eine ungewisse Zukunft. Sie blieb nicht stehen, um sich auszuruhen, verschnaufte nicht, um nachzudenken, sondern war wachsam und auf der Hut. Wenn ihr am Stadtrand ein Mensch begegnete, musste sie mit allem rechnen.
In der Ferne konnte sie die Sicherheitstürme blinken sehen. Das rote Licht spiegelte sich auf den Wellen und zeigte an, wo die Grenze verlief. Red-Mon-Stadt war eine Insel inmitten des Ozeans. Erbaut, um Schutz vor den Gefahren des Festlands zu bieten. Sicherheit und Frieden galten als das größte Gut, denn sie alle waren hierhergekommen, um frei von Angst leben zu können. Nur für Lorca hatte sich alles anders entwickelt. Die Stadt hielt ihnen gegenüber keine Versprechen, denn sie zählten zu den Nutzlosen und mussten jeden Tag aufs Neue um ihr Überleben kämpfen. Die Stadt war eine Arena, in der sie stets auf der Flucht war. Sicher war es nirgendwo.
Manchmal fragte sie sich, ob sie nicht versuchen sollte, auf das Festland zu gelangen. Egal, wie streng die Hygienepolizei den Hafen kontrollierte, um zu verhindern, dass jemand flüchtete. Womöglich wartete weit hinter dem Meer ein besseres Leben auf sie.
Doch jetzt war ihre letzte Chance eine Gruppe von Menschen erfüllt mit Hass. Die Rebellen forderten zwar das Ende der Lorcavernichtung, waren jedoch nicht besser als die Soldaten der Stadtverwaltung. Viktor hatte oft gesagt, sie solle sich von ihnen fernhalten, da für sie der Zweck die Mittel heiligte. Hinrichtungen gehörten zum Tagesgeschäft, wehrlose Stadtbürger wurden zu Opfern. Sobald sie dort war, wäre sie Teil eines Aufstands, den sie nicht unterstützen wollte.
Während sie lief, ließ sie den Sichelturm nicht aus den Augen. Bald musste sie ins Zentrum der Stadt und sich durch die taghell erleuchteten Straßen kämpfen. Sie zog in Erwägung, am Stadtrand zu bleiben und abzuwarten, bis die Nachtsperre einsetzte. Die Lichter waren dann ausgeschaltet und nur wenige Zivilisten mit Sondergenehmigung auf der Straße. Dann verwarf sie den Gedanken. Wenn die Lichter der Stadt ausgingen, war die SDF am aktivsten. Da Lorca nur an düsteren Orten ihre helle Haut und die unnatürliche Augenfarbe verbergen konnten, wagten sie sich meist nachts aus ihren Verstecken. Jeder wusste das, deshalb war es sicherer, im Hellen durch die Straßen zu schleichen.
Bevor sie jedoch den Stadtrand verließ, duckte sie sich in einen Schatten zwischen zwei Gebäuden. Sie knetete ihre kribbelnden Beine und schickte einen Wunsch in die Dunkelheit. Dann strich sie ihre zerzausten Haare glatt, richtete sie mit den Fingern so, dass sie ihr Gesicht zur Hälfte verdeckten und machte sich auf den Weg.
Während sie lief, senkte sie den Blick, zwang sich zur Ruhe und redete sich gut zu. Sie war nur ein Mensch, genauso wie jeder andere. Dabei zählte sie ihre Schritte. 1 … 2 … 3 … 4 … Ständig verlor sie den Faden, da ihre Gedanken wieder und wieder zu der Wohnung zurückkehrten, in der sie ihre Freunde zurückgelassen hatte. An irgendetwas musste sie sich jedoch festhalten, um nicht auf ihre Füße zu hören, die sie drängten, fluchtartig bis zum Südmarkt zu rennen. Kam ihr ein Mensch entgegen, schoss ihr feurige Hitze durch den Körper. Würde er sie erkennen, schreien und mit erhobenem Finger auf sie zeigen?
Endlich erreichte sie den Sichelturm. Auf die gläsernen Eingangstüren war das Wappen Red-Mon-Stadts geschliffen. Ein gestauchtes Verteidigungsschild mit den Buchstaben RMS, das oberhalb die Form der Stadtsilhouette nachbildete. Über den Türen war ein metergroßes Display angebracht, welches einen ihr wohl bekannten Werbespot zeigte: Zuerst sah man die Stadt aus der Vogelperspektive. In der Mitte thronte das Verwaltungszentrum wie ein kostbares Juwel auf einem samtenen Podest. Von dort aus gingen in alle Richtungen strahlenförmig Straßen und Monoraillinien ab, die bis zum Stadtrand führten. Ein Szenenwechsel folgte und es wurde ein SDF-Soldat gezeigt. Das Bild eines anonymen Mannes, dessen Gesicht nicht zu erkennen war und der mit einer Waffe in der Hand von einem Dach aus die Stadt im Auge behielt. Sie erkannte ihn sofort – den Totenläufer. »Wir garantieren euch Sicherheit, solange ihr der Stadt treu bleibt«, propagierte eine Männerstimme. Wieder wechselte die Szene. Die Einkaufspassage Maxshopper wurde eingeblendet. Ein Gewimmel aus bunt leuchtenden Reklameschildern und Bürgern, die friedlich durch die Straße schlenderten. Dann wurde der Bildschirm abgedunkelt und Schrift brach aus der Schwärze hervor: »Im Namen der Bewohner Red-Mon-Stadts kämpfen Soldaten, egal wie gefährlich die Mission ist.« Ein Schwenk auf einen streunenden Lorca, der hässlich die Zähne bleckte. Aus Angst, aber sie verkauften es so, als täte er es mutwillig. Danach Bilder von sterbenden Menschen, zuletzt ein Schnitt, und eine dumpfe Stimme echote über den Vorplatz: »Der Totenläufer ist unsere Antwort auf die Lorcagefahr.«
Rina wandte sich ab. Ihr Herz raste. Sie musste ein Versteck finden und zwar schnell. Irgendwo zwischen den Brücken wäre eine Möglichkeit. Es gab ab und an Hohlräume in der Struktur, die groß genug waren, um sich darin zu verbergen, doch so einen Platz zu finden, konnte im schlimmsten Fall Stunden dauern.
Ihre Gedanken wirbelten unruhig durch ihren Geist, obwohl Nachdenken sie nicht weiterbrachte. Sie musste sich bewegen, durfte nicht verharren. Wenn sie wartete, konnte ihr Gesicht jederzeit von einer Kamera aufgenommen und als Bedrohung enttarnt werden.
Mit den Augen suchte sie die Umgebung ab und entdeckte eine Transportröhre. Sie diente der Warensendung und war groß genug, um sich geduckt darin aufhalten zu können. Ihr Blick wanderte auf die Straße. Bis auf ein oder zwei Fußgänger war niemand in der Nähe.
Jetzt oder nie. Rina huschte wie eine streunende Katze entlang der umliegenden Häuser und umging dabei den Vorplatz des Sichelturms weitläufig. Die Hälfte war geschafft. Nur noch ein paar Meter. Schnell lief sie über eine Brückenkonstruktion. Unter ihr rauschten Monorailautos dahin und verloren sich irgendwo zwischen den Häusern wie Blitze in einer dunklen Nacht. Das Licht der Brückenlaternen fiel auf sie. Jeder konnte in diesem Moment ihr verräterisches Äußeres erkennen. Sie rannte. Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Gerade als sie sich aufmachte, auf einen Baum zu steigen, von dem aus sie die Transportröhre erreichte, hallte ein schrilles Heulen über den Vorplatz.
Das unverkennbare Geräusch eines Alarms.
Hastig kletterte sie den Baum hinauf, stieg über einen Ast auf die Transportröhre, lief bis zur nächsten Häuserwand. Der Einlasser für Pakete war geschlossen. Hoffentlich war der Sicherheitsschlüssel zum Öffnen noch immer so simpel wie vor einem Jahr. Mit kalten Fingern drückte sie auf das Display. 1-3-5. Nichts rührte sich. Variante zwei. 2-4-6. Immer noch nichts. Der Alarm klingelte in ihren Ohren. Ihr blieben nur noch zwei Nummern.
»Bitte«, flüsterte Rina und tippte 3-5-7. Ein Klicken ertönte und die Klappe öffnete sich.
Rasch ließ sie sich in die Transportröhre hinunter, zog den Deckel zu und horchte auf das, was sich draußen abspielte. Das Geräusch von Stiefelsohlen, die auf den Boden schlugen, ertönte. Rina biss sich auf die Lippe. Sie waren bestimmt nicht wegen ihr da. Schüsse ertönten. Der Geschmack von eisiger Kälte lag ihr auf der Zunge. Ihre Glieder wurden steif, verkrampften sich, sie presste die Zähne so fest aufeinander, dass sie glaubte, sie würden zerspringen. Doch Rina behielt Recht, die Schüsse galten nicht ihr. Vorsichtig kroch sie durch die Röhre, bis zu einer Stelle, wo ein Spalt im Metall zu finden war. Sie blickte hindurch und sah den Vorplatz. Eine Gruppe von Leuten stürmte aus dem Haupteingang des Sichelturms heraus. In ihren Händen hielten sie Maschinengewehre, trugen jedoch keine Soldatenuniform. Rebellen. Das da draußen waren Rebellen.
›Hier bin ich‹, rief sie in Gedanken. ›Ich bin hier!‹
Ihre Finger legten sich auf das kalte Metall. Niemand sah sie, niemand hörte sie.
Sie strebten in Richtung Südmarkt, kamen jedoch nicht weit. Von der Seite her tauchten SDF-Soldaten auf. Gewehrfeuer durchkämmte die Stille der Nacht. Befehle wurden gebrüllt. Schmerzerfüllte Schreie mischten sich darunter. Das Lärmen eines Hubschraubers war zu hören. Keine Chance. Die Rebellen hatten keine Chance. Einer nach dem anderen fiel, sank auf die Knie. Blut verteilte sich auf den Platten des Vorplatzes. Eine Bombe explodierte im Sichelturm. Qualm, Chaos, Durcheinander.
Rina wandte sich ab. Kauerte sich in der Röhre zusammen und presste ihr Gesicht auf die Knie. Jeder Schuss ließ sie zusammenfahren. Tot. Alle tot, so wie Viktor und die anderen, die sie im Stich gelassen hatte. Wie sehr sie es hasste, das Lied des Todes. Warum konnte es nicht aufhören? Wieso war der Kampf nötig? Rebellen gegen Soldaten. Nutzlose gegen Nutzvolle. Schwarz gegen Weiß. Sinnlos. Besser war es, wenn niemand mehr auf diese Weise starb. War das wirklich so schwer?
Die Einzigen, die lebend den Vorplatz verließen, waren die SDF-Soldaten. Sie waren bereit, alles zu tun, was man ihnen befahl. Die Sondereinheit Red-Mon-Stadts. Vielleicht war er unter ihnen. Der Soldat, der sie verschont hatte. Vielleicht dachte er gerade an sie und zweifelte an der Entscheidung, sie ausgerechnet hierher geschickt zu haben. »Ich muss verrückt sein«, waren seine Worte gewesen und das war er. Ab jetzt zählte er zu den Mittätern, zu den Verrätern, zu den Rebellen. Menschlichkeit wurde bestraft, denn diese Stadt ernährte sich von Angst und Grausamkeit.
X
Tom hatte genug. Wie lange wollte er sich noch einreden, dass er mit seiner Rolle zurechtkam. In einer blauen Uniform mit silbernem Schildemblem am Ärmel tötete er Menschen. Das war nicht, was er sich unter einem Soldaten des Kontrollregiments vorstellte. Bevor er hierher versetzt worden war, hatte er angenommen, seine Aufgabe bestünde darin, zu beobachten und Gefahrensituationen zu melden. Er war davon ausgegangen, mit einer RMP7 auf Anschlag durch die Stadt zu jagen, läge außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs. Weit gefehlt. Aufgrund seiner bescheinigten Hochqualifizierung im Umgang mit Schusswaffen, schickte ihn die Stadtverwaltung überall dorthin, wo sie ihn brauchte. Ein Deut auf seine Nutzversicherung genügte und er musste für sie in jedweder Art tanzen. Sich den verschiedensten Situationen anpassen zu können, gehörte zu seinen Spezialitäten. Er war ein Springer, ein Mensch ohne Konstanten.
Routiniert legte er seinen Helm auf die Ablage, zog seine Schutzweste aus und ließ sich auf den Sitz neben seinem Kameraden fallen. Zumindest gab es hier etwas Frieden. Mit den Fingern massierte er seine Schläfe und versuchte, die Bilder der letzten Stunden auszuschalten, doch so sehr er sich auch bemühte, sie standen grell leuchtend vor ihm. Sich zu sagen, sein Handeln wäre notwendig, half da leider gar nicht. Nein, so hatten sie sich das nicht vorgestellt. Jay wäre außer sich, wenn er erfuhr, was er in den letzten Monaten alles im Namen der Verwaltung hatte tun müssen.
»Vorhin gab’s einen Alarm wegen einer Transportröhre«, sagte Toms Kamerad ohne Begrüßung. Er hatte die SDF Ausbildung gerade so abgeschlossen und fühlte sich mit allem überfordert. Ihn schickte die Stadtverwaltung sicher nicht so schnell zu einem Außeneinsatz. Sein Finger deutete auf den Monitor, der das Areal um den Sichelturm zeigte.
»Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Deshalb habe ich gewartet, bis du zurück bist.«
»Das bedeutet nichts«, sagte Tom. »Die Dinger geben regelmäßig einen Fehlalarm ab.«
»Aber sollten wir es nicht wenigstens melden, damit jemand vor Ort sich das mal genauer ansieht?«
»Vor Ort haben sie gerade andere Sorgen.«
»Ich weiß ja, nur wenn ich mir die Richtlinien ansehe, dann sind wir verpflichtet, auch die kleinste Unregelmäßigk…« Die Richtlinien. Ein guter SDF-Soldat kannte sie auswendig und betete sie herunter wie ein radikaler Gläubiger die Bibel. Wirf deinen eigenen Willen weg und tausch ihn gegen blinden Gehorsam. Kann ja nur gut gehen.
»Okay, wenn du unbedingt willst, kannst du es anzeigen, aber ich rate dir davon ab.«
Sein Kamerad richtete sich auf dem Stuhl auf und rutschte nervös hin und her.
»Und wieso?«
»Nun, wir haben dort derzeit eine Notsituation. Durch deine Anzeige wird einer von der Hygienepolizei informiert und beauftragt, die Transportröhre zu checken. Die sind nachts allerdings nur ein paar Männer und werden in diesem Moment damit beschäftigt sein, den Mist aufzuräumen, den die Rebellen vor dem Sichelturm hinterlassen haben. Dann geht der Typ hin, schaut in die Röhre rein und findet – nichts. Was passiert? Du wirst von der Spitze verwarnt, weil du die Arbeiten am Sichelturm gestört hast. Es gibt Prioritäten. Und eine davon lautet, morgens ist die Stadt sauber. So einfach ist das.«
»Und wenn sich da ein Lorca drinnen versteckt? Ich habe schon von solchen Fällen gehört. Die nutzen doch alles, was ihnen …«
»Es war ein Fehlalarm.«
So langsam verlor er die Geduld. Tom schob seinen Stuhl näher an den Bildschirm heran, zog mit seinem Finger das Fenster auf dem Monitor zur Seite und tippte eine Zahlenkombination ein. Sofort öffnete sich der Ausschnitt einer Stadtkarte, über den sich rote Lichtpunkte verteilten.
»Siehst du das? Das sind die Fehlalarme der letzten Woche. Es gab insgesamt mehr als zehn in unserem Kontrollgebiet. Ich habe keinen davon gemeldet.«
Sein Kamerad studierte die Lichtflecke. Nach einem Moment der Bedenkzeit berührte er einen der Punkte. Darüber wurde der Vermerk »Fehlalarm Südstadt, Türdefekt« eingeblendet. An einer anderen Stelle stand eine Notiz, die sich auf ein zu lang offen stehendes Fenster bezog.
»Aber das sind keine Orte, wo sich jemand verstecken kann, oder?«
»Darum geht es auch nicht. Stell dir einfach die folgende Frage: Würden die Rebellen einen Angriff auf das Medienzentrum planen und einen Lorca vergessen?«
Unterbewusst kratzte sich sein Kamerad an der Schulter, betrachtete den Bildschirm und wippte nervös mit dem rechten Bein.
»Ich glaube nicht«, nuschelte er. »Ich dachte ja nur, nach allem was heute schief gegangen ist. Erst der Einsatz Totenläufer in Westend und jetzt dieser Alarm. Ich weiß ja, dass wir nicht die Zeit haben, jeden Alarm zu prüfen, aber die Anweisung ist doch, dass wir zumindest eine Überprüfung in Erwägung ziehen.«
»Wir haben sie in Erwägung gezogen und ich sage, da ist kein Hase im Zylinder versteckt.«
Dafür erntete Tom einen verständnislosen Blick. Diese SDF-Leute, kein Humor im Blut. Ob er sich jemals mit einem von denen verstehen würde?
Doch tatsächlich wandte sich sein Kamerad dem linken Bildschirm zu, markierte die bedenkliche Stelle und tippte »Fehlalarm« in das Fenster ein.
Gut so. Tom würde nichts riskieren. Nicht nach heute Nacht.
X
Als Rina die Stufen zur U-Bahnstation Südmarkt hinunterlief, fühlte sie sich leer. Ein Orkan war durch ihren Körper gefegt und hatte jede Empfindung fortgerissen. Die Welt war nur noch ein rationaler Ort ohne Farben. Grau und gleichgültig. Wie sie es aus der Transportröhre geschafft hatte, verblasste bereits in ihrer Erinnerung. Es kam ihr vor, als habe sie Ewigkeiten im Dunkeln verbracht, umgeben von Schüssen und Schreien sterbender Menschen. Irgendwann hatte sie die Dunkelheit verlassen und war durch die Straßen getaumelt. Bis hierher.
Ihre Schritte hallten in den Gängen der U-Bahnstation wider. Reklametafeln warben für keimfreie Shampoos und kostspielige Sicherheitssysteme in Wohnungen. Dazwischen kurze Videoclips, in denen sich zwei Worte feindlich gegenüberstanden: Lorca – Totenläufer. Viktor nannte diese Werbung Propaganda. Ein Mittel, um die Stadtbevölkerung zu verdummen und ihnen einen Mann ohne Skrupel und Mitleid als Held zu verkaufen.
Vor einer Rolltreppe, die noch tiefer in die Station hineinführte, blieb sie stehen. Was, wenn der Soldat gelogen hatte und sie direkt in seine Falle lief? Das ergab mehr Sinn als die Vorstellung, dass er sie tatsächlich hatte davonkommen lassen. Soldaten wollten ihresgleichen tot sehen. Eine andere Option gab es nicht. Ihre Haut begann zu jucken. An den Armen, an den Beinen, am Rücken, einfach überall. Sie kratzte unwillkürlich an den Stellen, aber es half nicht. Es half niemals.
»Was willst du hier?« Die laute Stimme eines Mannes drang an ihr Ohr und sie fuhr zusammen. Augenblicklich sah sie die Rolltreppe hinunter und von dort unten blickte ihr ein Mann in aschegrauer Kleidung, Stoffhose und Schutzweste entgegen. Er trug ein schwarzes Tuch, auf dem in orangen Lettern REKA stand. In den Händen hielt er eine Maschinenpistole, die er auf sie richtete.
»Ich … bin … ein Lorca.« Ihre Stimme wurde von den Wänden nach unten geworfen. Ein lautes Echo in der menschenleeren U-Bahnstation. »Und ich suche Schutz.«
»Ein Lorca?«, fragte der Mann. »Hier ist seit Monaten kein Lorca mehr aufgetaucht.«
»Ich … bin einer«, rief sie ihm zu und dachte bei sich, dass er es doch sehen musste.
»Ich komme die Treppe hoch und du bewegst dich nicht vom Fleck, okay?«
»Ja«, sagte sie und wartete, bis er neben ihr stand. Sein Blick wanderte über ihr Gesicht, ihren Körper, von oben nach unten und blieb letztendlich bei den Augen hängen. Innerlich zerfraß sie eine brennende Unruhe, weshalb sie die Hände zu Fäusten ballte und fest zusammendrückte.
»Tatsache«, murmelte er und legte seinen Finger auf ein Nanofunkgerät in seinem Ohr.
»Wir haben in Gang neun einen Lorca«, funkte er. »Soll ich ihn zum Kaninchenbau bringen?« Pause. »Nein, ich täusche mich ganz sicher nicht. Okay. Ja, verstehe.« Dann nahm er den Finger herunter und lächelte ihr aufmunternd zu.
»Du hast es geschafft. Wir kümmern uns jetzt um dich. Du bist sicher.« Aus seinen Worten sprach ehrliche Zuversicht und sie stand ihm gut zu Gesicht, doch Rina hörte diesen Satz nicht zum ersten Mal. Viktor hatte es gesagt, und zwei Menschen in einer weit entfernteren Vergangenheit, genauso wie der Junge von damals, kurz bevor sie zum ersten Mal Red-Mon-Stadt betreten hatte.
»Jemand wie ich ist niemals sicher«, sagte sie deshalb und ihr Mund wurde trocken.
X
Sie lebte. Es war nicht zu leugnen. Irgendwo in ihrem Kopf kreischte eine Stimme, dass es nicht fair war, doch sie hörte nicht hin. Was war schon fair in einer Stadt, in der die Farbe deiner Haut und Augen entschied, ob du sterben musstest oder nicht.
Der Rebell führte sie durch einen der U-Bahntunnel. Es war stockfinster und Rina hatte Mühe, ihm zu folgen. Immer wieder stolperte sie über ihre Füße und glaubte, vor Erschöpfung zusammenbrechen zu müssen. Ein Zittern hatte sich in ihren Körper geschlichen wie ein Virus. Der Rebell hingegen redete unentwegt. Er sagte, dass der Unterschlupf der REKA einem Kaninchenbau glich. Überall Tunnel mit zahllosen Ausgängen. Südmarkt sei schon seit Monaten von ihnen besetzt, doch die Stadtverwaltung vertuschte diese Tatsache. Sie sprach von einem Erdrutsch, obwohl es nie einen gegeben hatte.
Rina konnte sich nur schwer auf seine Worte konzentrieren. Die Realität begann an ihr abzuperlen wie Wasser an Folie. Ein stetes Rauschen hastete durch ihren Kopf und sie meinte, unter einer Kuppel zu sein. Alles war seltsam trüb und dumpf. Schritte trieben vor ihr her. Zwischendurch roch es nach Erde und feuchtem Untergrund. Es wurde hell und weißes Deckenlicht brannte in ihren Augen. Lippen bewegten sich. Eine Leibesvisitation schloss sich an. Sie wehrte sich nicht. Lief von hier nach dort. Etwas Weiches wurde ihr um die Schultern gelegt. Bleierne Stille hüllte sie ein und etwas fiel von ihr ab, landete auf dem Boden und sickerte in den Grund. Sie sank in sich zusammen, fühlte sich plötzlich winzig und bedeutungslos.
Niemand blieb für ewig. Nichts war für die Unendlichkeit bestimmt, denn eine Linie hatte stets ein Ende. Alles andere war paradox. Endlichkeit machte das Leben erst lebenswert, hatte mal jemand gesagt. Nicht irgendjemand. Viktor. Es war sein Motto. Trotz all der Entbehrungen blickte er stets optimistisch in die Zukunft.
»Im kalten Sturm wird Blut vergossen«, flüsterte Rina, ohne sich dessen bewusst zu sein. Schreie klopften an eine verschlossene Tür. Tropfen von Rot und ein tiefdunkler Hass vermischten sich, wurden zu einer Bedrohung, die hinter einem blickdichten Vorhang auf sie lauerte und das Ende vieler Linien zeichnete.
Jemand schnipste und Rina erwachte.
»Ich sagte doch, sie hat einen Schock.«
Als sie aufsah, stand ihr gegenüber eine Frau mit kurzen, fuchsroten Haaren. REKA stand auf einem Tuch, das sie um ihren Arm gewickelt hatte. Rebellen. Richtig. Sie war nicht mehr in der Wohnung. Sie war an einem fremden Ort mit fremden Menschen.
»Bist du jetzt endlich wach?«, fragte ein Mann, der schräg neben ihr auf einem Stuhl saß. Unter seinem linken Auge prangte das Tattoo eines Adlers im Sturzflug. Waren Tattoos nicht verboten?
»Sie braucht ein Bett, eine Dusche und Ruhe. Wir können auch morgen mit ihr reden.«
»Morgen ist zu spät. Wir halten uns an die Routinen«, wandte der Mann ein und die Frau verschränkte die Arme vor der Brust und warf Rina einen entschuldigenden Blick zu. »Also, Sweetie, plaudern wir doch mal ein bisschen. Was verschlägt dich zum Südmarkt?«
»Ich will nicht reden«, sagte Rina aus einem inneren Impuls heraus. Dieser Mann kam ihr falsch vor wie eine Schlange. Lässig saß er da, musterte sie unverhohlen aufdringlich und sprach in einem Ton, der verdeutlichte, dass er allein entschied, was als Nächstes geschah.
»Was du willst oder nicht willst, interessiert mich nicht. Du hast nachher noch genügend Zeit zum Alleinsein. Wir wechseln jetzt ein paar Worte miteinander und alles wird gut. Glaub mir, so ein Gespräch wirkt Wunder.« Bitterer Sarkasmus. Sie erkannte es daran, wie er »glaub mir« betonte. Einen Hauch zu selbstgefällig.
Rina sammelte sich. Erst jetzt bemerkte sie die weiche Decke über ihren Schultern. Die Rebellen mussten sie ihr bei der Ankunft gegeben haben. Ein Symbol ihrer falschen Gutmütigkeit. Sie zog die Decke herunter und legte sie neben sich ab. Mit solch einer albernen Geste würde sie sich nicht auf ihre Seite ziehen lassen.
Ihr entging nicht, dass die Frau verwundert die Stirn runzelte.
»Dann reden wir«, meinte sie und zwang sich, ihrer Stimme eine kräftige Note zu geben.
»Schön, dass wir das geklärt haben. Beginnen wir beim Standard, bevor wir zu den Details kommen. Wer bist du, woher kommst du und wie zum Teufel hast du es hierher geschafft?«
»Mein Name ist Rina Morita, ich hatte eine Nutzversicherung als Transporteurin, komme aus dem Wohnviertel von Westend und habe dort mit acht Lorca gelebt. Ein Mann namens Viktor hat uns versteckt. Vor einem Tag …« War es wirklich erst einen Tag her? »… hat uns die SDF entdeckt und ich bin geflohen. Am Stadtrand entlang bis zum Sichelturm und dann weiter zum Südmarkt.«
»Geflohen also. Und wie hast du das angestellt? Die SDF hat bei solchen Einsätzen eine Erfolgsquote von, lass mich lügen, hundert Prozent.«
»Ich war schnell.«
»Du warst schnell?«
»Ja.«
»Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist in einer Wohnung, die SDF stürmt sie und du kannst einfach durch die Vordertür fliehen?«
»Durch das Fenster. Ich bin durch das Fenster, dann eine Etage nach unten geklettert, habe dort die Scheibe eingetreten und bin weggelaufen.«
»Und die Leute in der Wohnung darunter?«
»Es war niemand da.«
»Dann muss die Wohnungstür verschlossen gewesen sein.«
»War sie nicht.«
Der Mann schnalzte mit der Zunge.
»Das nenne ich ja mal Glück. Und von der SDF hat das niemand bemerkt?«
Rina dachte an den Soldaten und seine unglaublichen Worte im Regen. Sie antwortete nicht.
»Okay, anderes Thema. Vorhin hast du einen Satz gesagt. Erinnerst du dich noch daran?«
Der Satz, stimmt, sie hatte ihn ausgesprochen, dabei war das nicht nötig gewesen. Die Rebellen nahmen jeden Lorca auf. Zumindest waren das die Gerüchte.
»Rina, du brauchst vor uns keine Angst haben. Niemand wird dir etwas tun.« Nun sprach wieder die Frau. »Es ist nur so, dass nur ein paar Mitglieder diesen Satz überhaupt kennen. Er ist ein gut gehütetes Geheimnis und wir müssen wissen, woher du ihn kennst.«
Sie spürte, wie sich ein Knoten um ihre Kehle schnürte. Nur ausgewählte Mitglieder. Ein Geheimnis. Aber er war doch Soldat und hatte nichts mit der REKA zu tun.
»Hat ihn dir der Mann gesagt, der dich versteckt hat?«
Viktor? Nein, er war tot. War vor ihren Augen auf die Knie gesunken und zwischen seine grauen Haare hatte sich Blut gemischt.
»Viktor war das nicht.« Sie musste den Knoten um ihre Kehle nur lösen und die Worte aussprechen. So schwer war es nicht. Vier Worte. Nur vier Worte. »Es war ein SDF-Soldat.«
Ungläubiges Schweigen dehnte sich aus.
»Ein SDF-Soldat?«, fragte die Frau.
»Ja, es war einer von denen. Er hat die anderen umgebracht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Trotzdem hat er mich laufen lassen.« Welch Ironie des Schicksals.
»Und da bist du dir hundertprozentig sicher?«
»Das bin ich. Er hat mir auch gesagt, dass ich zum Südmarkt muss.«
Der Mann pfiff durch die Zähne und lehnte sich im Stuhl zurück.
»Das ist ja mal eine Aneinanderreihung von Zufällen.«
»Zufälle? Ich dachte, du bist der Letzte, der an so etwas glaubt?«
»Ich hab ja auch nicht gesagt, dass ich daran glaube.« Erneut betrachtete er Rina und schien ihre Miene deuten zu wollen. Hitze stieg in ihr auf. Unterstellte er ihr etwa, dass sie log?
»Ich lüge nicht«, sagte sie.
»Auch das habe ich nicht behauptet«, meinte er nur und fuhr sich mit den Fingern über das Kinn. »Wir haben kein Leck. So viel steht fest. Jedes unserer Mitglieder ist loyal.«
Rina sah auf die Hände in ihrem Schoß. Die Haut war rau und an einigen Stellen aufgeschürft.
»Er hat sie umgebracht«, murmelte sie. »Ich habe gesehen, wie er die Waffe auf sie gerichtet und abgedrückt hat. Emotionslos und gradlinig. Ohne ein kurzes Zögern. Er war der Erste in der Wohnung und der Einzige, der mich gesehen hat.«
Ein Soldat. Ein Mörder. Es war ihr zuwider. Die Frau legte eine Hand auf Rinas Arm, doch sie zuckte sofort zurück. Distanz. Sie brauchte Distanz. Wollte einfach nur ihre Ruhe, damit sie einen klaren Kopf bekommen konnte.
»Du kannst uns vertrauen. Wir werden dir nichts tun.« Vertrauen. Was bedeutete dieses Wort? Sie konnte sich nicht daran erinnern.
»Wieso hat er mich laufen lassen?«
Rina sah die Frau an, als könne sie ihr eine Antwort geben. Doch der Einzige, der diese Frage beantworten konnte, war der Soldat selbst.
»Ich weiß, es ist schwer, aber versuch dich noch einmal zu konzentrieren. Der Soldat, hattest du den Eindruck, dass er dich hinters Licht führen wollte?«
»Wieso sollte er das tun?«
»Um herauszufinden, wo wir unser Versteck haben. Die Stadtverwaltung weiß, dass wir am Südmarkt sind, aber nicht, wo unser Zugang ist. Das U-Bahnnetz ist weit verzweigt und nicht beleuchtet. Sie riskieren keinen SDF-Einsatz, wenn sie nicht genau wissen, an welcher Stelle ihr Ziel liegt. Also, hattest du den Eindruck, dass er dich laufen lassen hat, um dir später zu folgen?«
»Nein«, antwortete sie sofort. »Er, er hat mich nicht benutzt.« Dabei war sie sich in Wirklichkeit gar nicht sicher. Sie war gut darin, an dem Gesicht und den Bewegungen eines Menschen zu erkennen, ob er eine Bedrohung war oder nicht, und sie täuschte sich nie. Der Soldat jedoch war widersinnig gewesen, so als kämpften in ihm zwei gegensätzliche Pole miteinander, aber doch nicht, weil er sie betrügen wollte. Das konnte nicht sein.
»Wie gesagt, Caren, wir haben kein Leck«, wiederholte der Mann, woraufhin die Frau entnervt seufzte.
»Dein Vertrauen in allen Ehren Jay, aber es ist eine Möglichkeit, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Wir sollten zumindest überprüfen, ob vor unserer Tür jemand lauert oder Rina verwanzt ist.«
»Meinetwegen. Aber ich garantiere dir, wir werden nichts finden. Wenn du einen Moment scharf nachdenkst, weißt du, wer ihr den Satz gesagt hat.«
Die Frau fixierte ihn, dann drängte sich ihr eine Erkenntnis auf.
»Niemals. Das ist absolut unmöglich. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Tom …«
»… was? Dass er zu so etwas nicht fähig ist? Unterschätz ihn nicht. Er ist alles andere als nur ein guter Schauspieler. Es passt zu ihm. Es passt wie die Faust aufs Auge. Aber gut, schauen wir erstmal, ob du Recht hast. Der Sicherheitscheck ist vorhin ja schon gelaufen, also bringst du sie am besten ins Technikzimmer.«
Der Mann stand auf, zog aus seiner Tasche eine Schachtel Zigaretten, klopfte eine heraus und steckte sie sich zwischen die Lippen. Als er weitersprach, nuschelte er.
»Caren ist deine direkte Ansprechpartnerin und mich wirst du hoffentlich nicht allzu oft sehen«, sagte er, holte eine Streichholzschachtel hervor und zündete sich die Zigarette an. »Ich bin immer ein schlechtes Omen.«
Er schüttelte das Streichholz aus, zog einmal an der Zigarette und verließ das Zimmer ohne ein weiteres Wort.
»Was hat er gemeint?«, fragte Rina und die Frau stemmte die Arme in die Seite.
»Er denkt, es war einer von uns, der seit ein paar Monaten bei der SDF ist, um Informationen zu sammeln. Ein Schleuser. An sich ist er nicht zuständig für Einsätze gegen Lorca, aber es könnte sein, dass sie ihn dazu abkommandiert haben.« Sie machte eine kurze Pause und fügte hinzu: »Wenn das so ist, tut es mir sehr leid.«
Unweigerlich kehrten ihre Gedanken zurück zu dem Soldaten. Er war also ein Schleuser der Rebellen. Jemand, der glaubte, die richtigen Dinge zu tun, obwohl er das Leben ihrer Freunde gestohlen hatte. Für sie war er nicht mehr als ein Heuchler.
Tom hatte alles perfekt geplant. Der Köder war so gut wie fertig, neben ihm der Barhocker frei und er selbst darauf eingestellt, sich an jede erdenkliche Situation anzupassen. Er war bereit, sein Täuschungsmanöver auszuführen. Es fehlte nur noch seine Zielperson, die laut Informant pünktlich nach Einsetzen der Nachtsperre auftauchen sollte.
Der Barmann in der verqualmten Kneipe Hintertüren schenkte einem Kerl Klaren ins Glas, den dieser sofort runterspülte. Die beiden unterhielten sich seit einigen Minuten über die Ungerechtigkeit von vorgegebenen Pflichten in Red-Mon-Stadt. Dabei berichtete der Betrunkene lallend von seinem Job auf den Gemüseinseln außerhalb der Stadt. Es ginge da nicht um echte Landwirtschaft, sondern einzig und allein um Zahlen. Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen, Wachstumsrate, Röte von Tomaten. Alles musste ständig geprüft werden, da sonst das Essen der Stadtbewohner einging.
»Eine sowas von langweilige Aufgabe«, lamentierte er und fügte hinzu, dass sein Antrag auf Änderung seines Nutzens mit einer fadenscheinigen Begründung abgelehnt worden war.
»Würd’ lieber hier in dem Schuppen arbeiten«, sagte er, »aber das kann sich ja keiner aussuchen.«
Die Spitze von Toms Kugelschreiber flog über das Papier, während er zuhörte. Seine Zeichnung war ihm heute nicht recht gelungen, aber sie erfüllte ihren Zweck. Eine künstlerische Meisterleistung konnte von ihm eh niemand mehr erwarten. Er war übermüdet und hatte seit Tagen nicht richtig geschlafen, da er entweder seinem Scheinjob nachging oder als Spitzel agierte. Konzentrationsmangel war da nur eine von vielen unangenehmen Begleiterscheinungen. Nicht die besten Voraussetzungen für einen Offensivschlag, aber er würde das Beste daraus machen.
Seine Zielperson ließ sich ungewöhnlich viel Zeit. Inzwischen war es weit nach Mitternacht. Diese Änderung konnte alles und nichts bedeuten. Der Informant hatte sich vertan, die Bespitzelung war aufgeflogen, sein Ziel war spontan zu einem Noteinsatz gerufen worden, verletzt oder gar tot.
Tom wollte nicht vom Schlimmsten ausgehen, allerdings wusste er, dass sein Ziel viel Wert auf Routinen legte. Wenn er die Kneipe besuchte, was nur alle paar Wochen passierte, bestellte er immer zwei Tequila, setzte sich immer an die Bar, blieb höchstens eine Stunde und suchte sich stets einen neuen Gesprächspartner. Hatte man ihn also enttarnt? Nein, dazu war er zu vorsichtig gewesen, war anfangs unregelmäßig aufgetaucht, dann regelmäßiger und nun ein Stammgast. Der Barkeeper und einige der versifften Kunden begrüßten ihn mit einem Nicken und kannten seinen Namen. Er war einer von ihnen. Und wäre er tatsächlich aufgeflogen, säße er jetzt wohl nicht mehr hier, sondern in einer Zelle des Kuppelbaus Safe City, wo jeder landete, der seinen Nutzen verloren hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach war seinem Ziel etwas dazwischen gekommen. Vermutlich ein Einsatz oder ein herumstreunender Lorca, der ihm zufällig begegnet war. Er hoffte es nicht, denn ein solches Aufeinandertreffen endete für einen Lorca tödlich.
Kalte Luft zog durch die Kneipe und als Tom aufsah, erkannte er den Mann mit dunklem Filzmantel in altmodischem Schnitt sofort. An ihm hafteten die Abgeklärtheit eines Soldaten und die kalte Berechnung eines Auftragsmörders. Seine Schritte waren konzentriert und durchdacht, das Gesicht zu weich für jemanden wie ihn, aber seine Augen durchdringend. Nichts an ihm wirkte überflüssig. Alles hatte seinen Platz und seine Berechtigung. Er war es, der Totenläufer. Jener Mann, von dem niemand sonst wusste, wie er tatsächlich aussah, weil die Verwaltung es streng geheim hielt.
Sein Blick streifte über die Köpfe der Gäste und Tom wandte sich seiner Zeichnung zu. ›Komm schon‹, flüsterte er in Gedanken. ›Du siehst, was ich hier mache. Ich bin interessant. Meine Zeichnung hat eine Geschichte zu erzählen und auf die stehst du doch.‹
Der Totenläufer ging um die Bar herum, lief an einigen Männern vorbei, die volltrunken auf den Barhockern saßen, passierte leere Plätze. Dann blieb er stehen. Direkt hinter Tom. Der Köder. Tom zeichnete. Seine Finger zitterten nicht. Die Striche waren klar und gerade. Und das, obwohl er innerlich kochte.
›Setz dich‹, rief er dem Totenläufer in Gedanken zu, ›setz dich!‹
Für einen grauenvoll langen Augenblick war Tom überzeugt, dass der Totenläufer weitergehen und neben dem alten Kauz am anderen Ende der Bar Platz nehmen würde. Weil alte Menschen bessere Geschichten kannten. Das brachte ihre Erfahrung mit sich. Dann setzte er sich doch.
Innerlich beglückwünschte sich Tom für seinen Schachzug und sah den König schon fallen. Nach Wochen, nein Monaten war er dem Totenläufer nicht nur auf der Spur. Nein, sie saßen nebeneinander und Tom bekam die Chance, herauszufinden, mit was für einer Person die REKA es zu tun hatte. Es war die Gelegenheit, ihn aus der Reserve zu locken, ihn einzuschätzen, ihn zu beschnuppern und daraus Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit zu ziehen.
Er zeichnete weiter und die geübten Bewegungen seiner Finger gaben ihm ein Gefühl von Kontrolle.
»Zwei Tequila«, hörte er den Totenläufer sagen. Geliebte, bösartige Routine. Soweit so gut.
Die Sekunden rasten und Toms Stift flog über das Papier. Hier fehlte ein Schatten in den Haaren, da ein Detail im Gesicht. Er bemerkte, dass er beobachtet wurde. Ein gutes Zeichen.
Als die Getränke kamen, leerte der Totenläufer seinen Tequila in einem Schluck. Nicht zögern, sofort handeln. Das passte zu ihm.
Tom spürte die Ungeduld in sich kratzen wie eine eingesperrte Katze an einer Wand. Am liebsten hätte er sofort das Gespräch begonnen. Aber so funktionierte das nicht. Der Totenläufer musste ihn ansprechen, nur so war er nicht verdächtig. Deshalb verdeckte er die Hälfte der Zeichnung mit der linken Hand. Gerade so, dass sein Ziel das Gesicht einer jungen Frau erahnen konnte, sich aber nicht hundertprozentig sicher war, was für ein Bild entstand. Das erzeugte Spannung, weckte die Neugierde und brachte ihn womöglich zum Reden. Es dauerte eine Weile, ehe der Totenläufer die Initiative ergriff, doch Tom behielt Recht.
»Bist du Künstler?«, fragte der Mann neben ihm beiläufig.
Tom stutze, drehte sich zu ihm und fragte, als sei er aus einer Trance gerissen worden: »Ähm … hast du was gesagt?«
In den Augen des Mannes sah er Unruhe, obwohl seine Miene diese verbarg. Ein zaghaftes Lächeln spielte um seine Lippen. Es war nicht so, als ob er sich über Tom lustig machte. Im Gegenteil, es strahlte Mitgefühl aus. Mitgefühl. Was für ein Wort in Zusammenhang mit dieser Person.
»Ich habe nur gefragt, ob du ein Künstler bist? Man sieht in Red-Mon-Stadt nicht oft jemanden zeichnen.«
Tom fragte sich, ob er das aus der Perspektive des SDF-Soldaten sagte, der sichergehen wollte, dass sich alle an die Spielregeln hielten. Kunst hatte keinen konkreten Nutzen, keinen greifbaren Wert. Sie war nicht verboten, aber nur eine unliebsame Randerscheinung.
»Ich, Künstler? Nein, ich … na ja, ich zeichne einfach manchmal.«
»Hm, verstehe«, sagte der Totenläufer. »Dafür ist es ziemlich gut. Kann ich es sehen?«
»Na ja, es ist wirklich …«
»Ich bin kein Kritiker, keine Sorge. Es interessiert mich nur.«
Wieder dieses einnehmende Lächeln. Tom spürte Sympathie und die ging einher mit brennender Wut. Wenn er alle Menschen so um den Finger wickelte, war es kein Wunder, wieso er der Liebling der Stadtverwaltung war. Wie gern wäre Tom aufgesprungen, hätte den Revolver aus seinem Schuh gezogen und ihm eine Kugel in die Brust gejagt. Konzentrieren. Er musste sich konzentrieren. Es ging nicht um ihn und seine Abneigung, sondern um das große Ziel. Sein Tod wäre an dieser Stelle nur verschwendet.
Deshalb nahm Tom das Papier mit dem Portrait und gab es dem Totenläufer. Der betrachtete es eine Weile im Stillen.
»Sie sieht sehr lebendig aus«, sagte er dann und gab ihm die Zeichnung zurück. »Ist das eine Bekannte von dir?«
»Eher eine sehr gute Freundin, wenn du weißt, was ich meine.« Er sah den Totenläufer an. Der nickte, als habe er verstanden, und wartete darauf, dass Tom fortfuhr. »Also heute ist mir da jemand über den Weg gelaufen, der ihr irgendwie ähnlichsah. Da habe ich mich plötzlich an sie erinnert. War alles wieder da. Die Zeit, die wir zusammen hatten. Gute Sachen und schlechte, aber meistens die guten. Schon merkwürdig.«
»Gute Erinnerungen sterben nie, was?«
Tom rang sich ein trauriges Lächeln ab, von dem er hoffte, es wirke ehrlich.
»Nein, das tun sie wirklich nicht. Manchmal denke ich, dass sie direkt vor mir steht. Ich kann sogar ihre Bewegungen spüren. Sie ist da, aber eigentlich nicht. Es ist ja auch nicht möglich, dass sie mir hier begegnet. Dafür ist sie viel zu weit weg.«
Darüber dachte der Totenläufer nach. Zwischen seinen Händen drehte er das leere Tequila Glas. Sein zweites stand unberührt daneben.
»Sie ist also auf dem Festland?«, fragte er nach einer gewissen Zeit. Tom betrachtete die Zeichnung, so als würde er an eine längst vergessene Zeit zurückdenken.
»Wenn sie auf dem Festland wäre, dann wäre sie nah. Wirklich sehr nah.« Er machte eine Pause, rang mit den Worten. »Sie ist tot.«
»Tot?«, fragte der Totenläufer. Seine Lippen waren leicht geöffnet, die Augen wach und darin las Tom Überraschung. Zum Teufel, er wusste ja, dass der Mann sich gut verstellen konnte, aber dass er ihm so dreist den Geschockten vorspielte? Nun gut, wenn er das Schauspiel wollte, dann bekam er es auch.
»Ja, sie wurde umgebracht. Das ist schon einige Jahr her und der Täter ist nicht gefasst worden. Sie hat damals auf dem Festland gelebt, wollte aber nach Red-Mon-Stadt einwandern. Verrückte Welt sag ich dir. Sie lag einfach ausgeblutet in einer Straße. Abgelegt wie ein Kleidungsstück. Ihr Bruder hat es mir erzählt. Ich bin nur froh, dass ich dieses Bild nicht sehen musste. Es hätte mich vermutlich auch ins Grab gebracht.« Tom kaute auf seiner Lippe, betrachtete das leere Schnapsglas vor sich, so als läge darin der Schatten seiner toten Freundin. Die Frau, die tatsächlich auf der Zeichnung zu sehen war, saß augenblicklich mit seinem besten Freund im Kaninchenbau der REKA und erfreute sich bester Gesundheit. Ihr Name war Caren. Eine Frau mit feuerroten Haaren und einem unverbesserlichen Sinn für Gerechtigkeit.
»Es ist eine verrückte Welt, da stimme ich dir zu. Es passieren zu viele Dinge, die wir uns nicht erklären können. Jemanden zu verlieren, der einem viel bedeutet ist unerträglich. Tut mir leid, um deinen Verlust.«
Tom sah den Mörder neben sich an, suchte nach einer Spur von Falschheit, doch es zeichnete sich ehrliche Bestürzung auf seiner Miene ab.
»Danke«, brachte er erstickt heraus.
Der Totenläufer hob seinen Arm, winkte den Barkeeper heran und bestellte zwei Klare. Er legte Tom eine Hand auf den Rücken und sagte: »Lass uns auf deine Freundin trinken. Keiner sollte ohne Grund sterben.«
Es widerte ihn an. Die Berührung, die Freundlichkeit. Er musste sich zusammenreißen.
»Danke, das weiß ich zu schätzen.«
Gemeinsam stießen sie auf das Leben an und tranken auf ex. Der Alkohol floss durch Toms Glieder und wärmte ihn angenehm. Wenigstens etwas Normalität. Auf die Wirkung von Schnaps konnte man sich immer verlassen.
Tom klopfte sich auf die Brust und hustete kurz, so als kämpfe er mit dem Geschmack des Alkohols.
»Verträgst wohl nichts, was?«
»Nein, nicht wirklich. Ich komm so oft hierher, aber der Alkohol und ich, wir haben ein merkwürdiges Verhältnis …«
»Ist nicht jeder gleich.« Er machte eine Pause und fügte hinzu: »Und du bist wirklich öfter hier? Hab dich noch nie gesehen.«
»Ja, ich sitze meist hinten in der Ecke, aber heute war es irgendwie anders.«
»Hm«, sagte der Totenläufer, »heute solltest du mich treffen.« Tom versuchte zu deuten, was er damit sagen wollte. Glaubte er an Schicksal? War das der dezente Hinweis darauf, dass er ihn durchschaut hatte? Oder doch nur eine Floskel?
»Wahrscheinlich«, sagte Tom und entschied, trotz Unsicherheiten einen Vorstoß zu wagen. Irgendwann musste er ja den Spieß umdrehen. »Und, was verschlägt dich in diese Kneipe?«, fragte er. »Doch sicher nicht eine vergangene Liebe?«
Der Totenläufer fasste in seine Manteltasche und zog eine Münze heraus, die nach einem Einzelstück aussah. Auf die Vorderseite war ein Falke geprägt. Nichts, was man in Red-Mon-Stadt normalerweise zu Gesicht bekam. Er hielt sie ins Licht und meinte: »Die habe ich heute gefunden. Jemand hat sie nach Red-Mon-Stadt geschmuggelt. Ich wollte der Frage nachgehen, wer sie wohl hierher gebracht hat. Dazu lasse ich gern meine Gedanken baumeln.«
»Dann bist du sowas wie ein Hygienepolizist?«
Der Totenläufer lachte bitter. »Nein, mein Job ist komplizierter. Das ist eher ein Hobby. Ich sammele Geschichten. So wie deine. Wenn mich etwas interessiert, dann frage ich nach und manchmal entdecke ich etwas Gutes. Das ist so, als würde ich einen Film sehen. Einen dieser alten Streifen, die verstaubt wirken, aber doch faszinierend sind. Man kann sich sowas nicht in die Vitrine stellen, aber sie bleiben einem im Gedächtnis. Erinnerungen sterben nicht, richtig?«
Sympathie. Erneut. Es war nicht zu leugnen. Auch wenn dieser Mann keinen Respekt verdient hatte, etwas an ihm strahlte von innen heraus.
»Das macht doch keinen Sinn«, sagte Tom. »Ich brauche Dinge, die ich anfassen kann.«
Der Totenläufer stellte die Münze auf ihre Kante und stieß sie an, sodass sie sich im Kreis drehte. Sie tanzte auf der Platte. Im trüben Licht der Barbeleuchtung glitzerte das Silber.
»Das ist der Fehler dieser Gesellschaft«, sagte der Totenläufer. »Wir sammeln Materielles, aber das, was wir nicht anfassen können, ist das, was wirklich Bedeutung hat. Freundschaften, Beziehungen, Vergangenes, Erinnerungen. Das macht uns aus.«
»Und Taten«, rutschte Tom heraus. Der Totenläufer sah zu ihm. Ein glimmender Funken schlug sich durch seine Augen. »Ich meine, machen uns nicht auch Taten aus?«
Die Münze schlingerte, verlor die Standhaftigkeit und hörte letztendlich auf zu kreisen.
»Du hast recht. Taten machen uns aus. Aber nicht etwa das, was wir getan haben, sondern der Grund, weshalb wir es getan haben.«
Er sprach im Wir, meinte jedoch sich selbst, das war unverkennbar. Welche Gründe konnte er haben, zu tun, was er tat? Geld? Rache? Hass?
»Gründe sind doch nicht alles. Das Ergebnis zählt.«
Der Totenläufer lachte und nahm die Münze zwischen die Finger.
»Das sagen sie alle, aber ich denke, das ist ein Missverständnis. Frag dich selbst, ob es wichtig ist, dass sich die Münze dreht, wenn ich sie anstoße oder ob es nicht wichtiger ist, warum ich sie angestoßen habe. Weil ich mich langweile und bereits abschweife? Weil ich dir damit etwas zeigen wollte? Weil ich einfach Lust darauf hatte.«
»Spielt das wirklich eine Rolle?«, fragte Tom. »Wenn ja, dann wäre meine Zeichnung nichts wert. Ich habe sie ja nur gezeichnet, weil ich gerade Lust darauf hatte.«
»Guter Punkt, aber wer sagt denn, dass das kein guter Grund ist?«
»Ist das irgendeine Philosophie? Klingt gewaltig danach.«
»Nicht direkt. Es war lange Zeit der Grundsatz der Rechtsprechung. Ohne Motiv gibt es keine Täter. Aber Red-Mon-Stadt hat seine eigenen Regeln. Hier zählt allein der Nutzen einer Tat. Im Grunde das Ergebnis.« Der Totenläufer nahm seinen Tequila und trank ihn in einem Schluck aus. »Das wird uns allen noch das Genick brechen.« Er sagte es leise und mehr zu sich selbst. Dann holte er sein Portemonnaie aus der Manteltasche, zog einige Geldscheine hervor und legte sie auf die Kneipentheke.
»Ich werde jetzt gehen, aber deine Drinks gehen auf mich. Tob dich aus.«
Zu früh. Der Moment war vorbei und Tom hatte es nicht einmal bemerkt.
»Du willst schon gehen?«, fragte er deshalb wie einstudiert.
»Man soll gehen, wenn es am besten ist, sagt man doch. Unser Gespräch hat mich auf eine Idee gebracht. Und so eine Idee hat man nicht jeden Tag.«
›Noch nicht‹, kreischte eine Stimme in Toms Kopf. ›Du musst ihn stoppen.‹
»Ich kann dich nicht überreden, noch eine Weile zu bleiben?«
»Ich fürchte nicht.« Der Totenläufer reichte Tom die Hand und er ergriff sie automatisch. Sein Handschlag war fest, aber nicht erdrückend.
»Es war ein gutes Gespräch. Wie war noch gleich dein Name?«
»Glenn. Ich heiße Glenn«, sagte Tom und kam sich dumm vor.
»Glenn also. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja noch ein zweites Mal.«
Der Totenläufer löste sich aus der Berührung, wandte sich ab. Toms Kehle wurde trocken. Es durfte nicht umsonst gewesen sein. Der ganze Aufwand und dann das? Er musste es probieren. Entweder oder.
»Wie heißt du eigentlich?«
Der Held Red-Mon-Stadts drehte sich um, sah ihn an, dachte nach. Namen wurden nur intern weitergegeben. SDF-Soldaten waren nur so lange geschützt, wie sie außerhalb der Einsätze anonym blieben. Er rang mit diesem Fakt und Tom konnte die abschmetternde Antwort bereits von seinen Lippen ablesen. Doch nicht zum ersten Mal an diesem Abend wurde er vom Gegenteil überrascht.
»Neel«, sagte er. »Neel Talwar.«
Dann verließ der Totenläufer die Kneipe und das Einzige, was zurückblieb, waren Tom und sein kalter Herzschlag. Er hatte ihn. Seinen Namen. Der Geruch des Sieges lag in der Luft, doch er hatte etwas Bitteres an sich, das ihm Sorgen bereitete. Irgendetwas an Neel Talwar war ganz und gar nicht so, wie es sein sollte.
X
Der Entschluss, dem Totenläufer zu folgen, kam spontan. Als Tom im schummrigen Licht der Bar seine Zeichnung betrachtete, die unruhigen Linien und das Schwarz der Striche, wurde ihm bewusst, dass er mehr wissen wollte. Über Neel Talwar, der vorgab, Interesse an Schicksalen zu haben und dennoch seiner Rolle als Schlächter der Kriminellen und Wahrer der Sicherheit nachkam. So einfach konnte er es nicht auf sich beruhen lassen. Deshalb packte er die Zeichnung ein und verließ die Bar übereilt. Diese spontane Entscheidung konnte ihn alles kosten. Er war nicht geübt darin, Beschattungen durchzuführen, besaß keine Genehmigung für die Nachtsperre und konnte nicht einmal sicher sagen, ob der Totenläufer von SDF-





























