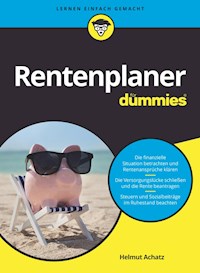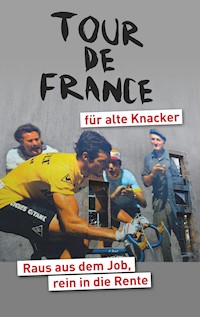
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Vom Beruf direkt in Rente ist eine schlechte Idee. Deswegen, und um dem Rentenschock zu entkommen, entschloss sich Helmut Achatz, die neue Lebensphase mit einem Tapetenwechsel einzuleiten. Andere Neurentner brechen auf und quälen sich auf dem Jakobsweg, für den bekennenden Nicht-Wanderer eine grauenhafte Vorstellung. Aber wie wäre es denn mit einer Tour de France? Aus der Idee wird ein Projekt, dass der frankophile Radfan im Sommer 2017 und 2018 tatsächlich umsetzt. In 52 Tagen strampelt er 3500 Kilometer in Frankreich ab. Meist allein unterwegs als anonymer Kulinariker und selbstzweiflerischer Protagonist seiner eigenen Tour. Von Diarrhö und Hexenschuss geplagt, von unerwarteten Anrufen aus der Heimat ausgebremst, ob des irreführenden Navis der Verzweiflung nah, passt Helmut Achatz seine Tour immer wieder den neuen Umständen und seinen Kräften an. Er schreckt auch vor Beschiss nicht zurück, feiert mit den Franzosen den Weltmeistertitel und schlürft Austern im Dutzend. Tour de France für alte Knacker ist Rentnercoaching, Reiseführer und Rad-Ratgeber. Der Neurentner erlebt seine Tour als kleines Abenteuer. Anregung und Ansporn für alle in ähnlicher Situation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärtsbewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren“.
Albert Einstein an seinen Sohn Eduard
Für
Sonja, Felicia, Franziska, Nicole, Moritz, Roger
Inhalt
Einleitung
Prolog
Vorbereitung
Training
Tourverlauf
Packen
Anreise
Start
Teil I – bis Bordeaux
1. Etappe : Col de la Faucille–Seyssel
2. Etappe : Seyssel–Crolles
3. Etappe : Crolles–La Mure
4. Etappe : La Mure–Gap
5. Etappe : Gap–Dignes-les-Bains
6. Etappe : Digne-les-B.–Castellane
7. Etappe : Castellane–Cannes
8. Etappe : Cannes
9. Etappe : Cannes–Marseille
10. Etappe : M.–10-en-Provence
11. Etappe : Aix–Cavaillon
12. Etappe : Cavaillon–Avignon
13. Etappe : Avignon
14. Etappe : Avignon–Nîmes
15.Etappe : Nîmes–St.Laurent-d’Aigouze
16. Etappe : St.-Laurent–Agde
17. Etappe : Agde–Narbonne-Plage
18. Etappe : Narbonne–Carcassonne
19. Etappe : Narbonne–Le Barcarès
20. Etappe : Le Barcarès, Argelès-Plage, Porte Vendres
21. Etappe : Le Barcarès
22. Etappe : Le Barcarès
23. Etappe : Le Barcarès–Quillan
24. Etappe : Quillan–Bram
25. Etappe : Bram–Toulouse
26. Etappe : Toulouse–Agen
27. Etappe : Agen–Marmande
28. Etappe : Marmande Bordeaux
Ende Teil I in Bordeaux
Teil II – ab Bordeaux
Fortsetzung Teil II ab Bordeaux
29. Etappe : Bordeaux
30. Etappe : Bordeaux – Blaye
31. Etappe : Blaye – Royan
32. Etappe : Royan – La Rochelle
33. Etappe : La R.–La Roche-sur-Yon
34. Etappe : La Roche–Nantes
35. Etappe : Nantes–Châteaubriant
36. Etappe : Châteaubriant – Rennes
37. Etappe : Rennes – Dinan
38. Etappe : Dinan – Saint-Malo
39. Etappe : Saint-Malo
40. Etappe : Saint-Malo – Avranches
41. Etappe : Avranches – Bayeux
42. Etappe : Bayeux – Deauville
43. Etappe : Deauville – Fécamp
44. Etappe : Fécamp – Rouen
45. Etappe : Rouen – Beauvais
46. Etappe : Beauvais – Couloisy
47. Etappe : Couloisy – Reims
48. Etappe : Reims – Ste-Ménehould
49. Etappe : Ste-Ménehould – Verdun
50. Etappe : Verdun – Rémilly
51. Etappe : Rémilly – Sarrebourg
52. Etappe : Sarrebourg – Strasbourg
Epilog
Literatur
Links
„Ich dachte, je schneller ich trete, desto früher kann ich in Rente“
Lance Armstrong
„Der kürzeste Weg zu sich selbst, führt um die Welt“, fand Hermann Graf Keyserling schon vor mehr als hundert Jahren heraus. Die Tour de France würde eine ganz spezielle Reise werden, so viel wurde mir schon früh klar.
Einleitung
Das war’s dann. War’s das? Ja, am 30. April 2017 endete mein Anstellungsverhältnis, seit 1. Mai bin ich Rentner. Nach 37 Jahren keine Themenkonferenz mehr, keine Layoutbesprechung, kein Redaktionsschluss, kein Gegenlesen, keiner, von dem du dir deinen Urlaub genehmigen lassen musst. Und jetzt? Das habe ich mich natürlich schon vorher gefragt.
Von der Redaktion direkt in die Rente? Eine schlechte Idee. Deswegen – und um dem Rentenschock zu entkommen – beschloss ich für mich, die neue Phase mit einem Tapetenwechsel einzuleiten und zu verreisen. Das würde nicht irgendeine Reise werden – keine Weltreise, kein Segeltörn, kein ayurvedisches Abtauchen in Südindien, keine Alpenüberquerung und kein Abmühen mit dem Jakobsweg, sondern eine ganz besondere: meine persönliche Tour de France. Aber wer redet von Reise – die Tour de France ist alles andere als eine Vergnügungsreise, eben eine Tour.
Auf die Idee bin ich übrigens bei der Lektüre des Buchs „Wenn das Wochenende 7 Tage hat“ von Herb Stumpf gekommen. Er empfiehlt, den Rentenbeginn mit einem „möglichst langen Urlaub, mit dem sprichwörtlichen Tapetenwechsel“ einzuleiten. Je mehr Abstand, desto besser.
Irgendwann keimte in mir der Gedanke an die Tour de France – meine Tour de France. Natürlich fielen mir da Lance Armstrong ein und Jan Ullrich, Eddy Merckx und Bernard Hinault. Hinault gewann die Tour insgesamt fünfmal, Miguel Indurain sogar fünfmal hintereinander.
Keine Angst, ich muss den Radprofis nicht nacheifern, habe ich doch alle Zeit der Welt. Es geht darum, das Bisherige hinter mir zu lassen, den Kopf frei zu bekommen und die Batterien neu aufzuladen. Es soll Spaß machen, die Sinne und den Geist anregen. Ich wollte die Tour ja nicht in drei Wochen wie die Profis absolvieren, aber vielleicht in sechs, sieben oder acht Wochen; keine 231 Kilometer langen Etappen, wie sie 2018 auf der 105. Tour de France gefahren wurden, aber 70 oder 80 Kilometer am Tag müssten doch zu schaffen sein.
Klar, keiner würde am Straßenrand auf mich warten; kein Wasserträger, kein Besenwagen, keine Entourage, keiner mich anfeuern, wie die Fahrer während des Aufstiegs zum L’Alpe d’Huez oder zum legendären Mont Ventoux, dem „Giganten der Provence“ angefeuert werden. Ich, ganz allein, ohne Wertung, ohne gelbes oder grünes Trikot, nur mit dem Tourverlauf im Kopf. Wenn es mir gelänge, „meine“ Tour de France mit Anstand abzuschließen, könnte ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Eine Herausforderung allemal – und was für eine. Und so gewann diese Idee an Fahrt.
Apropos „ganz allein“. Ich würde auch keine Mitfahrer haben, anders als Hape Kerkeling, der sich, einer inneren Stimme folgend, auf den Weg nach Santiago de Compostela machte und seine Erfahrungen in dem Buch „Ich bin dann mal weg“ beschrieb. Den Weg von Saint-Jean-Pied-de-Port bis Santiago de Compostela laufen sicher gefühlt Millionen Pilger. Tatsächlich „wimmelt es von Pilgern aller Altersklassen und Nationen“ bei seiner Ankunft. Bei meiner Ankunft wäre ich ganz allein. Das ist der Unterschied zwischen Jakobsweg und „meiner“ Tour de France. Ich glaubte auch nicht an die „reinigende Kraft der Pilgerreise“. Für mich war die Tour der Ausdruck einer Zäsur in meinem Leben, der Abschied vom bisherigen Angestelltendasein und der Beginn der Rente, der dritten Lebensphase, auf die uns keiner wirklich vorbereitet.
Vielleicht noch ein Wort zu Radfahren und Frankreich – beides Leidenschaften von mir. Mein Französisch reicht aus, um in Frankreich problemlos zurechtzukommen – und 150 Kilometer am Stück bin ich auch schon geradelt, allerdings in jungen Jahren und ohne Gepäck. Und als Rentner hätte ich Zeit für ein derartiges Projekt.
Der Entschluss war gereift.
Prolog
JJournalisten sind wie Waschweiber – sie können ihren Mund einfach nicht halten. Kaum war der Gedanke geboren, schon musste ich die Idee hinausposaunen. „Wie, du willst die Tour de France fahren?“, zweifelten meine Kollegen meinen Vorsatz an. „Wann?“, insistierten sie. Am besten gleich zu Rentenbeginn. Das heißt, im Mai 2017. Mit 63! Wer weiß, ob ich später noch dazu in der Lage wäre.
Das war gefühlt ein halbes Jahr vor Rentenbeginn. Der Countdown lief – Zweifel und Fragen drängten sich auf. Wo? Wie? Wer? Was? Mit wem? So gelegentlich geisterten die Bilder ausgemergelter und ausgepowerter Tour-Fahrer vor meinem inneren Auge. Ich fragte mich, ob ich mir das wirklich zumuten sollte. Tausende von Kilometern auf dem Rad? Über Pässe und Kopfsteinpflaster? Mit Gepäck und ohne Domestiken? Die Monate plätscherten dahin, dann Wochen – und schließlich kam mein Abschied von der Redaktion.
Klar gab’s eine Abschiedsfeier – und Abschiedsgeschenke. Jeder, der bei FOCUSMONEY geht, bekommt „seine Titelseite“. Es hatte sich herumgesprochen, dass ich zu Rentenbeginn meine „Tour de France“ fahren wollte. Auf „meinem“ Cover prangte dann mein Konterfei mit Fahrradhelm in Blau-Weiß-Rot, im Hintergrund das Peloton vor dem Eiffelturm und die Headline „Le Président auf Tour de France“.
Meine Idee hatte sich verselbstständigt. Jetzt gab’s kein Zurück. Ich fühlte mich bei meiner Ehre gepackt. Und um mich zu motivieren, schenkten mir die Kollegen ein Rad-Navi und einen Korb voller Weinflaschen Cuvée „Président“. Die Schlussredaktion überraschte mich mit dem Buch „Ein Mann und sein Rad“ von Wilfried de Jong. Derart gerüstet, sollte es doch ein Leichtes sein, den richtigen Weg zu finden.
Schon vorher fragte ich mich, ob es für ein derartiges Abenteuer Vorbilder gibt. Jein, nicht wirklich. Zufällig stieß ich auf das Buch des britischen Journalisten Tim Moore mit dem Titel „Alpenpässe und Anchovis – eine exzentrische Tour de France“. Moore, der in England als „Meister der Comedy-Reiseliteratur“ gefeiert wird, liebt episches Schwadronieren. Zur praktischen Vorbereitung allerdings ist sein Werk weniger tauglich.
Vorbereitung
Wer „seine“ Tour de France fährt, braucht ein Rad – und nicht nur das. Vielleicht, so dachte ich mir, wäre es sinnvoll, mit dem Kauf nicht bis zum Start zu warten. Einfahren und etwas Training wären sicher keine schlechte Idee. Also würde mich mein Weg demnächst in den Bike-Shop führen.
Welches Rad kaufen?
Nur, welches Rad kaufen? Ein Tourenrad? Geht gar nicht. Es sollte schon ein Rennrad sein, schließlich ist die Tour de France das Rennen schlechthin. Nur welches? Vielleicht ein Mix aus Tour- und Rennrad, sprich ein Gravelbike? Oder ein Endurance? Im Bike-Shop schwirrt einem Ahnungslosen schnell der Kopf. Scheibenbremse oder Felgenbremse? Rahmenhöhe? Übersetzung? Ritzel? Zum Glück hatte ich Schwiegersohn Moritz dabei. Ich wollte ja weder einen Ferrari noch einen Fiat, sondern eher einen Toyota – einfach Mittelklasse. Schließlich blieb ich bei Cannondale hängen. Das Caad12 Disc Ultegra 3 sah zwar schnittig aus, aber im schwarz-grauen Kleid nicht ganz so spektakulär. Ich wollte doch tunlichst begehrliche Blicke vermeiden und lieber tiefstapeln, so dass sich keiner animiert fühlen würde, mein Bike einfach mitzunehmen. Die semikompakte Kurbel mit 52 und 36 Zähnen – für vorne mit zwei Zahnkränzen – taugt für Allerweltsfahrer wie mich, das 11-28-Ritzelpaket hinten war freilich überambitioniert. Eine 11-32-Kassette wäre für mich gerade in den Bergen wohl besser gewesen. Nur allzu oft merkte ich, dass mir am Berg die Ritzel ausgehen, sprich, ich war schon bei der kleinsten Übersetzung angekommen und es war noch so viel Berg übrig. Die Erkenntnis kam allerdings zu spät.
Alles rund ums Velo
Was darf so ein Velo kosten? Das Cycling-Magazin „Gran Fondo“ hat zehn Endurance-Maschinen getestet: Für die billigste blättert ein ambitionierter Anfänger annähernd 2600 Euro auf die Ladentheke, die Highend-Geräte kosten locker mehr als 10 000 Euro. Da war ich mit meinen 2099 Euro noch gut dran. Das Bike war nur der Anfang. Ich würde ja auf mich gestellt sein – keiner, der mich mit Getränken, Ersatzteilen und Powerriegeln versorgt, keiner, der sich um mein Rad kümmert, während ich schlafe. Ich brauche ein Rad, Satteltaschen, Gepäckträger, Flaschenhalter, Helm, Schloss, Hose, Trikots, Werkzeug, Schläuche, Magnesium, Gesäßcreme.
Gesäßcreme fürs Perineum
Apropos Gesäßcreme, wer den ganzen Tag auf seinem Perineum vulgo Damm sitzt, muss sich nicht wundern, wenn’s irgendwann nicht mehr auszuhalten ist. Es brennt, es juckt, es zieht. Mit Gesäßsalbe lassen sich die Qualen lindern und die stundenlange Folter auf dem Sattel besser überstehen. Der britische Reiseliterat Moore schwört auf Savlon. Ich habe den Apotheker gefragt und bekam die Protect-Salbe von Ilon vorgeschlagen – eine „türkisfarbene, zähe Pampe“, die nach Kräutern wie eine Inhaliercreme rieche, findet das Mountainbike-Magazin „Bike“. Hätte ich den Test vorher gelesen, wäre die Entscheidung anders ausgefallen. Bei „Bike“ bekommt Eule’s Gesäßcreme sechs von sechs Sternen für „Schutz“, die Protect-Salbe fünf von sechs. „Die zähe, nach Blumen duftende Salbe hinterlässt einen langanhaltenden Schutzfilm auf der Haut“, so „Bike“ über Eule’s Gesäßcreme – „Top-Schutz für Ultra-Marathons“.
Ach ja, die Pedale. Ich ahnte schon, dass ich in den Alpen irgendwann absteigen würde – schlecht bei Klickpedalen. Aber, es gibt ja Mountainbike-Pedale mit einer Klickmechanismus- und einer Flat-Seite – die ideale Kombi, das „Beste aus zwei Welten“, versprach die Werbung. Im Fachjargon heißt das „Klickpedal mit Plattform“. Das hört sich doch richtig profimäßig an – oder? Wozu habe ich Schwiegersohn Moritz, der Triathlet ist?
War’s das? Ein stinknormaler Tacho wäre auch nicht schlecht, zusätzlich zum Fahrrad-Navi. Einfach, um abschätzen zu können, wie schnell ich denn gerade in die Pedale trete. Alles in allem war ich jetzt bei 2614 Euro – und noch keinen Kilometer geradelt.
Training
Ich war jetzt zwar ausgestattet, aber noch keinen Kilometer gefahren. Natürlich habe ich schon früh Bekanntschaft mit Rädern gemacht. Als Vierjähriger eierte ich bereits die Straße hinunter auf einem, soweit ich mich erinnern kann, grasgrünen Fahrrad. In unserer Eisenbahnerfamilie gab’s kein Auto. Mein Vater erledigte alles mit dem Rad, selbst größere Einkäufe. Klar, dass wir, die ganze Familie, radelten – zum Einkaufen, zum Baden, zum Bahnhof. In meinem Leben habe ich gefühlt mehrere Dutzend Räder verschlissen.
Ich erinnere mich noch an mein taubengraues Rabeneick, mit dem ich von Nyon nach Südfrankreich strampelte, und an mein Alu-Rad von Kettler. In der Tiefgarage stehen mittlerweile drei Räder und im Keller zwei, darunter ein altes Hercules-Rennrad. Das heißt, ich bin weder Couch-Potato noch Kraftpaket, sondern irgendwas dazwischen.
Ich bin jahrzehntelang mit meinem Hercules-Rahmenschaltungsrennrad gefahren. Was so sperrig klingt, ist es auch – die Schalthebel sitzen am oberen Drittel des Unterrohrs. Beim Schalten muss der Fahrer die Hand vom Lenker nehmen und nach unten greifen – links ist der Schalter für die Kurbel, rechts der für das hintere Ritzelpaket. Das verlangt Feingefühl und etwas Übung. Vorteil der Rahmenschaltung: Sie ist unkompliziert und längst nicht so reparaturanfällig wie ein Brems-Schalthebel. Aber so eine Rahmenschaltung ist so was von retro und entspricht schon lange nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Heute ist die Schaltung im Bremshebel integriert. Wie bei der Rahmenschaltung ist der Schalthebel auf der linken Seite für die Kettenblätter vorn, der rechte Schalthebel für die Ritzel hinten. Der große Schalthebel ist für die leichteren Gänge, der kleinere für die härteren Gänge.
Patent von einem Deutschen
Das Patent für die Brems-Schalthebel-Technik stammt vom deutschen Fahrradkonstrukteur Hans-Christian Smolik, der seine Erfindung 1981 zum Patent anmeldete. Er hatte es damals Fichtel & Sachs angeboten, der Traditionshersteller lehnte aber ab und verkannte die Bedeutung dieser Erfindung. Der Tüftler konnte die Gebühr nicht zahlen und sein Patent verfiel. 1989 kam dann der japanische Hersteller Shimano mit eben dieser Brems-Schalthebel-Technik auf den Markt – heute gehören Brems-Schalthebel zum Standard bei Rennrädern.
Sachs ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmen Trends verschlafen und damit vom Markt verschwinden. Denn Sachs war einmal eng mit dem Fahrrad verbunden, entwickelte das Unternehmen doch den Freilauf, ohne den Fahrräder kaum massentauglich geworden wären. 1997 kaufte das amerikanische Unternehmen SRAM Fichtel & Sachs auf – und es war vorbei mit der deutschen Fahrrad-Legende. Vielleicht wäre die Geschichte anders verlaufen, hätte Sachs Smoliks Patent gekauft und vermarktet.
Mal kurz nach Ingolstadt
Aber eigentlich wollte ich ja über mein Training schreiben … Also, dann los! Erst mal einige Übungsrunden über 20 und 30 Kilometer, dann eine größere Tour nach Freising zu meinen beiden Jüngsten, Felicia und Felix, und dann nach Ingolstadt zu meinem Ältesten, Fabian – ohne Gepäck, dann mit.
Apropos Gepäck. Auf dem MTX Beam Rack E-Type alias Gepäckträger steht explizit: maximale Zuladung neun Kilo (Warning! Maximal loading weight 9 kgs). Dazu kommen noch Side Frames. Eingespannt wird das Rack am Sattelrohr – deswegen auch die Gewichtsbeschränkung.
Schon bei der ersten Trainingsfahrt stellte ich fest: Wenn der Gepäckträger zu unentschlossen eingespannt ist, kommt er ins Schwingen und die Seitenrahmen nähern sich gefährlich den Speichen. Ganz abgesehen davon, dass die Satteltaschen gleichmäßig austariert sein sollten.
Wer mit Rennrad und Gepäck auf Tour gehen will, muss sich an Vorgaben halten – und die sind: Beschränkung aufs absolut Nötigste.
Mein Cannondale in schlichtem Schwarz-Weiß
Tourverlauf
Okay, das mit der Kondition ist abgehakt, aber welche Tour fahre ich? Wie sollte mein Streckenverlauf aussehen? Tour de France ist doch Tour de France – von wegen! Die Tour nimmt jedes Jahr einen anderen Verlauf, anders als der Jakobsweg. Seit mehr als tausend Jahren pilgern Gläubige und Sich-selbst-Suchende auf dem Camino Francés vom französischen Saint-Jean-Pied-de-Port bis zum nordspanischen Santiago de Compostela. Pilgerreiseführer empfehlen, fünf Wochen für die 800 Kilometer einzuplanen. Fünf Wochen würden vermutlich für „meine“ Tour de France und die 3600 Kilometer nicht reichen. Und 3600 Kilometer war nur eine grobe Schätzung.
Einmal kreist die Tour im Uhrzeigersinn, einmal entgegen. Welche Tour sollte ich nehmen? Sollte ich die Tour von 2016 nachfahren oder die Tour von 2017 vorausfahren? Auf Letzteres, sprich, eine Tour vorauszufahren, kam übrigens Moore, der die Tour von 2000 sechs Wochen früher startete und schon Mitte Mai aufbrach, während das eigentliche Rennen erst Anfang Juli begann. In seinem Buch „French Revolution – Cycling the Tour de France“ (deutscher Titel „Alpenpässe und Anchovis“) beschreibt er seinen Kampf mit 3630 Kilometern. Verführt zu einem solchen Abenteuer hat ihn wohl der Glamour dieses Rennens, für das er als „bekennender Faulpelz“ (O-Ton Moore) denkbar schlecht gerüstet war. Moore hatte aber noch mit anderen Unwägbarkeiten zu kämpfen. 2000 gab es noch keine Fahrrad-Navis und kein richtiges Smartphone. Das erste richtige Smartphone brachte erst Apple 2007 auf den Markt. Seitdem hat sich auch die Radkultur verändert. Dank Navi und Smartphone wissen wir alles über gefahrene Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höhenprofil, verbrauchte Kalorien – und können jederzeit von überall Bilder verschicken und die Welt an unserem Abenteuer teilhaben lassen.
Von wegen „große Schlaufe“
Moore musste sich wegen des Tour-Verlaufs mit dem Pressebüro der Tour de France herumschlagen, „ohne dessen Zutun nichts in diesem Buch so schwierig gewesen wäre“, wie er schreibt. Die PR-Damen des Tour-Büros wollten ihm vor dem Start partout den Streckenverlauf nicht verraten, weswegen er sich auf eine „aus der Oktoberausgabe von Procycling herausgerissene Landkarte im Postkartenformat“ beschränken musste – schlechte Voraussetzungen für eine 3630 Kilometer lange Tour. Vermutlich war er damals einfach nur stinkwütend ob der Selbstherrlichkeit der Pressetante. Die Tour 2000 startete in Poitiers, die Fahrer umkreisten erst einmal den Vergnügungspark Futuroscope im Einzelfahren, bevor sie in Richtung Bretagne rollten, um dann wieder umzukehren und an Tours vorbei nach Süden zu schwenken. Die Profi-Radlerin Monika Sattler hat sich etwas Ähnliches einfallen lassen: Sie fuhr den Radprofis auf der Vuelta a España voraus – und saß schon in der Nacht auf ihrem Bike, als die Athleten noch schliefen. Ihre Challenge beschreibt sie auf dem Blog radmonika.com. Es gibt also noch mehr Rad-Verrückte.
Wer sich die Tour als große Schlaufe, „la Grande Boucle“, vorstellt, sollte diese Vorstellung ganz schnell revidieren. Die heutigen Touren sind eher vergleichbar mit Site-Hopping. Das heißt, die Tour beginnt im Irgendwo, die Fahrer umkurven eine Region, werden per Bus oder Flieger zum nächsten Hotspot transportiert und setzen dann ihren Parcours fort. Wer sich die Karte der Tour de France 2018 anschaut, staunt nicht schlecht. Zum Schlussspurt auf den Champs-Élysées wurden die Radathleten quer durch Frankreich geflogen, von Espelette ganz im Südwesten nach Paris. Von „großer Schlaufe“ kann keine Rede mehr sein. Die Tour de France ist ein PR-Spektakel. Wer die Kennzahlen der Tour de France 2018 überfliegt, bekommt eine ungefähre Vorstellungen davon, wie „big“ das „Business“ ist: 176 Fahrer nahmen teil und 450 Begleitpersonen; sechs Flugzeuge wurde gechartert; zehn Ärzte und sieben Schwestern standen parat, 80 Polizisten hielten sich ständig einsatzbereit; 4200 Schilder wurden aufgestellt, Dutzende von Straßen asphaltiert; 2000 Journalisten berichteten über die Tour.
4676 Kilometer – ein Wahnsinn!
Aber zurück zu meiner Tour-Auswahl: Der Streckenverlauf von 2000 war also auch keine gute Idee. Warum nicht die Tour von 1954 – mein Geburtsjahr – nachfahren? Ich schaute mir den Cours an und war enttäuscht: 1954 rollte das Peloton – pardon, der Tross – von Amsterdam nach Antwerpen, um dann in Lille die französische Grenze zu überqueren – Gesamtdistanz 4670 Kilometer. Selbst wenn ich jeden Tag 80 Kilometer führe, bräuchte ich 58 Tage, mehr als acht Wochen. Mit Pausen und Anfahrt wäre ich wohl neun oder zehn Wochen unterwegs, sehr optimistisch geschätzt. Ich blätterte weiter. „Wie wäre es mit der Tour des Vorjahrs, sprich 2016?“, sage ich mir. Das war eher ein „V“ statt einer Schlaufe, denn 2016 startete die Tour vom Mont-Saint-Michel zum Utah Beach, führte Richtung Pyrenäen, durchquerte Okzitanien und die Region Auvergne-Rhône-Alpes, nahm einen Abstecher in die Schweiz und endete schließlich in Morzine im Département Haute-Savoie, von wo aus es per Flugzeug nach Paris ging. Also, auch der Tourverlauf 2016 war keine gute Idee.
Ich blieb letztlich beim Streckenverlauf von 1955 hängen. Start in Le Havre, mit einem Abstecher nach Belgien und in die Schweiz – Gesamtlänge 4476 Kilometer. „Wie wäre es denn mit einer abgespeckten Variante?“, beruhigte ich mich. „Belgien und Schweiz müssten ja nicht sein“, dachte ich weiter. Die Tour ist längst eine ausgebuffte Marketingveranstaltung, deswegen sucht sie jedes Mal Nachbarländer heim mit dem Hintergedanken, dort Geld abzugreifen, aber auch, um der Welt zu demonstrieren, wie sexy doch die Typen in ihren bunten Trikots und auf ihren Hightech-Maschinen sind. Da bleibt dann auch in den Nachbarländern so ein bisschen Glamour hängen.
1955 tourte das Peloton durch Namur in Belgien und Zürich in der Schweiz. 2017 begann die Tour in Düsseldorf, führte dann über Lüttich nach Belgien und nach Bad Mondorf in Luxemburg.
Zufällig stieß ich beim Googeln auf ein Tour-de-France-Plakat von Pernod – und da sah die Tour vergleichsweise harmlos aus, ja geradezu beschwingt. Start in Le Havre und Ziel in Paris mit ebendiesen Abstechern in Namur und in Zürich. Vermutlich haben mich aber die Flaschen Pernod und Pastis animiert, weswegen ich mich für den Jahrgang 1955 entschied.
1955 das richtige Jahr
Die Tour hat sich in ihrer mehr als hundertjährigen Geschichte grundlegend verändert. Zur Erinnerung, 1903, als Henri Desgrange die Tour erfand, um die Auflage seiner Sportzeitung „L’Auto“ in die Höhe zu treiben, waren 60 Cyclisten am Start, nur 21 beendeten die Tour – der Rest blieb auf der Strecke. Die Entourage war überschaubar. Der Sieger schaffte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von sage und schreibe 25,6 Kilometern – da lachen die Routiers von heute.
Die Länge der einzelnen Etappen der 1955er Tour hätte mich allerdings aufhorchen lassen müssen: Colmar–Zürich 195 Kilometer, Zürich–Thonon-les-Bains 267 Kilometer, Briançon–Monaco 275 Kilometer – was für ein Wahnsinn! Worauf hatte ich mich da nur eingelassen? War ich eigentlich noch ganz dicht? Toursieger 1955 war Louison Bobet, ein Franzose. Er gewann die Tour dreimal in Folge. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit: 34,3 Kilometer pro Stunde – und das bei 4476 Kilometern in drei Wochen. Eine Kollektion von Radbekleidung ist nach ihm benannt. Bobets großer Konkurrent Fausto Coppi zollte dem Franzosen, den er wegen seiner Leidensfähigkeit bewunderte, Anerkennung. „Das Rad bedeutet ihm alles“, fasste er es in einem Satz zusammen. Die Routiers kämpfen – damals wie heute – Tag für Tag bis zum Rand der Erschöpfung und darüber hinaus und quälen sich die höchsten Alpenpässe hinauf und rasen in halsbrecherischem Tempo wieder hinunter – Unterschied zu damals ist allerdings der Helm.
Auf was habe ich mich eingelassen!
Mein Entschluss stand dennoch fest. Allerdings würde ich die Tour von 1955 angesichts der Länge nicht 1 : 1 imitieren. Ich bin weder Athlet noch Mitte 20, ohne Entourage und mit Gepäck. Meine Tour würde anders aussehen als die von 1955, so viel war mir klar – und 4476 Kilometer war entschieden zu lang. Aber das jetzt schon jemandem verraten? Ich behielt für mich, dass ich mich zwar grob an den Etappen der Originaltour orientieren würde, aber „meine“ Tour meiner Kondition anpassen würde. Das heißt, ich stellte mir meine eigene Tour zusammen – und die würde nicht in Le Havre beginnen und auch nicht in Paris enden, sondern am Col de la Faucille, 30 Kilometer von Genf entfernt, beginnen und in Strasbourg enden. Und so sah mein geplanter Streckenverlauf aus:
Col de la Faucille
Chambery
Grenoble
Digne-les-Bains
Cannes
Hyères
Marseilles
Avignon
Millau
Albi
Carcassonne
Aix-les-Thermes
Pau
Dax
Arcachon
Royan
La Rochelle
Nantes
Rennes
St. Malo
Le Mont Saint-Michel
Caen
Le Havre
Dieppe
Roubaix
Sedan
Metz
und Strasbourg
– alles in allem 3617 Kilometer in 42 Tagen. So zumindest war der Plan.
„Meine“ Tour de France
Start war am Col de la Faucille, dann ging’s über die Alpen nach Cannes, von da nach Marseille per Zug (deswegen rote Punkte), weiter an der Mittelmeerküste Richtung Spanien, den Canal du Midi entlang nach Bordeaux, durch die Bretagne und Normandie, Richtung Osten nach Reims mit dem Ziel Strasbourg. Weiße Punkte stehen für Etappenziele.
Packen
Und immer noch war ich bei der Vorbereitung, genauer gesagt – beim Packen. Was nehme ich mit? Was brauche ich überhaupt? Im Hinterkopf schwang immer das Gewichtslimit von neun Kilo mit. Im Einzelnen waren das:
3 Trikots
2 Radhosen
2 Paar Radhandschuhe
1 Paar Mountainbike-Schuhe
1 Helm
1 Regenjacke
1 Regenhose
1 Paar Überschuhe
1 Kulturbeutel (Zahnbürste, Nagelset)
1 Paar Flipflops
1 Paar Turnschuhe
2 Paar Radsocken
1 Tube Gesäßsalbe
1 Erste-Hilfe-Set
1 leichte Trekkinghose
1 T-Shirt
3 Slips
1 Taschenmesser
1 iPad
1 Tastatur
1 Apple-Pen
1 Handy
1 Rad-Navi (Teas! One)
1 Satz Michelin-Karten
1 Übersichtskarte Frankreich
1 Schloss
2 Wasserflaschen
1 Fläschchen Kettenöl
2 Ersatz-Fahrradschläuche
1 Werkzeug-Kombi-Set
1 Reparatur-Set
1 Warnweste (Pflicht in Frankreich)
1 Packung Magnesiumtütchen
1 Tüte Flohsamenschalen
1 Tube Reisewaschmittel
1 Fahrradweste
1 langärmliges Funktionsshirt
1 Flasche Sonnenmilch
1 Fahrradlampe
2 Ersatzbrillen
3 Ladekabel
1 Luftpumpe
1 Handtuch
Badezeug
1 kleines Fläschchen Spülmittel
In Summe neun Kilo
Klingt alles ganz harmlos, aber die Summe macht’s. Beim Probepacken war ich ganz schnell an der Neun-Kilo-Marke, denn allein die Satteltaschen von Vaude sind zwar leicht, wiegen leer aber doch rund ein Kilo – und dann erst das Gepäck. Aus der Gazelle von Rad wurde mir nichts, dir nichts ein Packesel. Die Satteltaschen samt Inhalt wogen annähernd neun Kilo, die Lenkertasche bestimmt zweieinhalb Kilo.
Habe ich was vergessen?
Habe ich irgendetwas vergessen? Aber wozu gibt’s das Internet. Wer nach „Packliste“ und „Fahrradtour“ googelt, wird schnell fündig. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) beispielsweise hat eine Packliste zusammengestellt und liefert auch Tipps fürs Packen und für die Gewichtsverteilung auf dem Rad.
Camping hatte ich allein schon wegen des Gewichtlimits kategorisch ausgeschlossen. Ich würde jede Nacht im Hotel oder Bed & Breakfast übernachten, insofern sparte ich mir Zelt, Schlafsack und das ganze Drum und Dran.
Wie machen’s die anderen? Ich hatte im Vorfeld bei Tim Moore und David Howell gespickt. Der Brite Tim Moore war leider nicht sonderlich hilfreich, was die Packliste betrifft. Der Amerikaner David Howell („The Descent into Happiness“) campte unterwegs und brachte es auf 50 Pounds einschließlich Satteltaschen – das sind 22,68 Kilo. Aber Howell war auch „cross-country“ von Seattle nach Milwaukee unterwegs, wo es manchmal eben keine Hotels gibt. Ich würde durch das kulinarische Frankreich radeln, wo an jeder Ecke – so dachte ich zumindest – ein nettes Café oder Bistro auf mich warten würde. Wer am Tag 4000 Kalorien verbraucht, darf auch ausgiebig essen.
Anreise
20. Mai 2017
Von Olching zum Col de la Faucille
Irgendwie muss ich ja zu meinem Ausgangspunkt, dem Col de la Faucille, kommen. Sollte doch nicht so schwer sein. Mit der Bahn allerdings ist das ein aussichtsloses Unternehmen. Warum muss ich auch ausgerechnet von einem Pass aus starten, auf 1323 Höhenmetern? Na, von da ab geht es erst mal ein Stück bergab mit einer fulminanten Abfahrt – die Steigungen würden noch früh genug kommen.
Meine jüngste Tochter Felicia chauffierte mich schließlich nach Frankreich, wofür ich ihr bis an mein Lebensende dankbar sein werde. Immerhin sind das annähernd 580 Kilometer und sechs Stunden reine Autofahrt. Ich montierte lediglich das Vorderrad ab, verstaute Sattel- und Lenkertaschen im Kofferraum – und los ging’s.
Der britische Radheld Tim Moore hatte da 2000 wohl mehr Probleme bei seiner Anfahrt von London nach Poitiers. Mit Zug und Fähre kam er immerhin bis Calais, wo er sich ein Auto für die Strecke nach Poitiers mietete.
Fondue mit Ei und Kirsch
Wir trudeln schon am Nachmittag ein und haben Hunger. Aber vor 19 Uhr hat es wenig Sinn, in Frankreich zum Essen zu gehen. Wir warten also mit einem Aperitif auf unser Fondue Suisse. Im Mai noch ein Käsefondue? Angesichts der Höhe und der Temperaturen nicht ungewöhnlich. Wenn die Savoyarden eines können, dann Käsefondue.
Übrigens, so viel hat mir der Wirt verraten, gelingt ein sämiges Fondue Suisse am besten mit Appenzeller, Gruyère und Vacherin. Der Kellner meint es noch besonders gut mit uns und verquirlt ein Ei mit einem Gläschen Kirschwasser im Caquelon, dem Topf. Pappsatt und leicht angeheitert schlafe ich ein. Am nächsten Tag sage ich meiner Jüngsten adieu und bon retour. Ab jetzt bin ich auf mich allein gestellt.
Start
Am Morgen beim Packen fährt mir der Schreck in die Glieder – ich suche verzweifelt meine Rennradschuhe. Die Erkenntnis, meine Klick-Treter zu Hause gelassen zu haben, raubt mir fast den Verstand. „Kann doch nicht sein?“ Doch, kann sein. Ich suche alles ab. Irgendwann dämmert es mir: Ich war in Sneakers ins Auto gestiegen statt mit Rennradschuhen, mit denen ich normalerweise losfahre. Ich hätte lediglich meine Packliste durchgehen müssen. Die aber war nur in meinem Kopf abgelegt, statt in Papierform. Also, wer etwas Ähnliches plant, sollte sich eine Packliste zusammenstellen, sie ausdrucken – und sich tunlichst danach richten.
„Das fängt ja schon gut an“, grummele ich vor mich hin. In dem Moment bin ich froh, mich für ein „Klickpedal mit Plattform“ entschieden zu haben. Damit lässt sich auch mit Turnschuhen fahren. Im Nachhinein hat sich die Entscheidung als gute Idee herausgestellt. Natürlich geht’s mit Spezial-Schuh besser. Ich verfluche mich nicht nur einmal, aber das hilft wenig. Deswegen beschließe ich, bei nächster Gelegenheit entsprechende Schuhe zu kaufen. Die „nächste Gelegenheit“ sollte allerdings zwei Tage auf sich warten lassen. Aber davon im Anschluss.
Also, tief durchatmen, das Alpenpanorama genießen – der Mont Blanc schimmert durch den Morgendunst – und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Mir würden im Lauf meiner Tour noch mehr Pannen passieren.
Teil I – bis Bordeaux
1. Etappe – 1re Étape
21. Mai 2017
Vom Col de la Faucille nach Seyssel
W