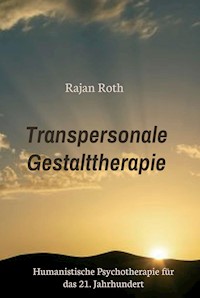
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Transpersonale Gestalttherapie ist eine neue Spielart der Gestalttherapie. Rajan Roth hat den Terminus nicht erfunden, aber er hat ihn sozusagen salonfähig gemacht. In diesem Buch wird an zahlreichen Beispielen aus dem Praxisalltag demonstriert und erklärt, wie sich Transpersonale Gestalttherapie ganz konkret umsetzen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Rajan Roth
Transpersonale Gestalttherapie
Humanistische Psychotherapie für das 21. Jahrhundert
© 2021 Rajan Roth
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-29752-4
Hardcover:
978-3-347-29753-1
e-Book:
978-3-347-29754-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Leitgedanke
Einleitung
1.Kapitel:
Transpersonale Weltsicht, transpersonale Psychotherapie
1.1 Kosmisches Bewusstsein. Richard Maurice Bucke
1.2 Bewusstes und Unbewusstes. Carl Gustav Jung.
1.3 Unbewusstes und Überbewusstes. Roberto Assagioli
1.4 Der Psychologie vom kranken Menschen eine Psychologie vom Gesunden hinzufügen. Abraham Maslow
1.5 Bewusstseinserweiterung ohne LSD. Stanislav Grof
1.6. Imagination, ein Weg nach innen. Jeanne Achterberg.
1.7 Die Grenzen des Denkens überschreiten, um zur Bewusstheit zu gelangen. Ken Wilber
1.8. Ein neues Bewusstsein ist möglich. Ervin Laszlò
1.9 Claudio Naranjo und das Esalen Institut
1.10. Die Inkarnation des Kosmischen Bewusstseins. Osho.
2.Kapitel:
Das Transistorradio und die Gestalttherapie
2.1 Das Hier-und-Jetzt Prinzip.
2.2 Der leere Stuhl
2.3 Das Psychodrama von Jacob Moreno
2.4 Das expressionistische Theater von Max Reinhardt
2.5 Die Gestaltpsychologie
2.6 Der Engpass
2.7 Was ist jetzt mit dem Transistorradio?
2.8 Fritz Perls im Urteil seiner Schüler
3.Kapitel:
Zur Verdeutlichung einiger Begriffe
3.1 Der Gestaltbegriff
3.2. Wahrnehmung
3.3 Gestalten schließen in der therapeutischen Praxis
3.4 Wie kommt es nun, dass Wahrnehmung in der Gestalttherapie eine derart zentrale Rolle spielt?
3.4.1 Fritz Perls, Erlebnisse, die ihn zur Achtsamkeit zwangen
3.4.2 Der Blick wird auf den Körper gerichtet
3.4.3 Psychoanalyse. Sich dem Innenleben zuwenden.
3.4.4. Kunst, Expressionismus, Dadaismus
4.Kapitel:
Transpersonale Gestalttherapie
4.1 Das Transpersonale ist das Normale
4.2 Die Transpersonale Gestalttherapie überwinterte in einer Nische
4.2.1 Claudio Naranjo
4.3 Transpersonale Gestalttherapie in der Praxis
4.3.1 Gudrun - Es braucht keine Lösung und der transpersonale Aspekt muss nicht benannt werden
4.3.2 Fritz Perls, die Traumarbeit und die Bedeutung der Imagination
4.3.3 Beispiel „Innere Bilder“
4.3.4 Gespräch mit der toten Oma
4.3.5 Dialog mit der Seele
4.3.6 Dialog mit Gott
4.3.7 Personale und transpersonale Anteile im Dialog
4.3.8 Gestalttherapeutisches Arbeiten in Pastlife-Sitzungen
4.3.9 Umgang mit vergangenen Leben in der Transpersonalen Gestalttherapie
4.3.10 Die Frau im blauen Kleid – wenn die Seele nie richtig im Körper angekommen ist.
4.3.11 Es läuft fast nie nach Schema ab
Kapitel 5
Schluß und Ausblick
Literaturliste
Danksagung
Über den Autor
Leitgedanke
Die Grundzüge der Humanistischen Psychologie wurden vor 60 Jahren formuliert. Alles, was sie bis heute auszeichnet, lag schon von Anfang an bereit. Auch der spirituelle Aspekt war immer präsent. In den ersten Jahren eher implizit, ab 1969, seit Gründung der Zeitschrift für Transpersonale Psychologie, auch explizit. Verändert hat sich in den sechs Jahrzehnten weniger die Humanistische Psychologie als vielmehr die Humanistische Psychotherapie. Zunehmend integrierte sie das transpersonale Verständnis des therapeutischen Prozesses oder sie verwandelte sich gänzlich begrifflich und inhaltlich in die Transpersonale Psychotherapie.
Hier seien einige Stationen dieses Weges skizziert: 1974 gaben Charlotte Bühler und Melanie Allen in ihrer „Einführung in die humanistische Psychologie“ einen Einblick in den Diskussionsstand zum Thema. Sie wählten für eine Zusammenfassung Worte von James Bugental. Er war der erste Präsident der AAHP. Seine wichtigsten Lehrsätze waren die folgenden:
I „Wenn auch postuliert wird, dass das Individuum selbst die größte Verantwortung für sein eigenes Leben trägt, sollte dies nicht als ein Rat betrachtet werden, sich zu isolieren und sich ohne Rücksicht auf die Realität auf sich selber zurückzuziehen. Das eigene Subjektsein zu akzeptieren und als Anspruch aufrechtzuerhalten, ist der erste notwendige Schritt auf dem Weg zu einer echten Begegnung mit einem anderen Menschen. Es bedeutet, sich für sein eigenes Handeln und Erleben verantwortlich zu fühlen und ist nicht als Freibrief gemeint, sich gehen zu lassen.“
II.„Das Ideal für die zwischenmenschlichen Beziehungen ist das der Gleichwertigkeit zwischen Menschen, von denen jeder ein Subjekt für sich ist und die Werte des Subjektseins und des anderen anerkennt und achtet.“ Bugental weist darauf hin, dass dies Martin Bubers Ich-Du-Beziehung ist (1958).
III. Die humanistische Ethik stellt eine existentielle oder Hier-und-Jetzt Perspektive auf und betont damit, dass „man immer nur im gegenwärtigen Augenblick lebt“. Dieser Begriff der Vitalität, wie sie jedem vorüberziehenden Augenblick innewohnt, wird zum Ausdruck gebracht, „wenn ein Mensch so gut wie möglich zu erkennen sucht, was er in jedem einzelnen Moment erlebt und was er mit der Situation, in der er sich befindet, in Wahrheit auf sich hat“.
IV. Die humanistische Ethik erkennt an, dass nichthedonistische Gefühle wie Schmerz, Konflikt, Kummer, Zorn und Schuld zum menschlichen Leben gehören und sogar geschätzt und nicht verdrängt oder versteckt werden müssen. Bugental betont, dass Gefühlsausdruck nicht einfach eine desorganisierte Reaktion ist, sondern für das Leben eines Menschen im Gegenteil eine Erlebnisbedeutung hat.
V. Menschen, die sich die humanistische Ethik wirklich angeeignet haben, suchen alle nach wachstumsfördernden Erlebnissen. (Bühler, Allen & Schön 1974, S. 82)
Die Entdeckung adäquater Werte und Überzeugungen sei das komplexeste und dringlichste Problem unserer Zeit. Es sei sogar die „Hauptaufgabe des modernen Therapeuten, dem Patienten zu helfen, sich über sein persönliches Wertesystem klar zu werden. Jourard, (ein Kanadischer Psychologe, 1968) ging sogar so weit, dem Therapeuten eine ähnliche Rolle wie die eines „Gurus“, des östlichen Seelenführers, zu empfehlen. Er kam auf diesen Gedanken, weil für ihn das Spirituelle in der menschlichen Beziehung wesentlich war“.
Auf den nächsten Seiten erörtern die Autorinnen die bedeutenden Wachstumschancen der Encounter-Gruppen, die damals gerade für viel Aufsehen sorgten. Thomas Greening kommt zu der Ansicht „dass diese Art des Erlebens bei den Gruppenmitgliedern zu einem Zustand führt, der einem mystischen Erlebnis nahekommen kann.“ (Bühler, Allen & Schön 1974, S. 84–85)
Fünf Jahre später, 1980, schrieb James Bugental in einer Aufsatzsammlung zur transpersonalen Psychologie: „Es gibt ein Wort, das, wie ich glaube, auf unsere unbeschreibbare Subjektivität hinweist – auf das unvorstellbare Potential, das in jedem von uns liegt, auf unsere Sehnsucht nach mehr Wahrheit und Lebendigkeit, auf unser tiefes Empfinden für die Tragödie des Menschseins, auf die endlos attackierte und doch unzerstörbare Würde unseres Seins, auf das Gefühl des Wunderbaren, in dem wir ständig leben, wenn wir wahrhaft bewusst sind und auf unseren Willen, dieses Wunderbare, das Wesen des Menschseins, zu erkunden - , und dieses Wort ist: Gott. Unsere Gotteserfahrung entspringt unserer tiefsten Intuition dessen, was letztlich in unserer eigenen Tiefe ist. Diese Anschauung ist mir aus meiner eigenen Suche entwachsen, aber sie wird bestätigt von den Entdeckungen anderer, die sich zusammen mit mir auf die Suche nach Transzendenz gemacht haben.“ (Walsh, Roger N., Vaughan, Frances 1985, S. 218–219)
Die humanistische Psychologie und Psychotherapie wiesen also von Anfang an transpersonale Implikationen aus. Am offensichtlichsten wird diese Feststellung belegt durch den Umstand, dass Abraham Maslow und Anthony Sutich nicht nur 1963 Mitbegründer der Gesellschaft für humanistische Psychotherapie waren, sondern auch die Mitbegründer der Zeitschrift für Transpersonale Psychologie, 1969, und der Association of Transpersonal Psychology, 1972. Sie zählten neben Carl Rogers und James Bugental zu den wichtigsten Theoretikern der humanistischen Psychologie und, darauf kommt es mir hier an: Die gleichen Neuerer initiierten sowohl die eine als auch die andere Schule. Mir scheint es daher offensichtlich: Die humanistische Psychologie war immer auch transpersonal. Nicht jeder humanistische Psychotherapeut hat das im Blickfeld, das ändert aber nichts daran, dass da immer eine Präsenz ist, die Veränderung erst möglich macht und Klient wie Therapeut durch den Prozess trägt.
Carl Rogers schrieb: „Ich verhalte mich auf eine Weise, die ich nicht rational begründen kann und die nichts mit meinen Denkprozessen zu tun hat. Aber dieses seltsame Verhalten erweist sich merkwürdiger Weise als richtig. Es ist, als habe meine Seele Fühler ausgestreckt und die Seele des anderen berührt. Unsere Beziehung transzendiert sich selbst und wird ein Teil von etwas Größerem. Starke Wachstums- und Heilungskräfte und große Energien sind vorhanden.“ (Rogers & Stein 2015, S. 80)
Als ich 1980 zum ersten Mal aus Indien nach Deutschland zurückkam, suchte ich nach Büchern von Ramesh Balsekar, von Ramana Maharshi oder von Bhagwan Shree Rajneesh. In den Regalen der Buchläden standen Bücher dieser Autoren nicht und sie über Bestellung zu beziehen, glich häufig einer Odyssee. Vierzig Jahre später gibt es keinen Buchladen mehr ohne Esoterik-Abteilung. Meditierende Geschäftsleute tauchen im Lotussitz in der Werbung auf, Yoga ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens Hunderttausender Europäer. Waren wir in den 80er Jahren mit unseren Ansichten noch Außenseiter, und daher auch vorsichtig mit dem was wir sagten, scheint es mir heute alltäglich über Spiritualität, außersinnliche Wahrnehmung oder vergangene Leben zu sprechen. Daher ist es meiner Ansicht nach jetzt auch an der Zeit, darüber zu sprechen und zu schreiben, ohne den Kopf einziehen zu müssen.
Diese Position ist schnell skizziert, länger dauert allerdings die Antwort auf die Frage: Wie sieht transpersonale Psychotherapie in der Praxis aus? Am Beispiel der Transpersonalen Gestalttherapie möchte ich das auf den folgenden Seiten darstellen.
Einleitung
Auf den letzten drei Seiten im „Handbuch der Gestalttherapie“ entfalten die Autoren Reinhard Fuhr, Martina Gremmler-Fuhr und Milan Sreckovic „Visionen für einen künftigen Gestaltansatz“. Die Ankündigung ist groß, das Ergebnis ist bescheiden. Nicht anders als auf den 1200 vorausgegangenen Seiten, wird darauf abgehoben, dass mehr Forschungsarbeit geleistet werden müsse und dass die Gestalttherapie eine widerspruchsfreie theoretische Grundlage brauche. „Einige zentrale Grundannahmen der Metatheorie der Gestalttherapie wie erkenntnistheoretische und anthropologische, ethische und bildungstheoretische Prämissen über die Natur, die Lern- und Beziehungsfähigkeit des Menschen wurden seit Gründung der Gestalttherapie aufgearbeitet, weiterentwickelt und differenziert.“ (Fuhr 2001, S. 1210) Dennoch habe die Theorie der Gestalttherapie noch genügend Defizite, die Praktiker wie Theoretiker in den kommenden Jahren beseitigen sollten.
Das Erscheinen des Handbuches liegt jetzt zwanzig Jahre zurück. Seitdem wurde unter anderem von Uwe Strümpfel 2006 „Therapie der Gefühle, Forschungsbefunde zur Gestalttherapie“ vorgelegt, im Übrigen wurde es eher still um dieses Thema. Ich blicke heute in eine andere Richtung: Meine therapeutische Praxis der letzten vierzig Jahre, vorwiegend mit Gestalttherapie, brachte mich zunehmend mit Inhalten in Berührung, die genau am anderen Ende des Spektrums menschlichen Wissens liegen: Es sind die nicht messbaren, nicht wägbaren Inhalte, es sind Qualitäten, nicht Quantitäten. Es geht um jene Einflüsse auf unser Leben und Denken, die in ihrer vollen Reichweite nicht dem Intellekt, sondern nur dem Gesamtorganismus Mensch zugänglich sind. Träume, Visionen, Kontakt zu den Ahnen, Außerkörperliche Wahrnehmungen, vergangene Leben, Meditationserfahrungen, das Erlebnis von Eins-sein mit dem Göttlichen, Schamanische Reisen, Erinnerung an vorgeburtliche Zustände, Nahtoderlebnisse und vieles mehr. Kurz, das Spirituelle oder, moderner ausgedrückt, das Transpersonale.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Wir wollen Therapeuten, die sich für fortschrittlich halten, nicht dazu ermuntern, ihrem Werkzeugkoffer noch ein paar raffinierte „Tools“ hinzuzufügen, mit denen sie den Erlebnishorizont ihrer Klienten um zusätzliche spirituelle Erfahrungen erweitern können. Wir sind mit Stanislaw Grof der Meinung, dass es ein grundlegendes Umdenken braucht, einen Paradigmenwechsel, weg vom alten, materialistischen Weltbild, hin zu einer holotropen, auf das Ganze gerichteten, Weltsicht.
Die westliche Wissenschaftswelt ist durch ihre Beschränkung auf das Primat der Materie auf einen Bruchteil dessen reduziert, was Wirklichkeit tatsächlich ausmacht. Die moderne Physik hat zwar das alte Weltbild nachhaltig erschüttert, dennoch versuchen Neurologen weiterhin die Herkunft des Bewusstseins aus der Materie, also aus dem neuronalen Apparat, zu erklären. Mir geht es in diesem Buch darum, ein grundsätzliches Weltverständnis vom Kopf auf die Füße zu stellen: Nach meinem Verständnis ist es nicht die Materie, die durch fortschreitende Differenzierung Bewusstsein hervorbringt, vielmehr ist das Bewusstsein primär, so etwas wie der Grundton alles dessen was ist. Daraus entstehen Seinsformen. Eine davon erscheint als dinghafte Welt. Wir müssen verstehen, dass es das Bewusstsein ist, welches sich in uns realisiert hat. Ein Bewusstsein, das von dem unbezähmbaren Verlangen getrieben ist, sich zu zeigen, lebendig zu werden, sich entfalten zu können. Wenn wir Leben als Erscheinungsform und als Spielfeld des Bewusstseins betrachten, schauen wir ganz anders auf unsere Psyche und auf unser persönliches Drama.
Wenn es eine Erneuerung der Gestalttherapie braucht, dann ist sie jedenfalls nicht in der Verfeinerung des theoretischen Wissens nach dem Vorbild traditioneller, universitärer Forschungsarbeit zu suchen, sondern in einer Öffnung gegenüber der Erfahrungswissenschaft wie C.G.Jung, Roberto Assagioli und Stanislaw Grof sie vorangetrieben haben. Es geht um das Wiederentdecken des Wunderbaren. Es geht darum sich daran zu erinnern, dass Gestalttherapie schon immer transpersonal war und dass sie erfolgreich eher aus dem Herzen denn aus dem Kopf praktiziert und weiterentwickelt werden kann.
Wie alles anfing:
Lüneburg, November 2015.
Ein Gestaltwochenende. Wir trafen uns mit Absolventen aus verschiedenen Jahrgängen des „Living the Gestalt“ Trainings. Wir laden regelmäßig zu solchen Wochenenden ein, damit der Kontakt untereinander nicht abreißt. So erfahren Dozenten und Studenten wo jeder steht. Wir arbeiten therapeutisch miteinander, weil es inspirierend ist, weil es das persönliche Wachstum unterstützt und Anregung für die eigene Praxis gibt. Ein Gestalttherapeut, eine Gestalttherapeutin ist niemals fertig, hört nie auf zu lernen. Wenn wir uns nach einer Pause von mehreren Monaten wieder treffen, sehen wir wie sich die individuelle Arbeitsweise in der Hand jedes einzelnen weiterentwickelt hat. Obwohl ursprünglich jeder dieselben Instruktionen bekommen hat, zeigt sich, dass es mit jedem neuen Gestalttherapeuten eine neue Ausformung der Gestalttherapie gibt. Wir wachsen persönlich und unsere Möglichkeiten in der therapeutischen Arbeit wachsen mit. Das muss ab und zu sichtbar dokumentiert werden. Unsere Gestaltwochenenden sind in diesem Sinne Wegmarkierungen.
Was ich sonst nur in der Einzelarbeit hinter verschlossener Praxistür erlebte, drängte an diesem Wochenende ins Freie. Gleich die ersten drei Demo-Sitzungen, die wir gaben, zeigten, wie Gestalttherapie, wenn man sie konsequent zu Ende führt, immer wieder über das Persönliche hinausweist.
Die Atmosphäre in dieser überschaubaren Arbeitsgruppe von zwölf Teilnehmern war entspannt. Wir Dozenten mussten unser Vorgehen keiner Überschrift unterordnen, wie das in Ausbildungsmodulen üblicherweise der Fall ist. Wir waren frei, von einem zum nächsten Moment mit dem mitzugehen, was aus der Gruppe entstand. Es herrschte eine lockere, wohlwollende, neugierige Zugewandtheit zueinander und zu den Möglichkeiten der Gestalttherapie.
Eine Offenheit war zu spüren: Alles liegt bereit, alles ist möglich.
Themen, Inhalte, Verbindungen, Dimensionen, die über das Biographische, das Persönliche hinauswiesen, zeigten sich drängend und unabweisbar. So erzählte Barbara in der Schilderung ihrer augenblicklichen Situation, dass sie alle Voraussetzungen zur Führung einer psychotherapeutischen Praxis erfüllt hatte. Prüfung bestanden, Zertifikate erworben, Praxisraum gemietet, Internetseite platziert, Visitenkarten gedruckt, aber es kamen keine Klienten.
„Wie fühlst du dich, wenn du davon berichtest?“, fragte Deva Prem, so wie wir das immer tun. Wir wollen immer wissen: Kannst du es fühlen? „Schließ´ die Augen und sag´ mir was du erlebst“, fügte sie hinzu.
Nach einigem Zögern begann Barbara: “Es fühlt sich an wie ein Sturm von Gefühlen. Totaler Aufruhr… Wut. Ich bin wütend. Und Verzweiflung. Als hätte ich alles getan und es nützt nichts. Mir ist, als hätte ich alles richtiggemacht und werde doch dafür bestraft.“ Es folgte ein kleiner unterdrückter Aufschrei.
„Mir kommt es so vor“, sagte Deva Prem, „als sähest du, wie sich eine ganze Szene vor dir abspielt. Mhm?“
„Ja, das ist verrückt. Um mich herum gibt es ganz viele Menschen. Sie sind aufgebracht und rufen und schreien durcheinander. Mir kommt es so vor, als sei ich der Mittelpunkt des Interesses…als stünde ich auf dem Marktplatz und mich umgibt eine tobende Menschenmenge…“
An dieser Stelle hielt Deva Prem für möglich, dass Barbara eine Szene erinnerte, die nicht aus diesem Leben stammte. Ein paar weitere Fragen halfen das zu klären. „Schau an dir runter, was trägst du für Schuhe? Was für Kleider?“ Oder: „Bist du ein Mann oder eine Frau?“ Und: „Wie alt bist du?“
Barbara war zum Zeitpunkt dieser Sitzung 32, sie fühlte sich aber wie knapp sechzig. Sie sah sich barfuß, der Rock war aus grobem Stoff. Der Marktplatz war ihr fremd und kam ihr doch bekannt vor. So gewann sie die Gewissheit, dass die Erinnerung aus einer anderen Zeit und von einem anderen Ort stammen musste. Wie die Geschichte weiterging? Das erzählen wir später, wenn wir aufzeigen wie wir derartige innere Ereignisse therapeutisch begleiten.
Die Arbeit mit Barbara ereignete sich am Freitag. Am Samstag und Sonntag wiesen weitere Sitzungen auf die transpersonale Dimension hin. Lisa arbeitete an der Frage: Wieso habe ich eine so verquere Beziehung zu Männern? Im Folgenden zeigte sich ihre Mutter und hinter ihr deren Mutter und dahinter eine lange Ahnenreihe von Frauen, die ihre Männer nicht hatten achten können.
In der dritten Beispielsitzung kamen wir von der Frage nach Sinn und Unsinn des Lebens auf einen Dialog mit Gott. Auch das ein deutlicher Blick über die Person hinaus.
Mir scheint heute, dass sich die transpersonale Dimension bei der therapeutischen Arbeit viel schneller zeigt und viel deutlicher sichtbar wird, wenn die Klienten bereits ihre Hausaufgaben gemacht haben. Unsere „Klienten“ an diesem Wochenende waren selbst Therapeuten. Jeder hatte mindestens zwei, eher drei Jahre Therapie und Ausbildung und damit ein gutes Stück Selbsterkundung hinter sich. Wie von selbst ging es tiefer oder höher, eben in transpersonale Bereiche.
Passen diese spirituellen Inhalte denn zu dem bodenständigen Pragmatiker Fritz Perls?
Das glaube ich wohl und ich bin keineswegs der Meinung, dass wir die Gestalttherapie unerlaubt ausdehnen, wenn wir deutlich machen, dass sie tatsächlich schon immer transpersonal war. Jeder kann nachlesen, dass Fritz Perls von Satori gesprochen hat, ein temporärer Zustand von Erleuchtung. Er verbrachte einige Monate in einem Zen-Kloster und er sah seine Aufgabe stets darin, die Teilnehmer seiner Gruppen auf dem Weg zu mehr Bewusstheit zu begleiten.
Zugegeben, es gibt kein Beispiel dafür, dass in seinen Sitzungen Klienten mit vorherigen Leben in Berührung kamen. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass sich in seiner Hand die Gestalttherapie von 1950 bis 1970 permanent veränderte. Die Menschen veränderten sich, die Themen wandelten sich und mit ihnen veränderten sich Fritz Perls und seine Therapie. Daher bin ich überzeugt: Wenn sich in seinen Therapiesitzungen ergeben hätte, was sich bei uns immer wieder zeigt, dann hätte er weitere Erlebnisfelder des Transpersonalen ebenso integriert, wie er den Engpass oder die Begegnung mit der Leere integrierte.
Am Ende der Traumarbeit mit Jane sagte Fritz Perls: „Wenn wir nun zwei entgegengesetzte Pole zusammenbringen, könnt ihr euch vorstellen, wie viel innere Spannung damit bereits beseitigt ist. So integrieren wir mehr und mehr, holen uns zurück was uns von unserer Persönlichkeit entfremdet hat, wachsen und werden zunehmend fähiger mit dem Leben zurecht zu kommen, anstatt Teile zu beschuldigen, zu bekämpfen, zu versuchen perfekt zu sein und all den Unsinn. Wir fangen an zu sein, zu glauben, Spaß zu haben, zu leiden, wenn es wirklich leidvoll ist und - was wollt ihr mehr von Therapie, was wollt ihr mehr vom Leben?“ (Perls 1968)
“What more can you want from therapy? What more can you want from life?”
Fritz Perls wollte, dass Klienten sich nach der Sitzung lebendiger fühlen. Er war also ein Verfechter oder ein treuer Diener eines erfüllten Lebens. Und so einfach ist es: Das Leben ist transpersonal, genauso wie der Tod, wie das Göttliche, wie Hingabe, wie die Unio Mystica.
Mir liegt daran, dass unsere Studenten die großartige und gewaltige Reichweite der Gestalttherapie kennen, sie selbst erfahren und sie auch tatsächlich in der Praxis nutzen. Seymour Boorstein schreibt, der transpersonale Therapeut unterscheide sich von seinen Kollegen der herkömmlichen Psychotherapie nur dadurch, dass er das Aufscheinen des transpersonalen Aspekts für möglich hält. Die transpersonale Psychotherapie unterscheide sich „von den traditionellen Ansätzen nicht so sehr in Methode oder Technik als vielmehr in Orientierung und Gesichtskreis. Es mag technische Neuerungen geben wie Meditation, Visualisierung und Bewusstseinstraining…aber der wesentliche Unterschied liegt in den Einstellungen des Therapeuten, Einstellungen, die den Verlauf der Therapie gestalten.“ (Boorstein 1988, S. 9)
Das trifft sicherlich den Nerv, aber was kann ein angehender Gestalttherapeut damit anfangen? Wie sieht eine gestalttherapeutische Sitzung aus, die den Klienten dabei begleitet den transpersonalen Raum zu öffnen und sich darin zu bewegen?
In diesem Buch möchte ich über Erfahrungen aus der Praxis der Transpersonalen Gestalttherapie berichten und dadurch anschaulich machen, dass man über diesen therapeutischen Ansatz mehr sagen kann, als nur: Der Therapeut braucht eben die richtige Einstellung. Es wird darum gehen, ganz generell den Blick für das Transpersonale zu schärfen, das tatsächlich in keiner therapeutischen Sitzung fehlt. Des Weiteren wird von Ahnenarbeit, Gesprächen mit dem Höheren Selbst und von erweiterter Traumarbeit die Rede sein.
Das Kernstück und der Höhepunkt dieser Ausführungen findet sich in der gestalttherapeutischen Arbeit mit vergangenen Leben. Bisher enthielt die Anleitung zur Begleitung eines Klienten nur, dass er das Geschehen aus anderen Inkarnationen noch einmal erlebt und fühlt, als geschehe es gerade jetzt, um dadurch mehr Bewusstheit in den Erlebnisraum zu bringen. Nach meiner Ansicht genügt das nicht. Ich werde hier darstellen was darüber hinaus nötig und möglich ist.
1. Kapitel:
Transpersonale Weltsicht, transpersonale Psychotherapie
In dem Begriff „Transpersonale Gestalttherapie“ kommen zwei Termini zusammen, die ich beide nicht erfunden habe. Beide wurden in den 1960er Jahren populär, vor allem in den USA.
Den Ursprung der Transpersonalen Psychologie finden wir bereits im 19. Jahrhundert bei dem kanadischen Arzt und Psychiater Richard Maurice Bucke. Er hatte in den 1870er Jahren ein Erleuchtungserlebnis. Von dieser Erfahrung ausgehend schrieb er später sein Hauptwerk “Cosmic Consciousness”. Diese Arbeit wird heute als das grundlegende Werk für transpersonale Wissenschaft betrachtet.
Zwei weitere Pioniere auf diesem Gebiet waren Carl Gustav Jung und Roberto Assagioli. C.G. Jung war Arzt und Psychiater am Burghölzli, der psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich. Der junge, italienische Arzt, Roberto Assagioli, promovierte und assistierte dort zwischen 1907 und 1915. Es entstand eine Zusammenarbeit und Freundschaft mit C.G. Jung, eine Kooperation, die für die Entwicklung der transpersonalen Psychologie und Psychotherapie von großer Bedeutung war.
Es ist nicht überliefert, ob Assagioli Buckes Veröffentlichungen kannte. Wenn nicht, so arbeiteten und dachten sie doch in die gleiche Richtung. Aus Briefwechseln zwischen Assagioli und C.G. Jung wissen wir, dass zu dieser Zeit der Begriff der Psychosynthese zuerst gebraucht wurde und dass seitdem auch vom „Transpersonalen“ die Rede ist. Von einer Dimension, die das Persönliche übersteigt. Allerdings dauerte es noch über 40 Jahre, bis in der Aufbruchsstimmung der 1960er Jahre der Begriff der Transpersonalen Psychologie einem weiteren Interessentenkreis bekannt wurde.
1969 kam es in Kalifornien zur Gründung des „Journal of Transpersonal Psychology“. Drei Jahre später wurde die ATP „Association of Transpersonal Psychology“ gegründet. Mitbegründer waren Abraham Maslow, Stanislav Grof und Ken Wilber. Schon seit 1963 existierte das fortschrittlichste Meditations- und Therapiezentrum dieser Zeit in Kalifornien. Es hieß Esalen. Dort begegneten sich unter anderen Perls, Maslow, Sutich und seit 1967 auch Stanislav und Christa Grof und seit dieser Zeit kann man auch in den USA von transpersonaler Psychotherapie sprechen. In Europa hatte Assagioli bereits 1926 sein Psychosynthese-Institut eröffnet. Die Psychosynthese gilt bis heute als eine der umfassendsten transpersonalen Therapieformen.
Der Begriff Gestalttherapie tauchte 1950 zum ersten Mal auf. Es war der Name, den Fritz und Lore Perls der von ihnen entwickelten neuen Therapieform gegeben hatten. Es wird im Folgenden noch viel über Gestalttherapie zu reden sein. Hier möchte ich nur die Bemerkung von Claudio Naranjo zitieren: “Es ist nicht generell bekannt, dass die Gestalttherapie … sich am deutlichsten von anderen Therapien unterscheidet durch ihre transpersonale Orientierung.“ (Boorstein 1988, S. 141)
In dem ich nun die beiden Begriffe zu einem zusammenbinde und im Folgenden von „Transpersonaler Gestalttherapie“ spreche, möchte ich hervorheben, dass Gestalttherapie immer transpersonal war und ist. So gesehen ist diese Wortverbindung unsinnig, denn wenn der Begriff Gestalttherapie immer schon den Hinweis auf den transpersonalen Aspekt enthielt, wäre die Wortkombination überflüssig. Aber hierbei verhält es sich ebenso wie bei der Wortprägung der Österreichischen Gestalttherapeuten, die ihre Fachrichtung „Integrative Gestalttherapie“ nennen. Wäre sie nicht integrativ, wäre es keine Gestalttherapie. Dennoch gebrauchen die österreichischen Kollegen diese Wortkombination und füllen sie für ihren Sprachgebrauch mit eigenem Sinn und Bedeutung. In einem Vortrag vor der ÖAGG hebt Hilarion Pertzold mehrfach hervor, dass in Österreich aus der Gestalttherapie die „Integrative Gestalttherapie“ geworden sei. (100 Jahre Fritz Perls 1994, S.41) Etwas Ähnliches schwebt mir für die erweiterte Gestalttherapie vor.
Für unsere Studenten, aber auch für Gestalttherapeuten, die seit Jahren praktizieren, soll diese Wortschöpfung ein leuchtend roter Zeigefinger sein, der immer darauf hinweist: Vergesst nicht den transpersonalen Aspekt! Degradiert die Gestalttherapie nicht zu einer Konversationsstunde oder zu einer effektvollen Kommodität. Nutzt die großartigen Möglichkeiten, mit Menschen Neuland zu betreten. Begleitet sie dabei Erfahrungen zu machen, die ihr Leben verändern werden!
Eine eindrückliche Zusammenfassung der transpersonalen Psychologie findet sich bei Stefan Schmitz: „Die Transpersonale Psychologie geht über herkömmliche psychologische und therapeutische Ansätze hinaus und erforscht die spirituelle Dimension der menschlichen Existenz. So befasst sie sich mit mystischen Erfahrungen und höheren Bewusstseinszuständen, mit dem mystischen Kern des Menschen und mit seinen spirituellen Entwicklungsmöglichkeiten, mit Meditation und Erleuchtung, aber auch mit spirituellen Krisen und mit dafür geeigneten Therapieverfahren.“ (Schmitz 2011, S. 353)
Dies sind die Autoren, um die es im ersten Kapitel geht:
Richard M, Bucke
1837-1902
C.G. Jung
1875-1961
Roberto Assagioli
1888-1974
Abraham Maslow
1908-1970
Osho Rashneesh
1931-1990
Stanislav Grof
geb. 1931
Ervin Laszló
geb. 1932
Claudio Naranjo
1932-2019
Jeanne Achterberg
1942-2012
Ken Wilber
geb. 1949
1.1 Kosmisches Bewusstsein. Richard Maurice Bucke
Im ausgehenden 19. Jahrhundert mischte sich neben fast allen anderen Nationen des Westens auch das gerade eben neu entstandene Deutsche Kaiserreich in den Wettstreit um die Verteilung der Kolonien ein. Das ging zum Teil auf den erstarkenden Nationalismus zurück, hatte aber vor allem wirtschaftliche und politische Gründe. Die Begleiterscheinungen dieses Interesses an fremden Kulturen brachte in den wenigen Jahrzehnten bis zum Ersten Weltkrieg tiefgreifende Veränderungen in die deutschen Bürgerhäuser. Es wurde Mode und gehörte zum gute Ton den Salon mit Trophäen, Sammlerstücken und Kultgegenständen der sogenannten Primitiven zu dekorieren.
Der prominenteste Reisende des 19. Jahrhunderts war Alexander von Humboldt. Als er schon 80 war und wusste, er würde keine Expedition mehr unternehmen, entdeckte er die Gebrüder Schlagintweit. Herrmann, Robert und Adolph. Sie wurden bekannt und berühmt als Bergsteiger, Universalgelehrte und Abenteurer. Gemeinsam und einzeln bereisten sie Indien und Hochasien. Sie brachten schriftliche und bildhafte Aufzeichnungen und Artefakte aus Süd- und Zentralasien mit – insgesamt 40 000 Objekte der Natur- und Kulturgeschichte der durchreisten Gebiete. (Brescius 2019)
Mit den wissenschaftlichen Aufzeichnungen zur Meteorologie, Geologie, Geographie und mit den neuen Dekorationsgegenständen, gelangten auch kulturelle und religiöse Informationen in die Häuser der Gebildeten und Reichen. Erzählungen über das Leben im Orient fanden offene Ohren. Die bemerkenswerte Lebensweise in buddhistischen Ländern fand in Deutschland immer mehr Interessierte. Das Studium des Buddhismus hatte schon seit der Romantik Anhänger gefunden. Nach 1850 nahm ihre Zahl im Westen ständig zu.
Das wichtigste Buch, „Die Lehre des Buddho“ von Georg Grimm, erschien zwar erst 1915, dennoch war Grimm, geboren 1868, eher ein Kind des 19. Jahrhunderts. Die zahlreichen Wiederauflagen seines Hauptwerkes zeigen deutlich, wie das Interesse an östlichen Weisheiten Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ständig anwuchs. Vor diesem Hintergrund muss man die Entwicklung der Transpersonalen Psychologie und die Arbeit von Maurice Bucke sehen: „Kosmisches Bewusstsein“.
Bucke wurde 1837 in England geboren. Seine Familie wanderte ein Jahr später nach Kanada aus. Nach wilden Jugendjahren studierte Bucke Medizin und verlegte sich auf das Fachgebiet Psychiatrie. Ein plötzliches und überwältigendes Ereignis veränderte 1872 sein Leben von Grund auf. Er versuchte jahrelang dieses Erlebnis zu verstehen und zu beschreiben. Das Ergebnis dieser Bemühungen war die Arbeit „Cosmic Consciousness“. Das Buch erschien 1901, ein Jahr vor Buckes Tod.
Es handelt sich um eine Beschreibung des menschlichen Geistes. Er stellt dort die Entwicklung des Bewusstseins in drei Stufen vor: Das einfache Bewusstsein der Tiere. Sie besitzen alle Sinne und können ihre Eindrücke verarbeiten und in Handlungen umsetzen. Weiter: Das Selbstbewusstsein des Menschen, wie es sich im Verstand, in der Achtsamkeit, in der Imagination und Ähnlichem zeigt. Schließlich das kosmische Bewusstsein. Hier beschreibt Bucke das Bewusstsein des Mystikers, in dem alle Grenzen aufgehoben sind, eine Realität gelebt wird, in der es kein „Ich hier drin“ gibt und kein „Gott da draußen“, vielmehr nur eine allumfassende Einheit des Bewusstseins.
Sein Erlebnis, das ihm während einer Kutschfahrt widerfuhr, beschrieb er so: “Er befand sich in einem Zustand ruhevoller, hingebender Freudigkeit. Mit einem Mal, ohne warnende Vorgefühle, empfand er sich wie von einer flammenden Wolke umfasst. In ersten Augenblick dachte er an eine plötzliche Feuersbrunst in der Stadt, im nächsten erkannte er, dass das Licht in seinem Innern hervorgebrochen sei. Zugleich wurde er von einem Frohlocken, einem Gefühl unbeschreiblicher Freudigkeit ergriffen und von einer so umfassenden Erleuchtung aller Verstandeskräfte, dass es unmöglich wäre, es in Worten wiederzugeben. In einem Augenblick hatte blitzartig Brahmas Glanz seinen Geist erleuchtet und ist ihm seitdem ein Licht auf seinem Lebensweg geblieben; ein Erlebnis der Seligkeit war in seiner Seele aufgegangen, die ihm für sein Leben eine Vorahnung des Himmels hinterließ. Unter anderem schaute und erkannte er, dass der Kosmos keine tote Materie, sondern lebendige Gegenwart ist, dass die menschliche Seele unsterblich ist und dass die Weltordnung ohne Zweifel dahin führt, sich zum Besten aller auszuwirken, dass das Grundprinzip der Welt das ist, was wir Liebe nennen, und dass die Seligkeit jedes einzelnen letzten Endes eine Gewissheit ist. Er behauptet, dass er in den kurzen Augenblicken der Erleuchtung mehr lernte als in allen vorhergehenden Jahren und manches, das ihm kein Studium je hätte bringen können… Das Erlebnis in jener Nacht war seine wahre und einzige Einweihung in ein neues und höheres Leben.“ (Bucke & Brasch 2018, S. 13–14)
1.2 Bewusstes und Unbewusstes. Carl Gustav Jung
Wie wenig bekannt die Schriften von Carl Gustav Jung sind, wurde mir bewusst, als ich für diese Ausarbeitung wieder in Jungs Werken las. Sein Buch „Bewusstes und Unbewusstes“ ist von 1957 bis 1973 vierzehnmal aufgelegt worden in insgesamt knapp 200 000 Exemplaren. Mein sozialwissenschaftliches Studium begann 1973, da schien Jungs große Zeit bereits vorüber, denn mir ist er an der Universität nicht begegnet. Bis heute kommt Jung im Studiengang der Psychologie kaum vor.
Seine Bedeutung liegt global gesprochen darin, dass er die Vorstellung vom Unbewussten aus der Enge befreite, in die Freud es gesperrt hatte. Bei Freud war das Unbewusste nur der Sammelort der vergessenen und verdrängten Inhalte. Auf einer oberflächlichen Schicht des Unbewussten mag das zutreffen, diese Schicht nennt Jung das persönliche Unbewusste. „Dieses ruht aber auf einer tieferen Schicht … das sogenannte kollektive Unbewusste.“ (Jung 1977, S. 11) Kollektiv nennt er es, weil dieses Unbewusste nicht individueller, sondern allgemeiner Natur ist. Es bildet eine allgemeine seelische Grundlage überpersönlicher Natur. Die Inhalte dieses Unbewussten sind die sogenannten Archetypen.
Anfangs nannte Jung sie auch Urbilder. Ihr bekanntester Ausdruck findet sich in Mythen und Märchen. „Dass Mythen in erster Linie psychische Manifestationen sind, welche das Wesen der Seele darstellen, darauf hat man sich bisher so gut wie gar nicht eingelassen.“ (Jung 1977, S. 14) Hier wird deutlich, weshalb Jungs Einsichten so epochemachend waren und sind: Er zeigte auf, dass die menschliche Psyche kein enger, dunkler Ort ist, keine Ansammlung eher unangenehmer Erlebnisse und Empfindungen, sondern eine unendliche Weite, eine das Universum umspannende überpersönliche Realität. „Dort bin ich in der unmittelbarsten Weltverbundenheit dermaßen angeschlossen, dass ich nur allzu leicht vergesse, wer ich in Wirklichkeit bin … darum muss man wissen, wer man ist. Kaum berührt uns nämlich das Unbewusste, so ist man es schon, indem man seiner selber unbewusst wird. Das ist die Urgefahr … .“ (Jung 1977, S. 31)
Jung zeichnete das Bild des Menschen, der im Zuge der Evolution aus dem paradiesischen Zustand, der Symbiose mit Gott und der Schöpfung, durch das Erwachen des Bewusstseins heraustritt. Das neu gewonnene Bewusstsein ist aufregend, aber auch sehr fragil. „Deshalb scheuen Primitive unbeherrschte Affekte, weil in solchen allzu leicht das Bewusstsein untergeht … Alles Trachten des Menschen ging daher nach Befestigung des Bewusstseins.“ (Jung 1977) Riten, Glaubenssätze, Geisterbannung, Enthexung waren daher Mauern dagegen, dass das Meer des Unbewussten die kleinen Inseln der Bewusstheit wieder überflutet und zurückgewinnt. „Es sind diese seit Urzeit errichteten Mauern, welche später zu den Fundamenten der Kirche wurden. Es sind darum auch diese Mauern, die einstürzen, wenn die Symbole altersschwach werden.“ (Jung 1977, S. 32)





























