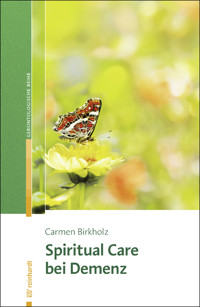Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Edition Leidfaden – Basisqualifikation Trauerbegleitung
- Sprache: Deutsch
Menschen mit Demenz sind in den letzten Jahren ihres Lebens von vielfältigen Abschieden und Verlusten betroffen, wobei ihr dementierendes Verhalten und Erleben und die gesellschaftliche Reaktion darauf für sie selbst und ihre Zugehörigen eine wesentliche Quelle von Trauer sind. Demenz unter dem Blick der Trauer zu betrachten eröffnet einen hilfreichen Zugang. Viele Emotionen und Verhaltensweisen werden leichter verständlich. Da viele Begleitende Trauer aus eigener Erfahrung kennen, ist es ihnen möglich, Menschen mit Demenz auf Augenhöhe zu begegnen, emotional Solidarität zu empfinden und deren Würde zu bewahren. Trauerbegleitung kann so zu einem wichtigen Schlüssel in der Begleitung von Menschen mit Demenz sein. Das Buch verbindet ressourcenorientierte Begegnungsansätze mit einer wertschätzenden Haltung der Trauerbegleitung. Die Autorin reflektiert Definitionen und Äußerungen verschiedener Disziplinen zu Demenz und fragt nach hilfreichen Annahmen für eine förderliche Trauerbegleitung. In vielen Alltagsbeispielen stellt sie Situationen guter Praxis dar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EDITION Leidfaden
Hrsg. von Monika Müller
Die Buchreihe Edition Leidfaden ist Teil des Programmschwerpunkts »Trauerbegleitung« bei Vandenhoeck & Ruprecht, in dessen Zentrum seit 2012 die Zeitschrift »Leidfaden – Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer« steht. Die Edition bietet Grundlagen zu wichtigen Einzelthemen und Fragestellungen im (semi-)professionellen Umgang mit Trauernden.
Carmen Birkholz
Trauer und Demenz
Trauerbegleitung als verstehender Zugang und heilsame Zuwendung
Vandenhoeck & Ruprecht
Für Helmy, Ingeborg und Janne – meine Lehrerinnen
Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-90082-7
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter:www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
Umschlagabbildung: Udo Geisler
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen /
www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Inhalt
Vorwort
1Einführung
2Wie äußert sich das, was man (noch) Demenz nennt?
3Zugänge zu dementierenden Menschen
4Demenzkonstruktionen
4.1Demenz im Selbsterleben von Betroffenen
4.2Demenz im Erleben von Angehörigen
4.3Demenz als lebendiges Totsein
4.4Demenz als Abschiedsweg aus dem Leben
4.5Demenz als »Auflösungsweg« von unerledigten Lebensaufgaben
4.6Demenz als neurologischer und sozialpsychologischer Veränderungsprozess
4.7Demenz als degenerative Erkrankung
4.8Demenz als Mythos einer Krankheit oder eine mögliche Form der Gehirnalterung?
4.9Demenz als Transzendieren der Knechtschaft der Vernunft – eine spirituelle Sicht
5Was ist Trauerbegleitung bei Menschen mit Demenz?
5.1Haltung in der Trauerbegleitung
5.2Hilfreiches aus der Trauerforschung
5.3Trauerfaktoren von Menschen, die mit einer Demenz leben
5.3.1Trauer, die durch die demenziellen Veränderungen ausgelöst wird
5.3.2Trauer, die durch die Pathologisierung und Medikalisierung ausgelöst wird
5.3.3Trauer durch Gewalterfahrung
5.3.4Trauer durch erzwungene Wechsel des Wohnumfeldes
5.3.5Trauer bei Demenz: unerkannt und infolge traumatisch
5.4Die Praxis der Trauerbegleitung bei Menschen mit Demenz
5.4.1Sprache finden in der Balance von Gestern und Heute
5.4.2Nähe herstellen, emotional und körperlich
5.5Trauerfaktoren von An- und Zugehörigen
5.5.1Kommunikationsstörungen
5.5.2Die Personen verändern sich
5.5.3Zukunftsbilder
5.5.4Veränderte Rollen
5.5.5Zeugen und Zeuginnen der Würdelosigkeit und der Entpersonalisierung
5.5.6Fehlende gesellschaftliche Solidarität
5.5.7Der Tod
6Herausforderungen für die Demenz- und die Trauerforschung
7Aufgaben von Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleitern im Lebensabschnitt mit Demenz
7.1Trauer begleiten
7.2Palliative Care und hospizliche Begleitung
8Frieden schließen mit Demenz und abschiedlich leben
Literatur
Vorwort
Dank
»Gott, wir bringen vor dich unser ungelebtes Leben:
Wenn wir lachen, ohne uns wirklich zu freuen,
wenn wir versuchen uns zu lieben ohne wirkliche Beziehung,
wenn wir depressiv sind, ohne wirklich zu trauern,
wenn wir uns mit Medikamenten betäuben, anstatt Tränen zu weinen,
wenn wir vom Geist sprechen, ohne wirklich begeistert zu sein.
Gott, hilf uns, leise das Leben wieder zu lernen.«
Joachim Scharfenberg
Seit über zwanzig Jahren arbeite ich als Dozentin, Trainerin und Projektleiterin im Feld der Altenhilfe mit dem Schwerpunkt der hospizlich-palliativen Kultur. In Schulungen und ethischen Fallbesprechungen haben mich viele Mitarbeiter/-innen an ihren Erfahrungen und dem Leiden an der Praxis teilhaben lassen. Die Trauer schleicht Tag und Nacht durch die Flure von Altenpflege-einrichtungen und beeinflusst die Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-innen gleichermaßen. Ich verdanke vielen Menschen in diesem Feld die Substanz und Echtheit der Erfahrungen, die in dieses Buch einfließen.
Grundlegende Einsichten, die meine Haltung zu Trauer und Trauerbegleitung prägen, verdanke ich meinem Lehrer Prof. Joachim Scharfenberg.
Mein besonderer Dank gilt Helmy, Ingeborg und Janne, die ich in ihrem Alter begleiten darf und die mir – jede auf ihre individuell eigene Art – ihre Trauer zeigen, mit der ich oft verwoben bin. Hier bin ich An- und Zugehörige und wir teilen diesen Weg. Sie haben mir Schmerzen bereitet, aber auch viele glückliche Momente im Zusammenleben geschenkt, wenn sie »leibhaftige« Beispiele dafür sind, dass es die Demenz mit ihrem »Verlauf« nicht gibt. Als ich in diesem Sommer nach zwei schlaflosen Nächten Helmy fragte (der eine schwere Demenz zugeschrieben wurde), ob ich Ingeborg zu ihr ins Haus holen dürfe, damit wir hier alle zusammenleben, habe ich gemerkt, wie abhängig ich von ihrer Zustimmung war. Sie hat das gespürt und gesagt: »Sie ist dir ganz wichtig, ne. Da halten wir als Familie doch zusammen.« Ohne Helmys Zustimmung wäre es nicht gegangen, dass wir ihr Wohnzimmer ausräumen und ein Zimmer für meine sterbende mütterliche Freundin einrichten. Ingeborg hat sich mittlerweile vom Sterben verabschiedet. Im Zusammenleben haben wir uns alle aufeinander eingelassen und teilen das Leben – ein Leben, das auch mich verändert. Das Leben ist schön und ich möchte diese Erfahrung nicht missen!
Dass ich das so sagen kann, geht nur, weil mein Mann Rolf Plake der wunderbare Mensch ist, der er ist, und wir gemeinsam das Leben in Loyalität gegenüber denen, die uns über viele Jahre viel geschenkt haben, genießen. Ihm verdanke ich auch das Lesen des Manuskripts und viele geerdete Anregungen. Auch meine Freundinnen Monika Benend und Elisabeth Pieper teilen mein Ringen um das Thema und haben kritisch gelesen. Autoren und Autorinnen eines Buches sind immer viele. Einige habe ich mit Dank namentlich genannt.
1Einführung
»Es ist lebenswichtig, in den Beziehungen zum anderen viel Raum für Wandel zu lassen. Zu solchen Änderungen kommt es in Übergangsphasen, in denen die Liebe tatsächlich reifen und sich ausweiten kann.
Dann ist man in der Lage, den anderen wirklich zu kennen – ihn zu sehen, wie er ist, mit seinen Fehlern und Schwächen, ein menschliches Wesen wie man selbst.
Erst in diesem Stadium ist man so weit, dass man sich ehrlich für den andern entscheiden kann – ein wahrer Akt der Liebe.«
Der XIV. Dalai Lama (in: Föllmi u. Föllmi, 2003)
Mir ist nicht wohl beim Reden von »Demenz«, weil ich glaube, dass es sie nicht gibt. Dieses Unbehagen begleitet mich bei all meiner Beschäftigung, beim Schreiben und Sprechen über das »Phänomen D«. Dieses Unbehagen auszuhalten ist wohl eine Aufgabe im Ringen um die Würde der betroffenen Menschen und im Versuch, angemessene Worte zu finden für das, was Betroffene erleben, und um eine diskursfähige Theorie zu entwickeln.
Die stigmatisierende, die ganze Person umfassende Macht der Wörter »Demenz« oder »demenzkrank« ist eine Verwundung der Würde der vielen alten Menschen, die zunehmend von Behinderungen im Alter betroffen sind. Dieses gesellschaftlich mächtige Phänomen der Hospitalisierung ohne feste Mauern, allein in den Köpfen breiter gesellschaftlicher Massen, löst in mir Ohnmacht und Trauer aus. Ich ringe um Worte, die dem Phänomen gerechter werden und die die Behinderungen zwar nicht wegreden, aber sie anders betrachten. Es ist mir noch nicht gelungen, ein anderes Wort zu finden, das fähig ist, einem Diskurs standzuhalten. Ich suche danach. Und gleichzeitig denke ich, ich finde kein Wort, weil es keines gibt, sondern die Lösung in der grundsätzlichen Abschaffung des Wortes »Demenz« liegt.
Es geht um überwiegend alte Menschen, deren Leistungsfähigkeit nachlässt und die, wollen sie ein erfülltes Leben bis zuletzt leben – ganz nach den Leitgedanken der Hospiz- und Palliativbewegung –, auf eine mitmenschliche Einbettung angewiesen sind. Diese Einbettung muss die ganze Gesellschaft leisten und kann nicht von den An- und Zugehörigen allein (persönliche Überforderung) oder den zunehmend verzweigten gesetzlichen Versorgungsformen getragen werden (finanzielle Überforderung).
Eine These: Demenz erscheint als Phänomen in einer immer schnelllebigeren Welt, die alle abhängt, die nicht schnell genug sind (vgl. Geiger, 2011, S. 58; Gronemeyer, 2013). In den dementierenden Erscheinungsformen zeigt sich in einem Aspekt die Trauer, dass man in unserer Gesellschaft nicht alt, langsam, bruchstückhaft werden darf, ohne aus dem »Wir« einer Gesellschaft herauszufallen, gar abgesondert zu werden. Dieses Phänomen hat der französischen Philosoph Michel Foucault beschrieben (Foucault, 1968) und die »Geburt der Krankheit Demenz« wird später unter dem Aspekt der Medikalisierung betrachtet.
Demenz unter dem Blick der Trauer zu sehen, eröffnet hilfreiche Verstehenshorizonte für die Betroffenen, die Begleitenden und eine Gesellschaft, die ein Jahrhundert der schnellen Entwicklungen und der mörderischen Gewalt hinter sich hat und in ein Jahrhundert übergegangen ist, in dem beides fortgeführt wird.
Die Demenz als Trauerreaktion zu interpretieren, ist ein Aspekt. Der andere ist, die Vielfalt von Erfahrungen in den Blick zu nehmen, die Trauer in den Betroffenen auslösen können.
Menschen mit Demenz sind in den letzten Jahren ihres Lebens von vielfältigen Abschieden und Verlusten betroffen, wobei ihr dementierendes Verhalten und Erleben und die gesellschaftliche Reaktion darauf für sie selbst und ihre Zugehörigen eine wesentliche Quelle von Trauer sind. Demenz unter dem Blick der Trauer zu betrachten, kann ein hilfreicher Zugang für Begleitende sein. Viele Emotionen und Verhaltensweisen werden leichter verständlich. Viele Begleitende kennen Trauer aus eigener Erfahrung. So ist sie eine Möglichkeit zur Begegnung auf Augenhöhe, in der emotional Solidarität empfunden werden kann. Trauerbegleitung kann so ein wichtiger Aspekt in der Begleitung von Menschen mit Demenz sein, die die Würde aller wiederherstellen kann (vgl. Birkholz, 2014).
Mit den Kategorien der frühen Trauerforschung (Elisabeth Kübler-Ross, Verena Kast) lässt sich die These aufstellen, dass Gesellschaften, die phobisch mit dem Phänomen Demenz umgehen, in der Phase des Verdrängens sind. Es stellt sich die Aufgabe (William Worden), den Verlust der Größenphantasie über den Menschen zu begreifen und dann weiter zu trauern, bis am Ende die Brüchigkeit und Sterblichkeit des Menschen Akzeptanz und eine sorgende Einbettung in das Soziale finden können.
Demenz wird hier als eine Form betrachtet, sich aus dem Leben zu verabschieden. Dieser Blick ermöglicht, die Würde der Betroffenen zu wahren. Mit dem Blick auf Faktoren, die die Trauer erschweren, geht es mir darum, das in der Gesellschaft vorherrschende Bild von Demenz als Krankheit kritisch zu hinterfragen und als Konstruktion zu verstehen. Menschen, die in der Altenhilfe oder der Palliativen Geriatrie dementierende Menschen begleiten, berichten vom Ringen um die Würde der Betroffenen und folgen verstärkt personzentrierten Ansätzen von z. B. Tom Kitwood und Naomi Feil. Es geht dabei immer wieder auch um die Suche nach einer angemessenen Sprache. Die niederländische Pflegewissenschaftlerin Corry Bosch (1998) hat in ihrer Vertrautheitsstudie z. B. den Begriff »dementierend« geprägt, da sie gegen ein statisches Verständnis von Demenz das Prozesshafte darstellen möchte und die An- und Zugehörigen oder Begleitende in der Pflege sich auf konkrete, sehr unterschiedliche und individuelle Verhaltensweisen einlassen müssen, um Menschen zu verstehen.
Das vorliegende Buch verbindet ressourcenorientierte Begegnungsansätze mit einer wertschätzenden Haltung der Trauerbegleitung. Neben der Trauer der dementierenden Menschen wird der oft lange und gesellschaftlich wenig beachtete Trauerweg der An- und Zugehörigen beschrieben. Es werden Definitionen und Äußerungen verschiedener Disziplinen zu Demenz reflektiert und nach hilfreichen Annahmen für eine förderliche Trauerbegleitung gefragt. Diese kann Wesentliches zur Qualität des Lebens mit Demenz beitragen. Es stellt in vielen Alltagsbeispielen die Unterschiedlichkeit erlebter Praxis dar. Speziell wird auf die Rolle der hospizlich orientierten Sterbe- und Trauerbegleiter/-innen eingegangen und ihren Begleitungsauftrag von Menschen mit und ohne Demenz.
2Wie äußert sich das, was man (noch) Demenz nennt?
»Wenn ich zu Hause bin, was nicht allzu oft vorkommt, da wir die Last der Betreuung auf mehrere Schultern verteilen können, wecke ich den Vater gegen neun. Er liegt ganz verdattert unter seiner Decke, ist aber ausreichend daran gewöhnt, dass Menschen, die er nicht erkennt, in sein Schlafzimmer treten, so dass er sich nicht beklagt.
›Willst du nicht aufstehen?‹, frage ich ihn freundlich.
Und um ein wenig Optimismus zu verbreiten, füge ich hinzu:
›Was für ein schönes Leben wir haben.‹
Skeptisch rappelt er sich hoch. ›Du vielleicht‹, sagt er.
Ich reiche ihm seine Socken, er betrachtet die Socken ein Weilchen mit hochgezogenen Augenbrauen und sagt dann: ›Wo ist der dritte?‹
Ich helfe ihm beim Anziehen, damit das Prozedere nicht ewig dauert, er lässt es bereitwillig über sich ergehen. Anschließend schiebe ich ihn hinunter in die Küche, wo er sein Frühstück bekommt.
Nach dem Frühstück fordere ich ihn auf, sich rasieren zu gehen. Er sagt augenzwinkernd: ›Ich wäre besser zu Hause geblieben. Dich komme ich nicht so schnell wieder besuchen.‹«(Geiger, 2011, S. 9).
Wann erscheint die Frage im Raum, ob jemand dement ist? Wenn jemand vergesslich wird und sich anders verhält, als man es gewohnt war und erwarten würde. Dieses »anders« bezieht sich auf zeitliche, örtliche, situations- und personenbezogene Dimensionen.
Wie lange jemand mit einer Demenz lebt, ist nicht genau zu sagen, da die Anfänge oft schleichend sind und eine Altersvergesslichkeit als »normal« empfunden wird. Man kann gut sieben bis zehn Jahre mit einer Demenz leben. Sowohl die Einschränkungen als auch der Verlauf sind individuell unterschiedlich und nicht vorhersagbar. Hält man eine Einteilung für hilfreich, gibt Tom Kitwood mit einer offenen Definition der Beschreibung der Wirklichkeit am meisten Raum. »In der allgemeinen Diskussion gilt eine Demenz als leicht, wenn eine Person noch immer die Fähigkeit hat, allein zurechtzukommen. Bei mittlerer Demenz bedarf es gewisser Hilfe bei der Bewältigung der gewöhnlichen Lebensführung, und eine schwere Demenz besteht, wenn dauerhaft Hilfe und Unterstützung erforderlich sind« (Kitwood, 2008, S. 43).
Im Rahmen ärztlicher Diagnostik werden Fragen gestellt wie: »Wissen Sie, welchen Tag wir heute haben? Können Sie mir sagen, wo wir hier sind? Was denken Sie, warum Sie hier sind? Wie heißen Sie und wer sind die Personen hier am Tisch?« Es gibt eine Reihe von medizinisch-psychologischen Tests, die zur Einschätzung einer Demenz und ihres Grades üblich geworden sind und diagnostische Relevanz erreicht haben. Am bekanntesten sind der sogenannte Mini-Mental-State-Test oder der Uhrentest (vgl. ausführlich Förstl, 2011, S. 551 ff.) und die ausführliche Skala nach Barry Reisberg, der sieben Stadien angibt und die Verschlechterung der Betroffenen nach neurologischen Faktoren beschreibt bis hin zu einem Zustand völliger Abhängigkeit und des Verlustes psychomotorischer Fähigkeiten (Reisberg et al., 1982).
Hinter der medizinischen Lesart steht ein reduktionistisches Menschenbild, das nach Schwächen sucht und über Defizite definiert. Sie entwickelt eine Pathologie, die Körper und Geist des Menschen umfasst. Es stehen sich Gesundheit und Krankheit gegenüber, normal und pathologisch.
Wobei z. B. die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht Krankheit definiert, sondern Gesundheit und die Abwesenheit von Gesundheit im Umkehrschluss Krankheit ist. So beschrieb sie 1948 Gesundheit als »ein[en] Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur [als] das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen ist ein Grundrecht jedes Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung« (Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Wien, o. J.). Diese Definition wurde 1986 durch die 1. Gesundheitskonferenz in Ottawa verfeinert und mit weltpolitischem Anspruch in der Ottawa-Charta (1986) formuliert. Gesundheit hängt von vielen Bedingungen ab und diese sollen für alle Menschen geschaffen werden. Diese Sicht ist gesundheitspolitisch revolutionär gewesen und immer noch in vielen Gebieten der Erde unerreicht. Sie hilft jedoch nicht weiter, wenn Menschen auf umfassende Sorge angewiesen sind und ihre Selbstbestimmung sich zunehmend einschränkt. Dann wird in ihrer Logik ein defizitäres Menschenbild gefördert und Menschen mit Behinderungen sind »krank«.
Die Mediziner Peter J. Whitehouse und Daniel George formulieren eine andere Sicht auf die Phänomene, die auf eine (beginnende) Demenz weisen. Sie nehmen die gleichen Desorientierungen wahr, interpretieren sie aber in einem anderen Werterahmen. Sie sehen in den Veränderungen einen möglichen, normalen Prozess der Gehirnalterung, der dazu herausfordert, die Lebenschancen des Alters aktiv zu gestalten (Whitehouse u. George, 2009). Ihr Interesse besteht darin, den »Mythos Alzheimer« zu entlarven und die Geschichte der Gehirnalterung neu zu schreiben, so dass das Phänomen eine Integration in die Gesellschaft findet und es für Betroffene leichter wird, damit sinnerfüllt zu leben.
Es gibt unterschiedliche Phänomene, die eine kognitive Behinderung ausmachen. Die Ausprägung und die Reaktionsmuster der Betroffenen hinsichtlich dieser Phänomene sind individuell und situativ unterschiedlich (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1: Dimensionen dementierenden Erlebens in Beispielen
Phänomen
Äußerung
Reaktion
Vergessen
•Versäumen von Terminen
•Vergessen von Essen, Trinken, Medikamenteneinnahme
•Vergessen kurz zurückliegender Ereignisse (Kurzzeitgedächtnis)
•Erschrecken, Verunsicherung
•Leugnen
•Verantwortung anderen geben (»Ich war das nicht«)
Zeitverschoben leben
•Sich in anderen Zeiten der eigenen Biografie erleben (als berufstätige/-r Frau/Mann; als Schüler/-in; als Tochter/ Sohn etc.)
•Sich als junge Frau/junger Mann empfinden
•Die Identität/Rolle eines vergangenen Ichs jetzt leben
Personenverschoben leben
•Abgleich der Personen, Orte etc. der Ist-Zeit mit der biografischen Jetzt-Erinnerungszeit
•Aktuelle Personen mit anderen Namen ansprechen
•»Wo ist denn Christel?« als Frage nach der verstorbenen Schwester
Situations-verschoben leben
•Ist-Zeit wird in bekannte Situationsmuster eingeordnet
•Tagespflege als Dienstzeit
•Gruppensingangebot als Chorgemeinschaft
•Mitbewohner/-innen im Tagesraum eines Pflegeheims als Kegelclub
3Zugänge zu dementierenden Menschen
Tom Kitwood, der Begründer der personzentrierten Pflege, beschreibt sieben Zugangswege zu Menschen mit Demenz. Die Quellen des Wissens sind dabei die Personen selbst in ihren Selbstaussagen, also was man hört, wenn man ihnen aufmerksam und phantasievoll lauscht, und wenn sie eine Sprache verwenden, die sich von der Alltagssprache unterscheidet. Man kann ihr Handeln beobachten und sie befragen. Auch die eigene »poetische Vorstellungskraft« (Kitwood, 2008, S. 115) ist als ein Weg zu verstehen, indem man die Sachsprache verlässt und in Gedichten sagt, was man wahrnimmt. Eine weitere Möglichkeit ist das Rollenspiel in der Gruppe, das Einfühlung erfordert und Erkenntnisse aus der Darstellung heraus gewinnt (vgl. Kitwood, 2008, S. 111 ff.).
Abbildung 1: Die wichtigsten psychischen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz nach Kitwood (2008, S. 122)
Tom Kitwood fragt nach dem, was Menschen mit Demenz brauchen, und sieht die Bedürfnisse nach Trost, Bindung, Einbeziehung, Beschäftigung und Identität (siehe Abbildung 1). »Bei Menschen mit Demenz, die weitaus verletzlicher und gewöhnlich weniger in der Lage sind, die zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse notwendigen Initiativen zu ergreifen, sind diese Bedürfnisse deutlich sichtbar« (Kitwood, 2008, S. 121).
Dabei achtet eine angemessene Reaktion die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz in ihrer Verletzlichkeit. »Bei jedem unvermeidlichen Leiden werden sie sich weitaus besser unterstützt und viel weniger allein fühlen. Sie werden ein neues Kapitel in ihrem Leben haben, mit seinen eigenen, speziellen Freuden und Vergnügen. Und schließlich werden sie auch eher in der Lage sein, in Ruhe den Eintritt des Todes zu akzeptieren« (Kitwood, 2008, S. 127).
Das verletzliche Wesen des Menschen nimmt auch die Mäeutik auf. Das Wort Mäeutik stammt aus der griechischen Antike und wird Sokrates zugeordnet. Der Philosoph führte sogenannte Sokratische Gespräche mit der Überzeugung, dass er nicht die Antworten gibt, sondern im Gespräch durch seine Fragen in den Anderen selbst die Antwort entstehen lässt. So ist das lebensberatende philosophische Gespräch wie die Kunst der Hebamme: Sie selbst lässt das Baby nicht entstehen, sondern verhilft der Mutter zur Geburt. Die niederländische Pflegewissenschaftlerin Cora van der Kooij nimmt diesen alten Begriff auf und definiert ihn für sich als »Hebammenkunst für das Pflegetalent« (van der Kooij, 2017, S. 19). Entstanden ist ihre Pflegetheorie aus der Arbeit mit Menschen mit Demenz im stationären Kontext heraus und hat sich weiter entwickelt in der Pflege von Menschen mit körperlichen Behinderungen, der Psychiatrie, Neurologie und in hospizliche Pflege hinein (van der Kooij, 2017, S. 20). Sie knüpft bei Tom Kitwood an und meint, Mäeutik »ist ein personenzentriertes Pflegemodell, mit einer psychodynamischen Orientierung auf Menschen, Gesundheit und Krankheit« (van der Kooij, 2017, S. 102). Sie stellt die pflegebedürftigen Personen in den Mittelpunkt und sieht den Menschen in seiner individuellen Lebensgeschichte. Entscheidend sind die Geschichten, die jemand von sich selbst erzählt, in denen sein »Selbstkonzept« sichtbar wird, also das, wie sie oder er sich selbst erlebt.
Fragen sind relevant: Warum benötigt jemand Pflege? Wie zeigt sich seine Verletzlichkeit? Worin ist er abhängig und was bedeutet ein Leben in Abhängigkeit für einen Menschen?
»Ausgangspunkt für Pflegewissen und Pflegequalität sind die positiven Momente von Kontakt und die sich daraus entwickelnden Pflegebeziehungen« (van der Kooij, 2017, S. 21). Diese Art zu pflegen wird Erlebnispflege genannt. Sie folgt keinem problemorientierten Denken und ihr Bezugsrahmen ist nicht fokussiert auf die Defizite und somit nicht auf das, was jemand »nicht mehr« kann oder »noch« kann, denn auch das »Noch« ist am Defizit orientiert.
Sie schöpft Wissen aus den echten Begegnungen der Pflegenden mit den zu Pflegenden. Das Menschenbild, das hinter der Mäeutik steht, sieht als verbindendes Element zwischen Menschen mit und ohne Demenz die Verletzlichkeit (van der Kooij, 2017, S. 30). Verletzlichkeit kennt jede oder jeder und so ist eine einfühlende, empathische Pflegebegegnung möglich.
Für die Qualifizierung der Pflegenden bedeutet dies, dass sie medizinisch-pflegerisches Know-how mit den Gefühlen und Empfindungen, die die Begegnung auslöst, verbinden und sie reflektiert in Worte fassen können. Das mäeutische Modell braucht daher Einzelne, die dies können, und ein Team, in dem die Erkenntnisse kommuniziert werden.
Die Pflegenden und Begleitenden finden mit dem Know-how ihrer Berufsbildung (Ausbildung plus Erfahrung) – verbunden mit einer situativen Intuition – einen Zugang zum Verhalten dementierender Menschen. Sie finden so für sich die Antworten für eine angemessene Reaktion. Die zu Pflegenden werden dann nicht nur gut versorgt, sondern auch »gekannt« und anerkannt (van der Kooij, 2017, S. 40). Pflege bedeutet dann immer eine Begegnung zwischen einem Ich und einem Du – in beide Richtungen (vgl. Buber, 2014). Cora van der Kooij kritisiert die reduktionistische Fragerichtung der medizinisch-psychologischen »Messinstrumente« zur Einschätzung einer Demenz. Sie stellt andere Fragen an das dementierende Empfinden und Verhalten der Betroffenen und beschreibt die Entwicklung als »das Bedrohte, das Ver(w)irrte, das Verborgene und das Versunkene Ich« (van der Kooij, 2004, S. 72).