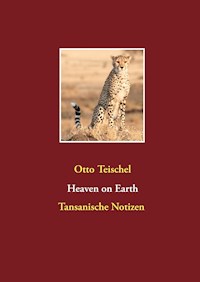Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Seit Menschen über sich und die Bedingungen ihrer Existenz nachdenken und diesem oft leidvollen Prozess auf schöpferische Weise Ausdruck geben – sei es philosophisch, literarisch, bildhaft, musikalisch oder auf der Bühne eines Theaters –, waren ihre künstlerischen Werke immer zugleich Spiegel ihrer seelischen Prozesse und Zeugnisse der Sehnsucht, auf diese Weise eine wahrhaftige, emotional berührende und Nähe ermöglichende Verbundenheit unter den Menschen zu schaffen. Insbesondere die filmische Inszenierung menschlicher Lebenszusammenhänge in ihrer Komplexität verfügt über ein vielfältiges Potenzial zur Existenzerhellung, Ermutigung und Inspiration. Wie dies auch therapeutisch in der Trauerbegleitung genutzt werden kann, zeigt Otto Teischel beispielhaft anhand von drei Filmen ("Das Haus am Meer", "Drei Farben: Blau" und "Der geheime Garten"), in denen sowohl Leid als auch Resilienzfaktoren zum Tragen kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EDITION Leidfaden
Hrsg. von Monika Müller
Die Buchreihe Edition Leidfaden ist Teil des Programmschwerpunkts »Trauerbegleitung« bei Vandenhoeck & Ruprecht, in dessen Zentrum seit 2012 die Zeitschrift »Leidfaden – Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer« steht. Die Edition bietet Grundlagen zu wichtigen Einzelthemen und Fragestellungen im (semi-)professionellen Umgang mit Trauernden.
Otto Teischel
Trauerspiel –Einführung in dieexistenzielle Filmtherapie
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 14 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99799-5
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
Umschlagabbildung: © Cab Productions/Warner Bros/New Line Cinema;Allstar Bildarchiv – mit freundlicher Genehmigung
© 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.deAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenenFällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen EPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Inhalt
IFilm als Kunst und Spiegel der Seele
Filmtherapie – Entwicklung und Perspektiven
Film und Psychoanalyse
Die Filmdeutung als Weg zum Selbst
IIExistenzielle Filmtherapie
Drei leidvolle und ermutigende Geschichten
»Das Haus am Meer«
»Drei Farben: Blau«
»Der geheime Garten«
Leid und Resilienz im Film – zehn weitere geeignete Werke
IIIÜber den therapeutischen Umgang mit berührenden Spielfilmen
Film und Selbsterkenntnis
Kriterien existenzieller Deutung: Aufmerksamkeit – Wiederholung – Übertragung
Aufmerksamkeit
Wiederholung
Übertragung
Filmtherapie in der Gruppe
Möglicher Ablauf eines Tagesseminars
Stationäre Filmtherapie in der »Reha-Klinik für Seelische Gesundheit« (Klagenfurt)
Nachwort: Die Bedeutung der Kunst für das Leben
Literatur
IFilm als Kunst und Spiegel der Seele
In dem 1977 erstmals erschienenen internationalen Standardwerk des amerikanischen Filmwissenschaftlers James Monaco »How to Read a Film« (deutsch: »Film verstehen«, 2009) beschäftigt sich das ausführliche erste Hauptkapitel mit dem Thema »Film als Kunst«. Der Autor unternimmt es darin, noch bevor er das Medium in seinen technischen, ästhetischen und kommunikationstheoretischen Besonderheiten genauer beschreibt, den Film entwicklungsgeschichtlich als eigenständige Kunstform zu begründen und in einen bestehenden Kanon anderer schöpferischer Ausdrucksweisen des Menschen einzuordnen. Dabei bezieht Monaco sich auf eine lange (kultur-)philosophische Tradition der Auseinandersetzung mit den grundlegenden Fragen zum Wesen der Kunst im Unterschied zu Philosophie und Wissenschaft, die bis zu den antiken Anfängen systematischen Nachdenkens und -forschens zurückreichen, da noch alle »metaphysischen« Kräfte, mit denen der Mensch sich dem Geheimnis des Seins zu nähern versuchte, als Zeugnisse seiner Größe und Tragik galten.
Das Staunen war für Platon (»Theaitetos«, 155 d) der Ursprung des Philosophierens. Und im Blick auf die ungeheure Vielfalt theoretischer Systeme und Erklärungsmodelle, nicht nur innerhalb der Philosophiegeschichte, sondern auch aller anderen Wissenschaften, Techniken und Künste, lässt sich der Eindruck gewinnen, dass wir Menschen als erkennende, ästhetische und ethische Wesen niemals über diese so unzulängliche und zugleich so wundervolle Fähigkeit des Staunens hinausreichen werden. Die Sehnsucht nach der Wahrheit mag uns leiten, doch sie wird zeitlebens notwendigerweise unerfüllt bleiben – und genau das könnte zur Quelle einer umfassenden Toleranz und Solidarität zwischen uns werden. Sobald wir Wissen behaupten und Eindeutigkeiten festschreiben, weil wir die Unsicherheit des Nichtwissens nicht ertragen können, beginnt schon die Gewalt der Intoleranz und Ausgrenzung andersdenkender und -fühlender Menschen und Gemeinschaften (Kulturen, Völker usw.). Alle ringen dann nur noch um ihre eigene Position und Bedeutung und versuchen mit ideologischem Eifer, idealistischen Rechtfertigungen und vermeintlichen Beweisen den »objektiven« Stellenwert ihrer jeweiligen »Wahrheit« hervorzuheben. Bis hin zu den heutigen »Beschwörungsformeln« einer angeblich so unverzichtbaren digitalen Vernetzung und Erfassung des Menschen, um ihn flexibler, optimierter und sozialer zu machen – tatsächlich jedoch eben dadurch, wie unabsichtlich auch immer, den selbstbestimmten, unabhängigen Einzelnen und dessen existenzielle Freiheit im Netz der Datenströme verschwinden zu lassen.
Und damit wären wir, angesichts der gegenwärtigen medialen Inszenierungen und Möglichkeiten, erneut inmitten einer Kontroverse über Sinn und Unsinn wissenschaftlich-technischer Errungenschaften des Menschen, über deren Bedeutung und Wesen er sich – auch gesellschaftlich – heutzutage dringend Klarheit zu verschaffen hat. Sofern er den Folgen nicht blindgläubig ausgeliefert bleiben soll, indem er einfach alles gutheißt, was möglich ist und geschieht. Doch wer oder was entscheidet überhaupt, was geschieht?
Die Filmkunst ist, wie die Psychoanalyse, eine vergleichsweise junge Art und Weise der Auseinandersetzung mit dem Menschen – etwa zeitgleich entstanden und begründet in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Doch beide haben seither eine überaus vielgestaltige und lebendige Entwicklung genommen, die mit den rasanten Veränderungen der menschlichen Lebenswirklichkeit am Übergang zur Moderne zusammenzuhängen scheint. Daher liegt eine innere Verbindung von Film und Psychoanalyse durchaus nahe: Einerseits reagiert und reflektiert die mediale Verarbeitung des technischen Zeitalters auf jene Entfremdung, durch die sie ihrerseits erst hervorgebracht worden ist. Und andererseits begann durch die psychoanalytische Erforschung des Unbewussten die menschliche Rationalität ihre Beschränktheit zu erkennen (Freud, 1917/1999), was wiederum erst auf der Grundlage fortgeschrittener Irrtümer jener vorherrschenden naturwissenschaftlichen Logik möglich wurde.
In unserer Gegenwart des frühen 21. Jahrhunderts geschieht wiederum etwas ganz Ähnliches vonseiten der modernen neurobiologischen Forschung, die unser bisheriges Leistungs- und Wettbewerbsdenken mit seinen Ausgrenzungs- und Belohnungssystemen zur vermeintlichen Steigerung von Macht und Effizienz als gänzlich kontraproduktiv, ja zerstörerisch für die schöpferischen Potenziale des Menschen erweist (Hüther, 2014).
Wir müssen also offenbar, als Einzelne wie als Gesellschaft, immer wieder von Neuem scheitern und auf Grenzen stoßen, um erst daran erkennen zu können, worauf es eigentlich ankommt, um uns verändern und weiterentwickeln zu können und klarer zu sehen, worin der verborgene Sinn unseres Tuns liegt.
Die Psychodynamik unserer Existenz, die zwischen Fühlen und Denken, Seele und Geist, Unbewusstsein und Selbstbewusstsein einen angemessenen Weg für sich ersehnt, der ohne Fragen, Suchen und Scheitern nicht zu finden ist – und auch dann nur solange gangbar bleibt, bis sich neue Fragen stellen –, scheint vom Einzelnen die Geduld und Unermüdlichkeit eines Sisyphos zu verlangen, um womöglich von Zeit zu Zeit und auch dann nur für sinnerfüllte, glückliche Momente bei sich anzukommen (Camus, 1942; dt. 1959, S. 101).
Das könnten wir für ein Trauerspiel halten – und in tiefer Depression erscheint das Leben manchmal so, als sei es unser verzweifeltes Bemühen nicht länger wert. Doch aus reflektierender Distanz betrachtet, erweist sich die ureigene menschliche Größe zuletzt gerade als Freiheit der Annahme unseres unabänderlichen, leidvollen Schicksals – in der Revolte gegen das Absurde unseres Nichtwissens um die letzten Gründe unserer Existenz, unseres Woher, Wozu und Wohin.
Von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit haben sich die Auffassungen und Kriterien vom Wesen der Kunst (der Künste) immer wieder gewandelt. Im Verlauf der historischen Ausdifferenzierung der verschiedenen Wissenschaften und Techniken wurde der Bereich dessen, was (noch) zur Kunst erklärt wurde – im Sinn einer »schöngeistigen«, ästhetisch vermittelten und erhabenen Welterfahrung, die nicht direkt Nutzbares hervorbrachte (wie Handwerk und Technik) oder Eindeutiges definierte (wie Naturwissenschaften und Logik), sondern vor allem dem intensiven Ausüben und Erleben des »Schönen, Guten, Wahren« diente –, zunehmend eingegrenzt. Bei den Griechen und Römern wurden Grammatik, Logik und Rhetorik zu den »freien Künsten« gerechnet (»frei« auch, weil sie kein Sklave auszuüben vermochte) ebenso wie Geometrie, Arithmetik, Musik und Astronomie – mit der Philosophie im Zentrum, gleichsam als »Mutter aller Wissenschaften und Künste«. Während im Mittelalter noch Theologie, Jurisprudenz und Medizin hinzugezählt wurden, begannen sich seit der Neuzeit zunächst die Naturwissenschaften, später auch die Geisteswissenschaften zu verselbstständigen. Und schließlich finden sich in der »Ästhetik« von Hegel (1823/1986) jene »schönen Künste« unterschieden – Architektur, Skulptur, Malerei, Musik, Poesie (Literatur), Darstellende Kunst –, zu denen dann, insbesondere durch französische und italienische Cineasten, bereits seit der Stummfilmära der Film als »Siebte Kunst« gerechnet wurde (Canudo, 1923, dt. 2003).
Ein exponierter Vertreter und Visionär der ästhetischen Kraft des Films, dem sich auch dieser Begriff verdankt, war der italienische Filmtheoretiker Ricciotto Canudo (1877–1923). Wenn Richard Wagner 1849 die Schaffung eines Gesamtkunstwerkes als Herausforderung für die Künste sah, die schließlich im Musikdrama zu sich selbst finden sollten, übertrug Canudo in seinem »Manifest der Siebten Kunst« von 1923 (dt. 2003) eine solche Größenfantasie auf den Film und das Kino, durch die er ein goldenes Zeitalter anbrechen sieht: »Schließlich ist es unserer Zeit mit geradezu göttlichem Elan gelungen, die unterschiedlichen Erfahrungsbereiche des Menschen zu verbinden. Wir alle haben die Pflichten und die Neigungen des Gefühlslebens zusammengeführt. Wir haben die Wissenschaft mit der Kunst verbunden. Hierbei meine ich die Verbindung von deren Entdeckungen mit dem Ideal der Kunst und nicht die Erkenntnis unverrückbarer Naturgesetze. Indem wir das eine auf das andere anwenden, können wir den Rhythmus des Lichtes einfangen und festhalten: Was nichts anderes bedeutet, als das Kino zu schaffen […] Die siebente Kunst versöhnt alle anderen« (Canudo, 1923, dt. 2003, S. 14).
Womöglich ist genau mit der Entwicklung dieser modernen Kunstform, die nicht nur, spätestens seit dem Tonfilm, alle anderen schönen Künste umgreift und deren besondere Ausdruckskraft zur Vermittlung der eigenen Botschaft einsetzt, ein entscheidender Schritt gelungen: hin zu einer umfassend existenzerhellenden Selbsterkenntnis des Menschen, die ihn als ebenso empathiefähiges wie freiheitsbegabtes Wesen in seiner Lebenswelt offenbart – mag diese Freiheit auch oft genug »nur« darin bestehen, ein unabänderliches Schicksal mutig anzunehmen.
Seit Menschen über sich und die Bedingungen ihrer Existenz nachzudenken begonnen haben und diesem oft leidvollen Prozess auch auf schöpferische Weise Ausdruck zu geben versuchen – sei es eher philosophisch reflektierend, poetisch, bildhaft, musikalisch oder als Theater inszeniert –, sind ihre künstlerischen Schöpfungen immer zugleich Spiegel ihrer seelischen Prozesse und Zeugnisse einer Sehnsucht, durch deren Mitteilung eine tiefe, emotional berührende und Nähe ermöglichende, solidarische Verbundenheit unter den Menschen zu schaffen und einander dadurch ebenso an die Potenziale ihrer schöpferischen Freiheit wie die Einfühlungskraft ihrer Liebe zu erinnern.
Es soll in diesem Buch beispielhaft nachvollziehbar gemacht werden, dass gerade die filmische Inszenierung menschlicher Lebenszusammenhänge in ihrer inneren (psychodynamischen) und äußeren (gesellschaftlich-ökologischen) Komplexität über ein ungeheuer vielfältiges Potenzial zur Aufklärung (Existenzerhellung), Ermutigung und Inspiration verfügt. Sie bietet einen wahren Reichtum an grenzüberwindender, solidarischer Kraft, eine universale Sprache, die uns weltweit zu berühren und zu verbinden vermag, indem sie die schicksalhaften Bedingungen und Möglichkeiten unserer Existenz veranschaulicht und so ein sichtbares empathisches Band der Liebe zwischen uns knüpft, das Halt und Orientierung bieten kann im Labyrinth der eigenen Existenz.
Nach einem kurzen Überblick zur bisherigen Entwicklung dieser noch sehr jungen, erst seit der letzten Jahrhundertwende sich zunehmend etablierenden Therapieform, folgt ein Exkurs zum Verhältnis von Film und Psychoanalyse, da die so wesentliche, den Menschen vielfach leitende und zugleich so verwirrende Dimension des Unbewussten für diese beiden Handlungsfelder und Forschungsbereiche im Zentrum des Interesses und ihrer Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten steht. Geht es doch im Film und für die Psychoanalyse um ein möglichst komplexes Ansprechen und Erreichen des »ganzen« Menschen: als einem potenziell reflektierenden, geistbegabten Wesen, das zugleich ursprünglich und spontan vor allem von seinen unbewussten Empfindungen und Gefühlen, von seiner Empathiefähigkeit,geleitet wird. Beide »Kunstformen«, Film und Psychoanalyse (denn im Vergleich zur funktionalen Rationalität von Naturwissenschaft und Technik erscheint jede existenzielle Bezugnahme auf den Menschen als »Kunst«), versuchen, anfänglich noch Unbekanntem und Unsagbarem einen bewussten oder bewusstseinsfähigen Raum und Ausdruck zu ermöglichen.
Das Kapitel über die Filmdeutung als Weg zum Selbst begründet den hier wesentlichen Ansatz einer existenziellen Filmtherapie, die ihre tiefenpsychologischen Einsichten mit der Entwicklung einer angemessenen, an den Möglichkeiten der konkreten Person dieses einzelnen Menschen orientierten schöpferischen Lebens- und Leidbewältigung verbindet.
Im zweiten Teil werden Komplexität und Erkenntnisreichtum des Mediums (Spiel-)Film an drei ausführlicher beschriebenen Beispielen verdeutlicht, die uns Leid und existenzielle Erschütterungen im Umgang mit den Grenzsituationen Krankheit, Sterben und Tod nachfühlbar vermitteln – im Spiegel der Lebensgeschichten ihrer Protagonisten.
Hinzu kommt eine kleine Auswahl von Filmen, die als ebenso wertvolle Beispiele dienen könnten, doch hier nur zur Ergänzung genannt und in Kurzform vorgestellt werden – abgesehen von unzähligen anderen (Film-)Geschichten aus aller Menschen Länder, die keine Erwähnung finden, weil sie mir weniger gut vertraut oder (noch) ganz unbekannt sind. Möge jeder Leser das hier Beschriebene auf seine eigenen Filmerfahrungen übertragen können und mögen die wenigen Beispiele genügen, die existenzielle Kraft des Mediums spürbar werden zu lassen!
Der dritte Teil beschreibt die wesentlichen Kriterien einer angemessenen Deutung und gibt Anregungen und Hinweise für die therapeutische Arbeit mit berührenden Spielfilmen, sowohl in der Gruppe wie auch für die Selbsterkenntnis des Einzelnen.
Filmtherapie – Entwicklung und Perspektiven
Seit der Verbreitung des Films als Massenmedium am Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es dessen psychologische, vor allem auch psychoanalytische Beschreibung und Interpretation – nicht zuletzt, weil beide Bereiche etwa zeitgleich Gestalt annahmen und öffentliche Verbreitung fanden. Der Film allerdings brachte bald eine eigene Industrie hervor und gewann spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg auch massenhaft an Einfluss, da er von den verfeindeten Parteien, die seine Wirkmacht erkannten und zu nutzen wussten, zu Propaganda- und Manipulationszwecken eingesetzt wurde.
Darin zeigt sich bereits die Widersprüchlichkeit des Mediums. Es kann zur bloßen Unterhaltung eingesetzt werden ebenso wie, auf mehr oder weniger raffinierte Weise, suggestiv verhetzend, verführend, verdummend und letztlich auch abstumpfend wirken – oder jedoch, wie das Medium Film hier vorgestellt sein soll, als eine Schule der Wahrnehmung und Empathiefähigkeit und ein vieldimensional erhellendes Medium menschlicher (Selbst-) Erkenntnis.
Gerade weil Filme in ihren formalen, (herstellungs)technischen, inszenatorischen und kommunikativen Gestaltungsmöglichkeiten so überaus komplexe Kunstwerke sein können, gibt es auch existenzerhellend und psychotherapeutisch ungeheuer vielfältige Einsatzbereiche und Gelegenheiten zur Auseinandersetzung mit ihren jeweiligen Geschichten. So wie unzählige Menschen an einer Großproduktion mitwirken und noch einmal unendlich viel mehr Zuschauer potenziell damit erreicht werden – wobei niemals die Anzahl der Beteiligten vor und hinter der Leinwand etwas über die Qualität oder Bedeutsamkeit eines Films aussagt –, bestehen ebenso unzählige Begegnungsmöglichkeiten zwischen einem Filmkunstwerk und seinen Rezipienten.
Immer trifft die Gestaltungskraft einzelner beteiligter Personen (Subjekte) an einer Produktion – vom Verfasser des Drehbuchs über alle filmtechnisch und filmästhetisch mitwirkenden Ausdruckskünstler bis zum Darsteller irgendeiner Nebenrolle, ja letztlich bis zum Kinobetreiber oder Medienhändler, der den jeweiligen Film auswählt und öffentlich anbietet – auf ebenso einzelne konkrete Personen (Subjekte), die gerade dieses Werk in dieser Situation ansehen und sich damit mehr oder weniger intensiv auseinandersetzen.
Wenn zehn Personen in einer Gruppe einen Film anschauen, um womöglich anschließend darüber zu diskutieren, haben zwar alle derselben Geschichte zugesehen, doch jeder hat dabei seinen eigenen Film wahrgenommen, weil jeder konkrete Einzelne in genau diesem bestimmten Moment mit dieser seiner konkreten eigenen Lebensgeschichte und dieser psychophysischen Tagesverfassung vor der Leinwand (oder dem Bildschirm) sitzt und auf den Film reagiert. Das macht jede Diskussion so lebendig und anregend, weil jedem etwas Eigenes aufgefallen ist, das kein anderer genau so bewusst bemerkt hat, und lässt die Wiederholung des Gleichen potenziell nie langweilig werden, weil ein Film eben niemals derselbe sein kann, sondern jedes Mal auf eine, wenn auch noch so geringfügig veränderte Situation bzw. Person und deren Gestimmtheit trifft.
Diese Zusammenhänge werden im dritten Teil noch näher beleuchtet, wenn die Rahmenbedingungen und Abläufe des filmtherapeutischen Settings im Mittelpunkt stehen.
In der Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Medium Film, wie sie auch Monaco (1977, dt. 2009) in seinem bereits mehrfach neu aufgelegten und erweiterten Standardwerk beschreibt, wird ein filmtherapeutisch-praktischer Umgang mit dem Medium meist nicht einmal erwähnt.
Fast immer dreht es sich in der einschlägigen Literatur zum Thema vor allem um die technischen Aspekte und Wirkungsweisen eines Films (wie und mit welchen Mitteln erzielt er seine Effekte?), um eine inhaltliche Beschreibung der jeweiligen Filmstoffe und die Kritik an ihrer Umsetzung, die Zuordnung und Erfindung immer neuer Genres und zunehmend – vor allem seit der Zeit des fatalen Missbrauchs des Films (und der bildnerischen Darstellung überhaupt) zu Propaganda- und Manipulationszwecken –, um eine soziologische und durch die Entwicklung neuer Medien vor allem auch kommunikationstheoretische Auseinandersetzung mit dem Film und dessen Inszenierung in öffentlichen und privaten Räumen: vom Kino über das Fernsehen bis zum jederzeit und überall verfügbaren On-Demand- Gebrauch via Internet.
Es hat sich im Laufe der vergleichsweise jungen Filmgeschichte bereits ein breiter Theoriekanon entwickelt (Albersmeier, 2003), ähnlich wie etwa in der Literatur-, Musik-, Kunst- und Theaterwissenschaft. Und wie es auch für diese klassischen Künste erst sehr viel später zur Entwicklung von Konzepten für einen praktischen therapeutischen Umgang mit ihrem jeweiligen Gegenstand kam (Bibliotherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie, Psychodrama usw.), ist der Gebrauch von Filmen in psychotherapeutischen Kontexten und Arbeitszusammenhängen theoretisch noch weitgehend unerforscht und kaum systematisch entwickelt.
Eher finden sich Veröffentlichungen und Konzepte pädagogischer Art, das heißt Überlegungen für eine möglichst zeitgemäße didaktische Vermittlung der besonderen Inhalte und ästhetischen Konzepte in den einzelnen Künsten, auch im Hinblick auf deren mögliche gesellschaftliche Relevanz und die potenziellen ethisch-moralischen Gefährdungen der (zumal minderjährigen) Rezipienten. Denken wir etwa nur an die zahllosen kritischen medienpädagogischen Stellungnahmen und Publikationen zum fatalen Einfluss gewaltverherrlichender Filme und Computerspiele (Kunczik u. Zipfel, 2006; Spitzer, 2005) und zu den Gefahren, die durch elektronische Medien überhaupt drohen – von den frühen visionären Kritikern wie Joseph Weizenbaum (1984) und Neil Postman (1985) bis zu den zeitgenössischen Warnungen der Neurowissenschaft vor einer sich rapide ausbreitenden »digitalen Demenz« (Spitzer, 2012).
Ebenso erscheinen zahllose Bücher und Zeitschriftenartikel, die einzelne Filme oder ganze Filmgenres gleichsam phänomenologisch beschreiben, als sei das angemessen »objektiv« möglich und als müsse ein bestimmter Film so oder so interpretiert und bewertet werden.
Oftmals werden sogar »Sterne« dabei vergeben und Kriterien benannt, die eine Wertung rechtfertigen sollen – zwischen null: »ärgerlich, anstößig, eine Zumutung« bis fünf Sterne: »herausragend, ein Meisterwerk« (FILMDIENST, 2015). So wie auch die Verleihung von Filmpreisen wie dem Oscar oder dem Golden Globe (um nur die bekanntesten zu nennen), die in allen wichtigen, an der Realisierung eines Films beteiligten künstlerischen, technischen und ökonomischen Kategorien vergeben werden, oder die Prämierung von Filmen, Regisseuren und Schauspielern auf mehr oder weniger großen internationalen Filmfestspielen, den Eindruck von Objektivität und Bewertbarkeit erwecken sollen. Zumal es dabei immer eigens einberufene Jurys gibt, die sich aus ebenfalls schon bewährten, bewerteten und möglichst prämierten Experten zusammensetzen und so die Seriosität und Angemessenheit einer Preisvergabe zu garantieren scheinen. Ganz ähnlich verhält es sich im Übrigen auch in allen anderen Bereichen künstlerischer Produktion: Literatur, Musik, Malerei, Architektur, Darstellende Künste usw. – immer entscheiden Expertenjurys über die Preiswürdigkeit eigens hervorgehobener Werke und zeichnen diese dann mit mehr oder weniger hoch dotierten Preisen aus.
Die Kriterien dafür bleiben ganz im Dunkeln nach der Devise: Es sind doch anerkannte Experten, die entscheiden und aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung schon wissen werden, wen sie warum als preiswürdig deklarieren. Außerdem findet manchmal sogar eine öffentliche Abstimmung nach vorheriger Diskussion statt, wodurch das Endergebnis ohnehin bereits relativiert wird, treffen doch immer unterschiedliche Sichtweisen verschiedener Menschen aufeinander. Oder es geht um vorgegebene Kriterien (eigentlich Vorurteile), die eine bestimmte Qualität definieren sollen – vom zugeordneten Genre, dem ein Film »perfekt« entspricht oder mit dem er »meisterhaft« spielt, bis zur schauspielerischen, inszenatorischen oder sonst wie technischen »Könnerschaft«, die an bislang so noch nicht gesehenen oder vergleichsweise spektakulären Darbietungen gemessen wird.
Das alles hat noch nichts mit jener Idee vom (selbst-)therapeutischen Gebrauch des Films zu tun, dessen Potenziale erst etwa seit den 1990er Jahren – hundert Jahre nach der Erfindung des Mediums – gezielt untersucht und genutzt werden: als führe erst ein über lange Zeit allgegenwärtiger, täglicher Gebrauch einer so neuartigen Technik zum Nachdenken über deren Möglichkeiten und Gefahren, die vorher nicht bewusst werden konnten. Doch andere Technologien, von der Eisenbahn bis zum Computer, riefen ihre jeweiligen Kritiker und Apologeten schon sehr bald auf den Plan. Und auch der Film fand seit seiner Einführung bis heute zahllose Fürsprecher und Gegner, was seine technischen Wirkungsebenen betrifft: die Lebendigkeit, den Unterhaltungseffekt und die globalen Einsatzmöglichkeiten des Mediums – gegen die Ablenkungen, Scheinwelten und manipulativen Betäubungseffekte, die den Nutzern die Wirklichkeit verstellen und sie von ihr abhalten können. Ganz ähnlich dem, was später auch dem Radio, Fernsehen oder Internet zugeschrieben wurde.
Wenn die ungeheure erkenntnisstiftende und therapeutische Kraft des Mediums Film erst vergleichsweise spät bewusst geworden ist und nur langsam in Bildungs- und Heilungsprozesse gleichermaßen Eingang findet (wenngleich in dieser Hinsicht keineswegs unumstritten ist), dann scheint das vor allem zwei Gründe zu haben:
Im gelungenen Fall, wenn es sowohl den an der Realisierung eines Films beteiligten Personen wie auch den Rezipienten, die von einem Film existenziell bereichert und angemessen berührt (auch unterhalten) werden möchten, um eine wahrhaftige, lebensnahe und konzentrierte Geschichte über (ein) menschliches Schicksal geht, wirkt diese gleich so intensiv, authentisch und inspirierend wie das Leben selbst – wie eine »echte« Begegnung mit Bezugspersonen auf der »Leinwand«, mit deren Situation sich der Zuschauer verbinden und auf die er seine eigene projizieren kann. Der Film wird dabei so selbstverständlich in die eigene Lebenswirklichkeit integrierbar, dass er als »Kunstform«, die eigens als solche hervorgehoben werden könnte, gar nicht wahrgenommen wird. Wie auch Lieder oder Bücher einen Menschen so unmittelbar ergreifen können, dass er nicht über deren ästhetische oder therapeutische Relevanz nachdenkt. Ein Film ist, so gesehen, also nicht »zu schön, um wahr zu sein«, sondern auf wahrhaftige Weise so schön, um nicht »nur ein Film« zu sein. Die Wirklichkeitsebenen verfließen dabei – »Ich kenne das Leben, ich gehe ins Kino«, wie ein Graffiti meiner Studententage an einer Hauswand in Hannover es in großen Lettern ausdrückte.
Der andere Grund für die erst etwa hundert Jahre nach der Erfindung der Kinematografie und dem Erscheinen der »Traumdeutung« von Sigmund Freud einsetzende Entwicklung und Erforschung einer psychotherapeutischen Arbeit mit Spielfilmen liegt in jenem rationalistisch-mechanistischen Blick auf den Menschen, der jeden anderen heuristischen und/oder therapeutischen Zugang – alle nicht quantitativ-methodischen Normen genügenden Ansätze – der Unwissenschaftlichkeit bezichtigt und für unseriös erklärt. Davon sind auch alle anderen kreativen Therapieformen betroffen – Kunst-, Musik-, Tanz-, Schreib-, Bibliotherapie usw. –, von denen manche, trotz nachweislich heilsamer – wenn auch nicht wie Blutdruck messbarer – Wirkung, schon lange um ihre öffentliche (gesetzliche) Anerkennung ringen.