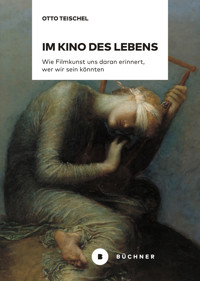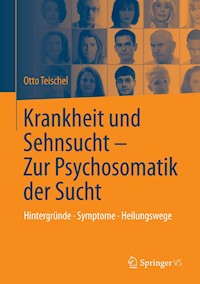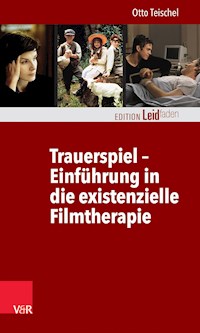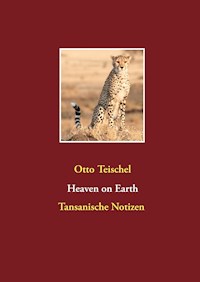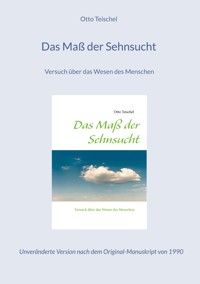
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die essayistische Form des Buches will den verschiedenen - psychologischen, philosophischen, gesellschaftlichen und religiösen - Aspekten der Sehnsucht gerecht werden, wobei sich unvermeidlich die Position eines distanzierten Betrachters mit der Perspektive seiner eigenen Leidenschaft verbindet. Wenn die Sehnsucht das leitende Motiv unseres Denkens und Handelns ist - und diese These wird hier begründet -, dann läßt sich ihr gar nicht unpersönlich nähern, sondern nur aus dem Zusammenhang jenes Widerspruchs, der Ich und Welt unüberwindlich voneinander trennt und in dessen Zentrum der fragende einzelne Mensch immer schon existiert. Seine Brisanz erhält das zeitlose Thema nicht zuletzt vor dem Dilemma der Gegenwart zwischen ausufernder Orientierungslosigkeit und einem blindgläubigen Machbarkeitswahn. Denn eine Besinnung auf die SEHNSUCHT als der eigentlichen - und einzig spezifisch menschlichen - Triebkraft hinter all unseren Ansprüchen könnte sozusagen aus sich selbst heraus ein Maß offenbaren, das unsere bedürftigen Leiber und Seelen endlich in einem wahrhaft solidarischen Geist vereinte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Über den Autor:
Otto Teischel, geb. 1953, Philosoph, Psychotherapeut und Schriftsteller, arbeitete als Kleinverleger, Galerist, Buchhändler, Dozent in der Erwachsenenbildung und in einer eigenen Philosophischen Praxis. Lebt als freiberuflicher Psychotherapeut in Klagenfurt am Wörthersee.
INHALT
Prolog
Die Unstillbarkeit des Verlangens:
A) Die Wege der Sehnsucht
1. Die Kräfte der Seele
2. Das Licht der Vernunft
3. Die Ewigkeit des Augenblicks
4. Demut und Ehrfurcht
B) Die Verheißung der Gesichter
1. Die Gnade der Augen
2. Die Unschuld der Sinne
3. Die Unsterblichkeit des Schönen
4. Selbstsein als Ziel
C) Sehnsucht und Politik
1. Der einzelne und die Gesellschaft
2. Kunst und Wissenschaft
3. Psychologie und Philosophie
4. Freiheit der Revolte
D) Liebe und Freiheit
1. Das Erwachen des Begehrens
2. Der Wunsch nach Erlösung
3. Die Erfahrung des Scheiterns
4. Liebe als Freiheit
Das Maß der Sehnsucht
Literaturverzeichnis
Für uns.
Everybody’s got a hungry heart.
Bruce Springsteen
Nur die Sehnsucht ist poetisch,
nicht der Besitz.
Annette von Droste-Hülshoff
Man hat uns nicht gefragt
als wir noch kein Gesicht
ob wir leben wollten
oder lieber nicht.
Jetzt gehe ich allein
durch eine große Stadt
und ich weiß nicht
ob sie mich lieb hat.
Ich schaue in die Stuben
durch Tür und Fensterglas
und ich warte
und ich warte
auf etwas.
Wenn ich mir was wünschen dürfte
käm ich in Verlegenheit
was ich mir denn wünschen sollte
eine schlimme oder gute Zeit.
Wenn ich mir was wünschen dürfte
möcht’ich etwas glücklich sein
denn wenn ich gar zu glücklich wäre
hätt’ich Heimweh nach dem Traurigsein.
Marlene Dietrich
(in einem Lied von F. Hollaender)
PROLOG
Die Absurdität einer Einleitung zum Kapitel unserer Sehnsucht …
Doch gerade dieser Widerspruch berührt das Thema unmittelbar.
Nichts wünschen wir uns mehr, als Klarheit in die Abgründe unserer Seele zu bringen, doch gerade durch diesen Wunsch und unser Bemühen verhindern wir sie am meisten.
Die Tragik des Gegensatzes markiert die Grenze unserer Freiheit und bezeugt zugleich die Würde unserer Existenz, die imstande ist, das Unglaubliche zu verlangen.
Eben darum wird es hier gehen – so wie alles menschliche Denken und Handeln um genau diesen Widerspruch kreist: die unstillbare Sehnsucht nach dem Erlöstwerden mit der beständigen Herausforderung unermüdlichen Weiterlebens zu konfrontieren und an diesem Schnittpunkt jene Wirklichkeit menschlichen Seins zu erhellen, die zugleich Ohnmacht und Größe unserer Situation verheißt.
Die Vergeblichkeit des letzten Wollens offenbart das Maß der Demut, die allein eine Solidarität zu befördern vermag, die nach Tat und Wort die Herzen aller lebendigen Existenz vereint.
Unser eingebildetes Recht auf Glück erweist sich erst im Angesicht der Unerfüllbarkeit des Wünschens als jener Appell, bescheiden zu sein, der in seiner tiefen Bedeutung nur dann begreiflich wird, wenn die Maßlosigkeit des Verlangens seine zerstörerische Wirkung zu entfalten beginnt.
Die Sehnsucht bleibt unser einziges Versprechen, die ursprüngliche Kraft hinter all unserem Denken und Handeln, und ist doch gerade dabei, wenn es ihr nicht gelingt, aus sich selbst jenes Ziel zu finden, das die suchenden Menschen dieser Welt in einem gleichen Geist vereinen kann, auch der Grund für das globale Verhängnis.
DIE UNSTILLBARKEIT DES VERLANGENS:
ÜBER DIE BEGRIFFE UNSERER SEHNSUCHT
Es kann keine Vorbemerkungen zum Thema geben, weil wir mit jedem Wort, das wir sagen, mit jedem Atemzug, den wir tun, schon immer mitten darin sind. Es wäre so, als wollten wir zu unserem Leben eine Einleitung schreiben, was ebenso unmöglich ist, da es doch immer schon längst begonnen hat, und wir niemals für seinen Ursprung verantwortlich sein können.
Wohl läßt sich rückblickend, so weit wir uns ihrer erinnern, unsere Kindheit erzählen, die wir später gleichsam als den Auftakt unseres Lebensweges empfinden; doch ist das jedesmal mit Wertungen verbunden, die aus viel jüngerer Zeit stammen und uns so zu deuten versuchen, wie es die Logik unserer Geschichte verlangt.
Aber darum geht es nicht.
Nicht, wenn es das Ziel sein soll, die Sehnsucht als das menschliche Maß zu bestimmen, als die alles verbindende und in jedem Augenblick gegenwärtige Kraft jedes einzelnen.
Ist doch das Kind bereits genauso von ihren Impulsen geleitet und sehnt es sich doch seit seinem ersten Blick in die Welt zurück nach dem verlorenen Paradies im Leib seiner Mutter. Zugleich ahnt es dessen endgültigen Verlust und beginnt, sich von ganzem Herzen die Versöhnung mit dieser Welt zu wünschen, die doch jetzt zur einzigen Quelle seiner Sicherheit wird, die es wärmt, nährt und schützt.
Jene Spannung, die unsere Sehnsucht markiert, das Gefühl des Zerrissenseins zwischen dem Verlangen nach dauerhafter Geborgenheit und einer nie wirklich zu erreichenden Ruhe, die jene des Todes wäre, den wir doch mit jedem Herzschlag aus ganzer Kraft ablehnen, prägt den Menschen zu allen Zeiten.
Deshalb kann auch der Versuch, Sehnsucht zu erklären, niemals systematisch sein, wird er keine Einleitung, keine Mitte und keinen Schluß haben können, ja ist nicht einmal angemessen in den Stufen der Zeit auszudrücken, weil deren Grenzen im Moment ihrer Allgegenwart verfließen.
So soll denn die Aufgabe dieser anfänglichen Worte nichts anderes sein, als von dem Vorhaben dieses Buches zu berichten und es sogleich mit der Sehnsucht des eigenen Lebens zu verbinden.
Jedes Bemühen, in vermeintlich objektiver Form, gelöst von dem eigenen Verlangen, über das Maß der Sehnsucht, also über das menschliche Leben zu schreiben, wäre nicht nur unbescheiden, sondern mehr noch unangebracht, weil es der Wahrheit unserer Situation widerspräche.
Das heißt freilich nicht, es könne von ihr bloß derart subjektiv und privat gehandelt werden, daß die Chance einer Verständigung reine Glücksache bliebe; so etwa, wenn zufällig ähnliche Schicksale einander begegneten.
Doch gerade das Gegenteil ist der Fall. Und sogar, wie der Gang der Darstellung belegen mag, nicht nur hierbei, wo es der Gegenstand eines so leidenschaftlichen und gefühlsbezogenen Themas vielleicht noch verständlich erscheinen ließe, sondern in gleicher Weise bei jeder anderen Erörterung philosophischer Probleme. Denn wenn diese den Anspruch erheben, für den Menschen bedeutsam zu sein – und welchen anderen Wert sollten sie sich beimessen –, sind sie, da es doch um sein Leben und nicht um die Struktur von Materie geht, immer auch an den konkreten einzelnen, an die Person desjenigen gebunden, dem sie sich eben nicht theoretisch als vielmehr in bestimmten Situationen stellen.
Erst der einzelne, dem in der ganz alltäglichen Praxis seines Daseins Fragen auftauchen, für die er nach Antworten sucht, füllt eine mögliche Erkenntnis mit Inhalt und bezeugt eben dadurch die Gemeinschaft aller, weil sie das Schicksal der Existenz teilen.
Ein Buch über den Menschen kann kein wissenschaftliches sein, wenn das bedeuten soll, nach logischen Regeln und aus sichtbaren, möglichst im Experiment nachzuprüfenden Fakten ein System zu rekonstruieren, das sich passend zur Wirklichkeit verhält. Alle Versuche, den Menschen nach dem Vorbild naturwissenschaftlich – mathematischer Methoden zu erfassen, haben ihn schließlich auf seine Körperlichkeit reduziert und schlimmstenfalls zur manipulierbaren Maschine erniedrigt. Dabei erweist noch jede Theorie der Determination und Kausalität im Blick auf den Menschen ihre Haltlosigkeit bereits im Ansatz, sind es doch Menschen, die sie entwerfen und mit ihrem Anspruch auf Erklärung gerade jenes Verlangen zum Ausdruck bringen, das in keine ihrer Theorien Eingang findet, weil sie eben aus ihm ihre Nahrung ziehen: jene Sehnsucht, die ihre Freiheit ist.
Doch greifen wir nicht zu weit vor, solche Zusammenhänge werden sich allmählich erschließen lassen und sind insbesondere dem Kapitel »Sehnsucht und Politik« vorbehalten.
Es erscheint an dieser Stelle nur wichtig, falsche Erwartungen zu enttäuschen und den Charakter des Buches wenigstens anklingen zu lassen, sofern das nicht immer schon von einem Inhaltsverzeichnis geleistet wird.
Man mag es noch akzeptieren können, ganz persönlich und anschaulich vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen von der Sehnsucht eines Lebens erzählt zu bekommen, sozusagen autobiographisch, so wie es auch in Filmen oder Romanen immer wieder spannend und ergreifend geschieht. Wenn es denn aber nicht in einer literarischen Form dargeboten werde, verlange die Absicht, von einem so weitgesteckten Thema zu handeln, wenigstens eine umfangreiche »Materialsammlung«, um dessen Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. Und Material nicht etwa aus dem persönlichen Erfahrungsschatz, sondern als Wiedergabe fremder Argumente, die in anderen Büchern als die mehr oder weniger eigenständige Meinung ihrer Autoren ausgeführt sind; wobei diese sich dann meist ihrerseits auf eine ganze Überlieferung verschiedener Standpunkte zum gewählten Thema beziehen – und so fort.
Die Fußnote scheint ein Inbegriff der Wissenschaftlichkeit zu sein und ihre Anhäufung Beleg eigener Kompetenz und Seriosität.
Erübrigt sie sich in naturwissenschaftlichen Publikationen häufiger, weil hier neue Methoden, eigene Meßergebnisse oder Experimente allein schon eine Darlegung der Fakten rechtfertigen, wird sie für jene Texte, in denen sich Zeugnisse der Seele und des menschlichen Geistes bekunden sollen, in dem Moment, da sie nicht eindeutig als Dichtung oder Fiktion ausgegeben sind, fast schon obligatorisch. Die Fülle von Querverweisen und Quellenangaben, Auflistungen, Einschüben und Zitaten, mit denen eigene Belesenheit und entsprechender Kenntnisreichtum dokumentiert werden, scheint überhaupt erst den Stoff und die Grundlage zu bilden, woraus sich dann möglicherweise ein eigener Standpunkt zusammensetzen kann und darf.
Doch die Chance dafür schwindet proportional zu der einverleibten Gedankenmasse.
Je sorgfältiger und redlicher man nämlich nach solchen Maßstäben der Quantität und Komplexität vorgehen wollte, desto weniger käme man zum Zuge; müßten doch immer weitere Verweise, die sich mit jedem nächsten Text ergeben, eingearbeitet werden und müßte theoretisch jede neue Publikation an Umfang alle bisherigen übertreffen.
Da dem offenbar nicht so ist, wird also aus dem verfügbaren Arsenal der Meinungen eine Wahl vorgenommen, deren Kriterien jedoch in den seltensten Fällen bewußt und angegeben sind, obwohl genau darin das eigentliche Problem liegt.
Bei genauerem Hinsehen nämlich würde eben in der Wahl jene Subjektivität erkennbar, die mit dem Anspruch auf ein umfassendes Quellenstudium gebannt werden sollte.
Entweder sind einem überhaupt keine anderen als die wiedergegebenen Texte vorstellbar, um den eigenen Standpunkt zu belegen, dann ist von vornherein die Willkür eigener Unfreiheit bestimmender Faktor. Oder aber die vorgebrachten Argumente stützen sich auf Strömungen der Tradition beziehungsweise des jeweiligen Zeitgeistes, wobei deren Bewußtseinsebenen als letztgültige Stufen interpretiert werden, die nicht mehr zu hintergehen seien – was natürlich doch immer wieder möglich und der Fall ist. Denn sonst müßte es ja längst einmal endgültige Antworten auf jene allgemeinen Fragen geben können, die sich dagegen mit jedem Menschen der in dieser Welt existiert, neu stellen und nach einer eigenen, subjektiven Gewißheit verlangen. Nicht nach einer für jeden verschiedenen, sondern vor allem nach einer, die aus eigener Kraft entdeckt und freiwillig angenommen werden konnte, das ist wesentlich.
Am deutlichsten ist die Subjektivität an jenen Versuchen ablesbar, bei denen ihre Autoren es ganz unverhohlen unternehmen, ein neues System zu entwerfen, das ihnen, weil es in gleichsam genialischer Erleuchtung zugefallen sei, das Recht gäbe, mit der Realität souverän und zweckdienlich umzugehen.
Vor allem bleibt der subjektive Ursprung deshalb hinter einer vermeintlichen Objektivität verborgen und unerkannt, weil er von den Subjekten selbst schon längst nicht mehr wahrgenommen wird – und das ist eine sehr große Gefahr, nicht nur für den einzelnen, sondern ebenso für die Gesellschaft. Denn der Verlust der eigenen Wurzel als der inneren Mitte des Menschen bedingt jene verhängnisvolle Haltlosigkeit, die sich mit Macht- und Wahrheitsansprüchen zu kompensieren trachtet. Auch davon wird noch zu reden sein.
Unvermeidlich muß schon allein der Begriff der <<Sehnsucht>> und jene Absicht, ihn als ein Maß zu beschreiben, einen Gegenentwurf provozieren, einen anderen Begriff, der mehr als solche Metapher der Subjektivität und scheinbaren Beliebigkeit geeignet ist, unsere Situation auszudrücken. In philosophischer Tradition böte sich etwa an, über <<Vernunft>> zu sprechen oder vielleicht von <<Erfahrung>>, ja ließe sich möglicherweise auch vom <<Willen>> handeln, ein glückliches Leben zu führen, wenn denn nun schon von einem bestimmenden Wesensmerkmal des Menschen geredet werden soll. Klarer umgrenzte Termini empfehlen sich von den unterschiedlichsten Erkenntnisbereichen her, und mögen sie auch direkt Entgegengesetztes bezeichnen, wie <<Materie/Idee>>, <<Körper/Seele, <<Verstand>> oder <<Gefühl>>, scheinen sie doch allemal vorstellbarere, konkretere Wirklichkeiten zu vermitteln, über deren Dominanz für den Menschen sich dann diskutieren ließe. Sehnsucht hingegen bliebe immer ein undurchsichtiger, verworrener Begriff, ebenso wie das dunkle, drängende Verlangen, dieser merkwürdig intensive, aber ziellos treibende Zustand, den er wiedergeben wolle.
Doch vielleicht gibt es keinen anderen für unsere Situation, vielleicht ist sie so unbestimmt, zerrissen und widersprüchlich, bleibt sie so geheimnisvoll und rätselhaft, daß sie paradoxerweise kein anderer Begriff so präzise und plausibel erhellen könnte wie diese »Sehn-Sucht«.
Schon ein genauerer Blick auf die Wortzusammensetzung hilft weiter: sehnen und suchen; das Sehnen, das Verlangen nach dem Suchen; das Verlangen zu suchen als das Ziel unseres Sehnens – es scheint ein Kreis zu bleiben und wird dennoch zu einer Bewegung, die eine Richtung weist. Denn die dauernde Unruhe, die sich in ihr spiegelt, der Impuls weiterzusuchen, unser Hoffen auf eine Antwort und der beständige Zweifel, ob eine erhaltene auch die richtige ist, treiben uns voran und beflügeln unsere Freiheit.
Aber auch die Gefahr steckt bereits im Begriff, den das Substantiv bei der Betonung seiner zweiten Silbe heraufbeschwört. Das Sehnen kann zur Sucht erstarren: es wird Selbstzweck und so zum Zwang. Der befreiende Impuls, der Wunsch zu entdecken, offen zu sein für jede Wahrheit, die begegnen kann, die Leichtigkeit sehnsüchtigen Staunens vor dem Wunder des Tages und der Nacht, schlägt um in Fesseln aus Miß-trauen und Angst. Getriebensein wird zur beherrschenden Kraft, die den einzelnen niederdrückt, die seinen Willen bricht und ihm auch dann keine Ruhe mehr läßt, wenn er sie nötig hätte. Er ist gezwungen, weiterzumachen und erschöpft sich in blinden Versuchen, mit Gewalt jene Sicherheit herzustellen, die er solange nie erreichen kann, wie er nicht auf sie vertraut.
Sehnsucht ist also ein dialektischer, zweifarbiger Begriff, vielleicht der in sich widersprüchlichste, den es gibt, weil er die Hoffnung auf ein Paradies ebenso trägt, wie er zum Ausdruck abgründigen Verzweifelns werden kann, da nur der Tod noch Geborgenheit verspricht.
Doch möglicherweise enthält er in dieser tragischen Spannung gerade auch den entscheidenden Hinweis ihrer Überwindung. Nicht, indem etwa ein Drittes eingeführt wird, um die Gegensätze synthetisch zu lösen, sondern indem sich die Wurzel des Begriffs als jene Wirklichkeit erschließt, in der sie in jedem Augenblick immer schon überwunden sind: die lebendige, konkrete, einzelne Existenz. Und nicht als eine gedachte, sozusagen transzendentale Existenz, die ihre Lebendigkeit bloß wieder in Theorien erstickt, sondern konkret als meine eigene so gut wie die jedes anderen Menschen.
Wenn es um den Menschen als ein lebendiges Wesen geht, und zwar nicht nur um seine physische Lebendigkeit, vielmehr um die Einheit all seiner widerstrebenden und doch zusammenwirkenden Impulse, kann von ihm nicht mehr einfach bloß Faktisches ausgesagt und Wahrgenommenes beschrieben werden. Dann muß auch erzählt, erinnert, verknüpft und geglaubt werden, dann muß seine Vielschichtigkeit auch schon in der Form des Ausgesagten irgendeine Entsprechung finden. Und dann ist es unverzichtbar, Objektives und Allgemeines vor dem Hintergrund subjektivem Erlebens zu schildern, so wie umgekehrt auch das Persönlichste, Konkrete noch im Blick auf seine mögliche Verbindlichkeit zu fassen wäre.
Wie das genau zu geschehen hat, ist für keinen, der sich an ein solches Vorhaben wagt, von vornherein festzulegen, sondern allein die eigene Spontaneität im Akt des Schreibens und der Bewegung des Nachdenkens kann einen Weg weisen; und nur das Empfinden einer »Richtigkeit« des Gesagten durch andere, denen die Identifizierung gelingen mag, wird zu seinem Wahrheitskriterium. Denn was die Einsicht des Herzens nicht erreicht, in der sich die Kraft des Denkens mit den Impulsen unserer Wünsche vereinigt, bleibt dem Menschen äußerlich, verkommt zum rein instrumentellen Wissen beliebiger Fakten, das bestenfalls Abstumpfung verursacht und im schlimmsten Fall zu einem weiteren Baustein jener Macht wird, mit der immer schon »Ungebildete« unterdrückt wurden, so als sei die Menge an Wissen und Erfahrungen ausschlaggebend für den Wert eines Menschen. Doch solches Denken hat uns nicht nur im Laufe unserer Geschichte an den Rand des Untergangs geführt, sondern es hat immer wieder – und wechselseitig mit der globalen Entwicklung zusammenhängend – die mögliche Freiheit des einzelnen im Ansatz zerstört.
Hat doch der – nach so quantitativen Maßstäben beurteilte – »Ungebildete« eine viel größere Chance, ein Empfinden für den Sinn seiner Existenz zu erlangen, der zuerst immer schon in ihrem bloßen Da-Sein, im Wunder des Lebens begründet liegt, solange er noch nicht durch die chaotische Fülle beigebrachten und angebotenen Materials von der gemeinsamen Wurzel alles Lebendigen abgeschnitten ist.
So wie jedes Kind, wenn es nicht zu früh schon physischer Not oder seelischer Grausamkeit begegnen mußte, aufrichtige Ehrfurcht gegenüber der Welt und den Menschen verspürt, und staunend noch von dem kleinsten Käfer entzückt sein kann, ist es gerade dieses so einfache, reine Glücksgefühl, die Freude, am Leben zu sein, die sich mit allem Wissen über naturgesetzliche Zusammenhänge, allen Kenntnissen historischer Fakten oder Bauplänen technischer Errungenchaften keineswegs mehrt, sondern allemal erschwert wird.
Nicht von ungefähr sehnen wir uns oft gerade in unseren dunkelsten Stunden nach der Klarheit und dem inneren Frieden jener Kindertage, die endlos zu währen und weder Vorher noch Nachher zu kennen schienen. Und wenn sie sicher häufig auch von Kummer und Angst erfüllt waren, verbindet sich mit ihnen doch meist eine Erinnerung unschuldiger Identität, an ein Ganz-bei-sich-Sein, das, hingegeben an den Augenblick, seine innere Mitte, sein Ich noch unmittelbar zu empfinden vermochte. Gerade weil es kein selbstbewußtes, reflektierendes Ich war, konnte es noch ein ganzheitliches sein, noch weitgehend unbehelligt von all den gesellschaftlichen Normen und Zwängen, an denen sich später unter ständigem Zweifeln, Rechtfertigen und Abgrenzen die eigene »Rolle« herauszubilden beginnt.
Natürlich ist die Beeinflussung durch die Umwelt überall gegenwärtig, aber auf eine Tendenz gilt es hinzuweisen: daß mit der Steigerung intellektuellen Wissens und der ihm entsprechenden Fähigkeiten proportional der Grad unserer Entfremdung wächst und nicht etwa abnimmt. Je mehr wir über die Fakten der Welt wissen, desto weniger kennen wir uns aus.
Nun mag es unvermeidliches Schicksal des Menschen sein, sich den Herausforderungen des Lebens stellen zu müssen und zwangsläufig auch das Wissen über dessen sich verändernde Abläufe zu mehren, um den Problemen wirksam zu begegnen; so wie auch das Kind nicht zeitlebens in der beschützenden Obhut seiner Eltern verbleiben kann, sondern einen eigenen Weg finden muß.
Aber in keiner Weise steht damit etwas über die Art des Wissens und sein Ausmaß fest, ebensowenig wie über die Richtung des eigenen Weges, in dessen Verlauf das Gewußte handelnd zu verwirklichen wäre. Und eben darauf kommt es an, erst hier stellt sich die eigentliche Frage nach der menschlichen Freiheit, denn erst in dem Moment, da er selbst zu werten beginnt, erhebt sich der einzelne über eine ausschließliche Bedingtheit durch die Umstände.
Bei ihm liegt die Entscheidung, wieviel Wissen er anhäufen will und was damit geschehen soll, und vor allem diejenige, welchen Bereichen er seine Aufmerksamkeit widmet, in welcher Form und mit welcher Absicht.
So genügen wenige Überlegungen, um zu zeigen, wie wichtig das Empfinden eigener Identität wird, die ihre Verantwortlichkeit für sich und alles Lebendige verspürt hat, weil sonst immer schon längst andere anderswo entschieden haben, was geschehen soll, und beliebige Fakten behalten das letzte Wort.
Wo ein menschliches Maß fehlt, regiert bloße Willkür.
Und auch wenn die Freiheit nicht mit unverhohlener Gewalt niedergedrückt wird, um die Herrschaft einzelner zu sichern, sondern vielmehr gestützt auf »wissenschaftliche« Erkenntnisse nur durchgesetzt werden soll, was den »Fortschritt« fördert und allen zugute kommt, führt das unweigerlich in die Katastrophe, wenn Machbarkeit und Pragmatismus unsere einzige Maxime sind. Denn die Natur zu beherrschen und nach Wohlstand zu streben ist kein Selbstwert, sondern wird, als solcher propagiert, pure materialistische Ideologie.
Die Frage ist also, ob sich ein verbindliches Maß unseres Handelns auffinden läßt, das weder subjektiver Willkür entstammt noch als vermeintlich objektives »verordnet« werden müßte – gerade so erneut seine Ungültigkeit beweisend, weil damit wieder nur Gewalt die Freiheit ersetzte.
Dieses Maß müßte zu empfinden statt zu lernen sein, zu begreifen statt zu verstehen – und das ist ein großer Unterschied –, es wäre nicht an Vorkenntnisse und nicht an einen bestimmten Grad von Intelligenz gebunden, weder an Alter noch an Rasse oder Gesellschaft, es bedürfte keiner bestimmten Methoden oder logischer Schlußfolgerungen, keiner Mahnungen oder Gebote und schon gar keines »kategorischen Imperativs «.
Alle Bedingungen, die jemals für ein moralisches Verhalten aufgestellt wurden, alle Voraussetzungen, die man zu erfüllen verlangte, trennten die Menschen bloß wieder in verschiedene Klassen, in wissend und unwissend, richtig und falsch, gut und böse; Wertungen, die von außen stammten und äußerlich blieben; bloß Feindschaft und Aggression entfachten, weil sie sich selbst genau wie dem anderen schon von vornherein die Chance nahmen, aus dem eigenen Erleben ein Wertbewußtsein zu entwickeln.
Bewußtsein – der Begriff bezeichnet eben etwas anderes als »Wissen«, bezieht sich auf das Verhältnis dessen, was einer weiß, weil er es erfuhr, zu dem, was einer ist, zur Tatsache seiner Existenz und dem, was das bedeutet. Darin drückt sich ein Zusammenhang aus, der auf die konkrete Lebenswirklichkeit des einzelnen verweist und nicht seine <<Verstandeskapazität>> meint.
Und diesem Zusammenhang gilt es erst recht zu entsprechen, wenn hier versucht wird, die Sehnsucht als jenes Maß zu beschreiben, das unser Ursprung und unser Ziel sei.
Deshalb muß sich eine Darlegung allgemeiner Gründe mit meiner persönlichen Hoffnung verknüpfen, daß sie auch durch das anschauliche Beispiel eigener Sehnsucht bezeugt werden kann, so wie auch gerade in deren konkretestem Ausdruck, wenn er trifft – sei es in einem Bild, einem Lied, einem Gesicht – manchmal eine ganze Welt aufscheint.
Es gibt in diesem Buch, und das sei zu Anfang ganz deutlich erwähnt, keinen im voraus festgelegten Plan für einen Wechsel der Reflexionsebenen, außer soweit er den Kapiteln des Inhalts entspricht, die übrigens auch spontan aus dem Wunsch entstanden, möglichst beiden ausreichend Raum zu gewähren. So folgt einem »objektiven«, mehr abstrahierenden Abschnitt (A und C) ein »subjektiverer«, der das Gesagte am Beispiel eigener Erfahrung zu konkretisieren bemüht ist (B und D), ohne daß solche Trennung doch wieder den Anschein einer Methode erwecken sollte. Es gibt sie nicht, wenn es um den Menschen geht, der immer Subjekt und Objekt, konkret und allgemein, Körper und Seele, Ordnung und Chaos zugleich ist, und dessen Lebendigkeit gerade in dem Augenblick preisgegeben ist, wo er nach einer Seite hin definiert wird – und sei es durch die Ordnung einer Methode.
Ist denn aber nicht auch die Zwiespältigkeit und Ambivalenz eine Kategorie, die festlegt und mögliche andere Wahrheiten damit ausschließt? Nun, allerdings, doch auch darum geht es ganz und gar nicht.
Hier sollen überhaupt keine Kategorien erstellt oder Systeme entworfen werden, das wäre einerseits gefährlich, weil genug Menschen sich noch immer von so etwas der Rätsel Lösung versprechen, und andererseits furchtbar öde und nervtötend, denn niemand denkt und fühlt in solcher Weise, ohne sich ungeheure Gewalt anzutun. Und wer tut das schon freiwillig?
Nein – ich möchte viel lieber etwas über die Sehnsucht erzählen, von dem, was ich darüber denke und wie ich meine eigene empfinde. Und natürlich hoffe und vertraue ich darauf, daß es anderen nachvollziehbar erscheinen möge, manches vielleicht sogar einem jeden, das wäre meine größte Sehnsucht.
Es wird nicht möglich sein – und ist zudem auch gar nicht beabsichtigt – Wiederholungen und Gleichklingendes zu vermeiden, durchzieht doch dieses eine Motiv die Darstellung in jedem Abschnitt und soll doch dessen Allgegenwärtigkeit hervorzuheben gerade das Ziel dieser Ausführungen bedeuten.
Der Zusammenhang mit der konkreten Lebenswirklichkeit des einzelnen darf nie aus dem Blick geraten, denn dadurch würde nur wieder jener verhängnisvollen Tendenz zum Zergliedern und Polarisieren Vorschub geleistet, die sich im Blick auf den Menschen noch immer als Irrweg erwiesen hat, weil sie die Einheit des Augenblicks zerstört. Und gerade in ihr existiert der einzelne als der konkrete, einmalige, besondere. Nicht als Gattungswesen, als Stellvertreter seiner Art, nicht als idealisiertes, transzendentales Ich, auch nicht als wandelnder Weltgeist, sondern als diese lebendige, in der Spannung stets wechselnder Situationen befindliche Einheit innerer Gegensätze.
Das ist der entscheidende Punkt.
Wenn die Gegensätze bloß als äußere, das heißt immer auch: von außen, beschrieben werden, gerinnen sie zwangsläufig zu feststehenden Merkmalen und starren Kategorien, die den Menschen definitorisch zu erfassen suchen und ihn aber gerade so gar nicht erreichen. Statt dessen entwerfen sie ein abstraktes Modell von ihm, das vielleicht mancherlei interessante Anregung bieten mag, aber durch die festgelegte Enge seiner Form sogleich mehr wird: Endgültigkeit suggerierend, die einen Anspruch auf Wahrheit erhebt. Und darin liegt eine große Gefahr, die eine solche Vorgehensweise hier ausschließen muß – jedenfalls ihren alleinigen Gebrauch –, denn auch wenn sich ein abstrakter Entwurf für ein »Menschenbild« ausdrücklich selbst zu relativieren sucht und zugibt, der Komplexität konkreter Lebenswirklichkeit damit niemals ganz gerecht werden zu können, muß doch schon durch die mühsame Ausarbeitung eines solchen Entwurfs der Eindruck entstehen, auf so konstruierte Weise könne überhaupt Wesentliches zur menschlichen Existenz mitzuteilen sein.
Doch die wird im Grunde nur von jedem konkreten einzelnen in seinem eigenen Dasein wirklich ausgedrückt, und auch darin viel weniger, indem er sie beschreibt, als vielmehr, indem er existiert. Außerdem erweckt jedes System, jede Kategorienlehre, die das menschliche Wesen zu ordnen und zu bestimmen versucht, den Anschein einer Komplexität seiner Natur, deren möglicherweise luzide Klarheit aber gerade dem sezierenden Blick eines nur an den Phänomen interessierten Wissenschaftlers verborgen bleiben muß.
Vielleicht ist das Wesen des Menschen vollkommen einfach und für jeden begreiflich, kompliziert und verwickelt dagegen immer nur die Lebensgeschichte des einzelnen, während der er sich aus dem ganz einmaligen Schicksal seiner besonderen Umstände täglich von neuem in die Welt hineinentwirft? Und die Auflösung solcher Zusammenhänge könnte dann immer nur der einzelne liefern, der das Abenteuer seines Lebens erzählt.
Die Chance einer eigenen Antwort, ja auch einer eigenen Ordnung des persönlichen Lebensplans, macht den Kern der menschlichen Freiheit aus, und erst wenn es gelingt, dafür einen öffentlichen Raum zu schaffen, läßt sich aus dieser jedem in gleich elementarer Weise zugänglichen Urerfahrung ein verbindendes Maß schöpfen, das alle trägt.
Dem einzelnen das Gespür eigener Verantwortlichkeit dadurch zu nehmen, daß man ihm Theorien über den Menschen und Modelle für das Leben anbietet, die er nur noch auf seine spezielle Situation anzuwenden habe – wodurch sich im übrigen nicht die Theorie differenziert, sondern alle konkreten Unterschiede eingeebnet werden –, verhindert die Freiheit bereits im Ansatz.
Und wenn sie das entscheidende Wesensmerkmal des Menschen ist, worin er sich von allem anderen Lebendigen abhebt – mögen wir den Rahmen dieser Freiheit auch noch so sehr durch Gesetze innerer und äußerer Natur eingeschränkt sehen –, müssen wir über ihn anders denken und sprechen als über Dinge der äußeren Erscheinungswelt, als über Objekte, denen wir ein solches Vermögen nicht zutrauen. Denn indem wir auch die »Tiefendimension« eines Menschen, seine Seele, wie ein Beobachtbares beschreiben, wie ein Sichtbares skizzieren wollten, sie nach logischen Gesetzmäßigkeiten auszuforschen und in Regelsystemen festzuhalten versuchten, bekämen wir immer wieder nur seine Oberfläche in den Blick, tote Begriffe und starre Prinzipien. Und die lebendige Freiheit des Menschen, das Geheimnis seiner konkreten Existenz, die nach sich selbst fragen kann, bliebe weiterhin verborgen, obwohl gerade sie doch ergründet werden sollte.
Freilich ließe sich so gesehen jedes allgemeinere Reden über den Menschen, jedes Abstrahieren, das immer die Ebene einer Schilderung persönlicher Eindrücke verläßt, einer verfehlten Perspektive verdächtigen.
Ja bedeutete nicht sogar schon jede Aussage eines Menschen über einen anderen dessen Bevormundung, weil sie die Freiheit seines eigenen Urteils beschneidet?
In gewisser Weise allerdings, und es ist dabei auch kein Trost, daß ihm ja ebenso ein Urteil über mich zustände, dessen Einfluß ich entzogen bin. Gegenseitiger Unterdrükkung entspringt noch keine Freiheit und ein Austausch von Vorurteilen wird schwerlich zur Wahrheit führen.
Nein, alles hängt davon ab, wie über den Menschen gesprochen und geschrieben wird: ob die Aussagen ihn als Objektives hinstellen und ein Bild seines Wesens entwerfen wollen oder ob sie vielmehr Raum schaffen für die Entfaltung des einzelnen. Das verlangte, mit allem, was sie allgemein formulieren, nichts anderes zu behaupten, als daß es um den Sinn konkreter Existenz geht, der sich erst in deren Selbstsein erfüllt: Sich also mit jedem Wort überflüssig zu machen versuchen, damit jenes Empfinden wachsen kann, das unsere Lebendigkeit beinhaltet.
Nur wenn es gelingt, den Gegensatz von Allgemein und Konkret, Objekt und Subjekt, Vernunft und Gefühl, in die Einheit des Existierens zu entlassen, wenn das Reden und Schreiben nichts anderes sein will als eine Brücke zu seiner eigenen Überwindung, als eine beständige Demonstration der Unzulänglichkeit jeder »absoluten« Lösung – »abgelöst« von der konkreten Wirklichkeit jedes einzelnen nämlich –, dann kann es gerechtfertigt sein. Nur, wenn es nichts ist, außer einer Beschwörung des grenzenlosen Reichtums alles Lebendigen, das wir zuletzt nur staunend verehren, aber niemals verstehen können.
Nur, wenn es nichts ist, als der Wunsch, alles zu lieben.
Doch auch dieser Wunsch noch läßt sich nicht behaupten, sondern bloß von anderen aus dem Gesagten erschließen, die dann allein entscheiden mögen, was dessen tragender Grund ist; ob sie ihre eigene Freiheit dadurch erweitert oder begrenzt fühlen.
Vielleicht klärt sich schon manches bei einem ersten Blick auf die »Begriffe unserer Sehnsucht«, so wie sie im Inhaltsverzeichnis genannt sind – was freilich mindestens ebenso absurd wirken muß wie jede Einleitung zum Thema. Aber möglicherweise kann es ja »vollständig« erscheinen, indem es so allgemein bleibt, daß auch dem Speziellsten noch Platz gelassen ist; soll es doch ohnehin nur um jene Tendenz gehen, die alles menschliche Streben durchzieht; darum, was überhaupt von ihm aussagbar ist, ohne den Reichtum der Wirklichkeit zu verstellen.
Allerdings wäre das Problem auch so nicht zu umgehen, bliebe denn strenggenommen immer nur eine Wahl zwischen Alles oder Nichts, zwischen endlosem Beschreiben oder ehrfürchtigem Verstummen vor der Fülle dessen, was ist.
Doch gerade in dieser Situation stehen wir alle jeden Tag aufs neue. In der Spannung unseres Verlangens, das alles von diesem Leben wünscht, weil es bedürftig in ihm ist, obwohl es sich doch vielmehr demütig vor einem solchen Wunder zu verneigen hätte, dem es in jeder Sekunde erst seine Existenz verdankt.
Und so, wie wir unsere Leiden besiegen, unsere Not lindern und unsere Sehnsucht stillen wollen, sind wir auf den anderen verwiesen, der unser Schicksal teilt, was uns Trost und Ansporn zugleich werden kann; erfahren wir doch darin dieses Leben als unsere gemeinsame Aufgabe, begreifen wir den Sinn der Verantwortung, die wir tragen, jeder für sich so gut wie für alle anderen.
Aber damit wir unsere menschliche Situation als ein gemeinsames Schicksal erleben können, das eine tiefe, umfassende Solidarität zu begründen hilft, müssen wir miteinander reden – und auch danach haben wir eine ungeheure Sehnsucht.
Niemals wird eine solche Verständigung vollkommen sein, abschließbar oder frei von Mißverständnissen, so wenig wie überhaupt ein Mensch auf seine Aussagen reduzierbar oder durch Sätze endgültig zu erklären ist.
Aber dennoch haben wir nichts außer der Sprache, um uns den Zusammenhang des Wunders gegenseitig zu vermitteln. Um eine Liebe zu bezeugen, die nicht an den Zufall des Augenblicks gebunden bleibt, sondern erst im Bewußtsein ihrer gemeinsamen Wurzel zur bestimmenden Kraft unseres Handelns wird; ja die erst dadurch wahrhaft Liebe sein kann, als ein Bekenntnis und eine Entscheidung, als Ausdruck einer Freiheit, die so allein dem Menschen zukommt.
Den Versuch einer Verständigung gilt es also immer wieder zu unternehmen, wir haben keine andere Chance, unsere Menschlichkeit zu bewahren, und wir wünschen uns zudem nichts tiefer, weil darin zugleich die höchste Möglichkeit liegt, ihr Ausdruck zu geben. Wir sehnen uns nach nichts so sehr, wie nach jenem beseligenden Zustand einer tief empfundenen Liebe zum Leben, wir begreifen sie als unsere einzige Größe und unseren ganzen Stolz. Und so kann am Ende vielleicht sogar unser Stolz noch unsere einzige Rettung sein.
Wie schon erwähnt, wechseln im Gang der Darstellung abstraktere und konkretere Passagen einander ab, wobei das nicht nur für die übergeordneten Kapitel gilt, sondern ebenso auch in ihre jeweils vier Teilabschnitte hinein. Die Anlage der Arbeit will in jedem Fall die Spannung der Gegensätze, in der ein Mensch existiert, widerspiegeln, ohne jedoch beim bloßen Konstatieren gegebener Widersprüche zu verharren. So folgt auf die Schilderung gewissermaßen »polar« aufeinander bezogener Kräfte jeweils ein Versuch, beide zusammenzudenken, das heißt, ihre wechselseitige Bedingtheit zu beschreiben und gleichsam aus der Distanz einer höheren Warte das verborgene Gemeinsame in ihnen zu entdecken. Der vierte Abschnitt zieht dann notwendige Konsequenzen und will die Brücke schlagen zur konkreten Lebenswirklichkeit des einzelnen.
An diesem Punkt bereitet sich das eigene Verstummen vor, hier wird das Denken in die Praxis der Existenz entlassen, vor der allein es sich erfüllen und rechtfertigen kann. Es gibt keine andere Synthese der vorhandenen Gegensätze als diese konkrete, lebendige Existenz des einzelnen, der die Spannung mit seinem Dasein vermittelt und aushält.
Keine erdachte Theorie und keine logische Schlußfolgerung, kein Gott, kein Weltgeist und kein idealer Staat vermag sie für den Menschen zu lösen oder abzuschaffen, vielmehr wird es seine unverzichtbare Aufgabe, Zeit seines Lebens in dieser unstillbaren Sehnsucht zu verbringen und aus ihr seine ganze Kraft zu schöpfen. Erst so kann jeder Moment, da er seiner Zerrissenheit offen ins Auge blickt und mit jedem Herzschlag über seine Verzweiflung triumphiert, zu einem Sieg über sein Schicksal werden und ihm ein Zeichen des Unsterblichen bedeuten.
Denn in diesem Augenblick, da er sich selbst bejaht und das Paradox seiner Existenz annimmt, bricht eine Möglichkeit aus dem Menschen hervor, die ohne den einzelnen nicht in der Welt wäre: seine Freiheit. Und in ihr begreift er das Maß der Sehnsucht.
A) DIE WEGE DER SEHNSUCHT
So wie der vorausgegangene Abschnitt die Aufgabe erfüllen sollte, auf den Grundgedanken dieses Buches und die Formen seiner Darstellung vorzubereiten – eben nicht in »das Thema« einzuführen, was unmöglich ist, weil schon jedes Wort aus ihm seine Nahrung zieht, genauso absurd wäre es, einem Neugeborenen Atemunterricht zu erteilen –, so sollen auch diese ersten Seiten eines Abschnitts bloß skizzieren, wovon er handeln wird und welche Bedeutung ihm im Rahmen des Buches zugedacht ist.
Dadurch mag sogleich der Verdacht eines vorgefertigten Plans entstehen, auch weil von Kapiteln, Einteilungen, Ober- und Unterabschnitten geredet wird und bereits ein flüchtiger Blick auf den Inhalt den Eindruck streng aufgebauter Komposition hinterläßt. Vier Hauptüberschriften sind vier Unterabteilungen zugeordnet, einem einleitenden Abschnitt scheint ein abschließender zu korrespondieren, dazwischen nichts als bestimmte Artikel und Substantive, die als Vier- oder Drei-Wort-Folge verknüpft oder gegenübergestellt sind – dahinter müsse sich ja Ordnung und System verbergen, und der gute Vorsatz sei sogleich blamiert.
Doch es war anders.
Als erstes stand nichts fest als der Titel und die in ihm bezeichnete Empfindung gleichen Namens – in umgekehrter Reihenfolge natürlich, denn bevor wir etwas bezeichnen können, muß es erst erfahren sein. Besagten Zustand erlebte ich schon längere Zeit als meinen eigenen – genaugenommen, wie ich jetzt denke, seit meiner Geburt –, aber mir fiel zunächst nichts auf als mein übermäßiger Gebrauch des Wortes, mit dem eine gesteigerte Unruhe, ein vermehrtes Getriebensein einherging – wieder andersherum selbstverständlich, das Schreiben kann offenbar die Wirklichkeit nur »verdreht« festhalten, weil es immer nachträglich geschieht.
Das heißt, die Unruhe hatte Gründe, die im Leben lagen, sie war spürbar, nicht erdacht, und hatte mit diesem Buch wie mit meinem Leben zu tun. Das wollte zuerst keine Buchform annehmen, und so konnte die Gestalt des Buches nicht lebendig werden.
Was immer blieb, war der Wunsch selbst.
Der Wunsch, über die Erfahrung dieser Situation, über die Widersprüche menschlicher Existenz und ihre gegensätzlichen Antriebskräfte zu schreiben, in dem festen Glauben, daß sich gerade darin unser gemeinsames Schicksal ausdrückt. Ohne dabei leichtfertig persönliche Not für ein allgemeines Verhängnis zu halten oder einen beliebigen Aspekt als Lebensgesetz auszugeben, ging es darum, aufmerksam der Verbindung des eigenen unstillbaren Dranges mit der Ruhelosigkeit in der nächsten Umgebung, in der Gesellschaft, ja in der Geschichte nachzuforschen, um vielleicht Parallelen oder gar einen direkten Zusammenhang zu entdecken.
Immer erst, wenn sich die eigene Erfahrung zu einem allgemeinen Eindruck verdichtet, wenn sie über sich hinaus auf ein Ganzes verweist, das nicht mehr nur die eigene Person ist, sondern schon den anderen, den nächsten einbezieht und manchmal sogar die Gemeinschaft aller, ja die Welt zu umgreifen scheint, dann drängt sie danach, sich zu äußern, wird sie Sprache oder Schrift. Und auch wo das impulsiv geschieht, wo die eigene Not oder das eigene Entzücken offenbar wieder nur Privates hervortreiben, bekundet sich noch mit jedem Äußern ein Gespür für etwas zutiefst Allgemeines: die Unvertretbarkeit der Existenz und das Recht jedes einzelnen auf seine eigene Geschichte, auf sein Leiden und seine Freude.
Dem Ausdruck zu verleihen, gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten, vom heimlichen Tagebuch oder einem vertraulichen Gespräch, über Gedichte, Erzählungen, Romane, bis hin zu öffentlichen Vorträgen und Diskussionen, wissenschaftlichen Erörterungen und umfangreichen Traktaten. Und damit ist nur der Bereich sprachgebundener Mitteilung umrissen, unzählige Wege bieten auch alle anderen kreativen Fähigkeiten des Menschen: die Malerei, das Schauspiel, die Musik.
Wahrgenommen werden zu wollen, beachtet zu werden, weil die Tatsache der eigenen Existenz jedem zugleich sein Recht darauf verleiht, ist jenes elementare Bedürfnis, das jede Erfahrung des einzelnen trägt und begleitet, in der er sich auch als Gattungswesen begreift, als Mensch in der Gemeinschaft, als ICH in der Welt.
Ist das potentiell in jedem Augenblick möglich, verwirklicht es sich doch leider nur in Ausnahmefällen.
Denn das Empfinden der eigenen Mitte, der eigenen Bedeutung, ist zu oft schon verlorengegangen, so sehr überdeckt von Ansprüchen und Forderungen, Befehlen und Verboten, Normen und Konventionen, daß nur noch die öffentliche Rolle, die Maske des anonymen Man, einen Wert zu haben scheint und das Recht verleiht, sich zu äußern. Was persönlich bewegt, ist soweit in private Bereiche abgedrängt und herabgewürdigt, daß es sich in seiner lächerlichen Kleinheit verschweigen muß, bis es fast verstummt; und was zu verlautbaren wäre, weil es öffentlichem Interesse entspricht, erübrigt sich, weil es immer schon längst von »jemand« gesagt ist.
Die Gesellschaft, das Gesetz, die Ordnung, das System können sich zwangsläufig immer bloß selbst reproduzieren, allein die lebendige Kraft einzelner Menschen, die auf ihren Wegen zu eigenen Zielen gelangen wollen, vermag Verhältnisse zu ändern und Erstarrtes aufzulösen.
Erst im Entschluß bezeugt sich die Freiheit, im Entwurf des eigenen Lebens. Gehorsam ist auch ein Hund, und genau vorgeschriebene Aufgaben führen Roboter allemal zuverlässiger aus.
Doch geht es nicht um blinde Willkür oder Selbstverwirklichung als Eigenwert, um das Neue als das Gute – keineswegs. Das bloße Vorwärtsstreben, der unbedingte Wandel ohne Maß und Ziel, vergrößert nur den unendlichen Bestand in den Arsenalen der Machtmittel, dient nur weiterem Ausgrenzen, Übervorteilen und Erniedrigen Andersdenkender und bleibt in seiner Borniertheit eine ebensolche Gefahr für den einzelnen wie jene erstarrte Ordnung, aus der es sich zu befreien meint.
Eigene Entfaltung ist immer sogleich auf diejenige aller Menschen bezogen, auch wenn sich ein solcher Zusammenhang vielleicht nur an dem nächsten meiner unmittelbaren Umgebung erschließt; aber so wie ich auf ihn wirke und er mich beeinflußt, setzt es sich potentiell in unendlicher Reaktion fort. Nur merkt das keiner mehr, der sich selbst abhanden kam, der das Gefühl seiner eigenen Bedeutung verloren hat – und damit die Wurzel aller Werte.
Die Kostbarkeit des Lebens begreift niemand aus einem Buch, sondern sie erschließt sich aus dem Wunder des eigenen Daseins und wird dadurch zu einer universellen Erfahrung, weil in ihr wahrzunehmen ist, daß jede Existenz denselben Grundbedingungen unterliegt.
So ist die menschliche Kreativität, jenes Denken und Handeln, das oft nur noch in den eigens dafür angelegten Reservaten von Kunst und Spiel aufgehoben scheint – wobei jedoch deren Lebendigkeit durch ein solches Gettodasein wieder stark eingeschränkt wird – im Grunde der eigentliche Ausdruck unserer solidarischen Existenz. Denn Kreativität setzt den Glauben an die mögliche Gleichheit und Freiheit aller Menschen voraus, weil doch jeder mit seinem Wunsch nach Kommunikation, dem Versuch einer Mitteilung an andere – und davon lebt ja die Kunst – darauf hofft, verstanden und geliebt zu werden. So wie sie in ihrem Tun die eigene Schöpferkraft und Spontaneität ausdrückt und den eigenen Lebenswillen bezeugt, bezieht sie den Impuls für das eigene Schaffen zugleich immer auch aus der Vorstellung, etwas Allgemeines, Gültiges zu vermitteln, in dem andere entsprechende Bereiche ihrer Lebenswelt wiederentdecken können. Ursprünglich ruht sogar jede Entäußerung eines Menschen, jedes Gespräch, auf einem solchen Vertrauen, ist deshalb genauso kreativ, weil es der lebendigen Freiheit des einzelnen entstammt und dessen Versuch bedeutet, konkret Gemeinschaft mit anderen zu verwirklichen.
Tatsächlich aber ist das Bewußtsein dafür immer mehr entschwunden, sofern es überhaupt jemals anders als in Ausnahmefällen verbreitet war. Das ist nicht so sehr daran abzulesen, daß die wenigsten Menschen sich künstlerisch betätigen oder sich auch nur dafür begabt halten – denn auch das besagt noch nichts, die Kunst kann ja ebenso leicht als Herrschaftsinstrument und Abgrenzungsmechanismus mißbraucht werden. Vielmehr wird es deutlich an der mangelnden Offenheit unserer Gespräche und unserer Handlungen, daran, daß entweder fast alles Reden und Tun rein sachbezogen bleibt, funktional im Dienst bestimmter Interessen steht, oder ganz direkt auf nichts anderes abzielt als die Erniedrigung und Übervorteilung des anderen.
Das eigene Ohnmachtsgefühl versucht sich dadurch zu kompensieren, daß es andere angreift, Vorwürfe ausspricht und Fehler kritisiert, während sich selbst gleichzeitig ein Schein von Tugend und Großartigkeit beigelegt wird, was nur noch tiefer treffen soll. Dabei kann alles auf die subtilste und dafür um so perfidere Art und Weise geschehen, versteckte Sticheleien, ironische Seitenhiebe, gespielte Bescheidenheit, wohlplazierte Lügen – das Feld der Möglichkeiten auf diesem Gebiet reicht sehr weit und wird tagtäglich fleißig bestellt. Kaum eine menschliche Begegnung geschieht um ihrer selbst willen, aus aufrichtigem Interesse am anderen Menschen, schon gar nicht in den sogenannten »Liebesbeziehungen«, die der Eigennutz oft besonders stark korrumpiert.
Woran liegt das alles und stimmt es so überhaupt? Bedingt der Verlust der eigenen Mitte – die fehlende Selbsterfahrung – den Verlust des menschlichen Maßes, und kann dies umgekehrt aus dem Empfinden der eigenen Bedeutung erwachsen?
Solche Fragen beschäftigten mich schon über mehrere Jahre und Bücher hinweg bis zum Heraufziehen jenes Begriffs, der mir immer zentraler wurde und endlich auch all das zu umfassen schien, was bislang als Erklärung nicht genügte. Freilich nicht als bloßer Begriff, sondern als die darin abgebildete menschliche Verfassung, die mir, je mehr sie meine persönliche Situation zu kennzeichnen schien, als jenes allgemeine Schicksal plausibel wurde, das noch hinter aller bloß logischen Interpretation, hinter der Angabe vernünftiger Gründe für bestimmte Lebenslagen, den ganzen Kosmos menschlicher Wirklichkeit prägt und gestaltet. Und eben deshalb nicht nur unser Verhängnis, sondern zugleich der mögliche Ursprung unserer Freiheit ist oder werden kann, sobald wir sie als so ursprüngliches Vermögen begreifen.
Je mehr ich mich also auf die Suche nach einer Antwort auf unser Schicksal begab, je häufiger und deutlicher ich immer neu auf Widersprüche und Sackgassen stieß, auf überall in kurzen Abständen oder sogar gleichzeitig verkündete und dabei oft diametral entgegengesetzte »Wahrheiten«, desto klarer begann sich die Sehnsucht als der allen Entwicklungen zugrundeliegende Impuls abzuzeichnen.
Und was das entscheidende war: nicht nur als ihr Antrieb, als der Ursprung des menschlichen Handelns, sondern zugleich als ihr verborgenes Ziel, als der Selbstzweck unseres Daseins: als das menschliche Maß.
Klar war jedoch ebenso von Anfang an, daß sich eine solche Einsicht, wenn sie denn eine lebendige, nachvollziehbare auch für andere sein sollte, nicht wieder in der Gestalt einer »Verkündigung«, dem erneuten Ausruf einer »endgültigen« Wahrheit mitteilen ließe; so wenig wie sie ja nicht als bloß logischrationaler Denkprozeß abgeleitet wurde, sondern gleichsam aus demjenigen des Lebens allmählich erwuchs. Beweis dafür kann keine konstruierte Objektivität werden, keine Folgerung aus vorgegebenen Prämissen, die ihre gewünschten Ergebnisse von selbst erzeugen, sondern allein die konkrete Existenz desjenigen, der eine Einsicht für sich als gültig behauptet.
Nicht die Menge einzelner, die sich einer bestimmten Auffassung anschließen, bezeugt deren Wahrheit, vielmehr die aufrichtige Empfindung ihrer befreienden Kraft bei jedem, für den sie gültig wird.
Und weil ein solches Gefühl der Freiheit nicht herzustellen ist, anzufertigen wie ein Programm, deshalb läßt sich wahre Einsicht niemals lehren, sondern immer nur lernen aus der Situation des Existierens selbst. Das »Medium«, in dem sie sich ereignet, ist das Erlebnis, bedeutet immer eine ganzheitliche Erfahrung aus Gedanken und Gefühlen; und dasjenige ihrer Mitteilung ist der Essay, der Bericht oder die Erzählung, also gleichfalls eine Verbindung des Gedachten mit der subjektiven Lebenswelt.
Es war beim Weizenbier in einem Münchener Bierkeller, in den ich eigentlich nur einkehrte, um mich von einem längeren Spaziergang ein wenig auszuruhen; zumal ich bis zum Beginn des Films, den ich mir in einem nahegelegenen Kino ansehen wollte, noch eine gute Stunde Zeit hatte. Ein strahlender Sommertag, etwa um die Mittagszeit. Die Aussicht darauf, zuvor meinen Durst löschen zu können, erfreute mindestens ebensosehr wie das Bewußtsein jener privilegierten Lage, mich gleich um 13.00 Uhr an einem hellichten, heißen Tage in einem wohltemperierten Raum meiner Leidenschaft für Zelluloid hingeben zu können. Viele hätten mich wohl um meine freie Zeit beneidet, mich jedoch zugleich für verrückt erklärt, sie bei so wunderbarem Wetter nicht draußen in der Sonne zu verbringen. Aber meine Sehnsucht nach der Kunstwelt des Kinos war stärker, von dem Augenblick an, da ich am Morgen in einer Anzeige von der Aufführung dieses Films erfahren hatte, den ich so lange schon sehen wollte und der nur für einen Tag auf dem Programm stand; gerade jetzt, da ich mich in der Stadt aufhielt.
So sehr begeisterte mich die Information und traf so unvermittelt auf den Boden meiner Sehnsucht, daß ich kaum noch an einen Zufall glauben wollte. Den ganzen Vormittag über fühlte ich mich euphorisch beschwingt und in meiner Hoffnung bestärkt, daß ein tief empfundenes Verlangen, wenn es geduldig ertragen wird, einmal auch seine konkrete Erfüllung zu finden vermag. Ich interpretierte das Ereignis nicht als ein beliebiges Zusammentreffen, sondern schrieb es der Kraft meines Wünschens zu, gleichwohl wissend, auch für diese Vermutung niemals irgendwelche Beweise zu haben.
Mir selbst jedoch konnte ich sie, wenn ich wollte, jederzeit geben, so wie ich mich auch unschwer sogleich für den Kinobesuch entschied und damit andere Möglichkeiten unberücksichtigt ließ.
Und etwas in mir hatte es offenbar auch grundsätzlich schon getan: den Gedanken der Sehnsucht seit langem im Kopf, das wohlige Gefühl des gleich mit dem ersten Schluck gestillten Durstes noch in der Kehle und das seiner Erlösung nahe Verlangen nach meinem Wunschfilm im Herzen, war in genau dem Moment die Zeit reif für den Plan dieses Buches.
In etwa einer halben Stunde entwarf ich seinen Inhalt, der sich sogleich in die vorliegende Ordnung fügte, abgesehen von geringen nachträglichen Veränderungen stilistischer Art, wobei ein anderer Begriff manchmal einen genaueren Klang ergab.
Die Reihenfolge entstand ebenso selbstverständlich wie sich die verschiedenen Aspekte des Themas zu den entsprechenden Substantiven und deren Zusammenhang verdichteten. Von allem sollte die Rede sein in diesem Buch, was mich schon immer zu ihm auf den Weg gebracht hatte, und wenn möglich auch gemäß der Geschichte meiner Erfahrungen, die ja, wenn sich tatsächlich im Leben des einzelnen Spuren unseres allen gemeinsamen Wesens finden, immer zugleich auch die Geschichte des Menschen überhaupt widerspiegeln müßte.
Zuerst wollte ich deshalb von den allgemeinen Kräften der Seele handeln, von dem, was uns ursprünglich ausmacht und umtreibt, solange noch nichts feststeht als unsere nackte Existenz, unser Dasein in der Welt.
Wenn nämlich die Sehnsucht unser wesentliches Bedürfnis sein soll, müssen sich dessen Wurzeln auch bis an den Anfang eines jeden Lebens zurückverfolgen lassen, dorthin, wo auch der Mensch noch ein weitgehend instinktgesteuertes Wesen und ganz auf die Fürsorge seiner Eltern angewiesen ist. Von da aus läßt sich auch erst übersehen, wie sich jene Kräfte zu entwickeln beginnen, die wir für die kennzeichnenden Merkmale menschlicher Existenz halten, die Vernunftbegabung seiner Seele und die Fähigkeit eines fragenden, reflektierenden Geistes.
Gelingt es ihm, Licht in das Dunkel seiner Ursprünge zu bringen, kann der Mensch sich mit Hilfe seines Bewußtseins über die Ebene triebgesteuerten Verhaltens erheben, wie weit vermag er es, und ist es überhaupt erstrebenswert?
Wege der Sehnsucht zu beschreiben, heißt in diesem ersten Hauptteil, die grundlegenden physischen und psychischen Bedingungen des Menschseins zu bedenken, einen ersten, ursprünglichen Blick auf die Zwiespältigkeit unserer Situation zu werfen, um von da aus vielleicht schon einen Eindruck von der Bedeutung des Lebens zu gewinnen, vom Sinn unseres Daseins und der Kostbarkeit des Augenblicks.
Entsprechend versucht der dritte Abschnitt – wie auch der dritte der folgenden Hauptteile – in gewisser Weise Schlüsse aus der zuvor beleuchteten Gegensätzlichkeit unserer Existenz abzuleiten, freilich ohne jede zwanghafte Logik und immer wieder auch jene Doppelheit einbeziehend. Die gilt es gerade nicht synthetisch aufzulösen, wie es immer wieder ideologisches Denken gewaltsam getan hat, sondern bewußtzuhalten und an die Verantwortung des einzelnen zu verweisen. Daher kann auch die Aufgabe des dort Gesagten nur im Beschreiben solcher Notwendigkeit bestehen, darin, jene Spannung soweit zu markieren, daß sie auch anderen als maßgeblicher Zustand des Daseins nachvollziehbar werden kann.
Wenn sich die Funktion des dritten Abschnitts, und ebenso auch diejenige des dritten Teils im Verhältnis zu den vorausliegenden, vielleicht als eine Art »Bestandsaufnahme« zuvor beschriebener Gegensätze interpretieren läßt, so wäre der jeweils vierte eher als »Appell« zu charakterisieren. Wenn hinter den drei ersten jedesmal ein Punkt stehen könnte, gehörte hinter ihn am ehesten ein Ausrufezeichen. Vorher habe ich angedeutet, daß sich in ihm das eigene Verstummen vorzubereiten beginne und dabei das Denken in die Praxis entlassen werden solle. Und »in der Tat« liegt am Ende nur in der Tat die Wahrheit, kann niemals Theorie die Praxis ersetzen, der Gedanke das Leben: was für die konkrete Existenz des einzelnen keine lebendige Bedeutung gewinnt, indem er danach zu empfinden und zu handeln versucht, hat überhaupt keine Bedeutung und bleibt leeres Geschwätz.
Aus diesem Grund wird alles Denken in einen Appell zu münden haben, jedes Philosophieren in ein Handeln, alles Allgemeine in ein Konkretes – wenn es eben nicht Selbstzweck und beliebiges Spiel bleiben, sondern uns angehen, uns existentiell betreffen will. In jedem Gespräch unter Menschen wird das spürbar, aus jedem Buch ist es herauszulesen; selbst dann, wenn es vorgibt, reine »Unterhaltung« zu sein, schließt doch auch das einen Appell, einen Hinweis auf deren Notwendigkeit ein. Wir verfolgen mit jeder Mitteilung eine Absicht, wollen mit allem etwas ausdrücken und tun das auch: und sei es mit einem Gähnen unsere Unaufmerksamkeit oder mit dem ungefragten Drauflosreden unser übergroßes Geltungsbedürfnis; also immer auch in jenen Augenblicken, wo wir uns tieferliegender Motive vielleicht gar nicht bewußt sind.
Soweit es mir also möglich ist, will ich deshalb auch von meinen Absichten offen reden, so wie ja auch der Anfang des Buches schon sein Ziel anzugeben versuchte, in dessen Richtung ohnehin längst der Titel deutet.
Jedes Märchen übermittelt mehr oder weniger verschlüsselt am Ende eine »Moral von der Geschichte«, und auch wenn ich mich in diesem Buch sicher weniger bildreich und geheimnisvoll ausdrücken werde – was wohl einfach auch daran liegt, daß meine entsprechenden Talente dafür nicht ausreichen –, scheint mir recht besehen all unser Denken und Handeln, jedes menschliche Leben, genauso »märchenhaft« zu sein: von einer zunächst verborgenen Bedeutung durchzogen. Und jede Aufklärung über sie, jeder Versuch einer Antwort auf die sich unausweichlich stellenden Fragen, führt, so vieldeutig, in Zweifel darüber, ob es denn die angemessene war, birgt sogleich neue Rätsel, die unsere Aufmerksamkeit verlangen.
So ist die menschliche Existenz eine unendliche Geschichte, die sich täglich forterzählt, und trotzdem müssen wir uns ebenso fortwährend auch große und kleine Antworten geben, um nicht im Meer wechselnder Empfindungen zu ertrinken. Es gilt, subjektive Gewißheit zu erreichen, ein intuitives Begreifen davon, wie die eigene Antwort zum tragfähigen Grund meiner Existenz wird. Wenn sie damit auch keine »objektive, verbindliche« Wahrheit rechtfertigen kann, ist doch unser aufrichtiges Bemühen um einen persönlichen Weg die einzige Chance, ihr jemals auch nur nahezukommen: eine Wahrheit, die nicht verbindlich gilt wie ein Gesetz, sondern die uns alle verbindet, indem wir an unserer eigenen Lebendigkeit diejenige der anderen als Wert ermessen.
Der Ausdruck »Appell« für das jeweils vierte Kapitel ist selbstverständlich keinesfalls als Handlungsanweisung, als Aufforderung oder gar als »Befehl« gemeint, sondern nur als Fingerzeig in jene Richtung, die sich für mich aus dem Zusammenhang des vorher Gesagten ergibt; als Quintessenz dessen, was die Bedeutung des Denkens für das Handeln ausmacht.
Wenn überhaupt zu irgend etwas gemahnt und aufgerufen werden soll, ist es allein dies: daß es für den Menschen immer auch eine Notwendigkeit zu handeln gibt, daß dabei das gleiche Wechselverhältnis vorliegt, auf das wir in jeder Lebenssituation wieder treffen, und daß sich eine Erkenntnis immer erst dann bewahrheiten kann, erst dann lebendig und gültig wird, wenn wir sie mit unserer Existenz gleichsam überprüfen und belegen.
Nicht etwa, daß darin jede Diskrepanz überwunden und Ideal und Wirklichkeit zur Deckung gebracht werden müßten – im Gegenteil garantiert ja erst ihr Abstand unsere eigene Motivation. Entscheidend ist das Bemühen darum, unsere Sehnsucht, so leben zu können, wie wir es von ganzem Herzen wünschen, auch wenn wir ahnen, dabei niemals Vollkommenheit zu erreichen.
Der Polarität des Subjektiven und des Objektiven sei damit erneut durch die Anlage des Buches entsprochen, daß ich wiederholt betone und durch ganz persönliche Schilderungen verdeutliche, wie jeder mögliche Anspruch zunächst nur für mich gilt und ich lediglich daran glaube, daß bestimmte Erkenntnisse wegen einer allen Menschen gemeinsamen psychischen Grundkonstitution möglicherweise verbindende Gültigkeit gewinnen könnten.
Diese Funktion sollte der vierte Abschnitt vor allem übernehmen, indem er die persönlich gültigen Maximen anderen Individuen für ihre Lebenswirklichkeit zu übermitteln versucht, auf daß sie frei darüber verfügen. Und entsprechend wird auch der letzte Hauptteil am ausgeprägtesten eigene Erfahrungen mit dem Anruf an ein Du, das jeder andere Mensch sein kann, verknüpfen, werden die persönlichen Erlebnisse so ernst und wichtig genommen, damit gerade an ihnen unsere gemeinsame Sehnsucht aufscheint: die eigene Existenz mit dieser Welt zu versöhnen.
Das alles mag, so aufgeschrieben und ausgeführt, noch immer viel zu konstruiert und systematisch wirken – zumindest macht es auf mich selbst gelegentlich den Eindruck; wenngleich ich mir doch sicher bin, daß es umgekehrt auch als hoffnungslos wirr, chaotisch und unwissenschaftlich erscheinen wird. Ein solches Urteil faßte ich allerdings nur als Kompliment auf, dem erstgenannten Verdacht gegenüber kann ich nur immer wieder beschwörend einwenden, daß es das weder ist noch sein soll, entstand doch das »Gerüst« sehr spontan, sozusagen spielerisch, und versuche ich immer nur auszuführen, was die einzelnen Blickpunkte der Aufmerksamkeit in mir hervorbringen. Die dabei entstehende Ordnung bleibt immer auch ein Zufallsprodukt und kann nur relativ, niemals zwingend sein, so wenig wie sich ein Zusammenhang menschlichen Lebens am nächsten Tag noch mit genau denselben Worten wiedergeben ließe wie zuvor. Es sei denn, wir errichteten dafür bestimmte Kategorien, entwickelten ein Modell, ein Raster von Regeln und Begriffen, das wir anschließend der Wirklichkeit überstülpen: so etwas läßt sich gut auswendig lernen und paßt künftig bei jeder Gelegenheit. Und derartige Methoden sind ja tatsächlich immer wieder überaus erfolgreich gewesen, mit ihrer Hilfe stellte der Mensch Berechnungen an, konstruierte Maschinen, die funktionierten, und lernte allmählich die Natur zu beherrschen.
Doch ebenso begann er sie zugleich auszubeuten und zu zerstören, und nicht erst an dem zunehmenden Ausmaß ihrer Vernichtung ist zu begreifen, daß Leben kein starres System ist und der Mensch keine mathematische Formel, sondern ein Prozeß und eine Aufgabe, denen wir uns täglich aufs neue überlassen sehen, ohne wirklich wissen zu können, wie uns geschieht.
Und dennoch können wir das Geheimnis des Lebendigen erspüren, sobald wir als Antwort auf unsere drängenden Fragen nicht blind weitermachen, sondern innehalten und ihm nachzudenken versuchen. Nicht durch das Gitter einer konstruierten Logik, sondern indem wir ursprünglich zu philosophieren beginnen, indem wir anfangen zu staunen vor dem Wunder des Seins.
1. DIE KRÄFTE DER SEELE
»Seele« – wie läßt sich von etwas handeln, wieder einmal und immer noch, das so vieldeutig, konturlos und unbestimmt erscheint wie dieser Begriff. Und wie könnte das, wenn überhaupt, anders geschehen als allenfalls rekapitulierend und resümierend, das heißt im Blick auf die Unmenge der im Lauf der Zeit darüber entstandenen Auffassungen und Theorien.
Muß es nicht vollkommen müßig, ja obsolet erscheinen, sich heute noch derart allgemeinen und weitgesteckten Themen zuzuwenden, wäre es nicht viel sinnvoller, endlich einmal zu schweigen, sobald wir uns nicht genau und bestimmt über einen Sachverhalt auszudrücken vermögen, so wie es die Positivisten verlangt haben. Statt dessen hätten wir uns an das Gegebene zu halten, an die Empirie der Sinne; darüber lassen sich Aussagen treffen, ihre Wahrnehmungen sind mit Begriffen beschreibbar, so genau, daß andere später jederzeit wiedererkennen können, was gemeint ist. Wer aber wollte schon von sich behaupten, er wäre imstande »die Seele« zu sehen?
Nun, so leicht erledigt sich das Thema offenbar nicht, auch wenn ein solches Argument in seiner simplen Logik bestechend sein mag. Ein Verdrängen des Problems ist kein Ersatz für seine erhoffte Lösung, und selbst ein ausdrücklicher Nihilismus verrät in seinem Bekunden noch die Notwendigkeit von Wertfragen. Entscheidend ist die Tatsache, daß Menschen überhaupt und immer wieder Allgemeinbegriffe hervorgebracht haben, die gerade mitteilen sollten, was nicht genau nachvollziehbar, nicht abbildhaft wiederzugeben ist, sondern nur andeutungsweise zu umschreiben, sprachlich einzukreisen, bis zu einem Punkt, an dem begreiflich wird, daß die mögliche Wahrheit erst jenseits der Worte zu leben beginnt.
Dabei spielt die Wahl der Begriffe zunächst gar keine Rolle, mag von Traditionen, Kulturkreisen, Sprachfamilien abhängig sein und obendrein noch fortdauerndem Wandel unterworfen. Wesentlich ist allein das Bedürfnis, Zusammenhängen Ausdruck zu geben, Inhalten, von denen wir begreifen, daß sie in einem logischrationalistischen Gebrauch der Sprache, die so verkürzt nur eine intelligente Verlängerung unserer Sinnlichkeit bedeuten würde, niemals aufgeht.
Die Vokabeln der Philosophie aller Menschen und aller Zeiten haben immer schon dieselbe Sehnsucht nach der Wahrheit transportiert, wollten das Geheimnis des Lebens bezeugen, indem sie das Unaussprechliche zu sagen versuchten. In ihnen allein wurde die lebendige Wirklichkeit des Menschen überliefert, weil sie ihn nicht auf jene materialistische Präsenz in einer ebenso verstandenen Welt reduzierten.
Freilich schoß man häufig auch über das Ziel hinaus, erklärte die empirische Welt zum Schein und verlor sich in willkürlichsten Spekulationen. Und dazu mußte sich dann früher oder später fast zwangsläufig eine Gegenbewegung formieren, die nun ihrerseits entsprechend jede Metaphysik als Illusion auszugrenzen begann.
Im Grunde zieht sich durch die gesamte Philosophiegeschichte – und nicht nur durch deren ausdrückliche Zeugnisse, sondern eigentlich durch die Geistesgeschichte überhaupt – die beständige Auseinandersetzung, ja der Kampf zwischen diesen beiden Positionen einer rationalistisch-empirischen und einer idealistisch-metaphysischen Weltsicht. Zwar bildeten sich auch immer wieder Mischformen als Kompromißversuche, doch bei genauerem Hinsehen zeichnete sich auch darin stets die Verbindung zu einer von beiden Einseitigkeiten ab.
Entweder war der Mensch als reines Wesen der Natur begriffen, ganz in deren Gesetzlichkeit eingebunden, aber gleichwohl, wegen seiner überragenden Verstandesbegabung fähig, sie zu erkennen und zu beherrschen, um sich in ihr nützlich und komfortabel einzurichten; oder aber es galt allein der menschliche Geist als wesentlich, die unsterbliche Seele, die einer anderen als dieser sichtbaren Welt zugerechnet war, in der höchstens eine vorübergehende Kulisse gesehen wurde, vor deren Hintergrund es nur auf die Entdeckung ewiger Wahrheiten ankomme.
Doch dabei bleibt jeder Positionenkampf, jeder Schlagabtausch der Argumente, jedes wechselseitige Schwingen der Parolen von richtig und falsch, völlig unphilosophisch und stupide, ist doch das Nachdenken, das Ringen um Gewißheit in ihm längst abgebrochen, und stehen sich nur noch starre Ordnungen gegenüber, die um jeden Preis ihren vermeintlichen Besitz verteidigen wollen. Und das um so lauter und heftiger, je mehr wohl längst geahnt wird, daß im Grunde keinem mehr gehört als sein Leben.
Viel wichtiger ist deshalb die hinter den lauten, spektakulären Wortgefechten verborgene Ursache solcher Abläufe: die Gemeinsamkeit jener ehrgeizigen Unruhe, des Dranges recht zu haben, auf beiden Seiten, der, unabhängig von den vertretenen Standpunkten, immer wieder den Menschen antrieb und antreibt.
Die Reaktion als solche war zuerst immer lebendig, noch ehe sie sich ihrerseits zum System zu verhärten begann; in ihr erhob sich eine ursprüngliche Freiheit gegenüber drohender Bevormundung und suchte sich ihrerseits Geltung zu verschaffen.
Aber weil der dogmatische Anspruch jeweils so absolut vertreten wurde, zwang jede Seite die andere gleichsam in eine Notwehrsituation, forderte sie derart provozierend heraus, daß es in der Hitze aufeinanderprallender Emotionen nie möglich war, das Verbindende zu erkennen: sozusagen nie die »Medaille« der Sehnsucht selbst wahrzunehmen, sondern immer bloß die eigene Teilansicht für die ganze Wirklichkeit zu halten.
Ein so bildhafter Ausdruck soll dabei jedoch nicht suggerieren, daß sich nun etwa in der Addition beider Pole vollkommene Erkenntnis wie von selbst ergebe – das kann gar nicht das Ziel sein.
Dagegen liegt die einzige Chance, die Gewalt des Anspruchsdenkens zu überwinden, für alle Beteiligten darin, ihre gemeinsamen Antriebskräfte zu begreifen oder, um im Bild zu bleiben, einmal genau hinzusehen: denn das Wesentliche einer Medaille ist ihre Mitte, ihr Kern, ist das, was überhaupt erst die beiden Seiten trägt, was sie von einer bloß ebenen Fläche unterscheidet und ihre Mehrdimensionalität ausmacht, wie gering sie auch sein mag. Einer flüchtigen Draufsicht muß das verborgen sein, sie bleibt im wahrsten Sinn des Wortes oberflächlich, während sich erst dem Blick von allen Seiten, erst aus der »Seiten-Perspektive« auch Tiefe offenbaren kann.
Und zurückübersetzt heißt das: wenn das Leben als jene Medaille gilt, die wir betrachten, dann bedeutet unsere Existenz, die in jedem Augenblick der Betrachter bleibt, ihre Mitte und vermag gar nichts anderes zu sein, weil sie ja selber Leben ist.
Nur die Mitte weiß von den Polen, nur sie empfindet zugleich ihre Vorderseite und ihre Rückseite, die sie hat, ohne sie zu sein. Immer bleibt sie die Mitte. Immer bleibt sie das Leben, und immer ist sie unsere Sehnsucht, dieses Leben zu begreifen.