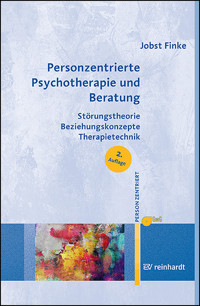28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Personzentrierte Beratung & Therapie
- Sprache: Deutsch
Innere Bilder sind vieldeutig, sie können Erlebnisinhalte symbolhaft verdichten und starke Gefühle hervorrufen. Das machen sich Personzentrierte Therapie und Beratung zunutze: Der Therapeut zeichnet Selbstdeutungen des Klienten empathisch nach und gibt ihm Impulse, seine "innere Welt" besser zu verstehen und Kraftquellen zu entdecken. Kenntnisreich bettet der Autor das Wissen über innere Bilder aus Traum- und Hirnforschung, Tiefenpsychologie, Märchenforschung u.a. in die Theorie des Personzentrierten Ansatzes ein. An zahlreichen Fallbeispielen werden praxisnah Methoden der personzentrierten Arbeit mit Bildern in Träumen, Märchen und Imaginationen vorgestellt. Ein Muss für alle, die das schöpferische Potenzial innerer Bilder therapeutisch nutzen wollen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Personzentrierte Beratung & Therapie; Band 11
Herausgegeben von der Gesellschaft fürPersonzentrierte Psychotherapie und Beratung e. V., Köln
Dr. med. Jobst Finke, Essen, ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie für Neurologie und Psychiatrie, Gesprächspsychotherapeut und tiefenpsychologischer Psychotherapeut. Er ist in der Ausbildung für tiefenpsychologisch fundierte und personzentrierte Psychotherapie tätig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-02974-7 (Print)
ISBN 978-3-497-60119-6 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61358-8 (EPUB)
ISSN 1860-5486
© 2020 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co. KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v § 44b UrhG einschließlich Einspeisung/Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.
Dieses Werk kann Hinweise/Links zu externen Websites Dritter enthalten, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich entfernt.
Printed in EU
Reihenkonzeption Umschlag: Oliver Linke, Hohenschäftlarn
Covermotiv unter Verwendung eines Werkes von Lioba Hartmann, München
Satz: Arnold & Domnick, Leipzig www.arnold-domnick.de
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
Einführung – Grundpositionen beim personzentrierten Arbeiten mit Bildern und Symbolen
1 Die „nicht bewusste organismische Existenz“ im Spiegel der Ideengeschichte und der personzentrierten Störungstheorie
1.1 Die personzentrierte Sicht unbewusster Phänomene
1.2 Das konzeptuelle und das organismische Selbst
2 Die Sprache der inneren Bilder
2.1 Das Bild als Ausdruck des organismischen Erlebens
2.2 Symbol und Zeichen
2.3 Die Vieldeutigkeit der inneren Bilder
3 Das personzentrierte Verstehen der inneren Bilder
3.1 Verstehen als Konsensbildung
3.2 Das Symbolverstehen im Sinne einer hermeneutischen Phänomenologie
Teil 1 – Personzentriertes Arbeiten mit Träumen
1 Die Sprache der Träume
2 Neurophysiologische und psychologische Charakteristika des Traums
3 Die Vielfalt der Träume
3.1 Durch formale Kriterien bestimmte Träume
3.1.1 Initialträume
3.1.2 Wiederholungsträume
3.1.3 Luzide Träume
3.2 Durch inhaltliche (thematische) Kriterien bestimmte Träume
3.2.1 Angstträume
3.2.2 Glücks- und Sehnsuchtsträume
3.2.3 Existenzielle Träume
3.2.4 Beziehungsträume
3.2.5 Alltagsträume
3.3 Die behandlungspraktische Bedeutung von Traumthemen
4 Die Bedeutung des Traumes in der Personzentrierten Psychotherapie
5 Das personzentrierte Traumkonzept
5.1 Das organismische Erleben als Quelle des Träumens
5.2 Das Selbst- und das Beziehungskonzept und die Selbstperspektive
5.2.1 Das Selbstkonzept und das Beziehungskonzept
5.2.2 Die Beziehungs- und die Selbstperspektive
5.3 Der Traum als Bühne der nicht bewussten organismischen Existenz
6 Die Funktionen des Traumes aus Sicht der Gesprächspsychotherapie
6.1 Die Problemlösungsfunktion des Traumes
6.2 Die stimmungs- und beziehungsregulierende Funktion des Traumes
6.3 Die Darstellungsfunktion des Traumes
6.3.1 Die Aktualisierung des organismischen Selbst
6.3.2 Die Aktualisierung des Selbstkonzeptes
6.4 Die ausgleichende, Ganzheit stiftende Funktion des Traumes
7 Personzentriertes Verstehen von Träumen
7.1 Der Traum als Rätsel
7.2 Das Vorverständnis des personzentrierten Verstehens
7.3 Klient und Therapeut als Experten des Traumverstehens
7.4 Ganzheit und Partikularität der Traumerzählung
8 Indikation der Arbeit mit Träumen
9 Praxis der Arbeit mit Träumen
9.1 Arbeiten auf der Imaginationsebene
9.1.1 Verdeutlichen und imaginatives Nacherleben der Traumbilder
9.1.2 Vergegenwärtigen und Wiederbeleben der Traumstimmung
9.1.3 Interaktion mit den Traumfiguren anregen
9.2 Arbeiten auf der Reflexionsebene
9.2.1 Aufgreifen der emotionalen und kognitiven Resonanz
9.2.2 Identifizieren und Differenzieren der Traumthemen
9.2.3 Interpretieren
9.3 Schematische Darstellung des personzentierten Traumverstehens
9.4 Beispiel einer Traumbearbeitung
9.4.1 Arbeiten auf der Imaginationsebene
9.4.2 Arbeiten auf der Reflexionsebene
9.4.3 Oszillieren zwischen Imaginationsund Reflexionsphase
9.5 Zusammenfassende Beurteilung eines Therapieverlaufes
10 Arbeit mit Träumen in der Gruppe
11 Resümee
Teil 2 – Imaginationen in der Gesprächspsychotherapie
1 Therapeutisches Arbeiten mit inneren Bildern
2 Indikation zum Arbeiten mit Imaginationen
3 Das psychotherapeutische Kommunizieren in Bildern und in Begriffen109
4 Die Imaginationen des Therapeuten als Mittel der Empathie
5 Klärungs- oder bewältigungsorientierte Zielsetzung bei der Arbeit mit Imaginationen
6 Methoden in der Arbeit mit Imaginationen
7 Themen der Imagination
7.1 Die Bedeutung des organismischen Erlebens für die Arbeit mit Imaginationen
7.1.1 Imagination zu einem Gefühl
7.1.2 Imaginationen zu einem Bedürfnis
7.2 Imaginationen zum Selbstkonzept
7.3 Imaginationen zum Beziehungskonzept – Die Beziehungs- und Selbstperspektive
7.4 Imaginationen zum Alter Ego
8 Bewältigungsorientiertes Arbeiten mit Imaginationen
9 Die Arbeit mit Imaginationen in der Gruppe
10 Resümee
Teil 3 – Personzentrierte Arbeit mit Märchen
1 Das Märchen in der Personzentrierten Psychotherapie
1.1 Strukturelle Ähnlichkeiten von Träumen und Märchen
1.2 Warum Arbeit mit Märchen in der Personzentrierten Psychotherapie?
1.3 Indikation der Arbeit mit Märchen
1.3.1 Anregung der Selbstexploration150
1.3.2 Vertiefung der Selbstexploration151
1.4 Narrative Charakteristika des Märchens
2 Die Praxis der Arbeit mit Märchen
2.1 Personzentriertes Verstehen von Märchen
2.1.1 Zentrale Märchenmotive und die Komplexität des Symbolverstehens
2.1.2 Auf den Klienten bezogenes Märchenverstehen
2.1.3 Die Symboldeutung häufiger Märchenbilder
2.2 Merkmale des therapeutischen Vorgehens
2.2.1 Einleitung der Märchenarbeit
2.2.2 Handlungsmuster für die personzentrierte Märchenarbeit
2.3 Fallbeispiele aus der Therapiepraxis
2.3.1 Befreiung aus depressiver Resignation: „Der Eisenhans“
2.3.2 Trennungsangst: Von der Mutterabhängigkeit zur Autonomie: „Die Gänsemagd“
2.3.3 Ein stützendes Alter Ego gegen Näheangst: „Aschenputtel“
2.4 Märchenarbeit in der Gruppe
3 Psychische Störungen im Spiegel von Märchenmotiven
3.1 Individuelle Störungsformen und Märchenmotive
3.1.1 Angst
3.1.2 Depression
3.1.3 Das „falsche Selbst“ und die Wege zur Selbstkongruenz
3.1.4 Von der Abhängigkeit zur Autonomie
3.2 Störungen in Paarbeziehungen
3.2.1 Die Kampfbeziehung: Machtanspruch und narzisstische Rivalität
3.2.2 Enttäuschte Beziehungserwartungen und Beziehungsvermeidung
3.2.3 Symbiose und einengende Verpflichtung
3.3 Familiäre Störungen und Konflikte
3.3.1 Rivalitätsbestimmter Mutter-Tochter-Konflikt
3.3.2 Inzestuöser Vater-Tochter-Konflikt
3.3.3 Mutter- und Vater-Sohn-Konflikt
4 Die therapeutische Weisheit des Märchens
4.1 Achtsamkeit und wertschätzende Weltbezogenheit
4.2 Ein hilfreiches Alter Ego aktivieren
4.3 Selbstvertrauen und Eigenwille aktivieren
5 Resümee
Epilog
Literatur
Sachregister
Märchenregister
Vorwort
Wenn in diesem Buch die personzentrierte Arbeit mit Imaginationen, Träumen und Märchen beschrieben wird, so werden hier drei psychotherapeutische Methoden versammelt, die unsere inneren Bilder, unsere meist stark optisch bestimmten Phantasien fokussieren. Der therapeutische Umgang mit diesen inneren Bildern, mit spontanen, geträumten oder erzählten Imaginationen ist also das leitende Thema dieses Buches. Dabei werden Imaginationen hier einmal als übergeordnetes Thema, als die Auseinandersetzung mit der Welt der inneren Bilder, sodann aber auch als spezifische Methode neben der Traum- und Märchenarbeit behandelt. Die Teile dieses Buches, die neben der theoretischen Abhandlung jeweils eine der drei Methoden behandeln, sind so angeordnet, dass jeder Teil weitgehend eigenständig ist und ohne Einhaltung einer Reihenfolge für sich gelesen werden kann.
Das Arbeiten mit Träumen, Imaginationen und Märchen wird hier als ein Vorgehen beschrieben, das den Rahmen eines genuin Personzentrierten Ansatzes nicht verlässt. Imaginations-, Traum- und Märchenarbeit sind zwar einerseits verfahrensübergreifende Methoden, die aber hier so modifiziert werden, dass ihre Anwendung als weitgehend verfahrensspezifisch gelten kann. Das hier zu erörternde therapeutische Vorgehen ist also konform mit personzentrierten Konzepten. Die Neuerung des hier zu Beschreibenden bezieht sich vor allem auf die Fokussierung bestimmter Inhalte, eben der Bilder der Imaginationen, der Träume und Märchen. Dabei soll der therapeutische Umgang mit diesen Bildern möglichst praxisnah und konkret dargestellt werden.
Bilder, Phantasie-, Traum- und Märchenbilder, sind immer dann auch als Symbole unseres Erlebens anzusehen, wenn sie emotional aufgeladen und so Träger einer oft vielschichtigen Bedeutung sind. Diese Symbole müssen verstanden werden, damit der Klient sich ihre Gehalte aneignen, sie in sein Selbstkonzept integrieren kann. Hierbei stellt sich die Frage, wie diese Aufgabe des Verstehens zwischen Klient und Therapeut aufzuteilen ist. Natürlich ist es nach personzentrierter Vorstellung zunächst der Klient, der seine Bilder verstehen soll. Es ist aber auch die Aufgabe des Therapeuten, dem Klienten im Prozess eines verstehenden Aneignens von Symbolbedeutungen behilflich zu sein. Muss er, um das leisten zu können, dem Klienten im Verstehen voraus sein? Welche Rolle soll die Perspektive, die Sichtweise des Therapeuten spielen, gerade auch dann, wenn sie von der des Klienten abweicht? Und wie sind gegebenenfalls beide Sichtweisen miteinander zu vereinbaren? Die Suche nach Antworten macht es nötig, in den folgenden Texten auch therapietheoretische Überlegungen anzustellen und nach der Stimmigkeit mancher diesbezüglich vertretener Positionen zu fragen.
Da hier eine Auseinandersetzung mit besonderen Inhalten wie Formen unseres Erlebens erfolgen soll, ist auch eine Beschäftigung mit der personzentrierten Persönlichkeits- und Störungstheorie notwendig. Dabei erscheinen manche dieser Aspekte hier in einem neuen Licht. Diese persönlichkeitstheoretischen Erörterungen werden im Wesentlichen jedoch nicht über die Konzeption von Rogers hinausgehen oder gar dieser widersprechen. Es werden nur einige Linien dieser Konzeption mit besonderer Akzentuierung deutlich gezogen.
Wenn hier von „therapeutisch“ oder „Therapie“ die Rede ist, so ist die Beratung immer mitgedacht. Zwar gibt es zwischen Therapie und Beratung Unterschiede in Zielen und Schwerpunktsetzungen, aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Je nach den besonderen Umständen einer Beratungssituation kann die Indikation, sich mit Imaginationen, Träumen und Märchen zu beschäftigen, auch zu diesen Gemeinsamkeiten gehören.
Auch gilt es, noch zwei terminologische Probleme zu klären. Das eine betrifft den Namen des hier in Rede stehenden Verfahrens, also ob es nun „Gesprächspsychotherapie“ oder „Personzentrierte Psychotherapie“ heißen soll. Zwar ist der letztgenannte Name dabei, sich zunehmend auch in Deutschland durchzusetzen. Jedoch gilt das vorerst nur für den internen Kreis der Vertreter dieses Verfahrens. Bei den Außenstehenden, die in Deutschland mit diesem Verfahren zu tun haben, etwa beim Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie, bei der Psychotherapeutenkammer, der Ärztekammer, dem Gesundheitsministerium und dem Gemeinsamen Bundesausschuss, gilt immer noch der Name „Gesprächspsychotherapie“. Da es erfahrungsgemäß schwer und eventuell auch risikobehaftet ist, ein Markenzeichen zu ändern, das sich sehr ins allgemeine Bewusstsein eingeschrieben hat, sollen hier beide Namen gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Die andere Frage betrifft die Genderproblematik bei der Rede von dem Therapeuten oder der Therapeutin bzw. dem oder der Klientin. In der Regel ist hier nur eine allgemeine, gewissermaßen überpersönliche Rollen- oder Funktionsbezeichnung intendiert. Die könnte man natürlich, da es keine Neutrumform gibt, ebenso gut in der weiblichen wie in der männlichen Form anzeigen. Ich habe die letztere gewählt, weil ich eben ein männlicher Therapeut bin und in vielen der hier aufgeführten Fallbeispiele jeweils auch der Therapeut war.
Ein Buch wie dieses entsteht nicht ohne Unterstützung von anderer Seite. So möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die direkt oder indirekt an dem Buch mitgewirkt haben. Sehr zu Dank verpflichtet bin ich Dr. Gerhard Stumm, der mit großer Intensität, Konsequenz und Gründlichkeit das Skript redigiert hat und dabei auch wertvolle Vorschläge zur Organisation und Struktur des Textes machte. Sehr herzlich möchte ich mich auch bei Dr. Beatrix Teichmann-Wirth bedanken für ihre kompetente Hilfsbereitschaft bei der Auseinandersetzung mit diesem Manuskript, für viele Anregungen und weiterführende Korrekturvorschläge. Mein ganz nachdrücklicher Dank gilt Dipl. Päd. Dagmar Hölldampf für ihr beherztes Engagement bei der Betreuung dieses Buches, für viele nützliche Gestaltungshinweise und für die aufwändigen Formatierungsarbeiten. Herrn Thomas Reckzeh-Schubert danke ich sehr für die Unterstützung dieses Projektes seitens der GwG. Zuletzt gilt mein ganz besonderer Dank meiner Frau, Dr. phil. Hannah Feldhammer, für viele formale und inhaltliche Anregungen, unermüdliche Korrekturarbeit und Gestaltungsvorschläge. Schließlich möchte ich dem Reinhardt Verlag und der GwG für die Inverlagnahme danken und Frau Dipl. Psych. Ulrike Landersdorfer vom Lektorat für ihre entgegenkommende Hilfsbereitschaft.
Essen, März 2013
Jobst Finke
Einführung – Grundpositionen beim personzentrierten Arbeiten mit Bildern und Symbolen
Mit Träumen, Imaginationen und Märchen wird bekanntlich in vielen Psychotherapieverfahren gearbeitet. Das Arbeiten mit Träumen war früher fast ein Synonym für die psychoanalytische Behandlungspraxis, und zwar sowohl für die Psychoanalyse im Sinne Freuds wie für die Jungs. Der Traum, gewissermaßen als Medium der Therapie, wurde dann auch von Verfahren der Humanistischen Psychologie aufgegriffen, so von der Gestalttherapie, der Daseinsanalyse, dem Psychodrama und seit fast 30 Jahren auch zunehmend von der Gesprächspsychotherapie. Die Arbeit mit Märchen und Imaginationen spielt vor allem in der Jung’schen Psychoanalyse eine Rolle, wobei die Arbeit mit letzteren über dieses Therapieverfahren hinaus heute bis in die Verhaltenstherapie sehr verbreitet ist. Die Arbeiten mit Träumen, Imaginationen und Märchen stellen also „verfahrensübergreifende Methoden“ dar (Stumm 2011a, 11), die dann jeweils verfahrensspezifisch modelliert werden. Dies bedeutet, bestimmte theoretische Positionen und Anwendungsmuster zu formulieren, die sich aus der gegenseitigen Bezogenheit von Methode (hier also die Arbeit mit Träumen, Imaginationen und Märchen) und der Persönlichkeits-, Störungs- und Therapietheorie des jeweiligen Verfahrens (hier also der Gesprächspsychotherapie) ergeben. Diese Positionen sollen einleitend erörtert werden, auch um zu zeigen, dass hier wesentliche Prämissen des Personzentrierten Ansatzes beachtet werden. Dabei ist in diesem Buch Imagination insofern einmal ein übergeordnetes Konzept, als ein Arbeiten mit inneren Bildern auch bei dem Umgang mit Träumen und Märchen eine zentrale Rolle spielt. Zum anderen ist hier „Imagination“ das Kennzeichen für eine spezifische Methode.
1 Die „nicht bewusste organismische Existenz“ im Spiegel der Ideengeschichte und der personzentrierten Störungstheorie
1.1 Die personzentrierte Sicht unbewusster Phänomene
Die Bilder des nächtlichen Traumes, aber manchmal auch des Tagtraumes, also des spontanen Imaginierens, haben es an sich, dass sie vom Träumenden nicht gewollt, von ihm nicht aktiv herbei gerufen sind, sondern dass sie ihm unbeabsichtigt erschienen sind, dass sie sich manchmal geradezu aufgedrängt zu haben scheinen. Das wirft die Frage nach unbewussten innerpsychischen Vorgängen und ihr Verhältnis zum Bewusstsein auf. Rogers charakterisiert die unbewusste und die bewusste Existenz der Person so: „Die Fähigkeit zum Gewahrsein und zur Symbolbildung kann man sich als die winzige Spitze einer riesigen Pyramide nicht bewusster organismischer Existenz vorstellen.“ (Rogers 1980 / 1981, 78). Die „nicht bewusste organismische Existenz“ nimmt nach Rogers also den weitaus größten Teil des Organismus ein. Dieser letztgenannte Begriff ist für Rogers die Metapher, die die Ganzheit der Person anzeigen soll (Wunderlich 2011). In der Rede vom Organismus kommt die Nähe des Denkens von Rogers zur Lebensphilosophie und zum Vitalismus zum Ausdruck (u. a. Nietzsche, Bergson, Driesch, Goldstein), die ihrerseits ihre Wurzeln zum Teil in der romantischen Naturphilosophie, vor allem eines Schelling, haben. Das bei letzterem zentrale Konzept eines ‚dynamischen Organismus‘ steht dort für die auf potenzielle Höherentwicklung angelegte Einheit von Natur und Geist (Gloy 1996). Und in diesem Sinne ist auch im Prinzip das Organismuskonzept bei Rogers zu verstehen. In der neueren Zeit sind zentrale Aspekte dieser Grundidee der romantischen Naturphilosophie im naturwissenschaftlichen Gewand der Systemtheorie wieder aufgegriffen worden.
Auch die Vorstellung von der nicht bewussten Existenz des Menschen geht auf die Romantik zurück. Ähnlich wie Rogers in der oben genannten Pyramiden-Metapher meint etwa Carus (1846 / 1975, 1), „daß der größte Theil des Seelenlebens in die Nacht des Unbewußtseins fällt.“ In Reaktion auf die Vernunftgläubigkeit der Aufklärung interessierten sich die Romantiker gerade für „das Andere der Vernunft“ (Böhme / Böhme 1996), für das von der Vernunft Ausgeschlossene, für die „Nachtseite“ des Menschen als das Reich des dunkel Ahnungsvollen, des geheimnisvoll Kreativen, des unberechenbar Spontanen, des irrational Widerständigen. Auch für Rogers ist die nicht bewusste organismische Existenz der Bereich des Schöpferischen, der Intuition, der Inspiration und einer quasi instinkthaften Klugheit (Stumm / Kriz 2003), was sich u. a. zeigt, wenn er sagt, „dass sein [des Menschen] totaler Organismus klüger als sein Bewusstsein sein könnte und es oft ist“ (Rogers 1961 / 1973, 191).
Es wurde oben schon angedeutet, dass auch die Vertreter der romantischen Naturphilosophie, analog zum Konzept der Aktualisierungstendenz bei Rogers, dem „dynamischen Organismus“ die Tendenz zur Selbstorganisation zuschrieben: „Die Organisation [des Organismus’] aber producirt sich selbst, entspringt aus sich selbst, …“ (Schelling 1797 / 1995, 130). Ähnlich wie bei Rogers wurde auch hier eine Tendenz des Organismus zur ständigen Entfaltung, Ausdifferenzierung und Höherentwicklung postuliert. Hier besteht also eine geistige Nähe von Rogers zu Denkern, die zwar in den USA durch Emerson (1836 / 1981) bekannt gemacht wurden, die Rogers aus eigener Lektüre aber vielleicht kaum kannte.
Die Konzeption der ständigen Weiter- und Höherentwicklung des Organismus’ erfuhr jedoch Widerspruch von einem Denker, der mit seinem Werk zwar zeitlich ebenso der Epoche der Romantik angehörte, aber dennoch ein Gegenkonzept entwarf: Schopenhauer. Auch bei Schopenhauer (1819 / 1998) gibt es eine den Menschen mehr unbewusst als bewusst bewegende Kraft, nämlich den Willen. Dieser Wille Schopenhauers ist aber weder eine bewusste Intention, noch verfolgt er das Ziel konstruktiver Selbstentfaltung. Er ist vielmehr ein blinder Drang, ein bewusstloser Überlebenswille, ein änderungsloser, immer gleicher Lebenstrieb, ein dumpfes, subjektloses Treiben. Dieser instinkthaften und stupide wirkenden Kraft ist der Mensch ausgeliefert und er wird von ihr getrieben, egoistisch zu sein und ebenso fremd-wie letztlich auch selbstzerstörerisch zu wirken. „Wille“ und „Vorstellung“ sind unaufhebbar divergent, die Idee personaler Ganzheit als Einheit von Natur und Geist ist eine Illusion, die zu Selbsttäuschung führt. Schopenhauer stellte so gewissermaßen das Konzept der romantischen Naturphilosophie auf den Kopf, er kreierte eine Art Aktualisierungstendenz mit umgekehrtem, also negativem, Vorzeichen.
Diese Grundkonzeption findet sich bekanntlich im eher pessimistischen Menschenbild Freuds wieder, der anfänglich sogar die Begrifflichkeit Schopenhauers übernahm, indem er die Abwehrkräfte „Wille“ nannte und die libidinösen Strebungen „Gegenwille“ (Schöpf 1993). So stünden sich also Rogers und die romantische Naturphilosophie einerseits sowie Freud und die Philosophie Schopenhauers andererseits gegenüber. Beide konzipieren, jeweils beeinflusst von der Lebensphilosophie, in ihrem Menschenbild eine Art Lebenskraft. Der eine mit optimistischem, der andere mit pessimistischem Vorzeichen.
Vor dem Hintergrund der hier bedeutsamen Grundthematik, nämlich dem gewissermaßen Bilder produzierenden Unbewussten, wäre in diesem Zusammenhang auch Jung (1989) zu nennen. Er steht, vor allem auch hinsichtlich seiner Konzeption des Unbewussten als eines Bereiches des nicht nur Abgewehrten, sondern vor allem des Kreativen und des prärationalen Wissens, im Vergleich zu Freud eher auf Seiten von Rogers und den Romantikern. Allerdings weist er stärker als Rogers auch auf die möglichen Gefahren der unbewussten Existenz hin, sofern diese nicht integriert wird.
Die oben genannte nicht bewusste organismische Existenz ist zwar für Rogers (siehe auch Rogers 1951 / 1973, 418 f; 1977, 121) ein Bereich des unbewussten oder manchmal höchstens dunkel empfundenen Fühlens und Sehnens, auch des Instinkthaften, der Intuition und der kreativen Phantasie. Rogers spricht aber in substantivischer Form lediglich von „dem“ Bewusstsein (er gebraucht dabei die beiden Termini Bewusstsein, „consciousness“, und Gewahrsein, „awareness“, jeweils in einem synonymen Sinne), nicht jedoch in gleicher Weise von „dem“ Unbewussten. Vermutlich, so lässt sich aus vielen anderen Äußerungen schließen, wollte er damit zum Ausdruck bringen, dass aus seiner Sicht „das Unbewusste“ kein gegen das Bewusstsein strikt abgegrenzter Bezirk und keine per se eigenständige Instanz ist, sondern dass es fließende Übergänge von bewussten zu unbewussten Phänomenen gibt (eine Position, die auch von neueren Ausrichtungen der Psychoanalyse geteilt wird, s. Mertens 2011). Sehr wohl aber beschreibt Rogers unbewusste Phänomene in adjektivischer Form. Vielfach weist er auf unbewusste Bereiche menschlichen Lebens hin. So besteht die Pointe des Inkongruenzmodells gerade in der Annahme nicht bewusster Aspekte des organismischen Selbst. Diese mit dem konzeptuellen Selbst nicht vereinbaren Aspekte werden hier nicht symbolisiert bzw. verleugnet („denial of perception“) und sind deshalb vom Gewahrsein bzw. vom Bewusstsein ausgeschlossen (Rogers 1959 / 1987, 29). Auch seitens der experimentellen Psychologie gelten übrigens unbewusste Phänomene, die das Entscheiden und Verhalten des Menschen beeinflussen, längst als nachgewiesen (Höger 2006). Für Rogers ist nun, wie oben schon angedeutet, die nicht bewusste organismische Existenz keinesfalls nur der Abwehr (Rogers 1959 / 1987, 30) geschuldet. Vielmehr ist für ihn das organismische Selbst schon wegen der Unerschöpflichkeit seiner emotionalen und kreativen Potenz primär weitgehend nicht bewusst. Hier zeigen sich die schon genannten inhaltlichen Parallelen zu dem Konzept des Unbewussten bei Jung (im Unterschied zu Freud, der Unbewusstes vor allem als Abgewehrtes thematisierte). Dabei ist hier allerdings nur vom individuellen Unbewussten die Rede, denn Rogers hat nichts konzipiert, das dem archetypischen Unbewussten Jungs (1989) entspräche. Das muss freilich die Annahme kulturell vermittelter kollektiver Erlebensformen und -gehalte, ob unbewusst oder bewusst, keinesfalls ausschließen.
1.2 Das konzeptuelle und das organismische Selbst
Die Bilder der Träume, aber auch der Tagträume und in gewisser Hinsicht sogar der Märchen sind vielschichtig und scheinen oft einen Doppelsinn zu haben. Die Begründung dieses Doppelsinns kann man im Inkongruenzmodell der Personzentrierten Psychotherapie sehen.
Hier beschreibt Rogers (1959 / 1987, 29) eine Unvereinbarkeit von Selbstkonzept und organismischer Erfahrung und damit auch die Möglichkeit des Selbstwiderspruches einer Person bzw. der Doppeldeutigkeit ihrer expliziten und impliziten Botschaften. Der Gegenstand dieser organismischen Erfahrung bzw. besser übersetzt, dieses organismischen Erlebens, dasjenige, das hier erfahren bzw. erlebt wird, ist das organismische Selbst oder die schon genannte „nicht bewusste organismische Existenz“ (Rogers 1980 / 1981, 78). Diese ist übrigens, wie Rogers andeutet, insgesamt unauslotbar und kann so grundsätzlich nur partiell erfahren werden.
Im Folgenden ist diese nicht bewusste organismische Existenz gemeint, wenn wir von dem organismischen Selbst sprechen (Weinberger 1998, Stumm 2011b). Mit diesem organismischen Selbst ist also nicht der Organismus als Ganzer, sondern nur seine unbewusste Seite gemeint. Die so genannte organismische Erfahrung (organismisches Erleben) ist gewissermaßen der subjektive Aspekt des organismischen Selbst und jener Teil, der am ehesten „am Rande der Gewahrwerdung“ (Rogers 1977, 21; Spielhofer 2001) auftaucht. Im Inkongruenzmodell steht dem organismischen Selbst das konzeptuelle Selbst, also das Selbstkonzept, gegenüber.
Im normalen Falle können bisher nicht bewusste Selbstanteile, Gefühle und Bedürfnisse zunehmend voll bewusst werden und sie werden dann mehr oder weniger in das Selbstkonzept bzw. das konzeptuelle Selbst integriert, wodurch dieses dann eine Änderung und zunehmende Erweiterung erfährt. Es sind also fließende Übergänge vom organismischen Selbst zum konzeptuellen Selbst anzunehmen. Im Falle ausgeprägter Inkongruenz bzw. der neurotischen Störung sind diese fließenden Übergänge aufgrund der Starrheit, d. h. der Strukturgebundenheit des konzeptuellen Selbst unterbrochen oder zumindest erschwert und störungsrelevante Gefühle und Bedürfnisse können nicht ohne Weiteres voll bewusst werden, sondern sie kommen nur bis an den Rand der Gewahrwerdung. Da sie mit dem konzeptuellen Selbst unvereinbar sind, werden sie gar nicht oder nur verzerrt symbolisiert (Rogers 1959 / 1987, 31).
Dies hat seinen Grund in der Prägung des Selbstkonzeptes durch fremde Normen und Werte, die die Person aufgrund der „Bewertungsbedingungen“ der meist elterlichen Bezugspersonen verinnerlicht hat (Rogers 1951 / 1987, 50 f). Da unter diesen Bedingungen Erfahrungen aus dem eigenen Inneren, aus dem organismischen Selbst als inakzeptabel zurückgewiesen, d. h. nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr symbolisiert oder nur verzerrt symbolisiert werden, ist das konzeptuelle Selbst sich selbst entfremdet. Es ist gewissermaßen das „falsche Selbst“, das um den Preis der Übereinstimmung mit gesellschaftlichen und familiären Vorgaben und Normen den Kontakt zum „wahren“, zum wirklich eigenen Selbst verloren hat (Rogers 1961 / 1973, 89 / 121). Es sei hier auf Parallelen dieser Konzeption zu bestimmten Aspekten der Existenzialphilosophie Heideggers hingewiesen. Es wird dort ein „Verfallensein an das ‚man‘“, d. h. an das, was ‚man‘ sagt und ‚man‘ tut, als „Uneigentlichkeit“ der „Eigentlichkeit des Selbstseins“ gegenübergestellt (Heidegger 1963, 184 ff).
Ergänzend sei gesagt, dass solche Gegenüberstellungen wie das „falsche und das wahre Selbst“ in dieser Einseitigkeit Modellvorstellungen sind, die nur innerhalb eines bestimmten Kontextes ihre Gültigkeit haben, um wie hier z. B. psychopathologische Sachverhalte anschaulich zu machen. Auch das „wahre Selbst“ ist natürlich kein solipsistisches Selbst, das alles nur in sich selbst entdeckt, nur aus sich selbst gebiert, sondern es ist auch in seinem authentischen Meinen, Werten und Erleben immer schon geprägt von vielschichtigen kulturellen und sozialen Einflüssen und es verdankt, im positiven Falle, auch solchen Einflüssen die Möglichkeit konstruktiver Entwicklung und Entfaltung (Galliker 2011). Der Mensch ist eben, so auch die Humanistische Psychologie, primär ein soziales und vergesellschaftetes Wesen. Das aber schließt andererseits die Möglichkeit kritischer Stellungnahmen gegenüber der eigenen Sozialisation und den entsprechend verinnerlichten Normen und Werten im Dienste der Autonomie nicht aus.
Im Falle der Inkongruenz können in besonders herausfordernden Situationen „organismische Erfahrungen“ immer wieder als implizites, also dunkel erahntes, unterschwellig gespürtes Bedeutungserleben (Wiltschko 2002) am „Rande der Gewahrwerdung“ auftauchen, und den Klienten unter ängstliche Spannung setzen (Rogers, 1959 / 1987, 30). Solche Gefühle und Bedürfnisse müssen natürlich ein zentrales Thema der Arbeit mit Träumen und Imaginationen sein, mit dem Ziel, das Implizite zunehmend zu explizieren, also bewusst zu machen. Dabei ist das organismische Selbst gewissermaßen der geheime Adressat, wenn der Therapeut den Klienten zu einem Gefühl oder Bedürfnis imaginieren lässt. Der Therapeut intendiert hier, den Klienten in der Unmittelbarkeit und unverfälschten Ursprünglichkeit der impliziten Gehalte seines Erlebens zu erreichen.
Gefühle und Wünsche, die einigermaßen akkurat symbolisiert, also bewusst wahrgenommen werden, weisen oft auf andere implizite Gefühle und organismische Bedürfnisse hin, die also noch nicht in deutlicher Bewusstheit wahrgenommen werden. So kann z. B. ein Gefühl von Ärger oder Wut auf das nur vage oder gar nicht eingestandene Bedürfnis nach Anerkennung oder Abgrenzung hinweisen. Das Gefühl von Angst etwa kann ein Zeichen für das bedrohte, aber kaum symbolisierte Bedürfnis nach absoluter Sicherheit und uneingeschränkter Geborgenheit sein und überhaupt für Bedürfnisse, die in sehr massiver Weise das Selbstkonzept bedrohen.
Viele Bilder in Imaginationen, Träumen und Märchen können in sehr spezifischer Hinsicht als Äußerungsformen des organismischen Selbst gelesen werden. Dabei sind durchaus verschiedene Aspekte, verschiedene Bereiche des organismischen Selbst anzunehmen.
Das organismische Selbst lässt sich z. B. zu einem zentralen Topos in der Mythologie in Beziehung bringen, gemeint ist das Verhältnis von Tiefe und Höhe, von Erde und Himmel. In der griechischen Mythologie (Parallelen dazu gibt es auch in anderen Mythologien wie z. B. das Yin Yang Prinzip oder auch die natürlich auf die Antike rekurrierende Vorstellung Nietzsches vom Dionysischen und Apollinischen Prinzip) wird die chthonische Götterwelt der olympischen gegenüber gestellt. Zu der ersteren gehören die Götter bzw. die Göttinnen des dunkel Erdhaften, der Fruchtbarkeit, des Rausches, des Trieb- und Instinkthaften, auch des mütterlich Bergenden und des dunklen Wissens und Ahnens um das Geheimnis des Lebens. Die olympischen Götter dagegen vertreten das Himmlische. Sie stehen für die Hellsicht der Vision, der Eingebung der Inspiration und die Weisheit der Intuition. Sie repräsentieren die Klarheit und die Ordnung der Dinge. Man hat im Chthonischen auch das weibliche Prinzip gesehen, die Welt der Mütter bzw. der Muttergottheiten, und im Olympischen das männliche Prinzip bzw. die Welt der Väter, also das Symbol des Patriarchats (Fromm 1982).
Wir können beide Welten auch als zwei Seiten des organismischen Selbst verstehen. Diese werden in Mythen und Märchen oft in typischen Bildern symbolisiert. Die Welt des Erdhaften, des Chthonischen kann man in der Tiefe eines Sees und des Meeres, eines Brunnens oder eines dunklen Waldes versinnbildlicht sehen. Die Welt des Himmlischen, des Olympischen würde sich dann in der oft als fast uneinnehmbar beschriebenen Höhe eines Berges (z. B. der in Märchen häufig erwähnte Glasberg) oder eines hohen Turmes, eventuell auch eines einsamen Schlosses ausdrücken. Es lassen sich natürlich noch andere Kategorien und Symbolbildungen bei der Beschreibung der verschiedenen Aspekte des organismischen Selbst denken. In jedem Falle scheint ihr harmonisches Zusammenwirken und ihre prinzipielle Zugänglichkeit zum Selbstkonzept für eine konstruktive Ausrichtung wichtig zu sein. Mögliche destruktive Entwicklungen sind aus der Lebenspraxis nur allzu bekannt. Diese „dunkle“ Seite des Organismischen wurde von Rogers vielleicht zu wenig ausdrücklich thematisiert. Das positive Menschenbild des Personzentrierten Ansatzes scheint es nahezulegen, vor allem den konstruktiven Aspekt der nicht bewussten organismischen Existenz des Menschen zu betonen und dabei die mögliche andere Seite dieser Existenz manchmal vielleicht zu wenig zu fokussieren.
2 Die Sprache der inneren Bilder
2.1 Das Bild als Ausdruck des organismischen Erlebens
Imaginationen, Träume, Märchen, die mit diesen Begriffen gemeinten Phänomene gehören eng zusammen. Es geht um das Reich unserer Phantasien, unserer mehr oder weniger bildhaften Vorstellungen, in denen sich unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche, aber auch unsere Ängste und Sorgen spiegeln. Imaginationen und Träume sind individuelle Phantasien, die sich in Tagträumen zeigen oder eben im Schlaf. Märchen dagegen basieren auf kollektiven Phantasien, durch die individuelles Wünschen und Sehnen jeweils sehr stark angesprochen wird.
In der Personzentrierten Psychotherapie hat die Welt des Phantasmatischen insofern immer eine gewisse Rolle gespielt, als Rogers forderte, dass der Therapeut in der „inneren Welt des Klienten mit ihren ganz privaten, personalen Bedeutungen zu Hause ist“ (Rogers 1977, 20). Diese innere Welt ist eben in besonderer Weise auch die Welt der Imaginationen, der Träume, der Wunsch- wie der Schreckensphantasien. Diese sich meist in bildhaften Szenen darstellenden Phantasien sind etwas sehr Persönliches, das meist auch kaum Eingang in unsere Alltagskommunikation findet.
Mit der Methode des Imaginierens musste sich die Personzentrierte Psychotherapie zumindest indirekt schon immer befassen, da der Therapeut beim einfühlenden Verstehen die innere Welt des Klienten zunächst imaginieren muss, d. h. sie sich imaginativ konstruieren muss, um den Klienten einfühlend verstehen zu können. Außerdem soll der personzentrierte Therapeut ja den Klienten in seinen persönlichsten Vorstellungen und Gefühlen verstehen. Und diese innere Welt ist im besonderen Maße auch eine Welt des Imaginären, d. h. der oft sehr subjektiven Deutungen, Bewertungen, Ahnungen, Überzeugungen, Empfindungen und Vorstellungen. Im Folgenden soll diese Welt in systematischer Weise Gegenstand der Erörterung sein.
Obwohl sich die Personzentrierte Psychotherapie schon in ihren Anfängen als ein auf die Unmittelbarkeit des Erlebens zentriertes Verfahren versteht, haben sich innerhalb ihres Ansatzes Methoden entwickelt, die dieses erlebenszentrierte und erlebensaktivierende („experientielle“) Moment noch stärker betont wissen wollen, so eben das Focusing und die Emotionsfokussierende Therapie. Auch die personzentrierte Arbeit mit Imaginationen, Träumen und Märchen will in diesem Sinne verstanden werden. Dieser Anspruch scheint besonders dann gerechtfertigt, wenn das imaginative Element in der Arbeit mit Träumen und Märchen eine starke Rolle spielt. Im Folgenden soll dies begründet werden.
Bei der Imagination im Wachzustand, also beim Tagtraum, ebenso beim nächtlichen Traum, aber auch in kollektiven Gestaltungen unserer Phantasie, wie etwa dem Märchen, spielt das Erleben in Bildern, d. h. spielen stark optisch bestimmte Vorstellungen eine große Rolle (auch Märchen rufen durch die Art ihres Beschreibens stark optisch geprägte Phantasien in uns wach). Und gerade das macht das therapeutische Arbeiten mit Träumen, Imaginationen und Märchen so bedeutsam. Denn charakteristisch für ein Vorstellen und Denken in Bildern ist die Nähe der Bildsprache zum ursprünglichen Erleben, wir können auch sagen zur organismischen Erfahrung bzw. zum organismischen Erleben (so würde man Rogers hier treffender übersetzen). Bilder stehen in einer besonderen Nähe zu Gefühlen. Bilder rufen Gefühle wach und Gefühle drücken sich in Bildern unmittelbarer aus als in Begriffen. Gefühle verleihen Bildern einen Sinn, d. h. sie verweisen in Bildern auf einen emotional-interaktiven Zusammenhang (Klemm 2003, Hammer 2005). Und genau dadurch wird ein Bild zum Symbol, d. h. ein Bild ist dann ein Symbol, wenn es zu einem vielschichtigen Bedeutungsträger geworden ist.
In den Bildern, also in den vorwiegend optisch bestimmten Szenarien der Imaginationen und Träume spricht sich das Persönliche und das sehr Private aus. Hier kommt aber auch das zur Sprache, was einerseits als Folge der Inkongruenz im Selbstkonzept weniger oder gar nicht abgebildet ist bzw. nur verzerrt symbolisiert wird und so der Selbstwahrnehmung nur eingeschränkt zugänglich ist. Zum anderen wird in diesen Bildern aber auch jenes Organismische angesprochen, das einfach wegen seiner Unermesslichkeit (und nicht nur als Folge der Abwehr) höchstens ansatzweise bewusst ist. Diese kaum symbolisierten Aspekte des organismischen Selbst (vor allem Gefühle, aber auch Wünsche, Vorstellungen) zeigen sich in ihrer Bedeutungsfülle eher in Bildern, in bildhaften Phantasien, als in der Sprache der Begriffe. Ihre „exakte Symbolisierung“, die für Rogers ein wichtiges Therapieziel darstellte (Rogers 1959 / 1987, 24), ist zwar nur in der lexikalischen Sprache, genauer in sprachlichen Sätzen möglich, da Bilder immer vieldeutig sind und insofern einen Sachverhalt nie in eindeutiger Exaktheit darstellen können. Aber Bilder bringen komplizierte emotional-motivationale Sachverhalte wegen ihrer Vielschichtigkeit und auch ihrer Anschaulichkeit eher unmittelbar zum Ausdruck als Begriffe bzw. als an die sprachliche Syntax gebundene Sätze. Bilder operieren gewissermaßen unterhalb der rationalen Denkschicht, wie sie von der diskursiv organisierten lexikalischen Sprache vertreten wird. Es geht also beim Vorstellen und Denken in Bildern um ein Freilegen dieser vordiskursiven Schicht im Erleben der Person. Deshalb sollte der Therapeut den Metaphern in Klienten-Äußerungen mit Wohlwollen begegnen und seinerseits öfter in anschaulichen Sprachbildern intervenieren (Oberlechner 2005, Schmitt 2019).
Die lexikalische Sprache, also das Sprechen in Begriffen und Sätzen, ist im Gegensatz zur Bildsprache durch ihre Syntax an feste logische Regeln gebunden, denen sich die sprechende Person unterwerfen muss. Sie bringt sprechend ihr Erleben nur in einer eng vorgegebenen, diskursiv strukturierten Form zum Ausdruck. Schon dadurch geht Manches von der individuellen Eigenart, Komplexität und Bedeutungsfülle dieses Erlebens verloren. Hinzu kommt, dass Sprache implizit auch von den Weltdeutungen, Normen, Lebensentwürfen und Verhaltensanweisungen der jeweiligen Sprachgemeinschaft geprägt ist. Durch den Spracherwerb und den Sprachgebrauch werden diese von dem Mitglied dieser Gemeinschaft übernommen (Lorenzer 2002). Da über diesen Weg Werthaltungen und Lebensentwürfe indirekt vermittelt werden, erscheinen sie der jeweiligen Person oft wie notwendig, selbstverständlich und unbezweifelbar. Erlebensinhalte, die mit diesen Normen und Haltungen nicht vereinbar sind, bleiben unsagbar, können nicht zur Sprache kommen, oder dies nur in verzerrter Form. Im Bild, d. h. in spontanen bildhaften Vorstellungen, können demgegenüber ursprüngliche, individuelle wie kollektive Erlebensmuster, quasi archaische Gefühle und Intentionen unmittelbarer und unverfälschter dargestellt werden. Daraus ergibt sich der Wert eines therapeutischen Arbeitens mit bildhaften Äußerungen unserer Psyche.
2.2 Symbol und Zeichen
Aber was meint hier „Symbolisierung“ und was ist hier ein Symbol? Unter den verschiedenen Symboltheorien gibt es solche, für die Symbol und Zeichen (im semiotischen Sinne) synonyme Begriffe sind, beide bezeichnen etwas. Sie weisen als Stellvertreter (Repräsentanten) eines anderen auf dieses Andere (z. B. eine Anweisung oder Sachaussage) hin. Das Bezeichnete (Signifikat) und das Bezeichnende (Signifikant) befinden sich dabei auf unterschiedlichen Realitätsebenen (über die verschiedenen Ebenen des Verhältnisses von Zeichen und Bezeichnetem (siehe Saussure 1916 / 1967). Die Position einer Gleichsetzung von Symbol und Zeichen hat wohl auch Rogers vertreten, wenn er die exakte bzw. die akkurate, also die begriffliche Bezeichnung, eine Symbolisierung nannte.
Für eine Psychotherapie, die sich mit Imaginationen, Träumen und Märchen befasst, dürfte es jedoch heuristisch fruchtbarer sein, jenen Theorien zu folgen, die zwischen einem Zeichen als einem präzisen Kennzeichen und einem Symbol einen Unterschied sehen. Das unterscheidende Kriterium ist dabei die Exaktheit, die Eindeutigkeit. Im Gegensatz zum reinen Zeichen als einem eindeutig geregelten Code, also z. B. einem Verkehrszeichen, dem Logo einer Firma oder eben einem sprachlichen Zeichen in Form eines Begriffes, ist demnach ein Symbol mehrdeutig, vielschichtig und insofern in seiner Bedeutung kaum ganz ergründbar. Ein Symbol ist sozusagen „ein allegorisches Zeichen, das einen zu entschlüsselnden, hintergründigen Sinn verbirgt“ (Plümacher 1999). Deswegen rührt ein Symbol auch an Tiefenschichten des Erlebens und wird oft emotional bewegend wirken. Wenn wir in einem Gegenstand oder seinem Abbild ein Symbol sehen, so werden wir, wenn wir es auf uns wirken lassen, emotional angesprochen. Etwas in uns gerät in Bewegung. Ob dies angesichts universeller bzw. kollektiver Symbole tatsächlich geschieht, hängt auch von der Einstellung des Betrachters und dem Kontext ab, in dem das Symbol einer Person begegnet. Ein Beispiel dafür wäre ein weihnachtlich geschmückter Tannenbaum oder das christliche Kreuz. Besonders das letztere kann, eben kontextabhängig, allerdings auch als bloßes Zeichen fungieren, etwa als rotes Kreuz auf dem Krankenwagen, als eisernes Kreuz auf einem deutschen Militärfahrzeug oder als Hinweis auf einen Friedhof oder eine Kirche im Stadtplan. Anders ausgedrückt: Auch primär „echte“ Symbole können ihren hintergründigen, emotional bewegenden Sinn in einem bestimmten Kontext so weit verlieren, dass sie zu reinen Zeichen werden.
Ist jedes Phantasiebild auch ein Symbol? Das hängt von der emotionalen Aufladung des Bildes ab. Bei einem spürbar emotional bewegenden Bild dürfen wir auch von einer hohen Bedeutungsdichte dieses Bildes ausgehen und insofern ist es ein Symbol. Vielleicht ist es nur ein individuelles, nur für diesen Betrachter gültiges Symbol. Wenn in uns selbst spontan ein Bild auftaucht, besonders wenn dies nicht absichtsvoll, sondern unwillkürlich geschieht und dieses Bild dabei nicht nur recht flüchtig ist, so können wir es häufig als symbolische, d. h. mit Bedeutung aufgeladene Darstellung einer bestimmten Problemlage verstehen. Es kann sich hier sogar um eine Darstellung der Tiefenschichten des organismischen Selbst handeln.
2.3 Die Vieldeutigkeit der inneren Bilder
Das Bild ist, anders als die Sätze einer den Regeln der Syntax folgenden Sprache, vieldeutig, und daher wird es in diesem Zusammenhang als Symbol bezeichnet, es symbolisiert einen komplexen Sinngehalt. In einem einzigen Phantasiebild können sich mehrere Bedeutungsgehalte verdichten. Bilder sind insofern ikonische Zeichen für komplexe Inhalte. Bilder, hier gemeint als spontane bildhafte Vorstellungen, können solche Inhalte aber nicht nur verdichten, sie können auch im Gegenteil gewissermaßen fragmentieren, indem sie nur einen bestimmten Aspekt eines Erlebenszusammenhanges bzw. einer Problemkonfiguration quasi isoliert darstellen und so in mehrere Bilder aufspalten.
Weil Bilder keine eindeutig abgrenzbaren Merkmale bestimmen, weil ihre Teile und ihr Ganzes unauflösbar verschränkt sind, sind sie zwar unexakt und mehrdeutig, aber auch offener für jene unterschwelligen Inhalte, die im Bedeutungshof eines bestimmten Erlebens liegen (Soldt 2005). Die nicht bewusste organismische Existenz drückt sich deshalb primär in Bildern aus. Wir können in der Sprache der Neuropsychologie auch sagen, dass beim Bilderleben vor allem unsere rechte, beim Denken in Begriffen aber die linke Hirnhälfte aktiviert ist. In ganz besonderer Weise gilt das Letztgesagte für Traumbilder, aber auch für Bildsequenzen von Tagträumen in einem sehr entspannten Zustand. Für das therapeutische Gespräch ist zu beachten, dass es auch ein Sprechen in Bildern gibt, nämlich dann, wenn die Sprache sehr reich an Metaphern ist. Metaphorische Sprache drückt einen Sachverhalt meist nicht sehr exakt, sehr präzise, dafür aber sehr facettenreich, d. h. vieldeutig und sehr nahe an der Fülle des Erlebens aus.
Aus dieser Vielschichtigkeit imaginierter Bilder folgt die Schwierigkeit, sie genau zu verstehen, d. h. ihre Botschaft durch Überführung in die Begriffssprache begreifbar zu machen, ohne ihre Aussagen zu verkürzen oder fehlzuinterpretieren. In der Therapie kommt es deshalb darauf an, in einem Prozess hermeneutischer Konsensbildung zwischen Therapeut und Klient diese Botschaft, diesen Sinn der Bilder gemeinsam so zu entziffern, dass immer Offenheit gegenüber anderen Möglichkeiten des Verstehens bleibt. Im Folgenden soll der therapeutische Umgang mit solchen Bildern gezeigt werden. Es soll deutlich werden, wie mit den Bildern unserer Imaginationen, Träume und Märchen personzentriert gearbeitet werden kann.
3 Das personzentrierte Verstehen der inneren Bilder
3.1 Verstehen als Konsensbildung
Der Bedeutungsüberschuss von imaginierten Bildern macht sie zu Symbolen in einem auch für die Psychotherapie interessanten Sinne. Wenn vom Klienten imaginierte oder geträumte bildhafte Symbole insofern mehrdeutig und vielschichtig sind, heißt das auch, dass sie rätselhaft sind. Psychotherapeutisch besteht die Aufgabe, diese Vieldeutigkeit zu verstehen und das wiederum heißt, sie in eine eindeutige, exakte Symbolisierung zu bringen, sie in eine begriffliche Sprache zu überführen. Denn nur mittels von Begriffen können wir begreifen, können wir einsehen, können wir im vollen Sinne des Wortes verstehen. Allein was wir derart verstanden haben, können wir in unser Selbstkonzept integrieren. Andererseits ist es für eine bildhafte Symbolisierung kennzeichnend, dass sich ihr Sinngehalt fast nie bis ins Letzte begrifflich ausdrücken lässt bzw. sprachlich erfasst werden kann. Insofern ist das Verstehen eines Bildes nahezu unabschließbar.
Für das Bildverstehen in der Therapie ergibt sich die Frage, wer dieses zunächst erbringen, wer die Übersetzungsarbeit vom Bild zum Begriff in erster Instanz leisten soll, der Therapeut oder der Klient. Die Antwort kann nur lauten, dass beide es tun müssen, wobei jeder seine ihm eigene Expertise mitbringt. Zunächst ist der Klient der Experte seiner selbst, denn er kennt natürlich viele Facetten seiner inneren Welt am besten. So kommt es ihm auch zu, zum Ausdruck zu bringen, wie er die Bilder, die seiner Imagination entstammen, versteht und welche Vorstellungen und Gefühle sie bei ihm auslösen. Der Therapeut wird diesem Verstehen nicht die Geltung absprechen, er wird es vielmehr als zumindest einen Aspekt der „Wahrheit“ anerkennen. Der Therapeut wird aber auch seinerseits Verstehensangebote machen und zwar so, dass diese Angebote unmittelbar Anschluss an das Selbstverständnis des Klienten finden und dieses weiterführen, es aber gleichzeitig in mancher Hinsicht auch verändern. Dabei wird der Therapeut den Klienten anregen, vielen Bedeutungsmöglichkeiten eines Bildes nachzuspüren, so dass Klient und Therapeut dann gemeinsam überlegen können, welcher Spur sie folgen wollen. Dieser das Selbstverständnis des Klienten weiterführende, aber partiell auch verändernde Beitrag des Therapeuten zum sinnvollen Verstehen ist schon deshalb wichtig, weil das Störungskonzept von Rogers impliziert, dass der Klient sich auch über sich selbst täuschen kann. Das Modell der Inkongruenz von Selbstkonzept und organismischem Erleben besagt schließlich, dass manche Aspekte dieses Erlebens gar nicht oder nur „verzerrt symbolisiert“ werden (Rogers 1959 / 1987, 30 f; Speierer 1994). Das bedeutet, dass die Person sich selbst, zumindest partiell verkennt, ihre „wahren“, eigentlichen Bedürfnisse und Gefühle gar nicht oder nur in semantisch entstellter Weise wahrnehmen kann. Somit verkennt sie auch manche Bilder ihrer eigenen Imaginationen und Träume, d. h. sie kann in ihnen zunächst keine angemessene Spiegelung ihrer Bedürfnisse oder Gefühle sehen.
Schon deswegen soll das einfühlende Verstehen des personzentrierten Therapeuten nicht nur ein nachfolgendes, ein die Selbstaussage des Klienten lediglich nachvollziehendes und nachbildendes Verstehen sein, sondern temporär auch ein vorausgehendes, d. h. ein den noch verborgenen Sinn entschlüsselndes Verstehen. Auch Rogers sagte (1951/1973, S. 114), dass der Berater dem Klienten in seinem Verstehen „mitunter“ auch voraus sei. Gerade deshalb kann dieser letzterem weiterführende Impulse geben.
Der Beitrag des Therapeuten beim Verstehen der inneren Bilder des Klienten ist schon aufgrund seines „Abstandhabens“, seines „Andersseins“ möglich. Als ein Anderer hat der Therapeut bei aller Teilhabe und allem Miterleben auch einen Abstand zum Bezugssystem des Klienten, hat er auch einen zumindest etwas anderen Blick, eine andere Perspektive und kann dadurch die Perspektive des Klienten ergänzen bzw. erweitern. Dies ist überhaupt ein zentrales Motiv, sich bei einer Problemklärung einen Gesprächspartner zu suchen. Verstehen hat auch immer etwas mit Verständigung zu tun, d. h. mit dem Abgleichen von zunächst unterschiedlichen Perspektiven zwischen Dialogpartnern (Gadamer 1975). Ein Wesensmerkmal der personzentrierten Therapie wäre dann in der dialektischen Vermittlung von polaren Positionen zu sehen, nämlich das einfühlende Verstehen des Klienten aus seinem Bezugssystem einerseits, aber auch aus dem des Therapeuten andererseits. Es geht hier um das dialektische Verhältnis der beiden zentralen Beziehungskonzepte der Personzentrierten Therapie, der Empathie basierten Alter Ego Beziehung einerseits und der durch Echtheit und Gegenseitigkeit bestimmten Dialogbeziehung andererseits (Finke 1999).
Der personzentrierte Therapeut wird deshalb die Selbstdeutungen seines Klienten nicht einfach nur bestätigend nachzeichnen (wie das von Außenstehenden über die Gesprächspsychotherapie gelegentlich behauptet wird), sondern er wird dem Klienten auch Anstöße geben, sich selbst, seine Träume und Imaginationen, immer besser, immer genauer zu verstehen und sein organismisches Erleben immer exakter zu symbolisieren. Das setzt voraus, dass der Therapeut, zumindest phasenweise und partiell, den Klienten besser versteht als dieser sich selbst. Solches vermag der Therapeut auch, weil er als „der Andere“ nicht der Symbolisierungsstörung und ihren Wahrnehmungsverfälschungen unterliegt. Die Expertise des Therapeuten gründet also nicht nur in seinem Wissen, konkret seinem Störungs- und Änderungswissen. Zwar soll in der personzentrierten Therapie der Therapeut den Klienten aus dessen Perspektive, aus dessen Bezugssystem heraus verstehen, also „die Welt des Klienten mit dessen Augen sehen“ (Rogers 1977, 116). Aber Rogers hat auch betont, dass dabei der „Als-ob-Charakter“ der Identifizierung mit der Sichtweise des Klienten nicht verloren gehen sollte (Rogers 1977, 20). Das ist wohl so zu verstehen, dass der Therapeut nie völlig, vor allem nicht überdauernd in der Perspektive des Klienten aufgehen soll. Aus der Identifizierung mit dem Klienten muss sich der Therapeut immer wieder zurückholen, um auch aus seiner eigenen Perspektive, aus der Perspektive des Außenstehenden den Klienten, sich selbst und die Interaktion zwischen beiden zu verstehen. Dadurch kann er Dinge sehen, die der Klient, befangen in den Verzerrungen seiner Symbolisierung, zunächst noch nicht sehen kann.
Wenn allerdings die Aufgabe des Therapeuten darin gesehen wird, gegenüber der möglichen Selbsttäuschung des Klienten ein Korrektiv darzustellen, so ist damit nicht gemeint, dass der Therapeut hier im Besitz einer objektiv gültigen, jeder intersubjektiven Kontextualität entbundenen Wahrheit wäre. Vielmehr ist über das Vorliegen einer Selbsttäuschung wie über die „Wahrheit des Selbstseins“ nur innerhalb des dialogischen Prozesses zwischen Therapeut und Klient zu entscheiden. Das aber bedeutet selbstverständlich auch, dass der Therapeut sein Verstehen dem Klienten nicht mit besserwisserischem Gestus entgegen stellt. Vielmehr wird der Therapeut den Klienten in ein inneres Zwiegespräch mit sich selbst zu bringen suchen, so dass das Verstehen des zunächst Unverständlichen eine gemeinsame und prozesshaft zu denkende Leistung von Klient und Therapeut ist.
Der Therapeut wird dabei die Selbstaussagen des Klienten spiegeln, aber auch so aufgreifen, dass diese in ihrem Sinn jeweils um Nuancen geändert bzw. umakzentuiert werden (Finke 2004). Gelegentlich wird er auch Verstehensangebote machen, die eine Alternative zur Selbstdeutung des Klienten darstellen. So erhält der Klient jene Anstöße, die ihm eine schrittweise Erweiterung und Veränderung seines Bezugssystems und seines Selbstkonzeptes ermöglichen. Dabei spielt auch die bejahende Grundhaltung des Therapeuten eine Rolle, die dem Klienten ein bedingungsloses Akzeptieren und Geltenlassen allen Erlebens kommuniziert. So kann der Klient zunehmend jene Aspekte seines organismischen Erlebens symbolisieren, die bisher, weil mit dem Selbstkonzept nicht vereinbar, von der Gewahrwerdung ausgeschlossen waren (Rogers 1959 / 1987, 24 f). Die Möglichkeit, solche Anstöße zur weiterführenden Selbstexploration geben zu können, setzt voraus, dass der Therapeut nicht nur aus dem Bezugssystem des Klienten versteht, sondern auch aus seinem eigenen. Das bedeutet, dass der Therapeut auch Bezug auf sein Störungswissen nimmt und in diesem Zusammenhang auch auf sein Wissen um Symbolik. Nun gibt es natürlich kein gesichertes Wissen um die psychologische Bedeutung von Symbolen. Gemeint ist hier ein Wissen um die verschiedenen Möglichkeiten, Bilder in ihrer psychologischen Bedeutung zu verstehen. Aber um welche Art Wissen handelt es sich dabei?
3.2 Das Symbolverstehen im Sinne einer hermeneutischen Phänomenologie
Für die Personzentrierte Psychotherapie gilt vor allem beim Verstehen von Traum- und Märchenbildern ein phänomenologisches Symbolverständnis (Keil 2002, Spielhofer 2003). Aber was heißt das? Phänomenologisch ist die Betrachtung eines Phänomens dann, wenn es so beschrieben und verstanden wird, „wie es sich an ihm selbst zeigt“ (Heidegger 1963, 35). Ein als Symbol verstandener Gegenstand wird dann phänomenologisch gesehen, wenn ich ihn in dem zu erfassen suche, als was er sich mir unmittelbar gibt, wie er sich mir in seinem unmittelbaren Gegebensein offenbart. Phänomenologie (die Besonderheiten der Husserl’schen Phänomenologie als Wesensschau sollen hier außer Acht bleiben) ist andererseits aber keine vermeintlich voraussetzungslose Deskription, die ihre eigenen Voraussetzungen, ihre eigenen Vorannahmen lediglich nicht durchschaut. In dem Bemühen, diesen Vorannahmen Rechnung zu tragen, wird indes versucht, jede einseitige Perspektive beim Betrachten der Phänomene zu vermeiden. Es soll dabei die Tendenz abgewiesen werden, von vorneherein sehr einseitig und „einsinnig“ etwas in einen Gegenstand „hinein zu sehen“, ihn nur aus der Perspektive einer ganz bestimmten Theorie zu verstehen. Vielmehr soll hier auf einen Überschuss an Bedeutung der Bilder und Symbole hin- und damit jede Einengung auf eine a priori exklusive Bedeutung zurückgewiesen werden.
So kann sich mir ein bestimmter Gegenstand, z. B. ein Tisch, in vielerlei Weise zeigen. Er kann sich mir als mein Arbeitstisch zeigen, als der Familienesstisch, als der „runde Tisch“, an dem ich mit Kollegen Fachgespräche führe und als der Tisch im Café. Wenn der Tisch mir nur in der Vorstellung, nur als Phantasiebild gegeben ist, kann er sich mir in den Bildern der Religion, der Mythen und Märchen zeigen, etwa als ein Altartisch oder als der Tisch, an dem Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte, oder als der Tisch der Tafelrunde von König Arthus oder als das „Tischlein-deck-dich“ des Märchens. Es sind also jeweils sehr unterschiedliche Aspekte meiner Lebenswelt, meiner Erlebnis- und Phantasiewelt bei dem Gegenstand Tisch berührt. Es sind unterschiedliche Sinngehalte, auf die dieser Gegenstand unmittelbar verweist. Oder anders formuliert: Der Tisch zeigt sich mir zunächst nie in reiner Abstraktion von allem Konkreten und isoliert von allen lebensweltlichen Bezügen. (Ein solcher Tisch an sich ist erst das Ergebnis einer nachträglichen Konstruktion.) Sondern er zeigt sich primär immer schon in einem bestimmten Kontext bzw. als Teil einer bestimmten „Bewandtnis-Ganzheit“, d. h. als etwas, womit es eine je bestimmte „Bewandtnis“ hat (Heidegger 1963, 83 f). Der Tisch als ein Ding meiner Umgebung verweist immer schon auf bestimmte Funktionen und Situationen, ich nehme ihn primär nur innerhalb dieses „Verweisungszusammenhanges“ wahr (Heidegger 1963, 82). Und damit werden auch je nach Kontext, in dem der Tisch sich mir zeigt, unterschiedliche Bedeutungsebenen angesprochen.
Mit diesen Andeutungen wird auf eine hermeneutische Phänomenologie verwiesen (Heidegger 1963), nach der die mir begegnenden Dinge dieser Welt mir immer schon im Horizont, im Kontext meiner Lebenswelt gegeben sind. Aus diesem Horizont, aus diesem Bezugssystem, aus diesem Sinnentwurf, den ich von dieser Welt habe, sehe ich sie, verstehe ich sie. Sehen ist so immer schon ein Verstehen, indem ich nämlich die Dinge jeweils als etwas sehe, d. h. sie in einem bestimmten Sinnbezug wahrnehme. Und dieses „Als-Etwas“ wird mir durch meinen Horizont, durch mein Vorverständnis möglicher Sinngehalte vorgegeben.
Die Bedeutung eines Gegenstandes, der als Symbol verstanden wird, z. B. ein Haus oder Schloss, ein Baum, ein Wald, ein See, ein Berg, hängt deshalb sowohl vom Vorverständnis des Betrachters wie vom Kontext ab, in dem der Gegenstand erscheint. Diese unterschiedlichen bedeutungssetzenden Möglichkeiten sind im Gespräch mit dem Klienten durchzuspielen und auszuloten. Dabei ist zunächst von der unmittelbar naheliegenden Bedeutungsebene auszugehen, um dann scheinbar immer entferntere Bedeutungssphären auf ihre mögliche Passung hin „durchzuprobieren“. (Weiteres hierzu in Teil 1, Kapitel 7.2 und Teil 3, Kapitel 2.1.3 dieses Buches).
Wenn z. B. in den Imaginationen des Klienten ein bestimmtes Haus auftaucht, so könnte sich der Therapeut zunächst konkrete Einzelheiten dieses Bildes beschreiben lassen, um dann zu fragen, ob und woher der Klient ein solches oder ähnliches Haus kenne. Aus diesem lebensgeschichtlichen Kontext und seiner emotionalen Bewertung seitens des Klienten ergibt sich dann eine Sinnzuschreibung. Ist dem Therapeuten schon bekannt, dass der Klient seine Kindheit mit recht positiven Erinnerungen verbindet, könnte er fragen, ob vielleicht dieses Haus in der Imagination an das Erleben von Geborgenheit erinnere und darin auch ein Wunsch nach Heimstatt und Zu-Hause-Sein zum Ausdruck komme. Auch könnte der Therapeut den Klienten bitten, sich vorzustellen, wer wohl in dem Haus wohnen würde. Sind dies dem Klienten bekannte und positiv erlebte Personen, könnte das Haus für einen Beziehungswunsch zu diesen Personen stehen. Insbesondere wenn es sich um unbekannte Personen handelt, könnte der Therapeut fragen, ob diese Personen vielleicht auch Aspekte des Selbst des Klienten darstellen. Schließlich könnte auch dieses Haus selbst mit seinen verschiedenen Stockwerken und Zimmern vielleicht das eigene Selbst versinnbildlichen.
Solches Fragen geht zunächst von einem Alltagsverständnis aus (das Haus als Heimstatt), um dann aber beim Durchspielen verschiedener Verstehensmöglichkeiten jeweils ein Verstehen vorauszusetzen, das den Raum der Kontextbezüge weiter ausdehnt. Das Haus als Heimstatt, als Ort der Geborgenheit ist eine Vorstellung, die vom Phänomen Haus unmittelbar nahegelegt wird. Aber das Haus als Symbol der personalen Mitte bzw. des eigenen Selbst, aber eventuell auch als eines geheimnisvollen, göttlich-heiligen oder dämonisch-bedrohlichen Bezirks, das sind Zuschreibungen, die sich erst aus einem erweiterten Kontext bei der intensiven Beschäftigung mit dem Phänomen Haus ergeben. Das genannte Bedrohliche eines Hauses könnte dann z. B. aus einer Selbstperspektive wiederum auch das eigene organismische Selbst darstellen, das der Klient bisher nicht zu symbolisieren wagte.
Natürlich wird der Therapeut sich dabei immer am Erleben und an den Vorstellungen und Deutungen seines Klienten orientieren und diese keinesfalls zurückweisen. Vielmehr wird er diese aufgreifen und sie eventuell modifizieren oder ergänzen. Er wird dabei auch zu erkunden suchen, was den Klienten zu seinem jeweiligen Symbolverstehen veranlasste. Zum anderen wird er bestimmte Aspekte dieses Verstehens mit seinem eigenen Verständnis zu verbinden suchen. Dabei kann sich ein längerer Prozess der Konsensbildung (Pfeiffer 1983), der Verständigung von Therapeut und Klient ergeben. Im Rahmen einer solchen Konsensbildung wird sich auch das Bezugssystem des Klienten ständig verändern. So ist z. B. auch zu der im vorigen Kapitel erörterten Symbolik von Höhe und Tiefe oder von Himmel und Erde, wie auch zu vergleichbaren Vorstellungen zu sagen, dass für einen einzelnen Klienten ein See bzw. ein Teich oder ein Berg immer auch eine sehr spezifische, individuelle Bedeutung haben kann. In der Therapie kommt es darauf an, zunächst diese individuelle Bedeutung zu verstehen und mit ihr zu arbeiten. Erst in einem weiteren Schritt kann dann abgeklärt werden, ob daneben eine kollektive Symbolik, ein mythologischer Sinn für das Erleben des Klienten von Bedeutung ist, ob diese ihm jeweils auch etwas zu sagen haben.
Teil 1 – Personzentriertes Arbeiten mit Träumen
1 Die Sprache der Träume