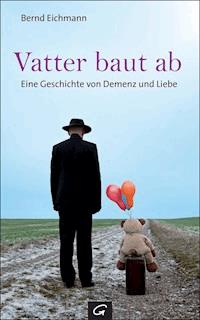Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie jeden Abend ging ihm das vertraute Paradoxon durch den Kopf: Mit mir stirbt die Welt! Und doch wird sie weiterleben ohne mich.
Das E-Book Treibholz wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Erzählungen, Nachkriegsgeneration, Berlin, Israel, politisch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Königskinder
Rheinische Symphonie
Wachstumsschmerzen
Das Alte Testament
Tachana Merkasit
Der Straßenhändler
Jerusalem, die Goldene
Rheinische Symphonie Zwei
Auf Trebe
Kraker und Autonome
Die Eule der Athene
Resi erzählt
Lieb Vaterland
Sand
Ich steh auf Berlin!
Im Krähwinkel
Pukka Sahib
Haschisch
Mehmets Traum
Braunau: Hitler und kein Ende
Rheinische Symphonie drei
Flohmarkt
Heroin
Im freien Fall
Abschied von der Kindheit
Im wilden Osten
Irmchens Balkon
Fichte
Im wilden Westen
Winterkind
Rückblicke
Die Büchse der Pandora
Sound der neuen Zeit
Zurück in die Zukunft
Epilog
Prolog
Ein Philosoph und ein Physiker stritten einmal darüber, was Leben sei. Der Philosoph bemühte Erkenntnistheorie, Ontologie und Metaphysik, machte einen Ausflug in die Religion und brauchte viele kluge Worte. Er sprach von Sein und Bewusstsein, von Dasein und Sosein und näherte sich nach vielen Wenns und Abers einer vorläufigen Definition.
Der Physiker hörte sich das alles ruhig an. Dann sagte er schlicht: Leben ist Bewegung.
2.
Leo war immer in Bewegung. Rhythmus durchpulste sein Leben. Schon als Flaschenkind hatte er im Takt des Trinkens gegen den Rand des Kinderwagens geschlagen. Später trommelte er auf alles, was ihm unter die Hände kam und gab dem Chaos Struktur. Seit er laufen konnte, gab es kein Halten mehr: Es trieb ihn hinaus in die Welt. Er schaute in die Wolken und sah nicht, was vor ihm lag. Rannte gegen Laternenpfähle und holte sich viele Beulen. Das schreckte ihn nicht; die Welt blieb verlockend und ewig neu.
Mit zwölf Jahren lernte Leo das Rauchen. Verteilte Zigarettenpausen wie Rettungsbojen über den Tag. Träumte selbstvergessen den blauen Wölkchen nach. Liebte Geruch und Geschmack seiner Roth-Händle und blieb ihr all die Jahre treu. Hasste Sozialingenieure, die Raucher zu Asozialen stempeln wollten.
Die Abendzigarette auf der Veranda war besonders wichtig; sie half Leo, die Bilder des Tages im Kopf zu löschen. Er überschrieb sie mit letzten Eindrücken: Der Himmel ist hoch und sternenklar; die Nacht wird kalt. Im Licht der Laternen gehen Fledermäuse auf Insektenjagd. Im Efeu raschelt ein Igel. Die Straßen sind leer; irgendwo schlagen Autotüren zu. Hinter dem Bahndamm fährt ein Güterzug. Die ferne City brummt leise: Sie ist geschäftig wie jede Nacht. Alles im Lot; Zeit, loszulassen!
Er ging ins Bett und fiel in traumlosen Schlaf. Sein letzter Gedanke galt der Kleinen Bärin: Sie würde sich später zu ihm legen und noch schlafen, wenn er die Augen wieder aufschlug.
Doch neuerdings versagte das Ritual. Leo hatte Einschlafprobleme; es ging ihm schlecht. Er schwankte wie ein Betrunkener und fürchtete, auf der Treppe oder in der Dusche zu stürzen. Die Hausärztin setzte seine Diuretika ab und verschrieb andere Blutdrucksenker; seither konnte er nur noch Tröpfchen pinkeln. Doch er schwankte weiter.
Der HNO-Arzt sprach von losen, körpereigenen Kristallen, die sich im Innenohr selbständig gemacht hatten und dem Hirn Scheinbewegungen meldeten. Er zeigte ihm gymnastische Übungen, um die lästigen Freischwimmer wieder an ihren Platz zu befördern. Sie halfen nicht.
Zuletzt suchte Leo einen Neurologen auf. Der maß die elektrische Spannung der Hirnrinde, schoss Computerbilder des Kopfinneren und scannte mit einem Elektromagneten das komplette Gehirn. Kein Befund. Der Spezialist schloss Schlaganfall, Parkinson und Alzheimer aus und wusste nicht weiter.
Auch die Welt um ihn herum wurde ihm fremd. Der regenlose Sommer hatte eine Staubwüste hinterlassen; vertraute Pflanzen gingen ein oder trieben Notblüten aus. Der Zünsler fraß die Buchsbaumhecken kahl. Ein Raubgewächs aus Asien hatte die Siedlung nebenan mit kräftigen Wurzeln unterwandert. Fremde, unbekannte Vogelschwärme plünderten die Beerensträucher. Eine Windhose war aus strahlend blauem Himmel im Nachbargarten eingefallen und hatte eine starke Kiefer enthauptet.
Auch der Abendfrieden auf der Veranda war dahin. Schwere Flugzeuge erschütterten den Nachthimmel. Unsichtbare Hunde strichen gespenstisch die Gartenzäune lang; hinter bunt blinkenden Halsbändern verschmolzen Köpfe und Körper mit der Dunkelheit. Die Fledermäuse blieben weg, seit die Laternen weißes LED-Licht auf die Straße warfen. Die Zeichen häuften sich, wurden zum Fanal: Nicht Leo war ins Wanken geraten, sondern seine Welt! Er fühlte sich wie eine Landratte bei schwerem Wellengang.
Mit Zwanzig hatte Leo hart getrunken und eine trotzige Zeile an die Hauswände geschmiert: In einer schiefen Welt steh ich allein nicht grad! Es gab nichts Richtiges im Falschen; alles war aus dem Lot. Terra Infirma! Da halfen keine Ärzte mehr.
3.
Leo war ein Gewächs der frühen Nachkriegszeit, mit Wurzeln, denen der Mutterboden fehlte. Der Zweite Weltkrieg hatte semitische, slawische und westfälische Gene zusammengewürfelt und kräftig durchgerührt. Besonders stolz war er auf die väterliche Abkunft vom Stamm der Leviten: Schriftgelehrte und Bücherwürmer seit Salomons Zeiten. Auch das mütterliche Erbe wog schwer: Schlesien hatte wechselnde Fremdherrschaft erduldet und wahre Meister des Überlebens hervorgebracht. Von den Westfalen hatte er die Sturheit übernommen: Sie hockten auf der Scholle und lehnten alle neuen Moden ab. Wie sie hielt er eisern an seinen Prinzipien fest; das gab ihm Halt in einer bewegten Welt.
Leo wäre gern in einer aufgeklärten Epoche aufgewachsen, als Diskurse frisch und Ideen noch nicht verbraucht waren. Doch die Luft seiner Kindheit roch abgestanden: Alte Männer mit Rezepten von vorgestern hatten die Macht. Die Kriegsgeneration sehnte sich nach Wohlstand und Stabilität; Konsum war erste Bürgerpflicht. Der Ohnemichel gab die Parole aus: Fress dich satt und sauf dich dick und halt dich raus aus Politik!
Die nächste Generation konfrontierte ihre Eltern mit dieser Vergangenheit. Riss die Fenster auf und lüftete das miefige Land kräftig durch. Leo genoss die Freiheit des Denkens, las Wittgenstein, Adorno und Camus, träumte vom Sieg der Vernunft.
Zwanzig Jahre später fand er sich in Zeiten der Beliebigkeit und des moralischen Bankrotts wieder: Nach der Wende hatten wieder Karrieristen das Sagen; die Massen stürzten sich hemmungslos in den Konsum. Materialismus und Neoliberalismus verschmolzen zu einer Botschaft: Hast du was, bist du was! Leo traf die Rolle rückwärts besonders hart: Er vermisste Mitgefühl und Solidarität, war enttäuscht von der Gier und der Selbstsucht der Menschen.
Leo galt inzwischen als lebensferner Idealist, als Spinner. Er fühlte sich wie ein Alien auf einem fremden Planeten. Ein grünes Männchen mit einer Antenne auf dem Kopf. Er suchte nach Wesen seiner Art; die Sehnsucht trieb ihn rastlos durch die Welt. Kurze Begegnungen waren nicht von Dauer. Er fand sich damit ab, dass er allein bleiben würde.
4.
Erst spät traf Leo die Frau, die es mit ihm aushielt. Sie war gelernte DDR-Bürgerin, Kopf eines Familienclans und lebte am Stadtrand von Berlin. Ihr Vorkriegshaus mit Bauerngarten war massiv und unerschütterlich. Sie hatte es jahrzehntelang um- und ausgebaut, kannte jeden Stein und jeden Strauch. Das machte sie manchmal nervös; dann sprach sie von Verkaufen. Doch Leo war angekommen und wollte nicht mehr weg.
Die Frau war ein Alien wie er; gehörte aber einer anderen Spezies an: Sie verbrachte ihre Zeit im Garten und loggte sich dort in fremde neuronale Netzwerke ein. Spürte den Signalen von Wurzeln, Rhizomen und Myzelien nach. Wusste Wolkenzug und Vogelflug zu deuten. Bot Igeln und Insekten in der zubetonierten Welt eine Zuflucht. Manchmal verschwand sie für Stunden im dichten Grün; Leo dachte dann, dass sie eines Tages Wurzeln schlagen würde, mit einem Nest in ihrem grauen Haar.
Alten Bäumen zollte die Frau Respekt; die Veteranen hatten viele Generationen überlebt und gaben der Zeit ein großes, ruhiges Maß. Im Schatten ihrer hundertjährigen Kastanie sagte sie gern, dass es der Welt ohne Menschen besser gehen würde.
Die Frau hieß Ursula: die Kleine Bärin. So nannte Leo sie von nun an. Der Name passte, wie das Totem zu einer Indianerin passt. Die Kleine Bärin hatte die Reisefreiheit der Nachwendezeit genutzt, die eisige Nordwelt zu erkunden. Sie lernte das trübweiße Licht der Mittsommernacht und die flüchtigen Farbwolken der Nordlichter kennen. War im Samenland Rentieren und Elchen begegnet. Im Eismeer hatte sie Orcas und Buckelwale gesehen, am Inarisee Myriaden von Mücken ertragen. Schließlich war sie in die finnischen Urwälder eingetaucht, um unweit der russischen Grenze ihrem Alter Ego zu begegnen.
Die Nacht des dritten Tages hatte sie auf einem grob gezimmerten Hochsitz verbracht. In der Morgendämmerung war eine Braunbärin mit erwachsenen Jungtieren über die Lichtung gekommen. Den Wind hatten die drei im Rücken: Ursula wurde nicht bemerkt. Sie hockte meterhoch über den mächtigen Tieren und zitterte vor Angst und Kälte.
Konnte ihr Urin nicht mehr halten. Und wurde gleichzeitig von Adrenalin und Glück durchflutet.
Von dieser Reise brachte Ursula Baumrinde mit grauen Flechten mit. Dazu ein lebendiges Stück Finnland für ihren Garten: eine Zwergfichte, deren Wachstum im subarktischen Klima so entschleunigt war, dass sie auch in fremder Erde all die Jahre nur wenige Zentimeter zulegen konnte.
Die Silvesternacht 1999 verbrachten die beiden auf einem einsamen Bahnsteig in Berlin-Adlershof. Sie hatten eine laute Feier verlassen, um den Countdown zur Jahrtausendwende in Ruhe vor dem Fernseher abzuwarten. Es war zugig, kalt und dunkel; die S-Bahn schien nicht mehr zu kommen. Sie lauschten dem diffusen Lärm der City und sahen Raketen in den Nachthimmel steigen.
Das ist nicht meine Welt! sagte Leo unvermittelt und schüttelte den Kopf. Dann lass uns nach Hause gehen! antwortete die Kleine Bärin. Nach Hause gehen: Das hatte er zuletzt als kleines Kind gehört. Er nahm ihren Arm und zog sie zum dunklen, eisig überfrorenen Treppenabgang. Sie gingen Hand in Hand durch die Nacht und kamen verspätet im neuen Jahrtausend an.
5.
Leo liebte Berlin. Anfangs hatte er die Stadt da draußen noch durchmessen und durchwühlt wie eine große Wundertüte. Doch mit den Jahren war er ruhiger geworden. Die Kreise, die er zog, wurden enger. Er kuschelte sich im Viertel ein. Lebte das Leben eines Kleinstädters und verließ den Kiez nur noch selten.
Die Menschen in seinem Umfeld wurden ihm vertraut: Der ostpreußische Bauer mit Armen wie Eichenwurzeln, der mit seiner Frau in einer verwohnten Klitsche lebte. Er hielt Karnickel und Tauben in Drahtverschlägen, schlachtete sie auf einem Block und briet sie auf einer Kochplatte in der Garage. Die Frau duldete das Dreckszeug nicht in ihre Küche. Von Frühjahr bis Herbst trieb der Achtzigjährige mit einem Vorschlaghammer Spaltkeile in Baumstämme und Stubben und stand auch im Winter an der Kreissäge. Für Briketts reichte die Rente nicht. Er würde überleben, solange er was zu Sägen hatte, sagten die Nachbarn mit spöttischem Respekt.
Zwei Häuser weiter hatte ein Frührentner seinen Garten in einen Bauhof verwandelt. Zwischen staubigen Brombeerbüschen und mannshohen Nesseln stapelten sich rostige Eisenträger, zerbrochene Schindeln und Wegeplatten, versteinerte Betonsäcke und ein defekter Zementmischer zu einem Denkmal des Verfalls. An seinem Zuhause hatte der Bewohner seit Jahren nichts getan. Er saß lieber auf einer Rolle Dachpappe in der Sonne und trank schon zum Frühstück die erste Flasche Bier.
Solche Veteranen der Mangelwirtschaft in ihren Datschen starben aus. Die nächste Generation richtete sich in den Nischen der Arbeitsgesellschaft und in den Silos des kommunalen Wohnungsbaues ein. Die Verlierer wohnten im Ghetto, einer bröckelnden Plattensiedlung jenseits der Bahngleise. Wählten rechts und zündeten samstags Raketen und Polenböller, um die Ligaspiele von Union Berlin zu feiern. In Baracken, die nur einen Steinwurf entfernt waren, duckten sich syrische Kinder unter ihre Bettdecken, weil der Krieg in ihren Köpfen nicht zu Ende gehen wollte.
Kleinbürger und Rentner lebten in einer genossenschaftlichen Mustersiedlung aus den dreißiger Jahren. Die Doppelhäuser mit spitzen Giebeln und parallelen Außentreppen waren vor dem Krieg für kinderreiche Volksgenossen gebaut und nach dem Krieg Staatseigentum geworden. Die Siedlung hatte nach der Wende die Fasson verloren: Aus Zweifamilienhäusern waren halbe Häuser geworden, in denen die Mietparteien ihre Individualität auslebten: Rosa Putz stieß auf gelbe Klinker. Holzportale mit Glaskassetten gesellten sich zu blauen Haustüren mit dreieckigen Sichtschlitzen. Hatte der linke Eingang ein Regendach aus Hartplaste, erhob sich rechts ein Kuppelvorbau mit stilisierten Säulen. War die eine Haushälfte mit alten Ziegeln eingedeckt, protzte die andere schon mit graublauen Edelschindeln.
Gemeinsames Flanieren durch das Viertel der Halben Häuser zählte zu Ursulas und Leos Sonntagsroutinen. Sie liebten es, über die Indolenz der Anwohner zu lästern. Die Ursache lag auf der Hand: Die neue Freiheit der Baumärkte hatte zum rapiden Verfall nachbarschaftlichen Denkens geführt.
6.
Berlin war endgültig auf den Hund gekommen. Hunderttausend Tölen schissen Parks, Vorgärten und Bürgersteige voll und bettelten um die Aufmerksamkeit von Herrchen oder Frauchen. Gehorsam war Bestandteil ihrer DNA; als Mitläufer folgten sie nur ihrem Rudelführer. Über fremde Artgenossen fielen sie wütend her; jede Fußhupe blies sich auf und gab die Deutsche Dogge.
Hunde konnten auch anders sein. Ursula hatte sich ein Rhodesian Ridgeback angeschafft, gezüchtet für die Löwenjagd in der Savanne. Die Kleine Bärin hasste Dressur und ließ die Hündin frei im Garten laufen. Bei der eigenwilligen Afrikanerin war von Unterwürfigkeit nichts zu spüren; sie öffnete alle Türen und bediente sich gern aus dem Kühlschrank. Als sie eines Nachts verschwand und nicht mehr wiederkam, war Ursula sehr traurig. Doch sie hatte ein großes Herz und übertrug ihre Liebe auf einen schwarzweißen Kater, der ihnen anvertraut worden war.
In Leos Eigenauskunft hätte gestanden: Raucher und Katzenstreichler. Die samtpfotigen Streuner standen ihm näher als Hunde; sie waren freie Wesen. Kannten keine Moral und folgten skrupellos ihren Bedürfnissen. Lebten Leos archaische Sehnsüchte aus, die er sich als Gutmensch schon früh versagt hatte. Er verzieh ihnen alles, war freundlich und fürsorglich und sprach gern mit ihnen. Dass ihre schamlose Bettelei abrupt in demonstratives Desinteresse umschlagen konnte, amüsierte ihn sehr. Ihr Kater war Anarchist und ignorierte alle Verbote. Doch man konnte ihn konditionieren. Leo hatte das Erfolgsrezept der Manipulation entdeckt: Steuerung durch Eigeninteresse.
Eines Abends kam ein Geräusch aus der Dunkelheit, das Leos Nerven zum Vibrieren brachte: Metallisches Kreischen einer heißgelaufenen Kreissäge endete in einem hellen, schwachen Laut. Es war der Todesschrei einer Elster, die soeben in den Zähnen seines Katers gestorben war. Dieses Erlebnis rückte das Verhältnis zwischen Mensch und Katze wieder zurecht.
Leos Beziehung zu Pflanzen war schwierig. In Ursulas Garten hatte er sich dem Anorganischen gewidmet: Er setzte Platten und Pflastersteine zu Terrassen und Beetumrandungen zusammen. Das Material gefiel ihm; es war gewichtig und dauerhaft: Die Welt ließ sich mühelos in Planquadrate aufteilen. Pflanzen waren ihm wesensfremd: Sie folgten fremden Regeln und kannten keinen rechten Winkel. Ihr maßloser Wachstumsdrang war Leo unheimlich: Pflanzen hatten jahrtausendelang menschliche Hochkulturen überwuchert, mit Wurzeln gewürgt, in Biomasse erstickt und letztlich verschluckt. Werden und Vergehen war ihnen eins.
Das alles warf immer wieder Fragen auf nach dem Warum und Wozu menschlicher Existenz. Geisteswissenschaftler und Theologen versuchten hilflos, dem Sinnlosen einen Sinn zu geben. Naturwissenschaftler wussten, dass der Homo Sapiens nur ein flüchtiges Elementarteilchen war, geworfen in eine gleichgültige Welt, die ihn nicht brauchte. Diese Erkenntnis versetzte Leo bei aller Rationalität in mystischen Schrecken.
Dann kam der Frühling und verscheuchte alle Abstraktion. Im Gartenteich der Nachbarn quakte ein paarungsbereiter Frosch. Im nahen Wäldchen schrie der Kuckuck nach einer Gefährtin. Ameisen schleppten ihre Brut. Tigerschnecken gingen auf die Jagd nach vegetarischen Artgenossen. Die Kleine Bärin hatte recht: Das Leben würde weitergehen, auch ohne sie und ihresgleichen.
7.
Zu Leos täglichen Zaungästen zählte eine junge Frau, die jeden Morgen ihren Staffordshire Terrier ausführte. Sie trug ein Headset fürs Handy und konnte reden, ohne Luft zu holen. Bevor sie in Sicht kam, klang ihr lebhafter Monolog nach tiefstem Ostberlin. Doch wenn sie um die Ecke bog, passten Bild und Ton nicht mehr zusammen: Die geschmeidige, tiefschwarze Schönheit kam aus Mosambik, war die Tochter von DDR-Vertragsarbeitern und nach der Wende geblieben. Sie verdiente ihr Geld in einer Nachtbar und zog damit einen Sohn groß, den sie von einem ansässigen Proletarier bekommen hatte.
Im nächsten Lottoladen stand seit kurzem ein Inder hinter der Kasse. Er trug ein Cricket-Shirt und war in Plauderlaune: Sie sind auch nicht von hier? fragte er und gab Leo seine Zigaretten. Der musste über die Wortwahl des dunklen Mannes lachen. Ich bin zugezogen, sagte er höflich, merkt man das? Der Inder nickte. Ja, erwiderte er dann: Sie sind eher so wie wir.
Im Bus Richtung Ghetto legte ein türkischer Junge seine Beine auf den Sitz und gab sich männlich. Er trug Kapuzenshirt und Sneaker, wühlte im Portemonnaie und sprach gleichzeitig ins Handy: Isch hab noch sechs Tacken für Pizza, Alter. Kein Bock auf Pizza? Dann Dürüm für zwei, Alter! Er leckte sich genüsslich die Lippen; die Vorfreude stand ihm ins pausbäckige Gesicht geschrieben. Der Junge lebte mit seinen Leuten seit kurzem im Hochhauskiez. Auf dem Parkplatz vor Netto traf er sich mit Kids aus dem Maghreb. Ihre Familien hatten Neukölln verlassen, weil das Viertel zu teuer geworden war. Die Mütter trugen Hidschab und bedeckten Arme und Beine.
Der alte Westen war nach zwanzig Jahren auch im Osten angekommen.
8.
Die Bewohner und Besucher des Hauses rauchten nicht mehr; selbst der Schwiegersohn war zur Elektrozigarette konvertiert. Leo wich zum Rauchen ins Freie aus und fand bei Minustemperaturen eine Zuflucht im Fahrradkeller. Doch der Unterschlupf war bereits besetzt: Handtellergroße Raubspinnen hatten sich vor dem Frost in der Dämmung verschanzt und hinter Leisten versteckt. Es gab weder Asseln noch Weberknechte hier; die Räuber schienen sich kannibalisch zu ernähren.
Wo er sich aufhielt, durften die Besetzer nicht sein. Er bewaffnete sich mit einer Kehrschaufel und zog in den Kampf. Er wusste vorher, was ihn erwartete: Wann immer er auf den Lichtschalter drückte, hockte das größte Exemplar an der Kellerdecke und stellte sich tot. Das dauerte Sekunden; dann erkannte das träge Spinnenhirn die Gefahr, und der Räuber huschte in Deckung. Die anderen Spinnen waren hinter den Leisten unangreifbar; die Lampe warf nur ihre vergrößerten Schatten an die Wand. Er musste den Vorposten erwischen, dann rückte der nächste Späher nach. Und er musste allzeit bereit sein für den nächsten, schnellen Schlag. Es wurde ein Gemetzel auf Raten. Zwei Wochen später war der Fahrradkeller spinnenfrei.
Leo konnte seinen Sieg nicht genießen; er fühlte eine an Entsetzen grenzende Scham. Die Raubspinnen waren ihm fremd und unsympathisch; doch er hätte nur abwarten und sie ihrem Überlebenskampf überlassen müssen. Stattdessen hatte er in phobischer Angst zugeschlagen und den Kick des Tötens genossen. Entsetzt hatte ihn die unheilige Verbindung von Angst und Aggression; in anderen Zeiten hätte er vielleicht auch Menschen erschlagen.
In den Tagen danach suchte er den Fahrradkeller nur ungern auf. Eine riesige Phantomspinne saß ihm beim Rauchen im Nacken. Schatten huschten über die Wände und verschwanden aus seinem Gesichtskreis, sobald er genauer hinsah. Es schien, als belauerten ihn seine Opfer, um in einem Moment der Unaufmerksamkeit als Wiedergänger über ihn herzufallen.
Leo begriff, dass er der Angst nicht entkommen konnte. Sie war der Preis des Lebens.
9.
An einem Wintertag musste Leo noch spät das Haus verlassen; er hatte einen Abendtermin beim Orthopäden. Am Zaun wartete schon eine frisch blondierte Nachbarin; sie wusste Neues zu berichten: Auf der Brache gegenüber werde die Stadt eine Siedlung für fünfhundert Asylanten hochziehen. Mit uns können sie es ja machen, sagte sie aufgebracht, wir müssen arbeiten, da passt keiner auf das Grundstück auf. Und die Schwarzen klauen wie die Raben!
Es beunruhigte ihn tief, dass ihm das Elend der Welt so nahe auf den Leib rückte. Doch der Spruch der Nachbarin durfte nicht unwidersprochen stehen bleiben: So heiß werde es nicht gegessen, meinte er begütigend. Diebstähle und Einbrüche habe es hier immer schon gegeben. Er sprach vom schweren Schicksal der Flüchtlinge und appellierte an ihr Mitgefühl. Doch seine Worte blieben schwach und blutleer. Sie schmeckten nach Routine, klangen fadenscheinig und abgegriffen. Die Nachbarin sah ihn irritiert an und wandte sich grußlos ab. Sie hatte auf einen Komplizen gehofft.
Leo machte sich wieder auf den Weg. Zum Orthopäden musste er quer durch die Stadt fahren. Er hasste es, zur Stoßzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein; Pendler und Hausfrauen mit ihren Einkäufen blockierten in der Regel alle Sitzplätze. Auf den vollen Gängen ließen sich Körperkontakte kaum vermeiden.
Er nahm die S-Bahn Richtung Norden. Die Leute standen dicht an dicht; er lehnte sich in Türnähe an die gläserne Trennscheibe. Stationen später schob sich eine Gruppe dunkler, junger Männer wie ein Stoßkeil zur Tür und kam ihm unangenehm nahe. Als die Bahn wieder anfuhr, tastete er nach seinem Portemonnaie. Es war nicht mehr da. Leo durchsuchte hektisch seine Taschen und seinen Cityrucksack. Nichts. Die Diebe hatten ihn kalt erwischt: Ausweise, Bankkarte, Fahrschein und Geld waren mit dem Portemonnaie verschwunden.
An der nächsten Station stieg er aus und checkte die Lage: Aus Gewohnheit hatte er für Straßenmusikanten noch Silbergeld in der Hosentasche. Auch das Handy war ihm geblieben, es hatte tief im Rucksack gesteckt. Er konnte telefonisch seine Bankkarte sperren und dann einen neuen Fahrschein ziehen. Doch vorher wollte er in aller Ruhe eine Zigarette rauchen.
Leo hatte gerade die Stufen Richtung Straße genommen, als er die jungen, dunklen Männer wiedersah, die im Rückraum der Treppe hockten. Sie hatten die nächste Bahn genommen und waren an gleicher Stelle wie er ausgestiegen. Sie erkannten ihn und machten sich aus dem Staub. Leos Blutdruck pochte in seinem Hirn. An eine Verfolgung war nicht zu denken.
Auf dem Fußweg zum Arzt ließ der hohe Blutdruck seine Nerven vibrieren, und die Augen schmerzten. Er sah alles wie durch Glas. In einem kleinen Park warfen Laternen gelbes Licht in die Winternacht. Aus tiefen Schatten abseits der Lichtkegel traten finstere Gestalten. Es waren Dealer auf Kundensuche, die wie große Schlangen hashisch, hashisch zischten. Als Leo an einer Fußgängerampel die Straße überquerte, schnitt ihm eine große dunkelhäutige Gestalt auf einem Fahrrad den Weg ab und brüllte ihm wütend fuck you zu. Auf der anderen Straßenseite kam er an einem Fitnessstudio vorbei, das aussah wie ein Trainingscamp der Balkanmafia. Durch ein grell beleuchtetes Schaufenster konnte er tätowierte junge Männer sehen, die brutal auf Boxsäcke eindroschen oder sich verbissen an stählernen Foltergeräten quälten. Halb Osteuropa schien hier vertreten zu sein.
Der Rückweg vom Orthopäden setzte die Schrecken des Hinweges nahtlos fort: Bereits auf dem Bahnsteig stolperte ihm eine alters- und geschlechtslose Gestalt in einer zerrissenen Djellaba über die Füße. Sie sprach manisch mit sich selbst und starrte ihn aus tiefen Augenhöhlen ins Gesicht, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. In der S-Bahn rammte ihm eine junge Romafrau einen Kinderwagen in die Hacken und beschimpfte ihn wütend. Das Kind schien sediert zu sein und glotzte stumpf wie eine Lumpenpuppe. Entnervt flüchtete Leo in den nächsten Wagen und fiel erschöpft auf einen freien Sitz.
Dort hatte jemand seine Zeitung liegen lassen. Die lokalen Schlagzeilen addierten sich zum Horrorszenario: Afrikaner an Wurstbude von Kumpel erstochen! Albanischer Einbrecher von Hausbesitzer erschossen! Und weiter unten: Massenschlägerei im Kiez! Mit Eisenstangen und Messern gingen arabische Großfamilien aufeinander los! Leo knüllte das Blatt zusammen und warf es auf den Boden.
In dieser Nacht fand er nur schwer in den Schlaf. Der Tag ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Doch am nächsten Morgen wachte er beruhigt auf: Nächtliche Träume hatten die Schreckensbilder vorerst entsorgt.
10.
Zwei Monate später lernte Leo auf einem Bahnsteig der Berliner Ringbahn die Kehrseite des eigenen Schreckens kennen. Er musste nur die Perspektive wechseln:
Die Sonne stand an diesem Märzabend schon tief. Der halb verschattete Bahnsteig füllte sich schnell mit Berufspendlern. Wenn der nächste Zug einlief, schoben sich Menschenströme geordnet aneinander vorbei. Die einen verließen die Bahnen, die anderen füllten sie wieder auf. Viele trieb es eine Treppe hoch aufs Straßenniveau. Andere eilten treppab, zu den U-Bahnen. Oder wechselten zum gegenüberliegenden Gleis. Wo sich die Ströme begegneten, entstanden Strudel. Dann schob sich die Menge auf dem Bahnsteig wieder zurecht und nahm erneut ihre Warteposition ein: ein selbstregulierendes, in Stoßzeiten hocheffizientes Prinzip.
Doch dann brach die Routine auf: Die Masse Mensch geriet in wellenförmige Bewegung. Empörte Stimmen wurden laut. Zwei schwarzhaarige Jugendliche in verdreckten, wattierten Jogginghosen, Kapuzenpullis und dicksohligen Tretern drängten sich rücksichtslos durch die Massen und rannten die Treppe zur Straße hoch. Auf der obersten Stufe blieben sie stehen und riefen Unverständliches Richtung Bahnsteig. Die Köpfe der Pendler wandten sich ihnen zu, dann nahmen sie das eigentliche Geschehen ins Visier:
In der Luft hoch über dem Bahnsteig hing ein dunkler Junge mit einem in die Stirn wuchernden Haarschopf und schlug um sich. Ein Mann in kalkbespritzter Maurerkluft, der die Menge um gut einen Kopf überragte, hatte ihn mit eisernem Arm am Kragen gepackt und schüttelte ihn so mühelos, wie ein Wolf ein junges Kaninchen schütteln würde. Dazu wiederholte er mit ruhiger Autorität das immergleiche Mantra: Lass fallen, Junge, lass fallen! In seinen blassblauen Augen und dem unbewegten Gesicht stand keine Wut, eher spöttisches Mitleid. Doch seine Lippen blieben streng verpresst. Und er schüttelte weiter.
Das Opfer war ein vielleicht siebzehnjähriger, rachitischer Junge mit der Statur eines Zwölfjährigen und einem alten Gesicht. Das staubige Licht der Welt hatte er in einer Mahala erblickt: einem jener Romaquartiere, die weder Arbeit noch Hoffnung kannten. Seine Leute waren vor den täglichen Entbehrungen und den ethnischen Säuberungen geflohen, die den Balkankriegen folgten. Und nun versuchte der Junge, sich wie ein Mann unter den Gadschos durchzuschlagen. Was sie nicht gaben, durfte er nehmen, damit die Familie überleben konnte. So war das Gesetz.
Sein Gewerbe hatte er noch in der alten Heimat gelernt. Er war der dritte Mann. Der erste stolperte dem Passanten in die Quere, der zweite griff ihm in die Taschen, der dritte übernahm die Beute und trat in den Hintergrund. Nach einigen Raubzügen trafen sie sich unter der Treppe, um die Beute zu bunkern. Dann ging es zurück auf den Bahnsteig.
Doch heute war etwas schiefgegangen. Schnelle Erfolge hatten ihn so leichtsinnig gemacht, dass er das Bunkern versäumte. Leute wühlten bereits in ihren Taschen. Seinen Partnern waren die Nerven durchgegangen; sie hatten das Weite gesucht. Nur er war auf diesen Turm von Mann geprallt, der von oben mehr sehen konnte als die anderen. Und der ihn nun am Wickel hatte.
Der Vorfall war eine willkommene Abwechslung für die Leute. Zustimmende Rufe wurden laut. Pendler klatschten. Die Roma auf dem oberen Treppenabsatz, zu denen sich ein wildlockiges Mädchen gesellt hatte, hielten dagegen: Loslassen, ihr Schweine! schrien sie von oben. Doch die Eskalation blieb aus. Niemand mischte sich ein. Es war eine klare Sache, Mann gegen Mann.
Der Junge hielt sich gut. Wehrte sich mit aller Kraft, trat mit den Beinen um sich, spuckte große Töne. Romani-Brocken mischten sich in seinen Wortschwall, Wutschaum quoll aus seinem Mund. Doch sein Gegner war unbeweglich wie ein massiver Kran: Lass fallen, Junge! wiederholte er stur: Lass fallen! In seine ruhige Stimme schlich sich ein Hauch von Ungeduld angesichts dieser Unvernunft, und seine Hand schloss sich enger um den Kapuzenkragen seines Opfers.
Dem Jungen schoss heißes Blut in den Kopf. Bilder aus einer frühen Kindheit wurden wach, die längst vergessen schienen: Baracken brannten im Morgengrauen, Wasserleitungen wurden zerschlagen, Kleinvieh wurde weggetrieben. Wütende Menschen schüttelten die Fäuste und skandierten hasserfüllte Parolen. Tigani! brüllte der Mob: Bastardi! Hoti! Criminali! Es dröhnte in seinen Ohren. Die Gesichter der Umstehenden verschmolzen zu einer dumpfen Masse. Eine uralte Angst aus dem kollektiven Gedächtnis seines Volkes kroch ihm ins Gedärm, und dem Jungen wurde übel.
Sein Widerstand brach. Er erschlaffte und hing wie eine Gummipuppe im unerbittlichen Griff. Wut, Überheblichkeit und Verachtung schwanden aus seinem Gesicht. Das zynisch wissende Grinsen, mit dem er sich schon als Straßenjunge im Balkan gewappnet hatte, fiel von ihm ab. Dann schob er die Unterlippe vor, wie ein hilfloses Kind, und Tränen der Demütigung liefen über seine Wangen. Mit fahrigen Händen stülpte er seine Taschen um und ließ Portemonnaies, Brillenetuis und Mobiltelefone auf den Boden fallen. Als nichts mehr zum Fallenlassen blieb, setzte ihn der Hüne sanft auf dem Bahnsteig ab und strich ihm kurz über den Kopf.
Diese wohlwollende Geste gab dem Jungen den Rest: Seine Beine knickten ein, er brach in sich zusammen und verbarg das Gesicht hinter seinen Händen. Die Leute rückten von ihm ab und schwiegen. Scham verdrängte die Genugtuung in ihren Augen. Sie waren Zeugen eines Zivilisationsbruches geworden: Mitten unter ihnen hatte sich Gewalt durchgesetzt und einen Menschen nackt gemacht.
Als der Junge wieder auf die Füße kam und sich Richtung Treppe schleppte, wichen die Leute zurück. Sie scheuten die Nähe des Unglücklichen, wie man das Stigma eines Leprakranken fürchtet. Auch die Roma auf der Treppe waren still geworden und wandten sich verlegen von dem so tief Gefallenen ab. Er ging blicklos, mit gesenktem Kopf an ihnen vorbei die Treppe hoch und verschwand in der Straßenmenge.
Auf dem Bahnsteig zerstreuten sich die Leute und kehrten auf ihre Warteplätze zurück. Sie wandten sich wieder dem Alltag zu. Der Maurer wies mit einer einladenden Geste auf das Häufchen Wertsachen und entfernte sich dann Richtung U-Bahn. Eine türkische Mutti hatte neben Leo ihre Einkaufstasche abgestellt und schüttelte ratlos den Kopf. Aman Allahim, seufzte sie aus tiefster Seele: Was für eine Schande!
11.
Am Abend dieses Tages machte Leo klar Schiff. Wischte den Staub aus dem Hirn, der sich in Zeiten der inneren Emigration angesammelt hatte. Begriff, worum es da draußen ging: Unter dem Firnis der Normalität lagen Abgründe; der Kampf der Kulturen spielte sich längst vor der eigenen Haustür ab.
Er wusste, warum die Afrikanerin nur mit ihrem Kampfhund auf die Straße ging und den Telefonkontakt zu Freunden und Familie nicht abreißen ließ: Es konnte immer etwas geschehen. Neulich hatte man den Inder aus dem Tabakladen mit zerschlagenem Gesicht im Rinnstein gefunden; er war im Krankenhaus aufgewacht und konnte nicht mehr sagen, was ihm zugestoßen war. Auch die bunten Kids in Berlin wurden bald hart und zynisch, alterten vor ihrer Zeit. Sie alle gingen barfuß über dünnes Glas und konnten jederzeit einbrechen.
In diese Welt wurden Menschen geworfen wie Knochen vor die Hunde. Sie brauchten Nahrung, Wärme, Unterkunft. Suchten Anschluss, Arbeit und Auskommen. Akzeptierten ihr Schicksal oder gaben auf. Sie hatten manchmal die Wahl, aber selten eine Chance. Und sie sprachen mit vielen Zungen, wie einst in Babylon:
Lingua Franca dieser Welt war primitives Wirtschaftsenglisch. Kolonialsprachen kehrten als Pidgin und Creol auf den alten Kontinent zurück. Arabische Rachenlaute und russische Konsonanten veränderten die Großstadtmelodie, machten den Beat härter. Deutschtürkisch eroberte die Szeneviertel. Selbst das junge Ivrit, das seltene Somali, das uralte Tamil und das Romani der Vaganten hatten ihre Nischen verlassen und reicherten den Sound der Metropole mit noch fremderen Klängen an.
Die Menschheit war wieder auf Wanderschaft. Die Oberfläche des Planeten wurde neu verteilt. Der feste Boden schwamm seinen Bewohnern unter den Füßen weg und brach auf. Grenzen wurden porös, alte Sicherheiten schwanden. Im Kampf um Ressourcen wurde der Mensch erneut des Menschen Wolf.
Nur die ewig Gestrigen begriffen nichts. Sie brüllten abgestandene Parolen und plünderten auf der Suche nach der verlorenen Zeit den Müllhaufen der Weltgeschichte. Alte Männer liquidierten Menschenrechte im Namen ihrer Götter. Überall auf der Welt flackerten Kulturkämpfe und Religionskriege auf; Medien bedienten den gierigen Markt und überboten sich mit reißerischen Schlagzeilen. Aus dem Netz quollen Hass, Ignoranz und Niedertracht. Es schien, als sei eine Zombieapokalypse ausgebrochen.
Auch Leo war zuletzt müde und bequem geworden. Hatte versucht, die Welt auszublenden, um zur Ruhe zu kommen und Gedichte zu schreiben. Doch es waren schlechte Zeiten für Eskapismus und Poesie. Er merkte es am Sound der Straße, am Gestank der Armut, am Dunst der Gewalt und an den Blicken des Hasses, der Gier und der stumpfen Verzweiflung: Babylon war überall. Man konnte ihm nicht entkommen.
Wurzeln (1947)
Königskinder
Die Nacht lag auf dem Land. Im Vollmondlicht warfen alte Ulmen Schatten auf den tief verschneiten Hof und die Backsteinbauten der Nervenklinik. Nur im Dachgeschoss von Haus Fünf brannte noch Licht; im Fenster waren die Silhouetten eines jungen Pärchens zu sehen, das in die dunkle Nacht blickte. Das Personal nannte die beiden liebevoll unsere Königskinder.
Resi hatte Harry in der Waldklinik kennengelernt. Das Flüchtlingskind aus Schlesien war hier im dritten Winter nach dem Krieg als Hilfspflegerin untergekommen; die Oberschwester teilte ihr Kopfschüsse und Verschüttete zu, weil sie Lazaretterfahrung hatte. Sie hielt sich gut und durfte sich bald um Nervenkranke kümmern. Der melancholische Harry in Haus Fünf wurde ihr Liebling. US-Soldaten hatten ihn aus Buchenwald befreit; danach war er in ein tiefes Loch gefallen. Ärzte der Bethel’schen Anstalten wollten ihn mit Elektroschocks aus seiner Depression reißen; nach der zweiten Behandlung war er geflohen und neigte seither zu Panikattacken und Nervenkrisen. Der Chefarzt der Waldklinik behandelte ihn konservativ; er gönnte ihm Ruhe.
Harry und Resi rückten allnächtlich in Haus Fünf zusammen und sponnen sich in einen Kokon ein. Die stille Schneelandschaft vor den Fenstern war ihre Welt, das Nachtlicht an Harrys Bett ihr Zentrum. Sie sahen beide den Schmerz in den Augen des anderen: Man hatte beide um ihre Jugend betrogen.
Harry war in einer westfälischen Kleinstadt großgeworden, als Sohn eines jüdischen Fabrikanten und einer evangelischen Bürgerstochter. Der Vater wählte deutschnational und war Schriftführer des örtlichen Kriegervereins. Den lippischen Pickert aß er am liebsten mit Leberwurst. Seinen Sohn ließ er protestantisch taufen und nannte ihn Harry. So hieß der große Heine, bevor er konvertiert war und als Heinrich heimwehkrank in der Fremde starb.
Als sechzehnjähriger Gymnasiast war Harry aus dem Leben gefallen. Der Biologielehrer, ein überzeugter Rassenkundler, hatte ihn zur Anschauung vor die Klasse gestellt. Seht ihn euch an! sagte er mit professionellem Interesse und maß mit Zirkel und Winkelmesser die Proportionen von Harrys Gesicht: So sieht ein Judenmischling ersten Grades aus! Dann musste Harry das Gesicht zur Wand drehen und warten, bis die Polizei gekommen war.
Im Lager war der Junge ins Visier eines kriminellen Kapos geraten. Der teilte das feine Bürgersöhnchen nach Luftangriffen auf das Umland den schlimmsten Kommandos zu: Leichen stapeln, Trümmer räumen, Blindgänger bergen. Ein Kommunist hatte sich vor den Jungen gestellt und ein Machtwort gesprochen. Seither war Harry Marxist.
Bei Resi wurde er redselig. Erzählte von seiner Kindheit in der elterlichen Villa. Vom Bildungstick des Vaters, der nur das Einjährige geschafft hatte, bei Tisch aber gern lateinische Sprüche von sich gab. Er rezitierte Schillerballaden und las mit Resi Novellen von Gottfried Keller. Und er sang ihr mit gepflegtem Bariton Lieder von Lehár und Schumann vor.
Resi hörte dem gebildeten jungen Mann gerne zu; er kam aus einer fremden, spannenden Welt. Sie hatte gelernt: Wenn ein Mann spricht, zeigt die Frau Verständnis und hält sich zurück. Aus ihrem Leben erzählte sie deshalb nur das Nötigste. Eines allerdings musste er wissen; sie sagte es mit Stolz: Es war ihr geglückt, im Chaos von Krieg und Flucht ihre Unschuld zu bewahren.
Sag mal, Harry, fragte Resi einmal: Warum nennen sie uns Königskinder? Er wusste es: Sie konnten beisammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief! sang er und lachte: Eine Polackin und ein Judenbengel? Im Jahre Drei nach Hitler? So tief war das Wasser noch nie! Er wurde übermütig, blockierte beim Abschied die Tür und forderte als Wegzoll einen Kuss.
Sie heirateten acht Wochen später in der Klinikkapelle; Trauzeugen waren der Chefarzt und die Oberschwester. In der milden Frühlingssonne standen die Kopfschüsse, die Verschütteten und die Nervenkranken Spalier. Sie warfen Maiglöckchen und applaudierten.
2.
Die erste Wohnung des jungen Paares lag im Dachgeschoss eines Münsteraner Pfarrhauses; der Stundenschlag der Glocken teilte den Tag in Portionen auf. Zum Kochen, Waschen und Putzen schleppte Resi schwere Wassereimer; die Pumpe stand drei Treppen tiefer im Hof. Am Samstag brauchte sie drei Eimer extra: Sie wurden auf dem Herd erhitzt und zum Baden in eine alte Zinkbadewanne gegossen. Kam Harry aus der Uni, servierte sie Stullen mit Rübenkraut oder Kartoffeln mit Quark. Am Freitag gab es gebratenen Hering mit Zwiebeln; die Küche stank tagelang nach Fisch.
Während Resi kaum wusste, wie sie mit achtzig Mark sattwerden sollten, half Harry seinem Kommilitonen Ewald, den väterlichen Monatsscheck unter die Leute zu bringen. Dafür half er dem verbummelten Bankierssohn durch das Wirtschaftsstudium. Vor Kneipentouren ließen sie sich rasieren und fühlten sich wie Graf Koks. Einmal gingen sie zum Notar und baten den verblüfften Mann, sie unter Kuratel zu stellen, weil sie dem Suff ergeben waren.
Inzwischen schickten die Schwiegereltern Fresspakete aus Lippe; dann gab es Mettwurst und Schinkenspeck auf die Stullen. Als die halb verhungerte Resi ein paar Kilo zulegte und ihre Monatsregel wieder funktionierte, brachte sie einen Sohn zur Welt.
Harry wollte ihn gern Humboldt nennen; das hatte er beim Umtrunk mit Ewald diskutiert. Er glaubte an die tiefe deutsche Seele. War überzeugt, dass der Geist der Aufklärung den Ungeist von Hitler und Konsorten überwinden würde. Quod erat demonstrandum, meinte Ewald skeptisch: Die Schlächter und Henker hätten die Dichter und Denker endgültig vertrieben.
Der Standesbeamte legte sich quer: Humboldt sei ein Familienname und als Vorname nicht üblich, sagte er und schaute streng über den Brillenrand. Harry war vorbereitet: Humboldt sei aus dem germanischen Hunboldt entstanden, der tapfere Hüne. Der Herr könne ja die Sprachwurzeln nachschlagen; er empfehle den Wasserzieher. Dort sei auch der Trunkenboldt zu finden, der sich allerdings weniger als Vorname eigne.
Der Beamte sah sich Harrys jüdisches Ponum an und wurde wütend: Dass der Herr sich einen der edelsten deutschen Namen ausgesucht habe, würde böses Blut machen; es könne auch mal wieder anders kommen! Harry blieb gelassen; er konterte kühl: Er wolle den Sohn ja nicht Wagner nennen, schon wegen der Götterdämmerung. Und Adolf sei ein bewährter Vorname, aus einschlägigen Gründen aber vorläufig nicht verfügbar.
Dann verwies er auf die liberalen USA: Dort dürften Eltern ihre Kinder auch Dollar, Vanille oder Cheesecake nennen. Er habe kürzlich gelesen, dass es in New York einen jüdischen Kriminalbeamten namens Meyer Meyer gebe. Man könne von den Amerikanern viel lernen; schließlich hätten sie die Demokratie zurück nach Deutschland gebracht.
Das traf ins Schwarze: Der Standesbeamte zuckte zusammen und dachte an seine Entnazifizierung vor einer US-Spruchkammer anno 1947; er hätte damals beinahe Beamtenstatus und Pension verloren. Er konnte nicht riskieren, dass sogenannte Antifaschisten sein Leben nochmal unter die Lupe nahmen. Er griff zum Füller, um Humboldt in die Geburtsurkunde einzutragen.
Harry hatte gewonnen; das machte ihn großzügig. Er dachte an Resi und ihren Vater; sie hatte ihn sehr verehrt. Milde lächelte er den Beamten an: Er wolle den Sohn nun doch lieber Leo nennen, nach seinem arischen Großvater. Dem Feind stieg das Blut zu Kopf, er wurde knallrot: Der Treffer saß! Das vollendete den Sieg.
3.
Die Ankunft des kleinen Leo änderte alles. Die Großeltern in Lippe packten gezuckerte Kondensmilch in ihre Pakete. Und für die Wöchnerin Frauengold und Badesalz mit Fichtennadelduft. Resi hatte sich nach der Geburt in ihr Innerstes zurückgezogen; die Mutterschaft war ihr eine Last. Doch sie tat ihre Pflicht, hielt den Sohn warm und sauber. Ließ ihn gegen Pocken und Diphterie impfen. Trichterte ihm Lebertran gegen seine Mangelernährung ein. Würgte Leo das fischige Zeug aus, musste er es nochmal schlucken.
Als der Vierjährige Windpocken bekam, band sie seine Arme und Beine am Bettgitter fest. Im Schlafzimmer lag der Possek bereit, ein Ledergürtel, mit dem Resi ihrem Sohn Disziplin einbläute: Kinder hatten nichts zu wollen! Manchmal ging der weichherzige Harry dazwischen. Dann fror Resis Gesicht für Tage ein, und sie ging stumm ihren Pflichten nach.
Um Resis Schweigen zu entkommen, nahm Harry seinen kleinen Sohn auf lange Waldspaziergänge mit. Leo liebte den Wald: Die Fichten strebten himmelwärts, wie die Säulen einer Kathedrale. Durch die Wipfel fiel grünes Zauberlicht. Verirrte Sonnenstrahlen streiften sein Gesicht, unter den Füßen federte ein Nadelteppich. In einer Lichtung baute er Häuschen aus Astgabeln, deckte sie mit Moos und bevölkerte sie mit Kastanienmännchen und Zapfentieren. Tief in der Schonung gab es Walderdbeeren: passend für die Zwergenmahlzeit.
Im westfälischen Kinderheim Asental mochte er den Wald nicht mehr. Dort luden ihn die Eltern ab, um den Sommer allein im Weserbergland zu verbringen. Leo hasste die Brote mit Vierfruchtmarmelade und den ewigen Hagebuttentee. Die harten Stockbetten und die Schwestern, die den obligaten Mittagsschlaf in alter BDM-Manier durchsetzten. Und die Waldwanderungen mit martialischen Gesängen: Wir lagen vor Madagaskar! Ob‘s stürmt oder schneit! Wildgänse rauschen durch die Nacht!
Im zweiten Sommer wollte Leo das Heim in Brand stecken: Ich zünd es an! Ich fackel es ab! Ich setz den roten Hahn aufs Dach! deklinierte er im Bett und schwelgte in seiner Sprachgewalt. Das half gegen Heimweh.
4.
Nach seiner Promotion wurde Harry Hochschulassistent an der Universität Saarbrücken. Sie zogen in ein Neubauviertel auf dem Kaninchenberg, hoch über der Stadt. Es war ein buntes Völkchen, das sich am Schwemmrand des Krieges hier zusammengefunden hatte: Die Saarrois sprachen saarfränkisch, elsässisch, französisch, sogar letzeburgisch und fühlten sich als Europäer. Doch das deutsche Wirtschaftswunder kam nicht bis zur Saar. Zehn Jahre nach Kriegsende wurden die Saarrois gefragt, ob sie wieder Deutsche werden wollten wie anno Fünfunddreißig. Isch hann die Flemm, isch will hemm! stand auf den Plakaten der Prodeutschen; es dauerte noch vier Jahre, bis die D-Mark eingeführt und der Anschluss vollzogen wurde.
Leos Einschulung fiel in die Umbruchzeit: Sein Banknachbar war der quirlige, schwarzhaarige Gaston. Die erste Lehrerin hieß Mademoiselle Lebrun, sie wurde in der zweiten Klasse von Fräulein Schlösser abgelöst. Die großen Fünffrancstücke aus Alublech taugten nur noch als Spielgeld. In Heimatkunde sagten die Schüler im Chor magische Ortsnamen auf: Saarbrücken und Saarlouis. Neunkirchen, Völklingen, Zweibrücken. Merzig und Mettlach, Sankt Ingbert und Sankt Wendel.
Im Peugeot eines befreundeten Ehepaares machten sie Sonntagsausflüge ins Umland: Resi stand in hellem Kleid und weißen Pumps am Aussichtspunkt hoch über der Saarschleife und sah jung und fröhlich aus. Im nahen Elsass aßen sie Choucroute, Champagnerkraut und Weinbergschnecken in Knoblauchbutter; sie lebten wie Gott in Frankreich.
Leo liebte seine neue Heimat; das alte Grenzland war voller Lebensfreude und Musik. Im Radio spielten sie Chansons; besonders gern mochte er das lustige Lied von den Deux Escargots: Es erzählte von Schnecken, die zum Begräbnis eines Herbstblattes gingen, aber erst im Frühjahr ankamen: A l’enterrement d’une feuille morte deux escargots s’en vont! Das Lied war von den Frères Jacques; Leo konnte es auswendig und trällerte es unentwegt.
Es war eine glückliche Zeit. Doch das Saarland blieb ein schöner Traum. Die akademische Karriere des Vaters versackte im braunen Sumpf, der auch an der Saar noch nicht ganz ausgetrocknet war: Die rassistische Seilschaft seines alten Naziprofessors hintertrieb die Habilitation des halbjü-dischen Dozenten. Harry verließ die Universität und ging nach Bonn. Die Bundestagsfraktion der SPD stellte ihn als Assistenten für Konjunkturpolitik ein und bezahlte ihn gut.
Rheinische Symphonie
Eingangs der 60er Jahre war der Wohlstand in Bonn-Kessenich angekommen. Harry fuhr einen grünen Opel Rekord mit weißem Dach und Weißwandreifen. Aus der Lakritzfabrik Hans Riegel Bonn wehten süße Düfte auf den Balkon. Im Herbst sammelte Leo Rosskastanien für das Jagdrevier des Haribo-Chefs; das Wildfutter wurde ihm zehn zu eins mit Konfektbruch aufgewogen. Doch als er im Fabrikshop mit Schnapsbonbons erwischt wurde, hatte das ein Ende.
Der Block in der Germanenstraße war eine enge Welt. Im zweiten Stock wohnte eine Kriegerwitwe, die Kinder hasste: Als Leo einmal Ligusterbeeren vor der Haustür zertreten hatte, sprach sie von Zuchthaus und Arbeitslager. Resi schrubbte weinend die violett verfärbten Steinplatten. Die nette Frau Müller im Erdgeschoss lud ihre junge Nachbarin manchmal zum Eierlikör ein, wenn Harry außer Haus war. Dann kam Leos Mutter angeheitert nach oben, drückte ihn an sich und nannte ihn Kurczak: mein Hähnchen.
Eines Tages klingelte der katholische Pfarrer und hielt Resi eine Standpauke: Er habe erfahren, dass ihr kleiner Sohn Wahlzettel für die SPD verteile. Dies sei Teufelswerk und mit der heiligen Mutter Kirche nicht vereinbar. Ihn wundere auch, dass sie als Katholikin in Mischehe mit einem Protestanten lebe; er habe sie wohl deshalb noch nicht in der Beichte gesehen. Resi blieb vor Wut die Spucke weg; sie warf den Pfaffen hochkant raus. Am nächsten Tag trat sie gemeinsam mit Leo in die evangelische Kirche ein. Das war praktisch; ihre Volksschule lag nur zwei Blocks entfernt. Doch das alte Kruzifix ihrer Eltern mit dem gekreuzigten Jesus in Bronze blieb an Resis Zimmerwand.
Ein Trümmergrundstück hinter dem Mädchengymnasium war Treffpunkt der Volksschüler; es wurde Die Wildnis genannt. Leo schloss sich einer Bande an, die für einen Herrn Pempelfort vom Stadttheater den schwarzweißen Münsterländer Lukas ausführte und sich Lukasbande nannte. Strenge Chefin der Sieben- bis Neunjährigen war die elfjährige Renate. Sie nannte Leo Schlaumeier und überließ ihm gnädig das Drehbuch ihrer Abenteuer. Er fraß sich gerade durch siebzig Bände Karl May: Ihr Hauptquartier wurde eine Blockhütte im Indianerland, die Schutz vor wilden Komantschen bot. Die Lukasbande war meist damit beschäftigt, den Unterschlupf aus Brettern und Zweigen neu aufzubauen, wenn ihre Feinde, die schlicht Die Anderen hießen, ihn wieder mal zerstört hatten. Kam es zum Kampf, war Leo nicht zu brauchen; er prügelte sich nur ungern und hatte Angst um seine Brille.
2.
Leo erinnerte sich aus dieser Zeit noch gut an Onkel Erich. Der schielende, braungebrannte Mann mit den verkrümmten Händen eines Bergmannes hatte eingangs der sechziger Jahre seinen Neffen Harry in Bonn besucht. Eigentlich war er Leos Großonkel, ein Vetter seines jüdischen Großvaters. Er hatte nach den Märzwahlen von 1933 die Gefahr erkannt, die der Judenheit in Deutschland drohte. War noch im gleichen Jahr nach Brasilien ausgewandert; dort hatte er in Minas Gerais als Minenarbeiter und Edelsteinhändler sein Glück gemacht. Er erzählte Leo von Smaragden, Turmalinen und den Sonnensteinen Goldtopas und Heliodor: Sie hätten schon die Diademe von Inkas, Azteken und Tolteken geschmückt. Nun führten seine Söhne das Geschäft. Er hatte sich auszahlen lassen und war zu einer letzten Pilgerreise quer durch Europa aufgebrochen: Er wollte wissen, wer von seinen Verwandten und Freunden die Naziverfolgung überlebt hatte.
Der alte Mann blieb nicht lange und musste bald weiter. Er habe nicht mehr viel Zeit, sagte er in jiddisch-portugiesischem Kauderwelsch und drückte alle kurz an seine Brust. Dann stieg er in ein Taxi und verschwand aus ihrem Leben. Leo konnte diesen Besuch nicht vergessen. Der Onkel aus Brasilien hatte ihm zwar keine Juwelen mitgebracht, doch tiefen Eindruck in seiner kindlichen Seele hinterlassen: Wie der ewige Jude war er im biblischen Alter noch mal auf Wanderschaft gegangen, um die Seinen aufzusuchen und nachzusehen, wer mit Adonais Hilfe dem Wüten der Philister und Edomiten entkommen war.
3.
Harry lud die Genossen der Fraktion abends gern nach Hause ein. Die älteren Herren trugen Vorkriegshosen mit angeknöpften Hosenträgern, die sie hoch über ihre Bäuche zogen. Sie tranken Bier, rauchten Pfeife und sprachen meist von vorgestern. Die jungen Gäste bevorzugten schmale Gürtelhosen, tranken Whisky, rauchten Zigaretten und sprachen von übermorgen. Zigarren wurden nur auf dem Balkon geduldet.
Resi trug an diesen Tagen Lippenstift und roch nach Chanel Nummer Fünf. Sie füllte Eier mit Mayonnaise und Tomaten mit Fleischsalat; dazu reichte sie Käsegebäck. Mit gekreuzten Knöcheln saß sie auf einem Lederkissen abseits der Männer, hörte den hitzigen Debatten zu und bangte um ihre weißgestärkten Gardinen, die sich trotz Zigarrenverbots gelb färbten.
Um Sieben wurde Leo frisch gescheitelt ins Wohnzimmer gerufen, um seinen Diener zu machen und den Herren gute Nacht zu sagen. Dabei bekam er viel mit: Den Kanzler Adenauer mochte niemand hier. Bei Ollenhauer stöhnten die jungen, bei Willy Brandt die älteren Genossen und nannten ihn Willy Weinbrand. Kam die Sprache auf Kennedy, hoben alle die Gläser und stießen fröhlich an. An einem denkwürdigen Abend stritten sich die Herren über Leute, die noch seltsamer hießen als Karl Mays Indianer: Lumumba, Kasawubu und Moische Tschombe. Sie gerieten so in Rage, dass sie Leo einfach vergaßen. Resi musste resolut werden, um den Sohn aus der Gefahrenzone zu bringen.
Am Morgen nach solchen Besuchen plünderte Leo die Anrichte, naschte vom Gebäck und leerte die Glasneigen in der Küche. An guten Tagen fand er noch einen Schluck Whisky in den Gläsern oder einen Likörrest in Resis Glas.
4.
Seit Harry gut verdiente, gönnten sich die Eltern Sommerferien an der Adria oder am Genfer See. Leo ließen sie in einem Ferienheim auf Langeoog zurück. Das Liedgut war inzwischen entnazifiziert worden; man sang Altbewährtes aus bündischen Zeiten: Mein Vater war ein Wandersmann. Wem Gott will rechte Gunst erweisen. Im Frühtau zu Berge, wir ziehn fallera! Die Betreuer hatten Pädagogik studiert und die Mittagsruhe abgeschafft. Leo dachte nicht mehr ans Zündeln; doch als das Heim wegen Masern geschlossen wurde, freute er sich sehr. Die Freude hielt nicht lange an: Leo dufte nicht nach Hause, er musste in Quarantäne bleiben. Im Krankentrakt auf Langeoog verbrachte Leo die ödesten Wochen seines Lebens.
Sonntags ging die Familie im Kottenforst spazieren. Nach dem Mittagessen setzte sich Harry in seinen Ledersessel, hörte Symphonien und dirigierte sie mit einem Bambusstock. War er gut gelaunt, holte er Leo dazu und erklärte ihm das Wesen von Programmmusik. Beethovens Pastorale legte er am liebsten auf. Leo fürchtete sich vor dem Gewittersatz, den er empathisch durchleiden musste: Vibrierende Spannung lag in der Luft, Blitze durchzuckten Körper und Hirn; er wartete zitternd auf ihre Entladung. Die erlösende Hirtenflöte ließ ihn erschöpft zurück.
Das Leitmotiv von Leos Jugend aber blieb Schumanns Rheinische Symphonie. Sie läutete als majestätisches Intro von Hier und Heute den Fernsehabend ein. Wenn sie erklang, war die Welt im Lot.
5.
Drei Jahre später zogen sie eine Autostunde weiter in den Westerwald. Harry hielt den Knochenjob für den tyrannischen Fraktionsvorsitzenden nicht mehr aus und bekam Herzprobleme. Er folgte dem ärztlichen Rat und ging in die Provinz. Eine Landjugendakademie stellte ihn als Dozent für Internationales ein. Von nun an war Harry oft im Ausland unterwegs. Resi ersetzte die freundliche Frau Müller durch eine Frau Pape, die mit einem Fabrikanten aus der Papierbranche verheiratet war. Sie trafen sich im Café Süße Ecke, aßen Sahnebaisers, tranken Eckes Edelkirsch und zogen über die abwesenden Ehemänner her.
Die Westerwälder Kreisstadt war ein wichtiger Knotenpunkt des ländlichen Güterverkehrs. An den Laderampen von Raiffeisen roch es scharf nach Stickstoffdünger, Kalisalzen und Roggensaat. Die Sommer auf den waldigen Höhen waren kühl und windig, die Winter eisig und die Bauern schroff wie ihre Landschaft. Die wortkarge Landjugend fuhr Traktor und traf sich im Klubhaus des Reit- und Fahrvereins. Leo vermisste das milde Klima und das liebenswerte Flussvolk an Saar und Rhein. Er war er auf sich selbst zurückgeworfen.
Im Spätherbst hatte Leo ein traumatisches Erlebnis: Sein Schulweg führte durch das tiefe Wiedbachtal. Bei Dauerregen trat die Wied über ihre Ufer und überschwemmte die Auen. Als Leo sich an einem dunklen Novembertag auf den Heimweg machte, blieb er auf halbem Wege stecken. Zahllose Kröten füllten dicht an dicht die Talsohle. Bei jedem Schritt zerplatzten ihre weichen Molluskenkörper unter seinen Schuhen. Als er endlich festes Land erreichte, ließ er die verkrusteten, mit Eingeweiden verschmierten Schuhe zurück und lief auf Strümpfen nach Hause. Kundige Einheimische trugen Gummistiefel und schlurften wie auf Schneeschuhen durch die Krötenflut. Doch Leo war den Schrecken der Fremde hilflos ausgeliefert.
Er brauchte eine Zuflucht. Im Wald grub er sich eine Erdhütte, verschalte sie mit Brettern und dichtete sie mit leeren Düngersäcken ab. Wenn er die hölzerne Falltür über sich schloss, fühlte er sich wie Huck Finn in der Höhle von Indianer Joe. Er möblierte sein Heim mit alten Matratzen und einer Kiste für seinen Schatz: Orientzigaretten der Marke Nil, eine Flasche Rumverschnitt, drei Flaschen Cinzano rosso, ein Klappmesser mit Horngriff, ein dicker Stapel Kerzen und eine Taschenlampe, die er auf Rot und Grün schalten konnte. Nach den Hausaufgaben machte er hier Privatparty und träumte dabei von der weißblonden Angelika aus der Parallelklasse. Zu Hause putzte er sich die Zähne und lutschte Senf gegen seine Schnapsfahne. Die Mutter wusste Bescheid, doch sie sagte nichts. Resi hatte keine Lust mehr auf Erziehung: Der Junge wuchs ihr über den Kopf und brauchte seinen Vater.
6.
Doch Harry war meist unterwegs. Kam er nach Hause, hatte er immer Souvenirs im Gepäck: Aus Prag brachte er eine Platte mit russischen Bassarien mit. Aus Bern einen fetten Holzmönch mit Spieluhr im Bauch: Üb immer Treu und Redlichkeit! plinkerte sie und blieb am fünften Ton hängen, weil Leo sie zu oft aufgezogen hatte. Aus Israel einen Schabbesleuchter aus Messing und geschnitzte Holzkamele. Schmonzes, wie Resi zu sagen pflegte.
Ein Mitbringsel aus Afrika löste dann eine schwere Ehekrise aus: Harry war in Gambia und Senegal gewesen, um dem westafrikanischen Politikernachwuchs die Regeln der Sozialen Marktwirtschaft beizubringen. Fotos zeigten ihn beim Tanz mit jungen afrikanischen Frauen; er trug kurz-ärmlige Hemden und elegante Slipper. Seiner Frau brachte er als Armreif eine Sklavenfessel aus schwerem Silber mit.
Resi hasste das Geschenk; zum ersten Mal in ihrer Ehe geriet sie außer sich: Er solle sich bloß nicht einbilden, sie versklaven zu können, schrie sie ihn an. Harry kapitulierte vor der Vehemenz ihres Zornes und gelobte tätige Reue. Er wolle sich künftig mehr Zeit für die Familie nehmen. Den nächsten Urlaub verbrachten sie mit ihrem Sohn in St. Martenzee, einem kleinen Badeörtchen an der holländischen Nordseeküste.
Sie quartierten sich abseits der Strandpromenade in einem Holzverschlag ein, der sich Bungalow nannte und von einem zahnlückig grinsenden Russen namens Tassebajow vermietet wurde. Es regnete ohne Unterlass. Das Dach leckte, die Fenster tropften, das Bettzeug schimmelte und die Elektrik sprühte und zischte, bevor sie endgültig ausfiel.
Beschwerden beim Vermieter fruchteten wenig. Tassebajow zuckte nur mit den Achseln: Tsar daleko, sagte er rätselhaft, der Zar ist weit! und wies stoisch zum Himmel. So flüchteten sie schon morgens in einen Kiosk am Strand und wärmten sich dort an einer rotglühenden Elektroheizung auf. Harry bestellte zum zweiten Frühstück Fish and Chips, alten Genever für sich, roten Genever für Resi, Coca-Cola für Leo. Durch feuchte Plastikplanen starrten sie stundenlang auf das trübgraue Meer und wünschten sich nach Hause.
Die langen Abende verbrachten sie im kalten Licht einer Baustellenlampe, die von einem Dieselgenerator gespeist wurde; Tassebajow war schließlich doch tätig geworden. Sie wickelten sich in ihre klammen Bettdecken und spielten bis in die Nacht Monopoly.
Resi nutzte die langen Abende zu einer Generalabrechnung: Harry habe genug herumgespielt! Nette Tänzchen mit schwarzen Weibern würden nicht mehr geduldet; nun sei die Familie dran! Sie wüsste, dass er auch der flotten Köchin in der Akademie nachsteigen würde! Aber wenn er keinen Skandal bei den Frommen wolle, müsse er sich endlich eine solide Stellung suchen!
Harry wehrte sich erbittert. Er warf Resi Selbstsucht vor: Hauptsache, es reiche für den Friseur und das Konditern mit ihrer Frau Pape! Von den Zwängen des Arbeitslebens wüsste sie nichts; er habe nur das Geld heranzuschaffen! Sie solle sich nicht wundern, wenn er das Weite suchen würde!
Nach neun Tagen Dauerregen reisten sie vorzeitig ab. Zu Hause legte Resi nach: Sie warf Harry aus dem Ehebett und ging stumm ihren Geschäften nach. Der Abgestrafte trank Cognac, rauchte Kette und hörte Dvoracs Cellokonzert, bis er erschöpft auf der Wohnzimmercouch zusammenbrach. Nach drei Tagen resignierte er und rief die Bonner Genossen an.
Die konnten helfen: In einer Bundesbehörde wurde auf dem SPD-Ticket eine Planstelle frei. Das Gehalt entsprach dem Sold eines Ministerialrates; auch die Verbeamtung wurde in Aussicht gestellt. Harry bezog eine Bundeswohnung am Fuß des Siebengebirges und wurde solide. Resi hatte gewonnen.
7.
Eingangs der Siebziger hatte die Jugendrevolte auch das verschnarchte Bonn erreicht. Autoritäten waren nicht mehr gefragt. Leo trug die Haare lang und rauchte auf dem Pausenhof. Die Eltern traten nur noch als Gemurmel aus dem Off in Erscheinung. Prägende Gestalten des schwelenden Kulturkampfes waren jetzt die Lehrer:
Studiendirektor Haller, ein passionierter Jäger mit Mensur auf der Wange, schwadronierte davon, seine Oberstufe mit Jagdgewehren auszurüsten, um den Rhein-Sieg-Kreis bis zur letzten Patrone gegen die Bolschewiken zu verteidigen. Haller gab Erdkunde und Englisch. Er sprach ein antiquiertes Bühnenenglisch mit harten Konsonanten, das er vor dem Krieg in einem Brandenburger Seminar gelernt hatte. Seine Rezitationen von Shakespeare-Monologen waren berüchtigt. Ein Referendar aus Oxfordshire, der einen seiner markigen Auftritte erlebte, hielt sich vor Lachen den Bauch und sorgte so für eine denkwürdige Schulstunde.
Der schmächtige Mathelehrer Rudi Zweier sah aus wie Heinrich Himmler. Man erzählte sich, dass er den Rasen in seinem Garten mit der Nagelschere schnitt und junge Obstbäume mit einem Nivelliergerät ausrichtete, um sie in Reih und Glied zu pflanzen. Er brannte für sein Fach und verachtete alle anderen Fächer; nur Physik ließ er gelten. Zweier war cholerisch und ohrfeigte gern. Sein Pensum war gnadenlos und verlangte den Schülern alles ab. Weil Leo es sich leisten konnte, boykottierte er seinen Unterricht. Die Mathestunden verbrachte er mit weiteren Rebellen im Marktcafé. Dort bastelten sie bei Kaffee mit Schuss an einer linken Schülerzeitung.
8.
Durch mehrere Schulwechsel hatte Leo gelernt, strategisch zu denken. Er warf sich auf ehrgeizige Referate, um für den Rest des Jahres Ruhe zu haben. Die elegante Dr. Fiedler in ihren strengen Kostümen war besonders empfänglich: Die Geschichtslehrerin war vom Schulamt verpflichtet worden, der Oberstufe auch Philosophie anzubieten. Sie hatte das nicht studiert; Leo half ihr aus der Klemme: Er hielt ein langes Referat über die Geschichte der Erkenntnistheorie von Platon bis Kant und brauchte dafür sechs Doppelstunden. Danach hatte Dr. Fiedler sich eingearbeitet; Leo war auf Eins in Geschichte und Philosophie abonniert.
Alle Lehrerinnen mochten Leo. Der kleinen, schüchternen Musikreferendarin lieferte er eine Steilvorlage für ihre Prüfung: Er hielt einen Vortrag über die Wurzeln der Rockmusik und unterlegte ihn mit Blues und Jazz aus dem eigenen Plattensortiment. Spirituals und Soul nannte er unpolitische Onkel Tom-Musik. Die Referendarin ergriff die Chance, hielt mit gesungenen Predigten schwarzer Bürgerrechtler dagegen und zitierte Martin Luther King. Die Klasse nahm lebhaft Anteil. Die Prüfungskommission war entzückt.
In Französisch half Leo die Sprachroutine aus dem Saarland: Zur Verblüffung der rotblonden Mademoiselle Arnaud hatte er eine Fabel von La Fontaine auswendig gelernt. Sie bat ihn vor die Klasse; Leo trug beschwingt das Drama vom Wolf und dem Lamm vor. Dabei riskierte er einen Seitenblick: Die Lehrerin hatte beim Zuhören die Schuhe ausgezogen und saß barfuß am Lehrerpult; ihr Minirock war bis zu den sommersprossigen Oberschenkeln hochgerutscht. Sie hatte die Dreißig schon überschritten; das störte ihn nicht beim Träumen.
Die ältliche Chemielehrerin roch nach Buttersäure und zündelte gerne. Leo wurde ihr Komplize: War ein Erlenmeyerkolben explodiert, räumten sie das Labor gemeinsam auf und spielten neue Experimente durch. Sie zeigte ihm, wie man aus Kaliumpermanganat und Glyzerin selbstzündende Brandsätze bauen konnte und sprach von exothermer Reaktion. Leo hätte ihre Expertise schon im Asental brauchen können.
Lateinlehrer Dr. Kastner durfte mit siebzig noch unterrichten, weil Altsprachler rar geworden waren. Der kleine, runde Greis tat es mit Leidenschaft. Als Hellenist hatte er einen Hang zur Knabenliebe und tätschelte Leos Hintern, wenn er ihn zum Skandieren vor die Klasse holte. Dr. Kastner mochte auch junge Mädchen; mit seiner ihm ergebenen Frau beschäftigte er zu Hause französische Au Pairs. Eines Tages brachte er die großäugige, sandbraune Catherine mit in die Schule. Sie war neunzehn und kam aus Guadeloupe. In ihrem Dachstübchen verlor Leo seine Unschuld; das Ehepaar Kastner war entzückt. Die Liebschaft dauerte einen Sommer; dann ging Catherine zum Studium nach Bordeaux.
9.
Leos Held war der kriegsversehrte Klassenlehrer Dr. Severing, der seine Prothese abschnallte, wenn der Beinstumpf schmerzte. Der Deutschlehrer gab prinzipiell keine Eins: Eine sehr gute Leistung sei ihm in zwanzig Jahren Unterricht noch nicht untergekommen, pflegte er zu sagen.
Severing liebte lakonische Kurzgeschichten von Borchert, Böll und Gaiser. Auf Band spielte er der Klasse Radioessays von Arno Schmidt und Reden von Fritz Erler vor, um ihre Sprache zu schulen. Begriffsstutzigen Schülern kam er mit Wieland klassisch derb: Friss deine Knackwurst, Sklav‘ und halt dein Maul! Er bürstete gern gegen den Strich; sein Credo stammte von Enzensberger: Staub blasen in die Lungen der Macht!
Das Vorbild dieses Lehrers ermutigte Leo, eine Gedichtinterpretation von Hänschen klein in die Schülerzeitung zu setzen, in der er die Emanzipation von Mutters Schürzenzipfel empfahl. Sie fand viel Zuspruch; selbst Dr. Severing klopfte ihm anerkennend auf die Schulter.
Der Jungredakteur legte mutig nach. Für die Bundestagswahlen forderte Leo eine Wählerprüfung: Nur wer Wirtschaftssysteme, Parteiprogramme und die parlamentarischen Regeln kenne, dürfe künftig seine Stimme abgeben. Dieser elitäre Ansatz sorgte für Aufruhr in der Lehrerschaft: Die Altnazis schäumten und sprachen von kommunistischen Umtrieben. Christdemokraten dachten an ihre betagten Stammwähler und hielten sich zurück. Die entsetzten Sozis zogen Parallelen zum preußischen Dreiklassenwahlrecht. Allein die feine Dr. Fiedler äußerte leise Sympathie.
Der Skandal amüsierte Dr. Severing. Er nahm Leo beiseite und erzählte ihm vom Börne-Heine-Disput anno 1848. Genüsslich schilderte er den bierseligen deutschen Michel, der in Lesekabinetten Zeitungen verschlang, in verqualmten Destillen das große Wort führte und buckelte, sobald er der Obrigkeit begegnete. Börne habe an die deutsche Republik geglaubt. Doch Heine sprach dem Michel jede Demokratiefähigkeit ab: Die beste Regierungsform für brave Deutsche sei eine Monarchie, hatte er gespottet, es müsse nur ein guter König sein!
Im Frühjahr standen die Abiturprüfungen an. In seiner Deutscharbeit gelang es Leo, den verehrten Doktor zu verblüffen. Er weigerte sich, einen Kafkatext zu interpretieren, begründete die Weigerung schlüssig und schrieb den Text einfach weiter. Severing nahm die Forderung an und ließ seinen Musterschüler im Mündlichen auf Eins prüfen; die Kommission war bass erstaunt. Leo sollte Frauenfiguren miteinander vergleichen, die er schon aus dem Unterricht kannte: Emilia Galotti, Luise Millerin und Rose Bernd. Im Prüfungsgespräch redete er wie ein Buch, lastete den Tod der drei Heldinnen dem Patriarchat an und stellte abschließend die Machtfrage. Er erntete Szenenapplaus bei den Frauen des Kollegiums.