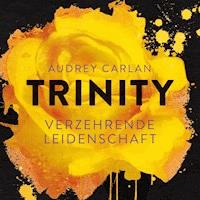2,99 €
Mehr erfahren.
Dunkle Perlen - Erotiknovellen -1. Buch
„Ja vielleicht sind wir Menschen nur dazu geboren, um ruhelos zu suchen bis zum Schluss?“ So schreibt und singt Hannes Wader in einem seiner schönsten Lieder.
Die ruhelose Suche beginnt in den Erotiknovellen in der Zeit des Eisernen Vorhangs, Liebe hinter Stacheldraht, Sehnsucht, Lust, Leidenschaft, Verzweiflung. Ein Mann, der Zeit seines Lebens auf der Suche war… Ob er jemals angekommen ist?
Frivol erzählt, kein Blatt vor dem Mund und trotzdem behutsam, feinfühlig geschildert die erste Liebe zu einer Amerikanerin, als noch nicht daran zu denken war, dass dieser Vorhang einst fallen wird.
Hélène, heimliche Treffen voll glühender Begierde als bereits Licht am Horizont zu sehen war.
Nicht ganz gewöhnliche Liebesgeschichten, die sich um ein Stück jüngerer deutscher Geschichte ranken.
Regenwürmer vertragen kein Coffein - Teil II
Du wirst dich biegen wie ein Halm im Wind. Doch wirst du nicht brechen…
Regenwürmer vertragen kein Coffein. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe. Sie vierzehn, er Mitte vierzig, lernen sie sich kennen, weil seine lockere Bekanntschaft zur Mutter, Mitte dreißig, auf deren Betreiben hin in eine feste Beziehung hinein wachsen soll.
Alles nur Spiel oder der Versuch, eine zerrüttete Familie zu retten? Ein Kampf zwischen Lust, Leidenschaft, Verantwortung und Angst. Gier nach Reichtum, Geltungssucht. Wer bleibt auf der Strecke?
Ein Buch mit sehr viel Herzblut geschrieben, wie der Autor selbst sagt…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Triangel der Lüste - Band 2
Erotikedition
Dunkle Perlen, 1. Buch - Das Buch widme ich Martha BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTriangel der Lüste
Erotikedition
Frank C. Mey
Band II
Überarbeitete Auflage
Text Copyright © 2015/ 2019 Frank C. Mey
Erfurt, Germany
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt Band II
Dunkle Perlen – Erotiknovellen 1. Buch
Dieses Buch widme ich Martha
Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle, und die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas (Offenbarung des Johannes).
Im Buchhandel als Taschenbuch erhältlich unter ISBN 9781091339309
Regenwürmer vertragen kein Coffein – Teil II
Die Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe
Du wirst dich biegen wie ein Halm im Wind. Doch wirst du nicht brechen…
Die Erzählung beruht auf einer wahren Begebenheit. Handlungsorte und Namen der Beteiligten sind frei erfunden.
Im Buchhandel als Taschenbuch erhältlich unter ISBN-9781979329392
Ausführliche Leseproben aus meinen Büchern in meinem Blog
Dunkle Perlen – Erotiknovellen 1. Buch
Du kannst in deinem Leben nicht mit allen Frauen schlafen, aber du solltest es wenigstens versuchen (polnisches Sprichwort).
Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle, und die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas (Offenbarung des Johannes).
Der Mund einer Frau ist nur so lange voller Worte
wie ihr Schoß leer bleibt (arabisches Sprichwort)
Leipzig, Herbst 1987
Wenn Manager (früher nannte man die Leiter oder Direktoren) eines Volkseigenen Betriebes (VEB) der untergegangenen DDR nach Leipzig zur Messe fuhren, unternahmen sie das nicht wie allgemein üblich, um einen Blick auf die neusten internationalen Angebote ihrer Branche zu dem Zwecke zu werfen, eine Investitionsentscheidung vorzubereiten oder eine Kaufentscheidung zu treffen. Sie fuhren lediglich dahin, um zu gucken, was es Neues gibt, das man ohnehin nie bekommen würde. Man drückte sich sprichwörtlich die Nasen platt an den frisch lackierten Maschinen einer schier endlos langen Liste westlicher Hersteller. Die berühmte Ausnahme: man vertrat einen der Betriebe, die eine hervorragende internationale Bedeutung besaßen und Devisen einspielten. Ansonsten musste man sich mit dem begnügen, was das eigene und die sozialistischen Bruderländer anboten. Produkte, die man auf den Weltmärkten, vornehmlich den kapitalistischen, für heiß begehrte Dollars oder D-Mark nicht los wurde. Zu dieser Zeit nahm die Nachfrage nach technischen Anlagen aus der DDR ohnehin spürbar ab, man hatte die Einführung mikroelektronischer Steuerungen schlichtweg verschlafen.
Doch selbst Maschinen oder Fahrzeuge aus eigener Herstellung waren knapp. Da stand so manch ein Betriebsdirektor, den Tränen nah vor dem neusten Schlager eines bekannten österreichischen Baumaschinenherstellers; vor seinem inneren Auge das Bild seines klappernden und quietschenden Baggers im heimischen Betrieb, dem die Reparaturabteilung gerade mit illegal beschafften Ersatzteilen ein drittes oder viertes Leben eingehaucht hatte.
Trotzdem fuhr man da hin, wenn auch die Augen tränten. Schließlich traf sich dort die Welt, und wenn man schon nichts zu kaufen imstande war, durfte man wenigstens, wenn auch nur für ein paar Tage, in eine Welt eintauchen, die man ansonsten allein aus dem Westfernsehen oder aus den in den Kinos zugelassenen Westfilmen kannte.
Wie jedes Jahr im Frühjahr oder Herbst, wurden bereits Wochen vor Beginn der Messe alle verfügbaren Baufirmen aus dem Umland und der Stadt zusammen gezogen, um potemkinsche Dörfer aufzubauen oder Scheinbaustellen einzurichten. Letztere dienten jedes Mal während der Ausstellung dazu, Umleitungsschilder wegen angeblicher Baustellen an den Zufahrten zu jenen Stadtteilen aufzustellen, die bereits so weit verfallen waren, dass nicht einmal mehr Scheinfassaden zu deren Kaschierung verhalfen. Die vielen Besucher aus dem Westen sollten schließlich davon überzeugt werden, dass der siegreiche Sozialismus den Kapitalismus bereits fast eingeholt hatte und gerade dabei war, den Überholvorgang einzuleiten.
Nun gut, fast – schlappe zwanzig Jahre fehlten in der Entwicklung, aber was waren schon zwanzig Jahre auf dem Weg zum Kommunismus, der Ordnung, die der Menschheit die Glückseligkeit für alle Ewigkeit bringen würde – amen.
Die Bauunternehmen der Stadt und des Umlandes beschäftigte man das ganze Jahr über mit mehr als der Hälfte ihrer Leistungsfähigkeit damit, die Messeeinrichtungen instand zu halten, da blieb für die Altstadt, die mehr und mehr verfiel, nichts übrig. Vielleicht war gerade das einer der Hauptgründe dafür, dass im Wendeherbst 1989 die größten Demonstrationen in Leipzig stattfanden.
Wir schrieben das Jahr 1987. Herbst, ein trüber zudem. Die Jahreszeit also, in der das Grau der bröckelnden Fassaden in der Leipziger Altstadt noch grauer erschien als sonst. Selbst die Blumenkästen an Fenstern und Balkonen, die dem Verfall im Sommer bisweilen einen gewissen Hauch von Charme verliehen, waren mittlerweile der kalten Witterung gewichen.
Wenige Wochen zuvor besuchte das Staatsoberhaupt des ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Acker, Generalsekretär der Sozialistischen Einheitsbreipartei, und was er nicht noch alles war. Einer dieser typischen Multifunktionäre eben, die alles konnten und machten, nur nichts davon richtig; eben jener hatte gerade dem Erzfeind in Bonn die Ehre zu Teil werden lassen, diesem den seit Langem gewünschten Staatsbesuch abzustatten. Ob der Genosse aus dem Osten Geschenke für das arme, geschundene Proletariat des Westens mitbrachte, ist leider nicht überliefert. Jedenfalls schenkte er einem bekannten Musiker Westdeutschlands, der ihn wenige Jahre zuvor mit dem „Sonderzug nach Pankow“ auf das Übelste verunglimpft hatte, eine Schalmei.
Auf dem Rückweg über München ließ der wackere Genosse sich sogar nebenbei schmutzige vier Milliarden D-Mark aufschwatzen, die man zwar nicht brauchte; aber gut, ehe man sich schlagen ließ, griff man lieber zu. Das ganze Übel eingefädelt von einem dickbäuchigen bayrischen Politiker, der bis dahin im Osten schlichtweg als der Antichrist galt, der Kommunistenfresser schlechthin.
Dass der inzwischen heller eingefärbte roter Bruder aus Moskau ein gutes Jahr später das Zehnfache von den Amerikanern, ein weiteres Jahr später einige Milliarden aus den Händen des Bundeskanzlers einstreichen und dafür die Kampfgenossen des Ostens im Regen stehen lassen würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand, der alternde Herr Honecker am allerwenigsten.
Den Untergang vermochte schließlich weder das eine noch das andere zu verhindern. Doch für die Paladine der Macht schien in besagtem Jahre 87 die Versorgung mit Apfelsinen und Bananen in den Sonderverkaufsstellen der Staatsfunktionäre für alle Ewigkeit gesichert zu sein, gelegentlich ein neuer Pornofilm für den Generalsekretär inklusive.
Man müsse eben den faulenden und sterbenden Kapitalismus, der bereits an allen Ecken zu stinken begann, schädigen wo es nur ging, so erklärte die Partei-Presse in dieser Zeit den Bürgern die Zustände. Die Postbediensteten in den Verteilerstellen des Ostens hielten sich die Nasen zu, wenn sie die Westpakete von den Bändern nahmen; eine Zumutung für die Menschen der DDR, dass ihnen die Verwandten aus dem Westen diesen Gestank obendrein in die Wohnzimmer lieferten.
Wie andere aus allen Teilen unserer schönen sozialistischen Heimat, besuchte ich in eben diesem Jahr die Leipziger Herbstmesse aus den oben genannten Gründen: tags zum Gucken, abends zum Trinken. Manchmal traf man auf Westbesucher, interessante Gespräche eingeschlossen. Ein Vorteil solcher Messe-Besuche bestand darin, dass man die Kosten des Aufenthaltes zu einem erheblichen Teil über die Firma abrechen durfte.
Mein Name: Frank Mälzer. Seinerzeit Fachdirektor in einem Baubetrieb im Süden der DDR, übernachtete ich in einem Privatquartier. Das Los all derer, die nicht zu den bedeutenderen Besuchern dieser Nabelschau der angeblichen Überlegenheit des Sozialismus gehörten. Die übel riechenden Westler schloss man hingegen in den besten Hotels der Stadt weg.
Halb Leipzig vermietete während der Messe legal, halb legal, illegal Privatzimmer, in den Platten-Neubauten ebenso wie in diesen halb verfallenen Teilen der Altstadt. Nicht selten kam es vor, dass sich alle Mitglieder einer Familie das Wohnzimmer zum Schlafen teilten, während Schlaf- und Kinderzimmer an Messegäste vermietet wurden; teils zu stolzen Preisen, versteht sich. Doch die Hotels waren in dieser Zeit schier unbezahlbar, zudem überwiegend ausländischen Gästen vorbehalten. Ausnahmen gab es selbstverständlich für Vertreter der Partei- und Staatsführung wie für hoch gestellte Wirtschaftsvertreter der DDR.
Wem das Glück zu Teil wurde, über die Flüsterpropaganda zufällig in den Haushalt einer alleinstehenden Frau zu gelangen, genoss, sofern diese den persönlichen Vorstellungen entsprach, den Vorteil, den Genuss des Abends oder der Nacht sprichwörtlich vor der Schlafzimmertür zu haben. Der Glückliche musste sich nicht in den vielen Bars der Stadt um ein passendes Herzblatt bemühen. Letzteres gestaltete sich ohnehin nicht so einfach; wenigstens dann nicht, wenn man den Blick auf die etwas jüngeren, die besser aussehenden Frauen fokussierte. Diese nutzten die Messetage lieber, sich des Nachts ein paar Westmark dazu zu verdienen oder sie waren aus Gründen des alltäglichen Kampfes gegen den kapitalistischen Klassenfeind ohnehin von der „Stasi“ auf Westler angesetzt.
So mancher höher gestellte Bundesbürger oder Besucher aus dem westlichen Ausland, der während seines Messebesuches die sprichwörtliche Liberalität der Ostfrauen in punkto Sex ausprobieren durfte, wunderte sich nicht selten wenige Wochen später, wenn ihm von einer unauffällig gekleideten Person ein Couvert voller delikater Fotos übergeben wurde. Bisweilen war das der Beginn einer für beide Seiten fruchtbaren Zusammenarbeit; die Ostgeheimdienste erhielten Informationen, der Bedienstete aus dem Westen ein „kleines“ Trinkgeld zusätzlich zu seinen bescheidenen Einkünften.
Vielleicht hatten die beiden Bundestagsmitglieder aus CDU und CSU, die sich im konstruktiven Misstrauensvotum gegen Willy Brandt im Jahre 1972 der Stimme enthielten, davor zur Messe oder während eines ähnlichen Anlasses in einem Interhotel der DDR übernachtet? Wer weiß das schon so ganz genau?
So verwunderte es jedenfalls nicht, dass sich eine Reihe Politiker des Westens nach der Wende gegen die Öffnung der Stasi-Akten aussprach. Vielleicht hatte der eine oder andere Grund zur Besorgnis. Und die Rosenholz-Dateien? Nun ja, wie sang der große Otto einst? Jesus lief nicht über `n See, er schwamm drüber, Schwamm drüber. Alles unterliegt eben seiner besonderen Ordnung.
Im Gegensatz zur Mehrheit meiner Kollegen, die lediglich über die von den Geldpressen der DDR reichlich gedruckten oder gestanzten Lappen und Alu-Chips verfügten, war ich stolzer Besitzer einiger D-Mark. An die gelangte ich über eine Erbschaft. Das Geld war sicher auf einem Bankkonto in Kassel deponiert, von dem meine Mutter regelmäßig abhob. Sie genoss zu diesem Zeitpunkt bereits den Vorteil, Rentnerin zu sein; somit besaß sie das unschätzbare Privileg, den fürsorglichen sozialistischen Staat über einen der wenigen Grenzübergänge verlassen und wieder betreten zu dürfen. Andere bezahlten dafür mit abgerissenen Gliedmaßen oder langen Zuchthausstrafen, wurde man ihrer habhaft. Zu Tode kam selbstverständlich keiner dieser Republikflüchtlinge, nein, man schoss doch nicht auf wehrlose Menschen! Im menschenfreundlichsten aller Systeme. Und wenn doch, handelte es sich um vereinzelte, bedauerliche Unfälle. Wer kann schon etwas dafür, wenn andere in als solche gekennzeichnete Minenfelder hinein rennen? Oder wenn sich jemand fahrlässig in das Schussfeld gerade das Schießen übender Grenzsoldaten begibt? Schließlich kann jeder auf seinem eigenen Territorium Minen verlegen, so viele er will oder Schießübungen abhalten. Die DDR-Bürger hätten doch wissen müssen, dass letzteres besonders häufig an den Westgrenzen stattfand.
Für den, der in der DDR über Westgeld verfügte, kamen derartige Wagnisse ohnehin nicht in Frage. Es lebte sich, verfügte man über die Möglichkeit, regelmäßig im Intershop einkaufen zu dürfen, sehr gut in diesem „Ländle“ des allgemeinen Mangels.
Mit der harten D-Mark in der Tasche konnte man sich in Leipzig, wie übrigens überall im Osten, einen angenehmen Aufenthalt finanzieren. Angefangen bei einer ordentlichen Privatunterkunft, wenn man den Wirtsleuten zu den von der Firma vorgestreckten Ost-Mark ein paar D-Mark zusteckte, bis hin zum Besuch bestimmter Restaurants und Bars, in denen während der Messetage ausschließlich in harter Westwährung bezahlt werden durfte.
Das Wunder begann an einem Donnerstagabend in einer Leipziger Hotelbar, der letzte Abend in Leipzig. Die Messe besuchte ich gemeinsam mit einem Kollegen, von dem ich meinte, ihm uneingeschränkt Vertrauen zu können. Klaus, ich wusste, dass er ebenfalls D-Mark besaß. Die Tante aus dem Westen, sein Goldesel, wie er sie gelegentlich nannte, ließ nach jedem Besuch reichlich davon zurück.
Mir waren zwar keine Gesetze bekannt, die DDR-Bürgern den Besuch solcher für westliche Ausländer und deren Gäste vorbehaltener Etablissements verboten, doch gab es nicht selten Sonderregelungen, die nicht in öffentlich bekannte Gesetze gegossen waren. Außerdem waren derartige Verbote sowieso nicht nötig, da allein die Währung, die man in der Tasche trug, die Rolle der Eintrittskarte übernahm. Aber man konnte nie genau wissen, wer da herum spähte. Wenigstens rochen wir nach Westen, da wir unsere Desodorants ebenfalls im Intershop einkauften.
So viel sei angemerkt: wie ich nach der Wende erfuhr, spitzelte Klaus für die Stasi. Man hatte ihn mit seinem „Goldesel“ erpresst.
Als wir gegen einundzwanzig Uhr erschienen, war die Bar bereits gut gefüllt. Und wie in Hotelbars der verlorenen ostdeutschen Republik üblich, spielte eine Band, wie ebenso üblich, ausschließlich Titel aus dem westlichen Ausland. Das war im Übrigen generell so, nicht nur zur Messe und in Läden, in denen überwiegend Gäste aus dem westlichen Ausland verkehrten. Nicht dass es in der DDR keine gute Musik gegeben hätte, allein tanzen konnte man nach den wenigsten Titeln. Den Professoren und Professorinnen an den Musikhochschulen lag der „Lipsi“ in den Knochen und Hirnen, der zudem in Leipzig auf Geheiß des früheren Partei- und Staatschefs Ulbricht erfunden wurde.
„Immer dieses eintönige yea, yea, yea aus dem Westen“, bemerkte der einst. „Wir brauchen eine eigene Musik, die den Bedürfnissen und Gefühlen unserer Werktätigen entspricht.“ Flugs erhielt ein Komponist den Auftrag, eine solche zu erfinden. Heraus kam besagter „Lipsi“, beschwingte Musik im zweiunddreißig vierzehntel Takt, eine Mischung aus Calypso und Wiener Walzer, nach der zu tanzen man sechs Beine benötigt hätte.
Bars wie diese, mit Musik und Tanz, bedienten in aller Regel das Bedürfnis nach Annäherung. Vorwiegend der männlichen Besucher an die Spezies des anderen Geschlechts, da es die im Westen reichlich vorhandenen Kontaktbars mit solch sinnlichen Bezeichnungen wie Privatklub, Saunaklub und anderen in der DDR nicht gab, jedenfalls nicht offiziell.
War es die Regel, dass andernorts im normalen Alltag die Frauen von den Männern gejagt wurden, herrschte hier eine andere Verteilung der Karten. Die anwesenden DDR-Bürgerinnen, ob vom Volkseigenen Handelsbetrieb, der Vereinigung Interhotel oder vom Ministerium für Staatssicherheit zur Unterhaltung der Westgäste delegiert, ließen im Allgemeinen keinen Zweifel daran aufkommen, zu welchem Zwecke sie sich einfanden. Ein regelrechtes Dorado für die Messegäste, musste man doch im Westen für den Dienst der Dame am Manne einige Scheine aufwenden. Hier genügten Drinks, ein Paar neuer Damenstrumpfhosen, schicke Dessous oder einige wenige D-Mark nebenher. Es soll sogar Frauen gegeben haben, die es für ein Stück Lux-Seife taten.
Wir verhielten uns möglichst unauffällig, um nicht sofort nach unserem Erscheinen als Ostbürger enttarnt zu werden. Man konnte nach West riechen, westlich gekleidet sein, dazu D-Mark in der Tasche tragen, doch eines würde in jedem Falle bemerkt werden: unsere unverkennbare Mundart, die man in keinem westdeutschen Bundesland sprach. Wenn man zufällig an eine der Besucherinnen geraten wäre, die im höheren Regierungsauftrag, sozusagen operativ, unterwegs war, hätte das fatale Folgen haben können. Man musste gewissermaßen auf der Hut sein, wollte man das gesteckte Ziel erreichen, des Nachts in irgendeinem Bett zu landen.
Außerdem gab es ein zusätzliches Problem. Wir wohnten nicht im Hotel, weder in diesem, noch in einem anderen, sondern in einem Privatquartier. In diesem Falle leider nicht im Haushalt einer alleinstehenden Leipzigerin, sondern in einem älteren Plattenbau bei einer Familie mit zwei Kindern.
Die Mehrheit der anwesenden Tänzerinnen erwartete wohlweißlich, dass man sie in ein Interhotelzimmer entführen würde. Zumal einige von denen, genauso wohlweißlich, zur Aufbesserung des Familieneinkommens beitrugen, und zu Hause womöglich ein Gatte wartete, der in der Messewoche die Aufsicht der Kinder übernahm.
„Meinste, hier läuft was?“, fragte Klaus gelangweilt, nachdem einer der Bar-Kellner die zweite Runde Campari-Soda vor uns abgestellt hatte. Währenddessen knisterte er auffällig mit einem Zwanzig D-Markschein, weil man die Drinks sofort bezahlen musste. Campari mit Soda, langsam getrunken, bietet den Vorteil, dass man relativ lange nüchtern bleibt.
„Warum nicht? Schau dich um, viel mehr Kühe als Bullen. Einige der Beschäler stehen kurz vor der Rente“, antwortete ich hoffnungsvoll. „Andere sind schon ziemlich alkoholisiert“, fügte ich mit dezentem Fingerzeig auf zwei ältere Herren, die neben uns an der Bar standen, hinzu. Deren bayrischer Dialekt war nicht zu überhören.
„Und was sagste, wenn dich eine fragt, ob du sie mit auf dein Zimmer nimmst?“ Die zu befürchtende Frage. War man zwar in der Lage, allein mit der Währung die Herzen der Damen zu öffnen, bedurfte es schließlich des geeigneten Ortes, an dem das Öffnen der Schenkel in möglichst bequemer Lage folgen konnte.
„Abwarten und Tee trinken, da warten bestimmt ein paar alleinstehende Muttis, die dich mitnehmen. Notfalls steckst du ihr zusätzlich einen Zehner in den Schlüpfer, bevor du dein Rohr in Stellung bringst“, antwortete ich so leise wie möglich, um nicht als Ossi enttarnt zu werden. Weil er gelangweilt grinste, fragte ich zu seiner Aufmunterung, ob er den Witz von den Mecklenburgern im Intershop kenne.
„Leg los“, erwiderte er. „Also“, begann ich, ebenso leise wie schon davor:
„Ein Bauer aus Mecklenburg fährt mit der Gattin zum ersten Mal in die Hauptstadt. Zufällig kommen sie am großen Inter-Shop, Bahnhof Friedrichstraße, vorbei. Der Bauer: Kiek, Moddern, wat hi nich all to köpen jift (Schau, Mutter, was es hier nicht alles zu kaufen gibt). Sie betreten den Laden, er schaut auf die Preisschilder. Nich ma tüer, sagt er (nicht einmal teuer). Beide nehmen sie sich einen Einkaufswagen, den sie bis über den Rand vollpacken. Eine Verkäuferin wird stutzig. Sie spricht beide an: Meine Herrschaften, besitzen sie denn auch Devisen? Worauf der Bauer antwortet: Jo, min Deern, de Wischen hämpf noch, de Äcker hemms us wechnomt. (Ja, mein Mädchen, die Wiesen haben wir noch, die Äcker haben sie uns weggenommen).
Wir lachten beide, bis zwei Damen vom Eingang her die Bar ansteuerten. Direkt auf die freie Lücke zu, in der kurz zuvor die Bayern standen. Beide unterhielten sie sich angeregt miteinander, fast schien es aufgeregt. Von allem, was sich um sie herum in der mittlerweile sehr gut gefüllten Bar abspielte, nahmen sie überhaupt keine Notiz. Selbst nachdem sie sich neben uns an den Rand der Bar stellten, setzten sie ihr Gespräch eifrig fort. Ich bemerkte sofort, dass sie französisch sprachen.
„Die sind ` ne Nummer zu groß für uns“, raunte mein Begleiter in meinen Nacken hinein, nachdem er bemerkte, dass ich mich den jungen Frauen zuwenden wollte. Denselben Eindruck gewann ich im ersten Moment ebenfalls, da keine von beiden uns auch nur eines einzigen Blickes würdigte. Selbst als die kleinere sich zu mir drehte, um dem Barkeeper mit einem Wink zu signalisieren, dass sie eine Bestellung aufgeben wolle, kam ich mir wie Luft vor.
Beide wesentlich jünger als wir, schätzte ich sie Anfang bis Mitte der Zwanzig. Sie sahen umwerfend gut aus. Das Besondere: die kleinere war von dunkler Hautfarbe. Nicht schwarz, eher diese kaffeebraune Färbung, wie man sie von den Kubanerinnen kannte, derer es in der DDR einige wenige gab. Zu denen Kontakt aufzunehmen, gestaltete sich leider außerordentlich schwierig.
Von einem Bekannten, in dessen Firma Kubaner ausgebildet wurden, erfuhr ich, dass es den Damen strengstens untersagt war, sich mit deutschen Männern einzulassen, den Männern umgekehrt ebenso. Bei Verstoß drohte die unwiderrufliche Rückführung. Ob sich alle daran hielten, vermochte ich nie zu beurteilen. Möglicherweise hielten sie sich daran, da das Leben in der DDR, im Gegensatz zu Kuba, für sie das Schlaraffenland gewesen sein muss.
Nun stand eine solch bezaubernde Frau direkt neben mir. Sie trug eine hoch auf toupierte Frisur, den in der DDR damals hinreichend bekannten „Angela-Davis-Schnitt“. Benannt nach der gleichnamigen amerikanischen Bürgerrechtlerin und Kommunistin, die ein um das andere Jahr durch die osteuropäischen Medien gejagt wurde, um den Menschen zu suggerieren, der Kommunismus würde bald in der Hölle des Kapitalismus, den USA, Einzug halten.
Ihre Miene wirkte gütig. Ein Gesicht, aus dem heraus zwei Augen wie Diamanten in sympathischer Freundlichkeit funkelten. Einen einzigen Moment nur sah ich diese leuchtenden Augen, während sie sich dem Barkeeper zuwandte. So wie sie lächelte, trug sie etwas Mädchenhaftes in ihrem Benehmen, geradezu unschuldig. Selbst der Umstand, dass sie fortwährend heftig gestikulierte und energisch mit ihrer Begleiterin stritt, änderte nichts an ihrem heiteren Ausdruck.
Die hellhäutige Begleiterin ein Rasseweib von Geblüt, ein Reptil von einer Frau. Mehr als einen Kopf größer als die dunkelhäutige. Unter dem kurzen Rock Beine auf High Heels, lang und schlank wie griechische Tempelsäulen. Üppige Brüste, die auf und ab hüpften, während sie beim Sprechen unablässig die Arme bewegte. Fein geschnittene Gesichtszüge, die streng wirkten, so wie sie sich gebärdete. Das mag am Thema des Gesprächs gelegen haben, von dem ich kein Wort verstand. Sie warf mir einen kurzen, abschätzenden Blick zu, nachdem ich sie ansah. Diesen „Was willst du von mir, du Knirps“ Blick.
Mir war das Glück zuteil geworden, in der DDR eine Oberschule besuchen zu dürfen, in der, neben Russisch, der Fremdsprache des Ostens Nummer eins und Englisch, zusätzlich die Französische Sprache gelehrt wurde. Wenn wir Ossis schon nicht reisen durften, lernte man wenigstens die Sprachen der Länder, in die man gern einmal gefahren wäre. Selbst wenn es ein Traum blieb, sich in Paris unter dem Eiffelturm dereinst mit einem richtigen Franzosen zu unterhalten. Die Schulzeit lag bereits einige Jahre zurück, bei mir fünfzehn an der Zahl, seit dem Abitur. Von den ohnehin dürftigen Französisch-Kenntnissen, die man uns vermittelte, war nicht viel übrig geblieben.
„Einen Versuch ist es wert“, raunte ich zurück. Weil diese beiden Perlen neben uns standen, räumte ich bereitwillig meinen Hocker. Anschließend tippte ich der Dunkelhäutigen, die mit dem Rücken zu mir stand, sanft auf die Schulter. Das Wort für Stuhl, „chaise“, hatte ich mir ohnehin wegen der Ähnlichkeit zu einem wenig beliebten deutschen Wort mit völlig anderer Bedeutung gemerkt. In brüchigem Französisch stammelte ich: „Madame, ma chaise s`il vous plaît.“
Wirkte ihr Blick in dem Moment, als ich sie antippte, erschreckend genervt - wahrscheinlich hielt sie es für einen dieser üblichen Annäherungsversuche - hellte sich derselbe augenblicklich auf, nachdem sie bemerkte, dass ich ihr meinen Barhocker anbot. Die Verwunderung in ihren Augen, weil ich sie in ihrer Sprache ansprach, war nicht zu übersehen. Ihre wunderschönen vollen Lippen zu einem „O“ geformt, lächelte sie mich geradezu einladend an, als sie erwiderte:
„Oh, le monsieur parle français?“
„Oui un peu“, dazu reichte es gerade. Mehr wäre mir bei der Aufregung, die mich in diesem Moment ergriff, ohnehin nicht eingefallen. Genau genommen rechnete ich überhaupt nicht mit einer Reaktion. Unsere Nachbarinnen erweckten nicht gerade den Eindruck, dass sie sich in dieser Bar über einen längeren Zeitraum dem Amüsement der übrigen Besucher hingeben wollten. Eher erinnerten sie mit ihrer nicht abreißen wollenden Diskussion daran, dass sie von einer Veranstaltung kommen, die ihre Gemüter sehr erhitzt zu haben schien.
Zu meiner großen Überraschung nahm die junge Dame meine Einladung an. Sie stützte sich sogar an meinem Oberarm ab, als sie auf den frei gewordenen Barhocker rutschte. Sie stützte sich an meinem Oberarm, fast oben an der Schulter. Welche Wonne, wie sehr wünschte ich mir in diesem Moment, kein Jackett und kein Hemd zu tragen, um diese zierliche Hand auf meiner Haut spüren zu dürfen. Allein die Berührung durch mehrere Lagen Stoff hindurch, Futter und Umnäher inbegriffen, elektrisierte mich.
Sie trug einen kurzen schwarzen Rock aus hauchdünnem Nappa-Leder, der sich ihrer bezaubernden Figur anpasste wie eine zweite Haut. Dazu eine weiße Seidenbluse mit einer Knopfleiste, die genau zwischen ihren Brüsten endete. Darüber eine cremefarbene Jacke aus demselben Material wie der Rock. Weil diese nicht zugeknöpft war, zeichneten sich ihre kleinen, spitzen Brüste, von einem dünnen BH gehalten, deutlich unter der Bluse ab. Während sie auf den Hocker rutschte, spreizte sie die Beine, die in ihrem Reiz denen der Begleiterin in nichts aus dem Wege gingen. Ein winziger Spalt, doch der genügte mir, um einen heimlichen Blick an das begehrte Ende der Innenseiten ihrer Oberschenkel zu werfen. Dahin, wo durch den dünnen Stoff der Feinstrumpfhose ein dunkelrotes Höschen blitzte. Dahinter das süßeste Tabu der Frau, wie es Shade Jahre später besingen sollte.
Trotz ebenfalls überhoher Pumps, war sie kleiner als ich. Das stellte ich bereits zufrieden fest, als sie neben mir stand. Dennoch, die Beinlänge im Verhältnis zum Oberkörper sehr gut proportioniert, was man bei kleineren Frauen nicht allzu oft antrifft. Ihre hochhackigen Schuhe verlängerten die Beine optisch um ein Weiteres. Ihr Unterbau strahlte in der Erhabenheit zweier glänzender Säulen aus Ebenholz, deren inneres Ende sich, wie sie vor mir saß, deutlich durch das dünne weiche Leder abzeichnete.
Was mochte sich hinter diesem Vorhang verbergen? Versucht, mir diesen fein geschliffenen Diamanten ohne Hüllen vorzustellen, schloss ich für einen winzigen Augenblick die Augen. Was hätte ich dafür gegeben, dieses Juwel behutsam aus seiner Fassung zu nehmen, es von allen Seiten zu betrachten, zu streicheln, um ein einziges Mal einzutauchen in den von Schweißperlen gesäumten Rand dieses endlos tiefen Schlunds, dieser uns Männer ewig lockenden Spalte.
„Merci monsieur“, murmelte sie mehrmals. „Très sympathique“. Während sie sprach, überschüttete sie mich geradezu mit einem nicht enden wollenden, einnehmenden Lächeln, den bezaubernden Mund in verschiedensten Formen dargeboten. Jetzt einen Arm um diese schlanke Hüfte legen, jetzt diese großen, weichen Lippen küssen, ging es mir schlagartig durch den Kopf. Ein warmer Schauer erreichte bereits die Region, die ich in dieser Nacht zu aktivieren gedachte. Mit ihr? Ein Traum!
Mein Begleiter indes, nachdem er das Entgegenkommen meiner Angebeteten bemerkte, rutschte ebenfalls von seinem Sessel. Mit freundlicher Geste der Hellhäutigen gegenüber, zeigte er auf den zweiten frei gewordenen Platz. Doch die reagierte mit deutlich ablehnender Handbewegung. „Non, non merci“, der Blick ähnlich dem, den ich von ihr bereits erhalten hatte.
Sie wirkte außerordentlich distanziert. Das wechselte in Unmut, nachdem ihre Begleiterin meine Einladung annahm. Sie stieß mehrere Wortsalven aus, deren Inhalt ich nicht verstand. Ihre Gestik verriet hingegen, dass sie über den Verlauf der Dinge nicht sonderlich glücklich zu sein schien. Doch die Perle vor mir reagierte gelassen mit einem milden, sanft-freundlichen Lächeln. So als gingen die Worte der Freundin ohne jegliche Wirkung an ihr vorbei.
„Vergiss es, Mälzer!“, knurrte Klaus mir zu, während er missmutig seinen Platz wieder einnahm. Doch in mein Inneres hinein war bereits dieser Sturm gefahren, der uns jedes Mal ergreift, wenn eine solch wunderschöne Frucht in greifbare Nähe rückt. Die Art, wie diese junge Dame bis dahin reagierte, bestärkte mich in der Hoffnung, der Abend könnte einiges mehr mit sich bringen als einen Small Talk an der Bar eines Leipziger Interhotels.
„Êtes-vous allemand.“ Ihre Stimme glockenklar, hell wie das Zwitschern einer Bachstelze. „Sie sind Deutscher“, das verstand ich. Nicht als Frage formuliert, sondern als Feststellung. Sicher unschwer zu erraten angesichts meiner auffällig zerhackten Französisch-Kenntnisse mit garantiert deutschem Akzent.
Ich nickte: „Oui ma dame.“ Weil meine Kehle bereits auszutrocknen drohte, griff ich mit zitternder Hand nach meinem Glas.
„Wir können Deutsch miteinander reden, wenn ihnen das lieber sein sollte“, trällerte sie in sehr gutem, fehlerfreiem Deutsch, untermalt mit diesem wunderbar weichen französischen Akzent. „Wohnen sie in West oder Ost?“
Dazwischen schoss die andere eine neue Wort-Salve, die meine Gesprächspartnerin mit eben demselben Lächeln quittierte, wie bereits Minuten zuvor.
„Cécile“, vermutlich der Vorname der Dame. „Cécile, calme, un peu de patience“, die Antwort an Cécile. Sie senkte die Stimme, was derselben einen energischen Unterton verlieh. Das Wort „Calme“ verstand ich, die Calmenzone am Äquator, die Zone der ruhigen Winde, ruhig also, die Freundin sollte sich beruhigen.
Der Dialog zwischen den beiden verschaffte mir Aufschub bis zur Beantwortung der Frage, ob ich oder wir aus Ost oder West kämen. Ich sah keinen Grund, die Unwahrheit zu sagen. Um eine dieser Damen, die mit einem Spähauftrag in der Tasche diese Bar besuchten oder einfach allein des Vergnügens oder der Jagd nach Westgeld willen, handelte es sich mit Sicherheit nicht.
„Aus dem Osten, Madame“, antwortete ich, nachdem sie sich mir wieder zuwandte. „Aus dem Süden des Ostens.“ Sie zog die Stirn kraus, die Wortverbindung: aus dem Süden des Ostens schien sie nicht verstanden zu haben.
„Quoi?“ Sie korrigierte sich sofort auf Deutsch: „Was, wie nun, Osten oder Süden?“ Jetzt wirkte sie nahezu infantil, kindliches Unverständnis im Blick. Ein niedliches Kindchen, würde man sagen, gehörte sie einer anderen Altersgruppe an. Doch ihre Augen behielten stets dieses Leuchten, diesen freundlichen, neugierigen Glanz.
„Aus dem Osten …“, präzisierte ich. „Also exakt ausgedrückt aus der DDR!“
„Ma chère“, warf die Begleiterin ihre Worte abermals ungeduldig wie einen Stein zwischen uns. Ein weiteres Mal von meiner Gesprächspartnerin abgewiesen.
Hellte sich deren bezauberndes Gesicht deutlich auf, nachdem ich ihr auf Französisch den Hocker anbot, nahm nach meinen letzten Worten ihre Miene eine Färbung an, als schaue sie an einem klaren, hellen Sommertag der aufgehenden Sonne entgegen.
„Oh, ah“, sie hob den Kopf. „Aus der DDR, aus Ostdeutschland?“ Das Wort „DDR“ verschluckte sie, während der zweite Satzteil fast wie eine Entschuldigung dafür klang, dass sie dieses Wort „DDR“ überhaupt in den Mund nahm. Der Grund dafür war mir allgegenwärtig, gab es doch in der Sichtweise des Westens Jahrzehnte lang diese „DDR“ überhaupt nicht. Später, nach Brandts neuer Ostpolitik, setzte man sie in Gänsefüßchen und erst seit dem Besuch Honeckers beim (gesamt-)deutschen Bundeskanzler, wenige Wochen zuvor im selben Jahr, hörte man plötzlich diese Staatsbezeichnung in den westlichen Medien. Einem Gänsefüßchen- oder einem überhaupt nicht existierenden Staat konnte man schließlich keinen Vier-Milliarden-Kredit gewähren, das war schon nachvollziehbar. Mich störte das allerdings herzlich wenig, da ich, eine kurze Episode ausgeschlossen, nie zu den Anbetern dieses missglückten Feldversuchs der Errichtung eines Arbeiter- und Bauern-Staates auf deutschem Acker gehörte.
Sie habe bereits sehr viel Gutes über mein Heimatland gehört, fuhr sie plötzlich in einem regelrechten Redeschwall fort. Ich war mir unter den zunehmenden Lobesäußerungen nicht mehr sicher, ob sie das alles ernst meinte oder ob sie mich auf den Arm nehmen wollte.
Leider habe sie in den paar Tagen, die sie hier anlässlich der Leipziger Messe verbringe, überhaupt keine Zeit, sich umzusehen. Es gäbe ständig ein und denselben Weg: frühmorgens vom Hotel mit dem Taxi zur Messe und abends zurück. Danach sei man stets völlig übermüdet, einzig den Wunsch, das Bett aufzusuchen oder vorher einen Drink an der Bar zu nehmen.
Während der letzten Worte schielte sie lächelnd zu Cécile, die ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trat. Offenbar sprach die kein einziges Wort Deutsch.
Mein Begleiter nahm von unserem Gespräch kaum Notiz. Zur Seite gedreht spähte er unentwegt in das Geschehen um uns herum. Hin und wieder sah er mich fordernd an: Verschwende nicht deine und unsere Zeit mit diesen Fasanen, hier gibt es genügend anderes Wild!
Bei mir hingegen wuchs die Neugier mit jedem neuen Satz, den die junge Frau über unseren hoch gelobten sozialistischen Staat sprach. Woraus sie wohl all diese Erkenntnisse geschöpft haben mochte, dachte ich mehrmals. Doch wollte ich sie nicht mit Fragen unterbrechen, weil sie sich mittlerweile gestikulierend und mit vollem Körpereinsatz derart in ihr Thema vertieft hatte, dass ihr nicht einmal der inzwischen sehr legere Sitz ihrer Kleidung, speziell die Positionierung ihres Rocksaumes aufgefallen war. Letzterer war Millimeter für Millimeter nach oben gerutscht. Aus meiner Perspektive heraus bot sich dauerhaft all das meinem Blick, was ich Minuten zuvor nur streifte.
Allein die ungehinderte Betrachtung des Verlaufes ihrer Schenkelkonturen bis hin an den magischen Ort hinauf, an dem sich dieses Bermudadreieck auftürmt, versetzte mich regelrecht in Verzückung. Meine Augen wanderten so lange zwischen ihrem strahlenden Gesicht und diesen beiden kaffeebraunen Säulen hin und her, bis sie es schließlich bemerkt zu haben schien. Ein verlegenes Lächeln, während sie den Rock nach unten zupfte. Fast glaubte ich, ein flüchtiges Schmunzeln, verbunden mit einem noch flüchtigeren Kopfschütteln, bemerkt zu haben, bevor sie, unbeeindruckt von diesem Zwischenfall, weiter redete. Dass ich ihr aufmerksam zuhörte, muss ihr sehr imponiert haben. Wahrscheinlich erntete sie in ihren heimatlichen Gefilden für solch ein Thema lediglich ein bedauerndes Lächeln.
Erst nachdem Cécile in einem Zug den Rest aus ihrem Glas trank, um dasselbe anschließend scheppernd auf dem Bartresen abzustellen, hielt meine bezaubernde Gesprächspartnerin inne. Wie erwartet folgten ein paar zischelnde Bemerkungen. Allein meine Perle rutschte schließlich gehorsam vom Hocker. Das Glas an ihrem wunderschön vollen Mund, trank sie ebenfalls die letzten Tropfen.
„Oh Monsieur, schade.“ Ihre Augen leuchteten unablässig, doch ihr Gesicht wirkte traurig. „Sie hätten mir sicher viel erzählen können über ihr Land …“ Darauf ein vorwurfsvoller Blick zur Begleiterin.
„Aber …“, verlegen hob sie die Schultern. Während Cécile ein knappes „bonsoir“ in meine Richtung ausstieß, zog sie ihre Begleiterin bereits am Arm zum Ausgang.
„Zeitverschwendung, sag ich doch“, meldete sich mein Kollege zu Wort, da waren die beiden Damen keine zwei Meter von uns entfernt. Inzwischen schienen beide das Gespräch, das sie während ihres Erscheinens führten, erneut aufgenommen zu haben. Wenigstens gestikulierten sie auf dem Wege zum Ausgang abermals. Traurig sah ich ihnen nach.
„Zu früh gefreut, mein Freund“, sprach ich im Inneren mit meinem ständigen Begleiter, der sich bereits erwartungsvoll in meiner Hose regte, während ich den klassisch geformten Unterleib der jungen Dame in Augenschein nahm.
„Kann schon sein, dass du Recht hast“, erwiderte ich, ohne meinen Blick von den beiden Frauen zu lassen. Die standen mittlerweile an der Ausgangstür. Das Wortgefecht sah dieweil von Weitem heftig aus. Sie blieben vor der Tür stehen. Weil sie ab und zu in unsere Richtung schauten, wurde mir schnell klar, worum sich der Streit drehen musste.
Plötzlich griff die Dunkelhäutige in ihre Tasche. Was sie entnahm konnte ich wegen der Entfernung nicht erkennen. Sie schien jedoch einen Zettel zu beschreiben, bevor sie schnellen Schrittes an die Bar zurück kam.
„Bitte sehr, Monsieur.“ Mit diesen Worten drückte sie mir ein Stück Papier in die Hand. Daraufhin verschwand sie in demselben Tempo, in dem sie erschienen war.
Ein Stück Papier, einen Zettel, ich war wie benommen, es ging alles so furchtbar schnell, vielleicht eine Telefonnummer?
„Was ist das? Zeig mal was sie dir in die Hand gedrückt hat“, drängte mich mein Begleiter mit unverhohlener Neugier. Ich hingegen saß wie versteinert auf meinem Hocker. Die Hand, in der ich den Papierschnipsel hielt, verkrampft, Schweiß trat mir aus allen Poren. Das winzige Stück Papier drohte in der Nässe meiner Handfläche zu zerschmelzen.
Klaus griff nach meinem Arm. „Nun zeig schon, hat sie dir ihre Telefonnummer aufgeschrieben?“ fragte er ungeduldig.
Ich öffnete allmählich die Hand, so langsam als läge etwas Lebendiges darin, etwas das wegzuspringen droht, wenn man nicht aufpasst. So wie früher als Kinder, wenn wir einen Käfer eingefangen hatten.
Auf dem kleinen Blatt aus einem Notizblock stand eine Zahl, 335, dreihundertfünfunddreißig, nichts weiter außer dieser einen Zahl …
Die Zimmernummer, ihre Zimmernummer, unschwer zu erkennen. „Ihre Zimmernummer …“, sagte ich wie zu mir selbst. Zuerst leise, ein zweites Mal laut.
„Du willst doch nicht etwa zu dieser Tussi aufs Zimmer gehen?“, fragte Klaus belustigt, bevor er heftig den Kopf schüttelte. „Die erzählt dir weitere zwei Stunden lang, wie schön und wie toll sie unsere geliebte DDR findet.“ Er rutschte vom Hocker. Breitmäulig grinsend sah er mich an, bevor er lachend fortfuhr: „Oder denkst du etwa, die lässt sich heute Nacht von dir vögeln?“
Ich hörte gar nicht richtig zu, ich verstand lediglich Bruchstücke von dem, was er mir gerade zu erzählen versuchte. Rauschen in meinen Ohren, eine Mischung aus dem Stimmengewirr um uns herum und der Musik von der Bühne, begleitet vom Hämmern meines Pulses in den Schläfen. Die Zimmernummer …
Dann ging alles sehr schnell. Ich sprang vom Hocker und rannte wie besessen dem Ausgang entgegen. Klaus rief mir etwas nach, das ich nicht verstand. Ich vernahm überhaupt nichts mehr, keine Stimmen der Gäste, keine Musik, Tunnelblick, Tunnelgehör. Ich sah allein die Ausgangstür vor mir, die näher und näher rückte, bis ich plötzlich in der Hotelhalle vor dem Aufzug stand.
Drei, Drei, Fünf, dritte Etage, das Zimmer mit der Nummer 335. Es dauerte, bis der Aufzug ankam. Sekunden dehnten sich zur Ewigkeit. Endlos die Fahrt zur dritten Etage, ewig das Irren über den Flur, schließlich die Tür mit der Zahl 335.
Erschöpft lehnte ich mich in den Türrahmen. Ich musste verschnaufen, mich sammeln, mir ein paar Gedanken darüber machen, wie ich sie ansprechen sollte. Der Zustand wie vor einer mündlichen Prüfung. Der Prüfer streckt dir die Hand mit den verschlossenen Couverts entgegen. Welches nimmst du? Scheiß, du bist keine Achtzehn mehr, einfach kommen lassen. Die Gedanken irrten hin und her.
Zuerst den Atem beruhigen. Den Schweiß, der inzwischen durch das Hemd in den Rückenteil meines Sakkos gesickert war, würde ich nicht mehr wegbekommen. Doch das zählte nicht, es war mir egal. Vielleicht würde ich in wenigen Minuten kein Jackett mehr tragen, kein Hemd, keine Hose?
Mir fiel ein, dass ich mich zum ersten Mal in einer solchen Situation befand. Zu keiner Zeit drückte mir eine Frau einen Zettel in die Hand, auf dem ihre Zimmernummer geschrieben stand. Bisher lief das stets anders ab. Die Hotelvariante kam ohnehin so gut wie nie in Frage. Nicht einmal Zettel mit Telefonnummern gab es, da in der DDR kaum jemand ein Telefon besaß.
Man tanzte mit den Damen, ging an die Bar, später gemeinsam ins Bett, oder nicht, je nachdem, wie es lief. Oder man lernte sich in der Firma kennen, oder sonst irgendwo. Der normale Ablauf im Alltag.
Jetzt stand ich an dieser Zimmertür eines Leipziger Interhotels, ohne zu wissen, was mich erwartet. Um Ficken für Geld ging es nicht, so sah die Lady nicht aus. Ihr Verhalten deutete nichts dergleichen an. Ihre Begleiterin hätte sich in diesem Falle an meinen Kollegen herangemacht, der im Übrigen sehr gut aussah. Sie hinterließ nicht den Eindruck, dass sie mehr wollte, als sich über meine tolle sozialistische Heimat zu unterhalten. Doch wer kennt schon die Gedanken, die durch die Köpfe solch schöner junger Frauen wandern, ganz genau?
Ich setzte mehrmals zum Klopfen an. Jedes Mal bevor meine Knöchel am dunkelbraunen Furnier der Zimmertür ankamen, überlegte ich es mir anders. Zurück an die Bar? Wir waren an dem Abend in diesen Laden gegangen, um etwas abzuschleppen. Spatz oder Taube lautete die einfache Frage. Hinter der Tür wartete die Taube, unten gab es vielleicht ein paar Spatzen, die weniger Aufwand bedurften. Weniger? Mehr? Darum ging es hier nicht, nicht um Geld, nicht um die Frage, wo vögeln wir heute?
Die Zeit rann davon, beim vierten oder vierzigsten Anlauf der Klopfer. Für einen Moment passierte nichts, nicht einmal das geringste Geräusch drang aus dem Zimmer heraus. Kein „Herein, die Tür ist offen“, oder Ähnliches, wie man es aus Filmen kannte:
Die Tür angelehnt, tritt der Held ins Zimmer. Auf dem Bett in wallendem Seiden-Negligé die Angebetete. Auf dem Nachtschrank daneben ein Sektkühler mit einer bereits geöffneten Flasche, dazu zwei Gläser. Er tritt näher, um die Gläser zu ergreifen, jedes zwischen zwei Finger einer Hand. Weltmännisch gießt er ein, anschließend reicht er ihr ein Glas zu. Sie erhebt sich, und während sie das Bett verlässt, gleitet ihr das seidene Nichts von den Schultern. Splitternackt steht sie vor ihm. Zum Wohl, die Dame …
Schließlich öffnete sich die Tür, zuerst um einen Spalt, die Sicherung lag vor. „Treten sie ein“, sagte sie freundlich lächelnd, nachdem sie sich davon überzeugt hatte, wer vor der Tür steht. Auf dem Weg zurück ins Zimmer drehte sie mir den Rücken zu. Tänzelnd bewegte sich ihr runder Po, der sich im dünnen Leder des Rocks deutlich abhob. Eingehüllt in eine Duftwolke, die mich auf ein teures Parfüm schließen ließ, lag ein weiterer Geruch im Raum, den ich mir nicht erklären konnte. Die fremden Gerüche war man von den Besuchen der Westverwandtschaft gewöhnt. Inzwischen konnte ich es mir leisten, ebenfalls anders zu riechen als der größere Teil des Ostens, doch dieser Duft übertraf alles bis dahin erlebte.
„Wo bleibt ihr Freund?“ fragte sie, ohne sich umzudrehen, bevor sie auf einem der beiden Sessel in einer Sitzecke, dem Bett gegenüber, Platz nahm.
Die Frage irritierte mich, wieso fragte sie nach meinem Freund?
Nachdem ich die Tür hinter mir verschloss, stand ich am Übergang des kurzen Flurs in den Wohn- und Schlafraum. Unschlüssig wie ein ängstlicher Tollpatsch kam ich mir vor.
„Darf ich mein Jackett ablegen?“, fragte ich schüchtern. „Bitte …“ Mit der Hand wies sie auf die Garderobe im Flur. „Dort hängt ein Bügel.“ Sie lachte mir entgegen, dasselbe Gesicht wie an der Bar, ruhig, freundlich, sanft.
„Wieso fragen sie nach meinem Freund?“, fragte ich zurückhaltend, während ich die Jacke auf den Bügel hing.
„Hätte doch sein können, dass er sich ebenfalls unterhalten möchte. Oder dachten sie vielleicht, ich will mit ihnen ins Bett?“
Ihr Lächeln blieb. Während sie die letzten Worte sprach, wendete sie den Kopf deutlich in Richtung des Bettes, dessen Decke bereits aufgeschlagen zu dem einlud, woran ich für einen Moment draußen auf dem Flur dachte. Sie hatte sich nicht umgezogen, sie trug dieselben Sachen wie an der Bar, sogar die hohen Pumps. Allein die Jacke hing in der Garderobe im Flur.
Vielleicht will sie mich bloß locken mit dieser Bemerkung, das Bett betreffend, wünschte ich mir. Die vollständige Palette des Vorspiels auskosten: Küsse, Hände, Knöpfe öffnen, die langsame Variante. Oder die stürmische, die brutale, sich rappen, sich gemeinsam auf das Bett werfen, Rock nach oben schieben, mit den Fingern den Weg bahnen und los. Ficken und nebenher ausziehen.
Nichts von dem schien in Aussicht zu stehen. Sie saß aufrecht in ihrem Sessel, geradezu majestätisch lächelnd. Ihre Beine übereinander geschlagen ließ das zwar einen Blick weit nach oben an der Außenseite ihrer Schenkel entlang zu, doch dieses magische Dreieck zwischen denselben blieb verborgen. Meine neugierigen Blicke auf ihre bezaubernd schönen Beine waren ihr an der Bar, als sie vor mir saß, nicht entgangen. Jetzt machte sie sich wahrscheinlich im Inneren einen Spaß daraus, mir gleiches ein weiteres Mal zu bieten. Wenn auch ohne die Vollendung.
Einen Moment lang dachte ich darüber nach, mich einfach umzudrehen und das Zimmer auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Wahrscheinlich hatte mein Kollege Recht. Was willst du bei dieser Tussi auf dem Zimmer, die vögelt sowieso nicht mit dir, sagte er im Ton vollendeter Gewissheit. Der gemeinsame Abend verfolgte ein einziges Ziel: amüsieren, etwas fürs Bett finden, nichts anderes. Ich hatte ihn allein gelassen, das tat mir leid.
Als hätte sie meine Unentschlossenheit mitbekommen, sprang sie plötzlich ruckartig aus ihrem Sessel heraus. Fast im selben Moment lagen beide Hände auf meinen Schultern. Sie gab mir einen Kuss auf die Wange, kurz vor dem Ohr. Einen dieser Begrüßungsküsse, weder Fisch noch Fleisch. Angedeutet, gehaucht, nicht einmal die Feuchte der Lippen spürt man auf der Haut. Einzig ihr Geruch, der nun so nah war, raubte mir beinahe den Atem. An der Bar waren wir uns nicht nah genug gekommen, außerdem schwebten dort tausende Gerüche durch den Raum. Wahrscheinlich hatte sie sich, nachdem sie ihr Zimmer betrat, frisch parfümiert.
Sie blieb einen Moment so stehen, fast hing sie an mir, beinahe eine Umarmung. Während sie aus dem Sessel sprang, streifte sie ihre hochhackigen Schuhe mit den Füßen ab. Nun deutlich kleiner als ich, ließ das einen Blick in ihre Achselhöhlen zu. Die Bluse ohne Ärmel, unter den Armen ausgeschnitten.
Einer Frau unter die Achseln zu schauen, dazu ein winziges Stück ihres Oberkörpers zu sehen, gleicht einem Blick zwischen ihre Beine. Diese Höhlung, dieses Loch, neben dem wenige Zentimeter entfernt die Ansätze der Brüste beginnen. Bei ihr kleine, geradezu zierliche Brüste, mit spitzen Warzen. Das konnte ich an der Bar deutlich erkennen, trotz BH. Die passten zu ihr. Alles an ihr war zierlich, bis auf die großen, gütigen Augen. Wie sie in dieser, für mich überraschenden Weise vor mir stand, lag bloß ein schmaler Spalt zwischen uns. So schmal wie ich mir den Spalt zwischen ihren braunen Schenkeln wünschte.
Meine Arme hingen schlaff herunter, zu keiner Aktion in der Lage. Was würde passieren, wenn ich in diesem Moment nach dieser schlanken Taille griffe, wenn ich sie fest an mich heran zöge? Der Gedanke schoss mir wie ein Blitz durch den Kopf, mehr als mich hinaus werfen hätte sie nicht tun können. Ich kam nicht dazu.
„Aber sie wollen ja gar nicht mit mir ins Bett“, stellte sie lächelnd fest. Wenige Zentimeter zurück getreten, nahm sie die eine Hand von meiner Schulter. Die andere ein Stück nach außen gerutscht, lag sie auf der Außenseite, fast am Oberarm. Sie sah mir pausenlos in die Augen. Das fiel mir bereits an der Bar auf. Nicht aufdringlich, noch weniger eindringend, wie jemand schaut, der einem anderen etwas einreden will; eher aufmerksam, interessiert. Ihr Blick erweckte den Eindruck, als wollte sie keine einzige Gelegenheit auslassen, ihrem Gegenüber alles zu entlocken, um sich gleichzeitig nichts von dem entgehen zu lassen, was dieser äußert, verbal und nonverbal.
„Ich habe ihnen angesehen, dass sie nicht darauf allein aus sind, mit einer Frau gleich ins Bett zu gehen“, sagte sie voller Zuversicht. Wenn die wüsste, dachte ich bei mir. Das „Allein“ betonte sie. Dass ich durchaus darauf aus sein könnte, mit einer Frau unter Umständen ins Bett zu gehen, räumte sie also ein. Noch immer wusste ich nichts zu sagen. Ich war wie betört von diesem Duft, von dieser wunderschönen Frau, von dieser unerwarteten Situation, allein mit ihr auf einem Hotelzimmer. Vielleicht mit offenem Ausgang?
„Es ist nichts dabei wenn ein Mann mit einer Frau ins Bett will“, fuhr sie nach einem Blinzeln aus ihren verführerischen Augen fort. In einem selbstverständlichen Ton, als sei das in ihrer Sicht die normalste Sache der Welt, als hätte sie meine Gedanken erneut erraten.
„Fast jeder Mann will das.“ Während sie sprach, schob sie mich sanft an meinem Oberarm zum zweiten Sessel. „Kommen sie, setzen wir uns.“
Artig wie ein Schulbub folgte ich der Aufforderung, ein weiteres Mal zu keinem Ton in der Lage. Als wir vor den Sesseln standen, griff sie nach meiner Hand, um mich das letzte Stück zu geleiten. Eine samtweiche, warme Hand. Bis dahin gab es keinerlei Berührungen Haut an Haut. Als sie auf den Barhocker stieg, stützte sie sich an meiner Schulter ab, eben davor lagen ihre Hände über dem Hemd. In diesem Moment spürte ich sie, wenn auch nur für einen Augenblick. Sie gab mir einen schwachen Schubs. Mehr indem sie mich mit ihrer Hand in den Sessel schob, eine Andeutung der Richtung, in die ich mich bewegen sollte, mit sanftem Druck auf den Unterarm.
„Möchten sie etwas trinken?“, die nächste Frage. Sie stand am Tisch, während ich bereits Platz genommen hatte. Keine wirkliche Frage, mehr die Feststellung: wir trinken etwas gemeinsam.
„Wir hätten an der Bar etwas trinken können“, fuhr sie fort. „Doch da war es sehr laut und Cécile …“ Sie hielt den Atem an, bevor sie weiter sprach: „Cécile wollte schnell ins Bett. Sie spricht kaum Deutsch, es wäre ihr langweilig geworden.“
Aha, dachte ich, der Grund, der mir nicht völlig einleuchten wollte. Sie, Cécile, hätte gerade so gut allein auf ihr Zimmer gehen können und warum verhielt sie sich derart giftig? Aber gut, die Lautstärke, der Lärm um uns herum, keine Atmosphäre für eine gute Unterhaltung, obgleich die Barmusiker, verglichen mit heutigen Diskotheken, eher leise spielten.
„Ja, es war sehr laut“, erwiderte ich leise. Die ersten Worte, die ich in den paar Minuten, seitdem ich das Zimmer betrat, aus mir heraus brachte.
„Bon …“, manchmal flocht sie französische Vokabeln zwischen ihre Worte, eher aus Versehen, wie ich meinte. Ein anderes Mal bemerkte ich, dass sie ab und zu innehielt, um nach dem passenden deutschen Wort zu suchen. Das verlieh ihrer Art zu sprechen eine sehr sympathische Note.
„Wollen wir nun etwas trinken?“, fragte sie ein zweites Mal.
Ohne eine Antwort abzuwarten, öffnete sie die Minibar, die auf einem Beistellschrank direkt neben der Sitzecke stand. Aus der entnahm sie zwei Piccolo Sekt.
„Sie können gern einen Whisky oder Wodka trinken, wenn ihnen das lieber sein sollte?“ Ständig lächelte sie, ob sie sprach oder gerade schwieg. Beinahe unheimlich, mit welcher Souveränität die junge Frau, die mich gerade ein paar Minuten kannte, allein mit mir in diesem Hotelzimmer umging.
„Nein danke, Sekt ist gut“, antwortete ich, inzwischen sicherer.
„Es gibt aber nur zwei kleine Flaschen davon in der Bar.“ Verlegen legte sie zwei Finger auf ihren schönen Mund, um dieselben einen Augenblick später aus zu schütteln. Diese ins Komische abgleitende Pose garnierte sie mit mehreren „oh, oh“.
„Wenn es ihnen nicht genügen sollte, können wir später etwas beim Zimmerservice bestellen.“ Es dauerte bloß ein Moment, bis sie in ihre gewohnte Haltung zurückkehrte. Ich kam nicht dazu, darüber nachzudenken, welchen Hintergrund dieser Ausrutscher gehabt haben könnte. Wie lange sollte dieser gemeinsame Abend womöglich nach ihrer Vorstellung dauern? Allmählich fand ich zu der mir eigenen Contenance zurück. Sie war wohl doch nicht so souverän, wie ich es gerade glauben wollte, oder spielte sie mit mir? War dieser Anflug von Schwäche eingeplant?
Sie stellte die beiden Flaschen samt Gläsern aus dem Beistellschrank vor uns auf den Tisch. Fast vergaß ich, dass es in der Regel Aufgabe des Mannes sein sollte, die Flaschen zu öffnen und die Getränke einzugießen. Ihr Gesicht strahlte, als ich sie höflich bediente. Sie hatte inzwischen Platz genommen.
„Verraten sie mir ihren Vornamen? Wir können Du zueinander sagen, wenn sie das nicht stört?“ Ihre erste Frage, nachdem wir uns zuprosteten und ein erstes Mal an den Gläsern genippt hatten.
„Frank“, antwortete ich kurz und bündig.
„Oh, Frank, Froonc“, sie wiederholte den Namen mehrmals in ihrem Akzent, was genau so klang, als spräche sie den Namen der französischen Währung aus.
„Mein Name ist Hélène“, reagierte sie postwendend. Das klang bezaubernd. Sie sprach den selbstverständlich französisch aus. Älän `h, das "H" am Ende daran gehaucht. Nicht wie man es hierzulande kennt, wie die Birne Helene. Nein, Älän `h, das klang, wie sie es aussprach, als stünde sie kurz vor einem Orgasmus.
Man erkenne in Frankreich den Pariser oder die Pariserin daran, dass sie an viele Worte am Ende ein gehauchtes "H" oder "CH" anfügten. Das erfuhr ich wenig später. Der Pariser sage nicht einfach merci sondern merci `ch, das "Ch" nicht hart ausgesprochen, lediglich gehaucht, mit Betonung auf dem "H".
Bis dahin unterschied ich Pariser von den übrigen Franzosen einzig und allein darin, dass sie aus Gummi bestanden. In der verstorbenen DDR zudem aus minderwertigem, das im entscheidenden Moment gern riss. Doch wir verfügten frühzeitig über die Pille und kannten kein AIDS, so dass Pariser eine untergeordnete Rolle spielten. Die wenigen Automaten, die man bisweilen in alten Bahnhofstoiletten antraf, gähnten vor Leere.
„Hélène“, wiederholte ich, ihren Namen sprach ich ebenso französisch aus. „Hélène, ein bezaubernder Name.“ Vor lauter Freude hüpfte sie fast aus ihrem Sessel.
„Froonc, das haben sie …“, abermals diese Geste mit den beiden Fingern am Mund. „Das hast du so sehr schön gesagt. Du sprichst meine Sprache fast fehlerfrei aus, das erlebt man nicht oft hier in Deutschland.“ Ihr sei das sofort aufgefallen, als ich ihr meinen Stuhl anbot. Vielmehr habe sie sich gefreut, als sie erfuhr, dass ich aus Ostdeutschland stamme.
„Unsere Kunden kommen alle aus dem Westen. Ostdeutsche trifft man gar nicht, nicht einmal im Hotel, außer dem Personal. Aber die dürfen keinen privaten Kontakt zu Gästen herstellen“, erzählte sie traurig von ihren Erfahrungen während ihres Aufenthalts in der DDR. Kunden? Ich wagte nicht zu fragen, welcher Tätigkeit sie nachging, doch das würde sie mir sicher später erzählen, war ich mir sicher.
„Wieso schwärmst du von diesem Land, wenn du es nie erlebt oder richtig gesehen hast, Hélène?“, fragte ich sie, nicht ohne Hintergedanken. Ich wollte dieses Thema möglichst schnell zu Ende bringen. Sie schien mehr und mehr aufzutauen. Da fielen mir sehr viel schönere Dinge ein, als sich über diese Affen-Republik zu unterhalten.
„Oh, mon dieu …“, sie spitzte ihren schönen Mund, den ich viel lieber geküsst hätte. Diese wundervoll aufgeworfenen Lippen in einem leuchtenden Rot, das sich deutlich von ihrem dunkelbraunen Teint abhob. Dazwischen blütenweiße Zähne, die wie Perlen glänzten.
„Oh, mon dieu“, wiederholte sie. „Das ist eine lange Geschichte, aber ich will versuchen, dir alles möglichst schnell zu erzählen, Froonc.“
Zuerst nahm sie ihr Glas zur Hand, um es mir zum Anstoßen entgegen zu reichen. Vorher müsse sie mir überhaupt ein paar Sätze zu sich selbst erzählen, damit ich alles richtig verstehen könne.
1961 in einem westafrikanischen Land geboren, sei ihr Vater Offizier in der französischen Armee gewesen. Kein Afrikaner, sondern Sohn eines Portugiesen, daher ihre hellere Haut, die sie von ihrem Vater geerbt habe, die Mutter Afrikanerin.
Als sie die Jahreszahl aussprach, muss ich geschmunzelt haben. Jedenfalls sah sie mich neugierig an und unterbrach ihren Redeschwall. „Was ist, warum hast du jetzt gelacht, Froonc?“ fragte sie erstaunt.
Ich hob beide Schultern. „Ach nur so, nichts weiter …“, versuchte ich abzuwiegeln, doch sie blieb energisch, unbedingt wollte sie den Grund wissen. „Dein Geburtsjahr …“, gab ich verlegen zu. „Ich hatte dich jünger eingeschätzt.“
„Oh“. wenn sie verwundert war, kam stets dieses „Oh“. Mit hoch erhobenem Kopf sah sie mich von oben herab an. „Bist du ein grand charmeur! Willst du mich gefügig machen mit deinem Kompliment?“ Sie lachte erfrischend herzlich, ihr Gesicht blieb freundlich, fast einladend ihr Blick. Geradezu als wollte sie mir sagen: Gedulde dich, du bekommst schon was du möchtest.
„Nein, nein“, antwortete ich und fing ebenfalls an zu lachen. „Ich hatte dich Anfang Zwanzig geschätzt, wirklich, ehrlich.“
Abermals folgte diese Geste mit den beiden Fingern am Mund, pusten und anschließendem Schütteln. Allmählich begriff ich, was diese zu bedeuten hatte. Die Reaktion darauf wenn man etwas Heißes anfasst, sich auf die Fingerkuppen bläst und danach die Hand schüttelt, um einen Luftzug an der Verbrennungsstelle zu erzeugen. Wenn sie solche Worte zu einer derartigen Reaktion treiben, muss sie in ihrem Kopf bereits weiter sein als allein beim gemeinsamen Sekt trinken und Small Talk, dachte ich mir triumphierend.
„Aber ich freue mich, dass du mich so jung einschätzt“, unterbrach sie meine Gedanken. „Und jetzt erzähle ich weiter, wenn du erlaubst?“ Ich nickte.
„Wo waren wir stehen geblieben?“ Sie hob nachdenklich den Kopf, kurz darauf beantwortete sie ihre Frage selbst: „Ah, bei meinem Vater, ja, bei meinem Vater.“ Ihr Blick trübte sich. Leider sei der vor einigen Jahren während einer Übung sehr jung ums Leben gekommen. Seitdem beziehe die Mutter eine hohe Rente vom französischen Staat. „Geld kann kein Leben ersetzen“, sagte sie leise. Anschließend schwieg sie einen Moment, bevor sie plötzlich fortfuhr, als hätte es die Trauereinlage nie gegeben.
Wenige Jahre nach ihrer Geburt habe in ihrem Land ein Putsch stattgefunden. Ihre Eltern seien mit ihr und den beiden Schwestern nach Frankreich, zuerst nach Marseille, später nach Paris emigriert. In Paris aufgewachsen, sei sie dort zur bis zum Abitur zur Schule gegangen. Lediglich ihr ältester Bruder sei in Afrika geblieben, allerdings in einem benachbarten Land. Die Verwandten der Mutter seien im Land geblieben, und ihr Cousin habe in der DDR zuerst einen Beruf erlernt, später hier studiert. Die Worte sprudelten aus ihr heraus, als schien sie begeistert darüber gewesen zu sein, jemanden gefunden zu haben, der ihr zuhört.
„Mein Cousin schwärmte von deinem Land, nachdem er zurück in Afrika war“, brachte sie ihre Bewunderung auf den Punkt. Manchmal seien Verwandte aus Afrika nach Paris zu Besuch gekommen und hätten davon berichtet.
Sie trank erneut, diesmal hastig, als wolle sie die Zeit nutzen, um möglichst viel von ihren Eindrücken loszuwerden.
„Ich würde gern mehr von deinem Land kennen lernen, Froonc …“ Mit bittender Gestik lehnte sie sich über den Tisch hinweg mir entgegen. „Ich wäre sehr froh darüber.“
Allein habe sie Angst. Man höre so viel im Westen, dass man als Westeuropäer aufpassen müsse, nicht ins Gefängnis zu kommen. Sie habe keine Ahnung, wie man sich hier angemessen benimmt. Nach ihren letzten Worten lehnte sie sich in ihren Sessel zurück. Mich traf ein fordernder Blick: du bist daran mit Reden.
Ihre lobenden Worte über die DDR wollte ich zunächst nicht kommentieren, überlegte ich mir. Das würde sie vielleicht als einen Affront auffassen oder als Belehrung. Das viele Gute, von dem sie erzählte, hätte ich, um bei der Wahrheit zu bleiben, erheblich revidieren müssen. Das hätte möglicherweise zu einem Streit geführt oder die Diskussion unnötig verlängert.
Dass es afrikanischen Studenten bei uns sehr gut ging, war mir hinreichend bekannt. Die bekamen einen Teil ihres Stipendiums in ihrer konvertierbaren Landeswährung ausgezahlt. Im Besitz eines Reisepasses durften sie nach Westberlin fahren, wo sie ihr Geld gegen D-Mark tauschten, um zurück in der DDR, im Intershop einzukaufen. Dass ihr Cousin von dieser Zeit schwärmte, war mir daher durchaus verständlich.
Ich beschloss, auf ihre Ängste einzugehen. Das war kein Streitpunkt und würde mir vielleicht in Aussicht stellen, mich später mit ihr treffen zu können. An einem oder zwei freien Tagen. Urlaubsstimmung, ohne den Terminzwang des frühen Weckrufs, der an diesem Abend zusätzlich in der Luft lag. Ungezwungener, vielleicht williger? Bei mir war es egal, wann ich auf dem Messegelände erscheinen würde, gleichgültig ob überhaupt. Doch sie würde am anderen Tag sicher wieder arbeiten müssen. Die Uhr, so stellte ich mit verstohlenem Blick fest, ging bereits der Elf entgegen.
„Du musst keine Angst haben wenn du dich in der DDR bewegst, Hélène“, erwiderte ich besänftigend. „Wenn du nicht öffentlich die Partei- und Staatsführung beschimpfst oder Gegenstände mitbringst, deren Einfuhr verboten ist, wir dir niemand etwas tun.“
Die letzten Worte sprach ich lachend aus, sie nickte zustimmend. Ja, so ähnlich habe sie es ebenfalls gehört. Dennoch verstehe sie einiges davon überhaupt nicht. Ihr Chef, für den sie hier arbeite, habe sie und die Kollegen vor dem Einsatz in Leipzig mit ähnlichen Worten belehrt. Das Beste sei, sich allein im Hotel und an der Arbeitsstelle auf der Messe aufzuhalten, dann könne nichts passieren.
„Also würdest du, wenn ich dich begleite, die DDR besuchen wollen?“, hakte ich nach.
„Ja!“ Mit gespitztem Mund, strahlte sie mich an, als gäbe sie mir in ihren Gedanken einen Kuss. „Ja doch, sehr gern!“ Das klang ernst.
„Wo hast du so gut Deutsch gelernt?“, fragte ich sie, weil ich das Gespräch schnell auf eine persönlichere Ebene bringen wollte. Der Besuch geklärt, waren nun die näheren Umständen gefragt.
Sie zögerte einen Moment mit der Antwort. Zum ersten Mal an diesem Abend richtete sie ihren Blick nicht direkt in meine Augen, sondern nachdenklich zu Boden.
„Ich arbeite oft in Deutschland“, antwortete sie nach einer Pause. „Die deutsche Sprache habe ich in der Schule gelernt, Deutsch und Englisch. Von meinem Vater ein wenig Portugiesisch.“ Deutsch habe ihr schon immer besser gefallen, ergänzte sie unsicher. Das klang nach einem weiteren Grund, doch ich wollte nicht nachfragen.
Die Situation war ohnehin fragil genug. Trotz ihrer nach außen strahlenden Souveränität, schien sie sehr feinfühlig zu sein, äußerst feinsinnig ohnehin. Manchmal wirkte sie zerbrechlich. Ein falsches Wort, eine übertriebene Geste hätte alles zerstören können. Sie sah mir ständig in die Augen, als suchte sie Zeichen, Vorwarnungen, die meine Absichten verraten würden, obgleich sie mich durchschaut haben musste. Dass ich gern mit ihr in dieses breite Hotelbett steigen würde, wusste sie. Sie gab es bereits zu und bezeichnete es als völlig normal, dass ein Mann so etwas möchte, was hätte ich andererseits also verlieren können?
Kurz nach Elf, Zeit auf den Punkt zu kommen oder zu gehen, mein Kollege würde noch an der Bar sitzen, davon war ich überzeugt. Die Zeit, etwas anderes aufzureißen, war jetzt gerade gut.
Dem gegenüber stand der in Aussicht gestellte Besuch. Wenn das wirklich passieren sollte, würde sie mich nicht bloß als ihren Begleiter, sondern vielleicht als ihren Beschützer sehen. Das brächte mich in eine völlig andere Rolle. Weiter wollte ich gar nicht denken. Eine französische Freundin, oh Gott. Eine die mich hin und wieder besucht, nicht auszudenken.
In der Straße, in der ich in meiner kleinen Geburtsstadt aufwuchs, lebte eine alleinstehende Frau mit zwei Kindern. Deren Geliebter wohnte in Frankreich, das war stadtbekannt. Er kam viermal im Jahr in einem Citroen, an dem wir uns als Bälger jedes Mal die Nasen platt drückten. Helga, so ihr Vorname, liebte einen Franzosen. Manche bewunderten sie, andere platzten vor Neid, doch alle zerrissen sie sich irgendwie die Mäuler.