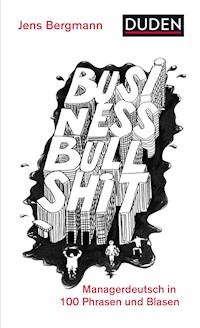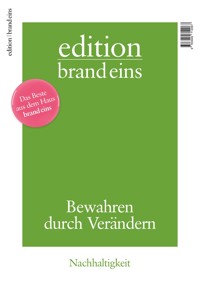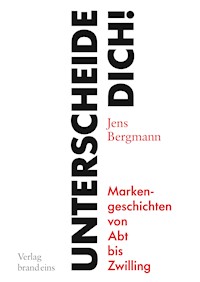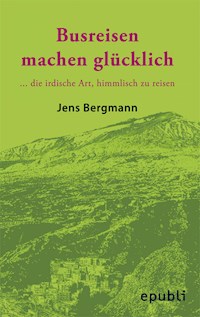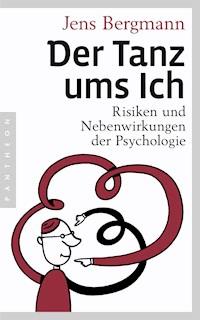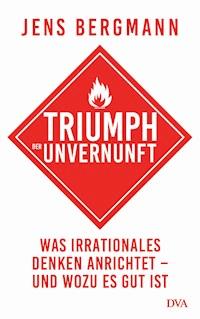
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Buch der Stunde: Der Journalist und Psychologe Jens Bergmann über Unvernunft
Noch nie war es so leicht, sich kundig zu machen, Fakten zu prüfen und Argumente gegeneinander abzuwägen. Alle Voraussetzungen sind da, um die Kernidee der Aufklärung – sich seines Verstandes zu bedienen – Wirklichkeit werden zu lassen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Allerorten triumphiert die Unvernunft. Populistische Politiker erzielen erstaunliche Wahlerfolge, obwohl ihre Versprechen offenkundig hohl sind. Weltweit sind fundamentalistische religiöse Bewegungen auf dem Vormarsch. Allein hierzulande hängen Millionen gebildeter Menschen Verschwörungstheorien an. Und zu den bitteren Realitäten der Coronakrise gehört, dass der Staat immer wieder und mit ungeheurem Aufwand die vielen Vernünftigen vor der Unvernunft einiger weniger schützen muss.
Wie aber ist diese Sonnenfinsternis der Vernunft im Informationszeitalter zu erklären? Wohin führt sie? Und wie ließe sich ihr Einhalt gebieten? Im Mittelpunkt dieses Buches steht der Sinn des Unsinns, denn es gibt durchaus gute Gründe für irrationales Denken – und niemand ist davor gefeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Noch nie war es so leicht, sich kundig zu machen, Fakten zu prüfen und Argumente gegeneinander abzuwägen. Alle Voraussetzungen sind da, um die Kernidee der Aufklärung – sich seines Verstandes zu bedienen – Wirklichkeit werden zu lassen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Allerorten triumphiert die Unvernunft. Demagogen erzielen erstaunliche Wahlerfolge, weltweit sind fundamentalistische religiöse Bewegungen auf dem Vormarsch, und allein hierzulande hängen Millionen gebildeter Menschen Verschwörungstheorien oder esoterischen Lehren an.
Wie aber ist diese Sonnenfinsternis der Vernunft im Informationszeitalter zu erklären? Wohin führt sie? Und wie ließe sich ihr Einhalt gebieten? Dreh- und Angelpunkt ist die Erkenntnis, dass irrationales Denken etwas zutiefst Menschliches ist – und dass es durchaus gute Gründe dafür gibt.
Zum Autor
Jens Bergmann, geboren 1964, schloss an der Universität Hamburg Studien der Psychologie und der Journalistik ab und besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule. Er arbeitete als Autor für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften und lehrte an Hoch- und Journalistenschulen. Seit 2001 ist er Redakteur bei dem Wirtschaftsmagazin brand eins, seit 2017 stellvertretender Chefredakteur. Er hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Zuletzt erschien von ihm Der Tanz ums Ich. Risiken und Nebenwirkungen der Psychologie (2015). Jens Bergmann lebt in Hamburg.
Jens Bergmann
Triumph
der Unvernunft
Was irrationales Denken
anrichtet – und wozu es
gut ist
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 Deutsche Verlags-Anstalt, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: total italic, Amsterdam/Berlin
Covermotiv: © Shutterstock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Gesetzt aus der Minion Pro
ISBN 978-3-641-20943-8 V002
www.dva.de
Vorbemerkung
Wir leben im Informationszeitalter, noch nie war es so einfach, sich kundig zu machen, Fakten zu prüfen und Argumente gegeneinander abzuwägen. Alle Voraussetzungen sind da, um die Kernidee der Aufklärung – der Mensch soll sich aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit befreien – Wirklichkeit werden zu lassen. Doch das Gegenteil scheint der Fall: Es triumphiert die Unvernunft. Die Sonne der Erkenntnis steht tief. Man spricht vom postfaktischen Zeitalter.
Autoritäre und faschistische Politiker erzielen in vielen hoch entwickelten Ländern erstaunliche Wahlerfolge und lehren traditionelle Parteien das Fürchten. Und das, obwohl ihre Versprechen, komplexe Probleme mit einfachen Methoden zu lösen, offenkundig hohl sind, und ihr Geschäft auf der Mobilisierung niedriger Instinkte beruht. Donald Trump, Marine Le Pen, Geert Wilders, Alexander Gauland, Viktor Orbán & Co. befeuern den Mythos des »wahren Volkes«, dessen Interessen sie angeblich vertreten. Und mobilisieren mit dem latent rassistischen Schlachtruf »Wir gegen die« ihre Anhänger. Sie liefern das geistige Rüstzeug für Hetzmeuten, die gegen andersgläubige, -denkende oder -aussehende Menschen losschlagen.
Überall auf der Welt stehen demokratische Institutionen unter Druck, in einigen Regionen zerfallen ganze Staaten. Auf dem Vormarsch sind dagegen fundamentalistische religiöse Bewegungen, die ihre nicht selten mittelalterlichen Vorstellungen mit allen Mitteln durchzusetzen suchen. Und allein hierzulande glauben Millionen gebildeter Menschen an Verschwörungstheorien, hängen esoterischen Lehren an oder vertrauen magischen Heilversprechen wie dem der Homöopathie. Das Geschäft mit dem Aberglauben sorgt für Milliardenumsätze und Renditen, von denen man in anderen Branchen nur träumen kann.
Wie ist der Sieg der Fiktionen über Fakten zu erklären? Warum gedeiht irrationales Denken? Wohin führt es? Und wie ließe sich ihm Einhalt gebieten? Darum geht es in diesem Buch. In seinem Mittelpunkt steht der Sinn des Unsinns, denn es gibt gute Gründe für irrationales Denken – und niemand ist davor gefeit.
Nützlich, aber unsexy: Vernunft
»Der Irrationalismus macht sich ja nicht davon, wenn wir ihn schmähen. Er ist ein Teil von jedem von uns. Wir sollten das Widervernünftige in uns selbst nicht verkennen.«
George Tabori1
Die Vernunft hat uns weit gebracht. Von der Savanne Afrikas, in der sich unsere frühesten Vorfahren mühsam durchschlagen mussten, bis zum derzeit etwa 223 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Mars, der heute mit Raumsonden erkundet und vielleicht noch in dieser Generation von Astronauten betreten wird. Alle Fortschritte, die je erreicht wurden, verdanken wir dem bewussten Einsatz des menschlichen Verstands, also der Fähigkeit, die Welt immer besser zu verstehen und sie nach unseren Bedürfnissen zu verändern.[*]
Die gesellschaftliche Entwicklung hat die Evolution zwar nicht außer Kraft gesetzt, aber mit so enormem Tempo überholt, dass sie für unsere Kultur nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Vom Faustkeil des Homo sapiens idaltu in Äthiopien bis zur heute allgegenwärtigen Computertechnik mit Zugriff aufs weltumspannende Internet vergingen lediglich rund 160 000 Jahre, gleichsam ein Wimpernschlag in den etwa 4,6 Milliarden Jahren seit Entstehung unseres Planeten.
Die menschliche Entwicklung hat sich immer weiter beschleunigt. Besonders die Epoche der Aufklärung verlieh ihr einen gewaltigen Schub, weil die Fesseln des Glaubens gesprengt wurden. Dank Voltaire, David Hume, Immanuel Kant und vielen weiteren Denkern und Forschern, die auf ihnen aufbauten, sind unser Wissen, unsere Produktivität und unser Wohlstand heute so groß wie nie zuvor. Wir haben uns die Erde untertan gemacht. Keine Spezies kann uns existenziell gefährlich werden, nur wir selbst. Die Welt ist zwar kein perfekter Ort, aber der beste, den es je für den Menschen, das einzige vernunftbegabte Tier, gab. Einerseits.
Andererseits scheint das Feuer der Aufklärung bestenfalls nur noch zu glimmen. Kants Forderung, der Mensch solle sich aus seiner »selbstverschuldeten Unmündigkeit«2 befreien, indem er sich mutig seines Verstandes bediene, zündet aus verschiedenen Gründen nicht mehr so recht. Einer ist Ernüchterung angesichts ungeheuerlicher Rückschritte trotz Aufklärung. So verhinderte die Moderne mit ihrer Fortschrittseuphorie und all ihren technischen Errungenschaften nicht den Siegeszug des Irrationalismus, der in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts mündete, in Deutschland in den Nationalsozialismus, von Max Horkheimer als »Sonnenfinsternis der Vernunft«3 bezeichnet.
Auf den Sieg der Alliierten über das nationalsozialistische Deutschland folgten die Spaltung der Welt in Ost und West und der Kalte Krieg, in dem die Atommächte sich gegenseitig in Schach hielten und der gesamten Menschheit mit Auslöschung drohten. Der Westen gewann den Kampf der Systeme, man sprach vom postideologischen Zeitalter. Der amerikanische Politologe Francis Fukuyama prophezeite damals gar das Ende der Geschichte: Nach dem Untergang der Sowjetunion und der mit ihr verbundenen sozialistischen Staaten werde der Liberalismus in Form von Demokratie und Marktwirtschaft weltweit den Sieg davontragen.
Es kam anders. Heute ist die Demokratie unter Druck wie selten zuvor, weltweit drängen autoritär- oder religiös-faschistische[**]Bewegungen und Parteien an die Macht. Es schlägt die Stunde der Demagogen, Propaganda bestimmt die öffentlichen Debatten wie seit den Dreißigerjahren nicht mehr. Es ist vom postfaktischen Zeitalter die Rede, der Ära der Lüge also, als sei das bereits eine ausgemachte Sache. Symptomatisch der Ausruf des konservativen englischen Politikers Michael Gove, der während der erfolgreichen Kampagne für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union im Sommer 2016 die Meinung vertrat, seine Landsleute hätten die Nase voll von den Experten und deren Faktenwissen. »Glaube statt Aufklärung«, hieß es dazu in einem Kommentar des Handelsblatts. »Politik wird zum Opium für das Volk.«4
Argumente verfangen nicht mehr, Stimmungen schaffen eine Realität eigener Art.5 Für das Diktum des Kommunikationswissenschaftlers und Psychotherapeuten Paul Watzlawick – »(…) Annahmen, Dogmen, Aberglauben, Hoffnungen und dergleichen können wirklicher als die Wirklichkeit werden (…)«6 – finden sich heute allerorten frappierende Belege. In vielen reifen Industrieländern breitet sich ein Klima der Gereiztheit aus, angefacht und für ihre Zwecke genutzt von einer autoritären Internationale. Mittlerweile sind auch in der Bundesrepublik Bewegungen wie Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands) und Parteien wie die Alternative für Deutschland (AfD) mit ihren Hauptthemen Hass auf Fremde, »den« Islam oder »die« liberalen Eliten weit über den rechten Rand hinaus erfolgreich.
Auch Menschen, denen solche Ressentiments fernliegen, erscheint die Ratio weniger als non plus ultra und mehr als langweilige, kühle, buchhalterische, technokratische oder gar zensierende Instanz – kurz: als unsexy. Sie stehen in der Tradition einer besonders in Deutschland bis heute einflussreichen Denkrichtung, die das unmittelbare Erleben, den Instinkt und den Mythos feiert. Dieser Lebensphilosophie sind unter anderem Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche zuzurechnen. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, hat wesentliche Ideen populär gemacht. Der Mensch, so seine These, werde von unbewussten Trieben, dem Es, bestimmt. Die Anforderungen der Realität träten ihm als Über-Ich, dem strengen Gewissen, entgegen. Das Ich sei als Vermittler dafür zuständig, diesen unauflöslichen Gegensatz immerhin so weit zu versöhnen, dass aus »hysterischem Elend gemeines Unglück« werden könne. Das ist laut Freud der Preis der Zivilisation, mehr ist nicht drin. Am grundsätzlichen »Unbehagen in der Kultur«, so der Titel eines seiner späteren Werke, lasse sich nichts ändern.
Diese Theorie ist zwar unter anderem deshalb fragwürdig, weil sie nicht erklären kann, wie Zivilisationen überhaupt entstanden sind, wenn sie doch den ureigenen Bedürfnissen des Menschen angeblich im Wege stehen. Auch ist die Psychoanalyse längst nicht mehr so sehr in Mode wie früher. Ihre zentrale Denkfigur aber wirkt bis heute fort in gängigen Vorstellungen, es gebe einen unaufhebbaren Widerspruch zwischen der Wahrheit des Gefühls und der des Verstands, zwischen Rationalität und Sinnlichkeit, natürlicher Lebensfreude und zivilisatorischen Notwendigkeiten. Der Romantiker Hermann Hesse hat diese Haltung einmal so auf den Punkt gebracht: »Der Vernünftige rationalisiert die Welt und tut ihr Gewalt an. Er neigt stets zu grimmigem Ernst. Er ist Erzieher.«7
Hesse zeichnet hier ein Zerrbild des Aufklärers, aber sein Verdikt enthält einen wahren Kern. Denn tatsächlich klingt der Ton, in dem Menschen aufgefordert werden, doch Vernunft anzunehmen, nicht selten belehrend oder gar nach Kasernenhof und reizt zum Widerspruch. Es sind häufig Mächtige, die ihre Interessen als die einzig wahren beziehungsweise als alternativlos ausgeben. Sie suggerieren, es sei vernünftig, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Wer das hört, fühlt sich zu Recht gegängelt und in seiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt.
Verrückt sind immer die anderen
Friedrich Dürrenmatt wendet das Thema in seinem Drama »Die Physiker« ins Groteske. Der Kernphysiker Möbius, Entdecker der gefährlichen Weltformel, begibt sich freiwillig in eine psychiatrische Klinik, um die Menschheit vor seinen Erkenntnissen zu bewahren. Dort gerät er in die Fänge von Doktor von Zahnd, der Chefin der Einrichtung, die im Gegensatz zu ihm tatsächlich wahnsinnig ist. Er fordert sie auf: »Nehmen Sie Vernunft an. Sehen Sie ein, dass Sie verrückt sind.« Sie erwidert: »Ebenso wenig wie Sie.«8
Dieser Wortwechsel ist aus mehreren Gründen erhellend. Erstens zeigt er, dass das, was als vernünftig gilt, Ansichtssache ist: Was dem einen logisch erscheint, hält der andere für irre. Zweitens wird deutlich, dass das Thema nicht einfach zu diskutieren ist, weil sich kaum ein Mensch die eigene Irrationalität unumwunden eingestehen wird. Vernunft gilt trotz allem nach wie vor als Referenz – auch Unvernünftige halten sich für vernünftig. Das kennt jeder von sich selbst aus ganz alltäglichen Situationen. Wer sich kritisch prüft, wird zum Beispiel feststellen, dass er, nachdem er sich aus dem Bauch heraus für eine Sache entschieden hat, meist im Nachhinein gute Gründe dafür (er)findet.
Für die vermeintliche oder tatsächliche Uneinsichtigkeit des Unvernünftigen gibt es einen wichtigen psychologischen Grund: Menschen können sich nicht bewusst schaden. Was sie bewusst tun, ergibt aus ihrer Sicht Sinn, auch wenn, von außen betrachtet, das Gegenteil richtig zu sein scheint.9 Da die subjektiven Motive unseres Gegenübers nicht ohne Weiteres zugänglich sind, neigen wir im Zweifel dazu, Unvernunft zu unterstellen. Verrückt sind immer die anderen.
Ausbrüche der Unvernunft
Vernunft ist seit je ein umkämpfter und zeitgebundener Begriff. So galt bis zur kopernikanischen Wende als unumstößlich, dass die Erde der fixe Mittelpunkt des Universums ist. Der herrschende Klerus wehrte sich mit Zähnen und Klauen gegen die aufkommende Erkenntnis, dass sie in Wahrheit um die Sonne kreist. Galileo Galilei, einem der ersten, der dies belegen konnte und seine astronomischen Einsichten ab 1610 veröffentlichte, hat die römisch-katholische Kirche verboten, sein Wissen zu verbreiten. Erst im November 1992 rehabilitierte der Vatikan den großen Gelehrten offiziell.
Eine zeitgemäße Formation im Abwehrkampf gegen wissenschaftliche Tatsachen sind die sogenannten Klimaskeptiker, die – zur Freude und mit freundlicher und Unterstützung einiger Konzerne – den wissenschaftlich sehr gut belegten Fakt der menschengemachten Erderwärmung hartnäckig leugnen und ihren Teil dazu beigetragen haben, dass Vereinbarungen der Weltgemeinschaft zur Reduktion des CO2-Ausstoßes hinausgezögert wurden.
Trotz solcher Widerstände verschieben sich die Grenzen der Erkenntnis immer weiter: Die Menschheit wird insgesamt klüger. Doch der Fortschritt schreitet nicht auf gerader Bahn voran; Um- und Irrwege sind immer möglich, das gilt sowohl für Individuen als auch ganze Gesellschaften. So kam es in der Geschichte der Menschheit wiederholt zu »Ausbrüchen der Unvernunft«, wie der Historiker James Webb in einer groß angelegten, im Jahr 1976 erschienenen Untersuchung schreibt. Für die abendländische Welt nennt er drei: Der erste zu Beginn unserer Zeitrechnung, »als eine Welle magischer Spekulationen die Errungenschaften des griechischen Rationalismus hinfort spülte«. Den zweiten kann man »die ›Krise der Renaissance/Reformation‹ nennen; sie bezieht sich auf das Aufwallen des Irrationalen, als das künstliche Gefüge des Mittelalters zusammenbrach. Die dritte Krise ist die des 19. und 20. Jahrhunderts (…), die man entweder als eigenständige ›Krise‹ oder als eine Entwicklung aus der Krise der Renaissance und Reformation ansehen kann.« In diesen Zeiten sei der Druck auf das Individuum so stark geworden, »dass er eine breit angelegte Flucht vor der Vernunft auslöste«.10
Nur: Was ist Vernunft? Es handelt sich ja nicht um eine wie in Stein gemeißelte ewige Wahrheit, sondern um einen dynamischen Kulturbegriff, der sich durch beständige Kritik an dem, was der Mensch soll und kann, verändert und ausdifferenziert. Der Philosoph Karl Hepfer schreibt: »(…) Vernunft ist diejenige Fähigkeit, die es uns erlaubt zu argumentieren, Schlüsse zu ziehen und zu allgemeinen und abstrakten Aussagen über die Welt zu gelangen –, doch davon abgesehen setzte noch jede Epoche die Akzente anders.«11 Sein Kollege Hans Lenk hat versucht, alle Facetten menschlicher Vernunft zu erfassen, und kommt auf nicht weniger als 21 »Rationalitätstypen«: von der »Wertrationalität« über die »Instrumentelle Rationalität« bis zur bereits angesprochenen »Rationalisierung als nachträgliche Selbstrechtfertigung«.12
Das, was Menschen für vernünftig und angemessen halten, ist nicht zuletzt durch ihre Kultur geprägt: So staunen Europäer über das liberale Waffenrecht in vielen Bundesstaaten der USA, während Amerikaner es kaum fassen können, dass man hierzulande mit 200 km/h über die Autobahn rasen darf. In der westlichen Welt lieben viele Menschen Hunde, in afrikanischen und arabischen Ländern ekelt man sich vor ihnen, in Korea werden sie gar verzehrt. Die Bereitschaft, solche Unterschiede in der Wahrnehmung der Welt zu erkennen und den eigenen Standpunkt zu relativieren, trennt das rationale vom irrationalen Denken: Ersteres lässt Kritik zu, Letzteres tut alles, um sich gegen sie zu immunisieren.
Der Mensch ist das einzige vernunftbegabte Wesen, deshalb aber nicht immer vernünftig, wie jeder aus eigener Erfahrung weiß. Die Vorstellung, wir könnten uns beispielsweise stets so berechnend verhalten wie der sprichwörtliche Homo oeconomicus – der immer noch durch die Wirtschaftswissenschaften geisternde Nutzenmaximierer –, ist selbst irrational. Und wer in seinem alltäglichen Leben versuchte, dem Idealbild des Skeptikers entsprechend zu handeln, also nichts Ungeprüftes zu glauben und die Ungewissheit dem Irrtum vorzuziehen, stünde wie gelähmt vor der Komplexität der Welt.13 Jeder Mensch ist beides zugleich: rational und irrational. Mal denkt er die Dinge durch, wägt Optionen sorgfältig gegeneinander ab, mal entscheidet er spontan. Mal lässt er sich von seinen Begierden leiten, mal vom Verstand. Als Faustregel kann gelten: Auf ihnen vertrauten Gebieten verhalten sich die Leute tendenziell vernünftiger, auf ungewohntem Terrain unvernünftiger.
Zudem ist menschliches Handeln nur im jeweiligen Kontext verständlich, wir leben in sozialen Räumen – in denen es naheliegend sein kann, wider eigene Überzeugungen zu agieren. Sei es durch den Konformitätsdruck von Gruppen, die abweichende Meinungen durch Ausgrenzung bestrafen. Sei es durch dominierende (Denk-)Moden oder den Zeitgeist, dem wir aus Bequemlichkeit folgen. Sei es durch bestimmte Logiken, Zwänge oder Machtverhältnisse, denen wir uns mehr oder weniger widerwillig ergeben.
Manchmal ist es auch sinnvoll, bewusst auf das Unbewusste zu setzen. So kann es in unübersichtlichen Situationen die beste Option sein, intuitiv zu entscheiden, weil der Versuch, alle Alternativen zu prüfen, aussichtslos wäre. Diese Strategie ist vor allem für jene erfolgversprechend, die sowohl über Wissen von einer Sache als auch praktische Erfahrung mit ihr verfügen. Sehr gute Schachspieler können zum Beispiel mit einem Blick eine Stellung auf dem Brett erfassen. »Was ich sehe, ist schwer in Worte zu fassen«, sagt der Weltmeister Magnus Carlsen über diese Fähigkeit. »Vielleicht trifft es das Wort Kraftfelder. Ich sehe sofort, welche Strategie der Gegner verfolgt. Ich spüre auch, welcher Zug der richtige sein könnte.«14
Auch wir durchschnittlich begabten Menschen haben schon die Erfahrung gemacht, dass sich der berühmte Geistesblitz zur Lösung eines Problems, mit dem wir uns lange herumgeschlagen hatten, unerwartet unter der Dusche einstellte. Nur Ahnungslose sollten sich besser nicht auf ihre Ahnungen verlassen – sie liegen intuitiv meist falsch. Dummerweise sind gerade sie es, die gern auf ihren Bauch hören.
Das menschliche Gehirn ist ein komplexes Organ, das auf verschiedenen Ebenen aktiv ist und nie schläft. Mit dieser Kenntnis lässt sich experimentieren. So berichtet der Philosoph Philipp Hübl von einem Wissenschaftler aus seinem Bekanntenkreis mit ungewöhnlicher Arbeitstechnik: »Wenn er einen Aufsatz über ein Thema schreiben will, das ihn seit Langem umtreibt, formuliert er einen anregenden Titel und kocht sich eine Marihuana-Milch-Suppe. Dann setzt er sich ans Klavier und spielt. Wenn sich die Töne in bestimmter Weise verändern, weiß er, dass die Wirkung des Marihuanas einsetzt, und er beginnt zu schreiben. Natürlich überarbeitet er sein Werk in klarem Zustand noch einmal. Offenbar funktioniert diese Technik bei ihm, weil er einige wirklich einflussreiche Aufsätze verfasst hat.«15
Jenseits solch unorthodoxer Optimierungsmethoden gehören auch Fluchten aus dem Alltag wie Leidenschaft, Rausch und Ekstase zu einem Leben. Nach Ansicht des Philosophen Robert Pfaller ist man wirklich erwachsen »erst dann, wenn man in der Lage ist, nicht zum Knecht seiner Erwachsenheit zu werden, sondern sich ab und zu freudige Momente scheinbar kindlicher Unvernunft zu gönnen. (…) Vernunft scheint mir gerade darin zu bestehen, zwischen den abwägenden und den sorglosen Impulsen differenzieren zu können.«16
Die zwei Seiten des Irrationalen
Vernunft oder Unvernunft – bei dieser Unterscheidung wird es schnell persönlich: Wer über das Thema nachdenkt, denkt notwendigerweise über sich selbst nach. Denn irrige Ansichten, widersinnige Überzeugungen und Aberglaube sind, nüchtern betrachtet, auch Ausdruck individueller Freiheit – und Zeichen von Luxus. Verhielt sich der frühe Mensch unvernünftig, bedrohte das nicht nur sein Leben, sondern die Existenz der gesamten Sippe. Abweichendes Denken und Handeln wurden erst ab einer bestimmten Stufe der Entwicklung – in der Gemeinschaften nicht mehr auf einen bestimmten Beitrag jedes Einzelnen angewiesen waren – möglich. Wir können seit diesem qualitativen Sprung in der Menschheitsgeschichte so oder ganz anders handeln und uns unser eigenes Bild von der Welt machen. Solange wir leben, haben wir die Wahl.
Aufgeklärte Gesellschaften können Exzentriker, Spinner und Verrückte nicht nur ertragen, sie brauchen sie sogar, denn Leute, die anders ticken als die Mehrheit, haben das Potenzial, die Welt voranzubringen. Das Irrationale hat zwei Seiten: Es kann großartige Kunstwerke hervorbringen, alternative Lebensformen, fantastische Welten – aber genauso Desorientierung, Dogmatismus und Hass. Die größten Stärken des Menschen – sein Vorstellungsvermögen, sein Wille und seine Fantasie – können zu seinen größten Schwächen werden.
Häufig liegt irrationalen Bewegungen, auch wenn sie noch so unangenehm in Erscheinung treten mögen, ursprünglich eine Idee der Befreiung zugrunde; ihre Vordenker wollen sich nicht mit den Verhältnissen abfinden, so wie sie sind. Die Welt erscheint ihnen ungerecht. Das ist der eigentliche Kern vieler Religionen, die versprechen, den Menschen aus seinem Jammertal zu führen, selbst wenn sich diese Versprechen als hohl erweisen. Gefährlich wird es für die vermeintlich Erleuchteten sowie deren Umwelt, wenn ihnen jede Ahnung verloren geht, dass die Welt womöglich doch anders beschaffen sein könnte, als sie glauben.
Vernunft bedeutet vor allem eines: bereit zu sein, die eigenen Sinneseindrücke, Emotionen und Überzeugungen infrage zu stellen, also einen Schritt zurückzutreten und sich selbst beim Denken zu beobachten. Eine genuin menschliche Möglichkeit. Die Vordenker des Irrationalen lehnen das ab, sie feiern die Unmittelbarkeit. Dahinter steht die Idee, allein durch Eingebung, Intuition und Gefühle sei wahre Erkenntnis möglich. Vor allem Letztere haben seit dem Bestseller Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman Konjunktur. Der Begriff suggeriert, dass Gefühle als solche klug sein können, man also, ohne nachzudenken, zu Erkenntnissen kommen kann. Das ist aber nicht der Fall. Emotionalität lässt sich als rasches individuelles Bewerten von komplexen Situationen mit eindeutigem Ergebnis definieren. Entweder wir fühlen uns wohl oder unwohl, zu einem Mitmenschen hingezogen oder von ihm abgestoßen. Die Frage, ob das, was der Bauch sagt, richtig ist, kann nur der Kopf beantworten. Die Verwechslung von Gewusstem mit bloß Gefühltem kritisierte bereits Hegel: »Darum hat ein Gefühl, wenn sein Inhalt doch der gediegenste und wahrste ist, die Form zufälliger Partikularität, außerdem dass der Inhalt ebensowohl der dürftigste und der unwahrste sein kann.«17
Allgemein lässt sich irrationales Denken als menschliche Möglichkeit verstehen, unter seinen Erkenntnismöglichkeiten zu bleiben. »Dummheit«, schreibt Matthijs van Boxsel in seiner Enzyklopädie zum Thema, »ist das Talent, unbewusst gegen das Eigeninteresse zu handeln, im Extremfall mit tödlicher Konsequenz.«18 Zum Beispiel, indem Probleme dorthin verschoben werden, wo sie nur scheinbar gelöst werden können. Durch die Unterwerfung unter zweifelhafte Autoritäten, blinde Abwehrreaktionen angesichts von Veränderungen oder die masochistische Verklärung inhumaner Zustände. Unhinterfragte Gefühle befeuern das Irrationale – es will sich nicht in die Karten schauen lassen. Wir versuchen es trotzdem.
Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt
Krisen und Zeiten von Umbrüchen sorgen für den Humus, auf dem Aberglaube gedeiht. Der Einzelne wird als Opfer von Schicksalsschlägen wie Krankheiten oder Unglücksfällen anfällig. Größere Gruppen werden es angesichts bedrohlich wirkender Veränderungen ihrer gewohnten Umwelt. So sahen sich die frühen Menschen den Kräften der Natur hilflos ausgesetzt. Sie reagierten darauf, indem sie diese beseelten, also Götter erschufen und anbeteten, um sie gnädig zu stimmen – der Beginn des religiösen Denkens, dessen Motive schon Demokrit erkannte, der um 460 bis 371 vor unserer Zeitrechnung lebte (siehe auch das Kapitel zur Religion).
Der Mensch ist ein sinnsuchendes Wesen; es liegt in seiner Natur, Muster und Zusammenhänge zu entdecken oder auch zu konstruieren. Das kann zu einem besseren Verständnis der Welt führen. Aber auch dazu, Dingen, Ereignissen und Phänomenen einen Sinn anzudichten, den sie nicht haben. So glauben tausende Menschen hierzulande an die sogenannte Chemtrail-Verschwörungstheorie, also daran, dass es sich bei den von Flugzeugen erzeugten Kondensstreifen in Wirklichkeit um eine Massenvernichtungswaffe handelt, die darauf abzielt, die Bevölkerung zu töten. Und nur wenigen Zeitgenossen ist die Gelassenheit des Königs in Alice im Wunderland gegeben, der sagte: »Wenn kein Sinn darin ist, so erspart uns das eine Menge Arbeit, denn dann brauchen wir auch keinen zu suchen.«
Mittlerweile wissen wir über die Zusammenhänge in der Natur dank des wissenschaftlichen Fortschritts so viel wie nie zuvor. Doch nun sind wir neuen Mächten ausgesetzt, die sich unserem Verständnis entziehen, obwohl sie menschengemacht sind. Sie erscheinen uns wie die unberechenbaren Naturkräfte von einst. Der Mensch sei, schreibt der Publizist und Religionskritiker Manuel Kellner, überwältigt »von sich selbst (von der eigenen Vergesellschaftung)«.19 Das größte Rätsel gibt uns die herrschende Art des Wirtschaftens auf.
Der Kapitalismus hat in verschiedenen Spielarten – vom angelsächsischen über den rheinischen bis hin zum von der dortigen Kommunistischen Partei gesteuerten chinesischen Staatskapitalismus – fast die gesamte Welt erobert. Aber weder seine Anhänger noch seine Gegner können schlüssig erklären, wie er funktioniert und mit welcher Volte er uns als nächstes überraschen wird. Das Credo seiner in jüngster Zeit aus gegebenen Anlässen leiser gewordenen naiven Propagandisten lautet, dass der freie Markt alles richte. Seine Kritiker prophezeien seit Marx und Engels das Ende des Kapitalismus, liegen damit bislang aber ebenso falsch wie die Zeugen Jehovas mit ihren Vorhersagen des Weltuntergangs.
Als besonders rätselhaft erscheint das Zahlungs- und Schmiermittel der Weltwirtschaft. Wir kommen nicht ohne Geld aus, lassen uns davon blenden, können nie genug davon bekommen, verstehen es aber nicht wirklich. Das ging offenbar auch den Politikern und Ökonomen so, die die bis dahin streng regulierten Finanzmärkte Mitte der Achtzigerjahre liberalisierten, weil sie Geld als Ware wie jede andere missverstanden. Der in der Londoner City so genannte Big Bang, also Urknall, führte zu neuer wirtschaftlicher Dynamik, bis dato ungeahnten Geschäften mit Geld, gigantischen Profiten für Banken und Spekulanten – und immer gefährlicheren Finanzkrisen.
Die jüngste, die im Jahr 2007 ihren Ausgang nahm, weitete sich zu einer Weltwirtschaftskrise aus, von der sich viele Länder bis heute nicht erholt haben. Die Folge ist ein »Minuszinsenkapitalismus«, so der Ökonom Rudolf Hickel: Die Zentralbanken fluten die Geschäftsbanken mit Geld, aber dieses kommt in der Realwirtschaft häufig nicht an, weil Unternehmen kein Vertrauen haben, dass sich Investitionen auszahlen könnten. Ein Szenario, das wohl auch Marx ins Grübeln brächte.
Und das mit den eher hausbackenen Vorstellungen von Toppolitikern in der europäischen Führungsmacht Deutschland offenbar auch schwer zu vereinbaren ist. So beschwor die Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Dezember 2008 beim CDU-Parteitag angesichts der Eurokrise folgendes Ideal: »Man hätte hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg, einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Sie hätte uns eine ebenso kurze wie richtige Lebensweisheit gesagt, die da lautet: Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Das ist der Kern der Krise.«20 Dass Volkswirtschaften tatsächlich funktionieren wie schwäbische Haushalte – und Sparen in Zeiten der Rezession eine gute Idee ist –, bezweifeln nicht nur viele Menschen in Südeuropa, die unter der maßgeblich von Deutschland durchgesetzten Austeritätspolitik leiden, sondern auch namhafte Ökonomen in aller Welt.
Glaubenssache: der Kapitalismus
Es spricht allerdings einiges dafür, dass solche Fehlschlüsse ihre Ursache darin haben, dass das scheinbar rationale Zahlungsmittel Geld allein mit ökonomischen Kategorien nicht zu fassen ist, weil es in Wahrheit noch einen ganz anderen Charakter hat. »Begriffe wie Schuldner und Gläubiger, Offenbarungseid und Erlös, Kredit und (Heilige beziehungsweise Handels-)Messe sind unüberhörbar religiöser Herkunft«, schreibt der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch. »Es gibt in beiden Sphären elementare Glaubensbekenntnisse, ohne die sie nicht funktionieren. Der tiefe Glauben an die ›invisible hand‹ des Marktes, die alles so weise einrichtet wie Gottes unerforschlicher Ratschluss, gehört dazu. Wer sich in Finanz- und ökonomietheoretischen Kreisen die kecke Frage erlaubt, ob die unsichtbare Hand des Marktes deshalb unsichtbar ist und heißt, weil es sie nicht gibt, gilt sofort als Ketzer – genau dies darf er so wenig in Frage stellen wie ein Theologe vor fünfhundert Jahren die Existenz Gottes.«21
Solche Begriffskritik ist erhellend, weil Menschen – anders als Esoteriker und andere Anhänger des Irrationalen meinen – keinen unmittelbaren Zugang zur Welt haben. Unser Denken ist durch Sprache vermittelt; nur durch sie ist Erkenntnis möglich. Daher sind Begriffe wichtig und umkämpft; wer sie prägt, gewinnt Deutungsmacht. Nicht umsonst sprechen die Anhänger der Atomkraft konsequent von Kernenergie, ein Spindoktor der Republikaner in den USA setzte den Begriff Klimawandel in die Welt, der netter klingt als globale Erwärmung, und Manager von Volkswagen benutzen unisono den Euphemismus »Diesel-Thematik« für den organisierten Betrug am Kunden und Verstoß gegen Umweltauflagen.
Wer solche Sprachbilder, auch Frames genannt, unhinterfragt akzeptiert, unterwirft sich ihnen und der von ihnen vorgegebenen Sicht der Dinge. Denn die Begriffe, die wir verwenden, um komplexe gesellschaftliche Phänomene zu erfassen, prägen entscheidend unser Weltbild, ja, sie schaffen eine eigene Wirklichkeit. Dies lässt sich exemplarisch an einem Wort mit bedrohlichem Klang zeigen, mit dem seit den Neunzigerjahren gern das Unbehagen am Wirtschaftsgeschehen zum Ausdruck gebracht wird: Globalisierung. Sie wird hierzulande von fast der Hälfte der Menschen als Bedrohung angesehen.22
Die erhöhte Mobilität von Waren, Kapital, Wissen, Technik und, in eingeschränkter Form, auch Arbeit, so eine nüchterne Definition, beschleunigt einerseits den Wandel und damit die berechtigte Sorge mancher, abgehängt zu werden. Die weltweite Vernetzung produziere Gewinner und Verlierer, schreiben die Historiker Jürgen Osterhammel und Niels P. Petersson – »gleiches gilt allerdings auch für die Zerstörung globaler Strukturen«.23 Dennoch wird die Globalisierung von Linken und zunehmend auch von Rechten für alle nur erdenklichen Übel auf dem Globus verantwortlich gemacht: von Umweltverschmutzung bis Sozialabbau.
Zu Unrecht. Fakt ist, dass die Integration von immer mehr Staaten in die Weltwirtschaft sich als erfolgreiches Armutsbekämpfungsprogramm für Abermillionen Menschen erwiesen hat, eine Herausforderung, an der die klassische Entwicklungshilfe weitgehend scheiterte. So sank die Zahl der absolut Armen – laut einer Definition der Weltbank Menschen, die kaufkraftbereinigt von weniger als 1,90 Dollar pro Tag leben müssen – von 1,9 Milliarden im Jahr 1980 auf etwas mehr als 700 Millionen im Jahr 2016. Und das bei einer stark wachsenden Weltbevölkerung.
Länder, denen es gelang, Teil der globalen Wirtschaft zu werden, konnten ihren Lebensstandard viel stärker erhöhen als andere; und dieser ist wiederum die Voraussetzung für ökologisches Bewusstsein und Handeln. Pointiert könnte man sagen: Nicht die Globalisierung ist das Problem, sondern der Ausschluss von ihr. Dessen ungeachtet nutzen Demagogen[***] den Begriff mit verschwörungstheoretischem und xenophobem Unterton für ihre Zwecke. Ihr Erfolg beruht auf der Konstruktion eines manichäischen Weltbildes, also der Aufteilung der Menschheit in Gut und Böse. Wir – das wahre Volk – gegen die anderen. Die drinnen gegen die draußen. Die Bösen sind wahlweise Eliten in Regierung oder Justiz, 68er, Feministinnen, supranationale Organisationen (Brüssel) oder eben die Globalisierung als Chiffre für fremde Mächte oder Einwanderer.
Dennis Snower, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, weist darauf hin, dass in den USA bereits heute auf eine Stelle, die ins Ausland verlagert wird, sechs bis sieben kommen, die von Robotern übernommen werden. »Diese Entwicklung ist allerdings schwer greifbar, sodass Populisten wie der amerikanische Präsident Donald Trump den Leuten weismachen können: Die Chinesen stehlen eure Jobs. Roboter eignen sich nicht gut als Feindbilder.«24
Dieses Angebot an »magischen Feindbildern, die eine Kur eigener Verletzungen via Feindbeschwörung und -bekämpfung ermöglichen sollen«, so der Politikwissenschaftler Reinhard Olschanski,25 erwies sich als so attraktiv für große Teile der Bevölkerung – und bei Weitem nicht nur für die sogenannten Globalisierungsverlierer –, dass xenophobe Politiker etablierte Parteien entweder vor sich her treiben konnten wie unter anderem in Frankreich, Großbritannien und Österreich. Oder diese gleich ganz kaperten, wie es zunächst den Tea-Party-Aktivisten und später Donald Trump mit der Republikanischen Partei in den USA gelang.
Der schillernde Globalisierungsbegriff eignet sich zudem gut, um einen durch das Verschwinden traditioneller Milieus und die Marktgläubigkeit vieler sozialdemokratischer Politiker »heimatlos gewordenen Antikapitalismus«26 zum Ausdruck zu bringen. Die Systemfrage wird heute von rechts gestellt. Dass damit ausgerechnet skrupellose reiche Männer wie Silvio Berlusconi oder Donald Trump erfolgreich waren und sind, mutet wie eine Ironie der Geschichte an. Manche ihrer Anhänger leiden tatsächlich unter Perspektivlosigkeit. Daran ist aber nicht die Globalisierung schuld, sondern es sind Missstände wie unter anderem eine ungleiche Verteilung von Bildungschancen, Einkommen und Vermögen – die autoritäre Politiker eher weniger interessieren.
Weil der Begriff relativ jung ist (er tauchte 1961 erstmals in einem englischsprachigen Lexikon auf), scheint es, als sei die Globalisierung urplötzlich über die Menschheit gekommen. Dabei existiert »die globale Weltgesellschaft« schon sehr lange, wie der Soziologe Wolfgang Streeck erläutert: »Mit der Eroberung des Aztekenreichs durch spanische Truppen 1521 begann eine den Erdball umfassende Weltpolitik, mit vielfältigen wirtschaftlichen und kulturellen Wechselwirkungen.«27 So beschleunigte das in Südamerika geraubte Gold in Europa den Übergang zur Geldwirtschaft. Und die deutsche Küche wurde dank der Landwirtschaft der Indios mit der Kartoffel bereichert, die italienische mit der Tomate.
Einer der Ersten, der die Folgen der globalen Vernetzung erkannte, war Friedrich Engels. Er schrieb 1847 in den Grundsätzen des Kommunismus: »Die große Industrie hat schon dadurch, dass sie den Weltmarkt geschaffen hat, alle Völker der Erde, und namentlich die zivilisierten, in eine solche Verbindung miteinander gebracht, dass jedes einzelne Volk davon abhängig ist, was bei einem anderen geschieht.« Engels sah übrigens – anders als viele national gesinnte Linke heute – in der Entwicklung Chancen für die internationale Arbeiterklasse.
Einen frühen Höhepunkt erreichte die Globalisierung, die damals noch niemand so nannte, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Danach führten Politiker Zölle ein, bremsten die Einwanderung und drosselten den Kapitalverkehr. Es folgte der vom deutschen Kaiserreich begonnene, aber auch von Nationalisten in anderen Ländern ersehnte Erste Weltkrieg. In den Dreißigerjahren, nach der Weltwirtschaftskrise, schotteten sich die Staaten strikt voneinander ab – mit katastrophalen Folgen und dem Versuch des nationalsozialistischen Deutschlands, die globale Herrschaft zu erringen. Erst Mitte der Siebzigerjahre wurde das einstige Niveau des internationalen Warenaustauschs wieder erreicht. Ab Mitte der Achtzigerjahre gab es – dank Innovationen in Sachen Kommunikation (Internet), Transport (Container) und des Falls des Eisernen Vorhangs – eine neue Qualität der Globalisierung. Nun wurden nicht mehr nur Waren gehandelt, sondern es entstanden Produktionsnetze über mehrere Länder hinweg. Heute ist die ganze Welt, so der amerikanische Ökonom Richard Baldwin, »in gewisser Weise eine Fabrik«.28
Umso unsinniger der Versuch, die Uhr zurückzudrehen. Als Reaktion auf den Aufstieg Chinas, Indiens und anderer Nationen in Asien und Lateinamerika, die die Chancen der Globalisierung genutzt haben, sowie zunehmende Migration propagieren Politiker in verschiedenen westlichen Ländern ein Rollback. Ihr Ideal ist der alte Nationalstaat – obwohl der offenkundig ungeeignet ist, drängende Probleme zu lösen, die heute regionaler oder globaler Natur sind. Falls die Unvernunft in Gestalt eines neuen Nationalismus triumphierte, könnte das in Zeiten einer stark verflochtenen Weltwirtschaft noch fatalere Folgen haben als vor hundert Jahren.
Bezeichnend war eine häufig von Donald Trump wiederholte Forderung, nachdem der US-Präsidentschaftskandidat die Republikanische Partei 2015 und 2016 im Sturm erobert hatte: Nach seinem Willen sollte eine gigantische Mauer an der rund 3250 Kilometer langen Grenze zu Mexiko errichtet werden – auf Kosten des Nachbarlandes. Die Entfernung entspricht in etwa der zwischen Bilbao und Moskau. Eine wahnwitzige Idee in Zeiten globaler Wertschöpfungsketten, die aber zum Kern des irrationalen Denkens führt: Probleme von heute werden mit Methoden von gestern bearbeitet. Dabei appellieren Trump & Co. weniger an den Verstand als an die Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die es nie gab: »Make America great again.«
Eine solche Politik der Gefühle, die mit Feindbildern und Täuschungen operiert, lässt sich nur schwer durch Fakten widerlegen. Erschwerend hinzukommen psychologische Effekte, die zur Ablösung von der Realität »draußen« beitragen. So verfestigen und radikalisieren sich unter bestimmten Bedingungen Meinungen in Gruppen. Das liegt einerseits am sozialen Druck: Das einzelne Mitglied will den anderen gefallen oder zumindest von ihnen akzeptiert werden. Und andererseits an der Entlastung von individueller Verantwortung – diese wird ja von der Gemeinschaft übernommen.
Dass sich Menschen durch Konformitätsdruck sogar dazu bringen lassen, offenkundig Falsches als richtig zu bezeichnen, hat der Psychologe Solomon Asch bereits 1951 in einem berühmt gewordenen und später häufig variierten Experiment gezeigt. Ein Proband sollte gemeinsam mit vermeintlich anderen Versuchspersonen – in Wahrheit Vertraute des Versuchsleiters – eine einfache Aufgabe mit eindeutigem Ergebnis lösen. Der Gruppe wurde jeweils eine Linie gezeigt und drei Linien zum Vergleich. Eine hatte dieselbe Länge wie die Referenzlinie, diese sollte genannt werden. Es gab insgesamt 18 Durchgänge des Experiments. Bei 6 antworteten die instruierten Probanden einstimmig richtig, bei 12 einstimmig falsch. Die einzelnen Versuchspersonen, deren Verhalten untersucht werden sollte, passten sich in etwa einem Drittel der Durchläufe der objektiv falsch liegenden Mehrheit an. Nur ein Viertel ließ sich überhaupt nicht beeinflussen und antwortete stets korrekt, auch wenn es mit dieser Aussage allein da stand.29
Nun lässt sich über die Erkenntnishaltigkeit psychologischer Experimente unter anderem deshalb trefflich streiten, weil sie in künstlichen Laborsituationen stattfinden.30 Ungeachtet dessen ist nicht zu übersehen, dass im 21. Jahrhundert ein neuer Tribalismus um sich greift: Gruppen richten sich in ihren eigenen Welten ein, werden dort immer engstirniger und sind von außen kaum noch zu erreichen. In den USA, auch bei dieser Entwicklung Vorreiter, lässt sich das unter anderem an der tiefen Spaltung zwischen Anhängern der Demokratischen und denen der Republikanischen Partei erkennen. Dem Politikwissenschaftler Torben Lütjen zufolge bewegen sich beide Seiten mittlerweile »in alternativen Diskurs-Universen«31, eine Verständigung sei nicht mehr möglich. Die eine Seite diskutiert, was gegen die globale Erwärmung zu tun ist; die andere bestreitet, dass es sie überhaupt gibt. Bestimmte Fakten dringen zu den Gläubigen nicht mehr durch. So zeigten sich im September 2015 bei einer Umfrage 43 Prozent der Republikaner-Anhänger überzeugt, Barack Obama sei Muslim – obwohl diese Behauptung nachweislich falsch ist und der damalige Präsident der USA sie bei verschiedenen Gelegenheiten richtiggestellt hatte.
In den Vereinigten Staaten sind die Echokammern nicht nur medialer Art, sie bestimmen das wirkliche Leben. So entscheiden sich die Menschen zunehmend, dorthin zu ziehen, wo politisch Gleichgesinnte wohnen, was unter anderem dazu führt, dass mehr republikanische und demokratische Parteihochburgen entstehen, die zuweilen nahe beieinander liegen, aber wie Gebiete verfeindeter Stämme erscheinen.32 Man bewegt sich jeweils in seiner Blase, das gegenseitige Misstrauen ist groß wie nie. So sagten noch in den Sechzigerjahren lediglich vier Prozent der Republikaner und drei Prozent der Demokraten bei Umfragen, dass sie ein Problem hätten, wenn ihr Sohn oder ihre Tochter einen Anhänger der jeweils anderen Partei heiraten würde. Im Jahr 2014 bekundeten 49 beziehungsweise 33 Prozent der Befragten Bedenken gegen eine solche Verbindung.33
Die Situation in den USA erinnert an die Zeit in Deutschland, als sich Katholiken und Protestanten unversöhnlich in voneinander getrennten Lebenswelten gegenüberstanden und sogenannte Mischehen zwischen den Konfessionen von den jeweiligen Kirchenoberen strikt abgelehnt wurden – obwohl man doch an denselben Gott glaubte. Viel wichtiger aber erschien die Frage, ob man Katholik oder Lutheraner war (beziehungsweise einer anderen protestantischen Richtung anhing). Die Konfession diente der eigenen Identität und Abgrenzung. Es dauerte fast 500 Jahre, bis sich diese Spaltung der Gesellschaft überlebt hatte.
Orientierung durch Desorientierung