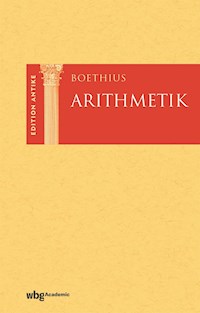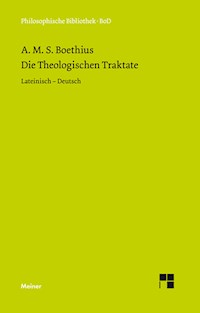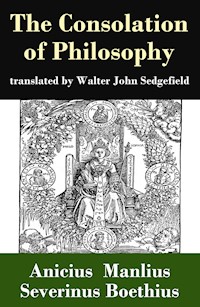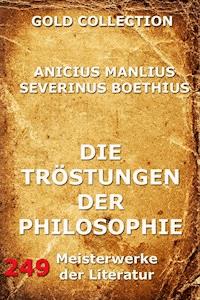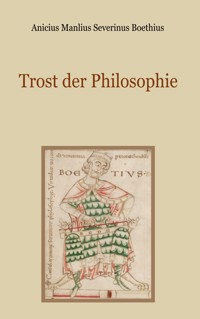
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Die letzten Gesinnungen eines großen, in jeder Hinsicht achtbaren und bemerkenswerten Mannes, gleichsam an der Pforte des Todes und im Angesichte der Ewigkeit geschrieben, müssen allen Zeiten und allen Menschen wert sein, die über den Zweck ihres Daseins, über ihre Pflichten und Hoffnungen nachdenken, und denen es nicht gleichgültig sein kann, darüber belehrt zu werden, so oft und so gut, als möglich ist. Die Schrift des verewigten Boethius vom Troste der Philosophie verdient daher vorzügliche Aufmerksamkeit, denn sie ist in hohem Grade geeignet, das Gemüt des Menschen tief und kräftig zu ergreifen, und den Geist auf Höhen zu führen, die uns einen umfassenden Anblick unseres eigenen Geschlechtes und seiner Schicksale gewähren, ja sogar erfreuliche Lichtstrahlen aus den uns erforschlichen Tiefen göttlicher Weisheit erblicken lassen. Wer immer jemals in seinem Leben unglücklich war, oder sich unglücklich dünkte, wer immer je sich die Möglichkeit vorstellte, es werden zu können, und vielleicht in trüberen Stunden über das große Rätsel des menschlichen Daseins sich härmte, und vergebens nach einer Lösung desselben suchte, der wird nicht ohne Nutzen diese Schrift Boethius´ zur Hand nehmen, mit ihm vielleicht klagen und nachsinnen, mit ihm der Wahrheit Spur erblicken, sie verfolgen, heller sie und heller schauen, und getröstet werden." - J. H. Weingartner
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem Lateinischen übersetzt von Eberhard Gothein
Vorwort von J. H. Weingartner, Pfarrer
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Das Wesentlichste aus dem Leben des Verfassers
1. Buch
Erstes Metrum
Zweites Metrum
Zweite Prose
Drittes Metrum
Dritte Prose
Viertes Metrum
Vierte Prose
Fünftes Metrum
Fünfte Prose
Sechstes Metrum
Sechste Prose
Siebentes Metrum
2. Buch
Erste Prose
Erstes Metrum
Zweite Prose
Zweites Metrum
Dritte Prose
Drittes Metrum
Vierte Prose
Viertes Metrum
Fünfte Prose
Fünftes Metrum
Sechste Prose
Sechstes Metrum
Siebente Prose
Siebentes Metrum
Achte Prose
Achtes Metrum
3. Buch
Erste Prose
Erstes Metrum
Zweite Prose
Zweites Metrum
Dritte Prose
Drittes Metrum
Vierte Prose
Viertes Metrum
Fünfte Prose
Fünftes Metrum
Sechste Prose
Sechstes Metrum
Siebente Prose
Siebentes Metrum
Achte Prose
Achtes Metrum
Neunte Prose
Neuntes Metrum
Zehnte Prose
Zehntes Metrum
Elfte Prose
Elftes Metrum
Zwölfte Prose
Zwölftes Metrum
4. Buch
Erste Prose
Erstes Metrum
Zweite Prose
Zweites Metrum
Dritte Prose
Drittes Metrum
Vierte Prose
Viertes Metrum
Fünfte Prose
Fünftes Metrum
Sechste Prose
Sechstes Metrum
Siebente Prose
Siebentes Metrum
5. Buch
Erste Prose
Erstes Metrum
Zweite Prose
Zweites Metrum
Dritte Prose
Drittes Metrum
Vierte Prose
Viertes Metrum
Fünfte Prose
Fünftes Metrum
Sechste Prose
Vorwort.
DIE letzten Gesinnungen eines großen, in jeder Hinsicht achtbaren und bemerkenswerten Mannes, gleichsam an der Pforte des Todes und im Angesichte der Ewigkeit geschrieben, müssen allen Zeiten und allen Menschen wert sein, die über den Zweck ihres Daseins, über ihre Pflichten und Hoffnungen nachdenken, und denen es nicht gleichgültig sein kann, darüber belehrt zu werden, so oft und so gut, als möglich ist.
Die Schrift des verewigten Boethius vom Troste der Philosophie verdient daher vorzügliche Aufmerksamkeit, denn sie ist in hohem Grade geeignet, das Gemüt des Menschen tief und kräftig zu ergreifen, und den Geist auf Höhen zu führen, die uns einen umfassenden Anblick unseres eigenen Geschlechtes und seiner Schicksale gewähren, ja sogar erfreuliche Lichtstrahlen aus den uns erforschlichen Tiefen göttlicher Weisheit erblicken lassen. Wer immer jemals in seinem Leben unglücklich war, oder sich unglücklich dünkte, wer immer je sich die Möglichkeit vorstellte, es werden zu können, und vielleicht in trüberen Stunden über das große Rätsel des menschlichen Daseins sich härmte, und vergebens nach einer Lösung desselben suchte, der wird nicht ohne Nutzen diese Schrift Boethiusʼ zur Hand nehmen, mit ihm vielleicht klagen und nachsinnen, mit ihm der Wahrheit Spur erblicken, sie verfolgen, heller sie und heller schauen, und getröstet werden. Wie viele der Sterblichen sind nicht bereits in ähnlichen Lagen gewesen, ihr Wirkungskreis und ihr Glück oder Unglück mögen noch so beschränkt oder unbedeutend sein, so scheint doch jedem sein eigenes Schicksal stets bedeutend, und auch das geringste Mißgeschick verursacht ihm Schmerz und Kummer, und leiht seiner Unzufriedenheit Vergrößerungsgläser, die ihm oft das Übel in der Welt als ein gräßliches Gespenst darstellen. Läuft er sogleich im übermäßigen Schreck vor demselben, so wird sein Elend mit seiner Furcht vergrößert. Getraut er sich aber, dem Ungetüme kühn unter die Augen zu schauen, so wird er seinen Irrtum, und seine überflüssige Angst erkennen. So verlieren die Übel in der Welt ihre Furchtbarkeit bei näherer Prüfung, die Schattenseite der menschlichen Schicksale hellet sich auf, und der Weise gelangt endlich zur Überzeugung, daß er eigentlich kein Übel zu fürchten habe, als das moralische, vor dem er sich stets verwahren kann, wenn er nur selbst will. Denn dies ist der Grundgedanke, der durch die ganze Schrift waltet; der Tugendhafte, der auf Gott traut, seine Bestimmung und seinen Wert erkennt, kann nie unglücklich werden. Sein Gut kann ihm niemand rauben, wenn er sich nicht selbst entwürdigt. Aller äußeren Gewalt ist sein Glück unzugänglich, unangreifbar, wenn er nur kein falsches, sondern das wahre Glück sucht, welches im getreuen Streben nach Gottähnlichkeit, in Tugend und Gerechtigkeit besteht. Von diesem Standpunkte aus erscheint die Welt und das Menschenleben im freundlichen Lichte einer erhabenen moralischen Weltordnung, die in der ewigen Weisheit und Güte Gottes ihren Grund hat, und von ihm so geleitet wird, daß den Guten alles zum Guten gereichen müsse. Von hier aus werden die falschen Güter von den wahren unterschieden. Der Weise beurteilt die Dinge nicht mehr nach dem gewöhnlichen Namen, mit dem sie oft die Welt unrichtigerweise bezeichnet, sondern nach ihrem wahren inneren Werte, den sie in allen Stürmen des Lebens, mitten im Wechsel der Schicksale behalten. Da diese Ansicht notwendig das höchste, unvergängliche Gut nur in Gott und seinen Anordnungen findet, so erzeugt sie eine unbedingte kindliche Ergebung in seinen Willen, eine heilige Sehnsucht, ihm wohlzugefallen, und söhnet den Weisen oder Guten mit aller Welt aus. – Es liegt in dieser erhabenen reinen Gesinnung eine so hohe Religiosität, eine so umfassende, belebende Liebe zum wahren Guten, daß dadurch das Glück des Menschen unzerstörbar und ewig gesichert ist. Wohl kann nur ein frommer Sinn solche Gesinnungen nähren, und ihre beseligenden Früchte vollkommen genießen; aber selbst der Gefallene kann durch sie aufgerichtet werden, wenn er den noch nicht erloschenen Funken seiner höheren Natur an dieser reinen, göttlichen Flamme entzündet, und die Täuschung sinnlichen Glücks mit der Wahrheit des ewigen vertauscht, wenn er auch in der Tat nach jenem höchsten Ziele strebt, nach dem alle Wesen ihre Bestimmung ruft, und ihre eigene, unverdorbene Natur gleichsam hinzieht.
Ist nun gleich die Einkleidung des Ganzen weder dem neueren Geschmacke, noch den Forderungen neuerer Philosophenschulen angemessen, so ist doch die Tendenz desselben so erhaben und schön, die Beweisführung so stufenweise folgerecht, daß es auch gegenwärtig seinen Zweck nicht verfehlen kann, und gewiß verdient mehr bekannt zu sein, als es wirklich ist.
Das Wesentlichste aus dem Leben des Verfassers.
ANICIUS Manlius Severinus Boethius war aus dem berühmten römischen Geschlechte der Anicier und Torquate entsprossen. Aber so glänzend auch seine Ahnen waren, so wurde doch er selbst der Trefflichste seines ganzen Geschlechtes, und trug mehr zum Ruhme desselben bei, als er selbst durch seine Abkunft berühmt war. An Weisheit und Tugend übertraf er alle seine Vorfahren, und die meisten seiner Zeitgenossen. Er ward geboren im Jahre 455, gerade zu einer Zeit, da Barbarei und Sittenverderbnis über den Okzident hereinbrachen, und Kunst und Wissenschaft mit einem allgemeinen Verderben bedrohten. Vieles Gute und Herrliche, das noch gerettet wurde, verdankte die Mittel- und Nachwelt den außerordentlichen Bemühungen unseres Boethius, der gleichsam von der Vorsicht dazu ausersehen, ein Beschützer, Beförderer und unerschrockener Verteidiger der Unschuld, Gerechtigkeit und Wahrheit sich dem verheerenden Strome mit seltener und dauernder Kraft entgegenstemmte. Achtzehn Jahre studierte er zu Athen, war ausgezeichnet durch attische und römische Beredsamkeit, und ein Freund der Dichtkunst. Die größten Verdienste aber erwarb er sich um die Philosophie. Seine trefflichen Erklärungen des Nikomachus, Euklides, Aristoteles und Ptolomäus sind von bleibendem Werte, und haben seinen Namen verewigt. Sein Kommentar über die Prädikamente des Porphyrius zeigte seine außerordentlichen Gaben in einem so herrlichen Lichte, daß ihm der römische Senat sehr frühzeitig verschiedene angesehene Ämter, und bereits im zweiunddreißigsten Jahre die Konsulswürde einstimmig zuerkannte, zu welcher er im Jahre 510 zum zweiten, und 522 zum dritten Male, nebst dem berühmten Symmachus, gewählt wurde, dessen Tochter Elphia er zur Gemahlin hatte. Er besaß die aufrichtigste Hochachtung bei allen Guten, so, wie er von den Bösen, mit denen er im unaufhörlichen Kampfe lebte, gehaßt und gefürchtet wurde. Bei einem so mühevollen und tatenreichen Leben, als das seine war, ist es um so mehr zu bewundern, daß er mitten unter den schwierigsten und verwickeltsten Staatsgeschäften eine so große Menge von Schriften verfassen konnte. Denn nach dem Scharfsinne sowohl, als nach der ausgebreiteten Gelehrsamkeit und dem Fleiße, wodurch sich seine Schriften auszeichnen, sollte man eher vermuten, er habe sich mit nichts anderem beschäftigt, sondern die reichlichste Muse bloß auf sie allein verwenden können. Dennoch lebte er so ganz für den Dienst seines Vaterlandes, daß man sagen kann, er habe es beinahe allein durch seine Klugheit und Festigkeit noch vor dem drohenden Verfalle gerettet. Unter dem gotischen Könige Theodorich war es eigentlich Boethius, der regierte, und den König, der bei manchen Fehlern nicht ohne große Gaben war, durch seinen weisen Rat leitete, durch seinen Starkmut unterstützte, oder von Mißgriffen abhielt. Sein großes Vermögen verwendete Boethius für das allgemeine Wohl, und wußte ebensogut die Not der ärmeren Klassen zu würdigen, als mit edler Freigebigkeit derselben abzuhelfen. Unwandelbar fest hielt er auf Gerechtigkeit, weder Drohungen und Gefahren, noch Lockungen eigenen Vorteils, denen wohl selten auch ein Redlicher ganz widerstanden wäre, konnten ihn zu einer Ungerechtigkeit verleiten. Dabei verschmähte er auch Schmeicheleien und verführerisches Lob mit trockenem Ernste, und war ein erklärter Feind aller derer, die das Volk unterdrücken wollten. Als einst während einer Hungersnot schwere Steuern ausgeschrieben wurden, ruhte Boethius nicht eher, als bis der ungerechte Befehl zurückgenommen war. Auch war er ein eifriger Verfechter der Rechte des Senats und des Volkes, schützte die beiden Senatoren Albinus und Paulinus, welche unschuldigerweise verfolgt waren, und setzte sich fast allein, da alle übrigen den Mut verloren hatten, den Ränken einiger elenden Menschen, eines Konigastus, Ciprianus und Triquilla entgegen, die er auch endlich ihrer angesehenen Hofämter beraubte. Doch eben diese strenge Tugend, dieser unbescholtene Ruf, und sein Widerstand, den er gegen alle Umtriebe niederträchtiger Absichten leistete, zogen ihm Neid, Haß, vielfache verleumderische Anklagen, und endlich den Tod zu.
Gerade auf dem Gipfel seines Ruhmes, im schönsten Glanze seines Glücks überfiel ihn der Schlag einer lange lauernden Rache. Seine beiden ausgezeichneten Söhne, Patricius und Hypatius, waren zu gleicher Zeit zu Konsuln erwählt worden, dreizehn Jahre nach dem ersten Konsulate des Vaters, und der Vater hielt bei der Gelegenheit eine feierliche Rede, in der er ihnen die Wichtigkeit ihrer Pflichten mit allem Feuer seines tugendhaften Gemütes ans Herz legte, und zuletzt der Vorsehung für das seltene Glück, das ihm dadurch selbst zuteil geworden, dankte.
Da traten plötzlich jene Menschen, deren Ungerechtigkeiten er einst bestraft hatte, mit verfälschten Briefen gegen ihn auf, worin er einer Verschwörung gegen den König Theodorich, und eines geheimen Einverständnisses mit dem Kaiser Justinianus beschuldigt wurde. An ihrer Spitze stand Triquilla. Die übrigen waren Basilius, ein treuloser Possenreißer; Gaudentius und Opilio, bekannte Nichtswürdige, welche vordem auf Befehl des Königs landesverwiesen waren. Das Zeugnis solcher Menschen wurde für hinreichend angenommen; dem edlen Boethius aber nicht einmal gestattet, sich zu verteidigen. Er ward ungesäumt nach Pavia verwiesen, und dort ins Gefängnis geworfen. Hier schrieb er die fünf Bücher: De consolatione Philosophiae, welche allein hinreichend sind, seine Tugend zu rechtfertigen, und die Bosheit der Anklage zu beschämen. Aber eben dadurch wurde das entlarvte Laster aufs höchste gereizt, und sein Tod beschlossen. Die Gegner des Boethius verbanden sich alle, den zu töten, den sie nicht widerlegen konnten, und dessen Leben ein beständiger Schrecken ihrer Verderbtheit war.
Mit Ungestüm erzwangen sie von Theodorich die Verurteilung des Boethius, und der Gouverneur von Pavia bekam den Auftrag, ihm dasselbe anzukündigen. – Boethius, im hohen Bewußtsein der Unschuld, hörte sein Endurteil mit der edelsten Ruhe und Fassung eines wahrhaft großen Geistes an, über welchen die niedrigeren Leidenschaften ihre Macht verloren haben. Mit einer Heiterkeit, mit der andere zu Vergnügen eilen, empfing er, nach einer Gefangenschaft von sechs Monaten, den Todesstreich, beiläufig im siebzigsten Jahre seines Alters, und die Welt sah einen Helden auf dem Blutgerüste, für dessen Verdienste kein Thron zu hoch gewesen wäre. Wahrer Edelmut kennt keine Furcht, und erscheint eben in den gefahrvollsten Lagen am achtungswürdigsten. Über alle Hindernisse, die ihm Lüge, Betrug und Neid entgegentürmten, steigt er zum höchsten Gipfel unvergänglicher Ehre empor, und indem er der Welt scheint unterzugehen, hat er seinen Triumph erreicht. Ein solcher war Boethius, und die Geschichte zeigt uns wenige Beispiele von Charakteren, die mit so hellen Einsichten, und so hoher Überzeugung so reine Absichten, und eine so streng konsequente, unerschütterlich feste Beharrlichkeit verbanden.
Mit Boethius ging, sozusagen, die Blüte der Wissenschaften, und ein Muster der Rechtschaffenheit für jene Zeiten unter, und Tausende der Guten verloren und beweinten mit ihm die kräftigste Stütze der Unschuld und Gerechtigkeit.
Philipp von Bergamo ist in Suppl. Chronic. IX. p.85 der Meinung, Boethius sei auf Betrieb der Arianer zum Tode verurteilt worden. Einige setzen ihn daher unter die Märtyrer, mit dem Beinahmen: Severinus Secundus, und behaupten, sein Körper sei zu Pavia in der Kirche des heil. Augustins begraben.
Eine alte Nachricht erzählt von ihm, er habe sein Haupt, als es durch den Schwertstreich vom Leibe getrennt war, rasch mit beiden Händen aufgefaßt, und auf einem nahestehenden Altare, gleichsam opfernd, niedergelegt.
Boethius besaß selbst eine vortreffliche Bibliothek, besonders von griechischen Werken. Seine eigenen Schriften sind: Eine Übersetzung mehrerer Bücher des Aristoteles; ferner die Arithmetik des Nikomachus; die Geometrie des Euklides; die Musiklehre des Pythagoras; die Mechanik des Archimedes; die Astronomie des Ptolomäus; die Philosophie des Plato, den er vor allen scheint hochgeachtet zu haben; nebst verschiedenen anderen philosophischen und theologischen Schriften. Darunter sind die bemerkenswertesten: Zwei Bücher Ad Isagogen Porphyrii de Divisione; dann eine Abhandlung in Topica Ciceronis; de differentiis topicis; de Arithmetica, und fünf Bücher von der Musik, welche zum ersten Male 1491 zu Venedig in Druck erschienen; eine Abhandlung über die Geometrie des Euklides; eine de Quadratura circuli; de Unitate et Uno, und verschiedene Briefe. Sein letztes und in seiner Art wichtigstes Werk: De consolatione Philosophiae, das er im Kerker schrieb, ist sehr oft aufgelegt, und beinahe in alle Sprachen übersetzt worden; vorzüglich von Christoph Knarr ins Deutsche, und von Outhof ins Holländische. Sie sind aber bei uns überhaupt wenig bekannt, und beinahe vergessen. Ein altes Manuskript davon soll sich in der Dombibliothek zu Merseburg befinden, und vollständiger sein, als die bisherigen Ausgaben. Alle seine Schriften zusammen hat Glareanus im Jahre 1546 zu Basel herausgegeben. Das Leben des Boethius haben Julius Marcianus Rota, P. Bertius und Joannes Clericus beschrieben. Viele Nachrichten darüber sind in Procopius de bello Gothico; in den Briefen des Cassiodorus; in Anastasius Biblioth.; im Honorius Augustodun. de luminibus Ecclesiae; im Trithemius; im Bellarminus de Scriptoribus Eccles.; im Baronius ad Annum 526; im Gesner. Possevin; im Vossius; im Basnage Annal. Tom. III. p. 669; im Miraeus; im Hendreich; im August. de Familiis Roman; in Clerc Bibl. choisie Tom. XVI. p. 192; in Gervaise Histoire de Boëce Senateure Romain, avec l'analyse de tous ses ouvrages etc., Paris 1715 V. Vol.; in de Ludewig Vita Justiniani; in Stolles Historie der Gelehrten; im Fabric. Bibl. Latin; in Blount Censur. Celeber. Auctor; und in Morhof Polyhistoria enthalten.
1. Buch.
Erstes Metrum.
Klage über den traurigen Wechsel des Schicksals.
Der ich Gesänge vordem in blühendem Eifer vollendet, Wehe, wie drängt das Geschick traurige Weisen mir auf. Also schreiben mir vor voll Schmerz die verwundeten Musen, Tränen von echtestem Leid haben ihr Antlitz genetzt. Konnte sie doch allein der Schrecken nimmer besiegen, Als Gefährten nur sie folgten allein meinem Pfad. Was die Zierde einst war glückselig blühender Jugend, Ist dem trauernden Greis Trost noch in Todesgefahr. Unvermutet erschien vom Leide beschleunigt das Alter, Jahre häufte der Schmerz auf das ermüdete Haupt. Von dem Scheitel zu früh ergrauend wallen die Locken, Schlaff erzittert und welk mir am Leibe die Haut. Seliger Tod, der sich nicht drängt in die Freuden der Jugend, Der dem Trauernden nur häufig gerufen erscheint. Ach er wendet sein Ohr verschlossen dem Flehen der Armen, Grausam weigert er stets Ruhe dem weinenden Aug’. Schon da das wankende Glück noch flüchtige Güter gespendet, Schien das Haupt mir versenkt fast in der Stunde der Angst. Jetzt da es wolkenverhüllt das trügende Antlitz gewendet, Da mir das Leben verhaßt, schleppt sich unselig die Zeit. Warum prieset ihr einst mich oft so glücklich, o Freunde? Wer so stürzte, der stand niemals auf sicherem Fuß.
Erste Prose.
Die Philosophie erscheint in einer ehrwürdigen Frauengestalt, entfernt die Musen als unfähig, den Kranken zu heilen, und verspricht ihm eine bessere Arznei aus ihrem Heiligtume zu geben.
WÄHREND ich solches schweigend bei mir selbst erwog und meine tränenvolle Klage mit Hilfe des Griffels aufzeichnete, schien es mir, als ob zu meinen Häupten ein Weib hinträte von ehrwürdigem Antlitz, mit funkelndem und über das gewöhnliche Vermögen der Menschen durchdringendem Auge, von leuchtender Farbe und unerschöpfter Jugendkraft, obwohl sie so bejahrt war, daß sie in keiner Weise unserem Zeitalter anzugehören schien. Ihr Wuchs war von wechselnder Größe; denn jetzt zog sie sich zum gewöhnlichen Maß der Menschen zusammen, jetzt aber schien sie mit dem Scheitel den Himmel zu berühren; und als sie noch höher ihr Haupt emporhob, ragte sie in den Himmel selbst hinein und entzog sich so dem Blick der Menschen. Ihr Gewand war von feinstem Gespinst und mit peinlicher Kunstfertigkeit aus unlösbarem Stoff gefertigt; sie hatte es, wie ich später aus ihrem eignen Munde erfuhr, mit eigner Hand gewebt. Seinen Glanz hatte wie bei rauchgeschwärzten Bildern ein trüber Anflug von Vernachlässigung und Alter überzogen. An seinem untersten Rande las man eingewebt ein griechisches Π, an seinem obersten aber ein θ. Und zwischen beiden Buchstaben schienen wie an einer Leiter etliche Stufen eingezeichnet, die von dem unteren zum oberen Schriftzug emporstiegen. Doch hatten dieses selbe Kleid die Hände einiger Gewalttätiger zerfetzt, und jeder hatte ein Stückchen nach Vermögen weggeschleppt. Ihre Rechte endlich trug Bücher, ihre Linke aber ein Zepter.
Als sie die Dichtermusen, die mein Lager umstanden und meiner Tränenflut Worte liehen, erblickte, sprach sie etwas erregt, entflammt mit finsteren Blicken: „Wer hat diesen Dirnen der Bühne den Zutritt zu diesem Kranken erlaubt, ihnen, die seinen Schmerz nicht nur mit keiner Arznei lindern, sondern ihn obendrein mit süßem Gifte nähren möchten? Sind sie es doch, die mit dem unfruchtbaren Dorngestrüpp der Leidenschaften die fruchtreiche Saat der Vernunft ersticken, die der Menschen Seelen an die Krankheit gewöhnen, nicht sie davon befreien. Wenn eure Schmeichelreden einen Uneingeweihten, wie es gemeinhin durch euch geschieht, ablenken, so würde ich das für minder lästig halten. In diesem aber darf unser Werk nicht verletzt werden; denn er ist mit den Studien Eleas und der Akademie ernährt worden. Drum hinweg ihr Sirenen, die ihr süß seid bis zum Verderben, überlaßt ihn meinen Musen zur Pflege, zur Heilung.“
So gescholten senkte jener Chor tief bekümmert die Blicke, Erröten verriet ihre Scham, so gingen sie traurig über die Schwelle hinaus. Ich aber, dessen tränenüberströmtes Antlitz ein Nebel hüllte, so daß ich nicht unterscheiden konnte, wer diese Frau von so gebietender Würde sei, verstummte, heftete mein Auge auf die Erde und begann schweigend abzuwarten, was sie nun weiter tun werde. Da trat sie näher an mich heran, setzte sich auf das Ende meines Bettes, blickte auf mein tränenschweres, auf die Erde geneigtes Antlitz und klagte in folgenden Versen über die Verwirrung meines Geistes:
Zweites Metrum.
Die Philosophie stellt dem Verfasser mit Bedauern vor, wie elend und verwirrt sein Geisteszustand, wie entfernt von dem vormaligen Streben nach Weisheit sei.
Wehe wie sinkt zum Grund nieder die Seele;
Also erschlafft, vergißt eigenen Licht’s sie,
Sucht mit schwankendem Schritt draußen das Dunkel;
Und vom irdischen Hauch immer vermehret
Wächst bis zum Übermaß nagende Sorge.
Und einst war sie gewöhnt Räume des Himmels
Zu ätherischem Flug frei zu durchmessen,
Schaute das rosige Licht frühe der Sonne,
Blickt’ auf den frostigen Glanz spät noch des Mondes,
Wie der wandelnde Stern zieht seine Bahnen,
In verschlungenem Kreis wieder zurückkehrt,
Hatt’ er in Zahlen gefaßt, hier auch ein Sieger.
Forschte die Gründe er doch, welche das Brausen
Regeln des Sturms, der tiefaufwühlt die Meerflut,
Welch ein geistiger Hauch umdreht den Erdkreis,
Was das Abendgestirn senkt in des Westens
Meereswogen und früh rötlich im Ost hebt,
Was die Tage im Lenz angenehm mildert,
Daß die Erde sich schmückt rosig mit Blüten,
Wer es macht, daß der Herbst schwanger von Früchten
Überfließt, bis zuletzt schwellend von Trauben.
Alles hat er erforscht, bis zur verborgnen,
Wechselreichen Natur Gründe gelangt er!
Und nun ist ihm des Geist’s Leuchte erloschen,
Und den Nacken im Druck engender Ketten
Zwingt die wuchtende Last nieder den Blick ihm,
Wehe nur dich zu schau’n, törichte Erde!
Zweite Prose.
Der Verfasser, von übermäßigem Schmerze betäubt, hört nicht auf zu klagen. Die Philosophie trocknet freundlich seine Tränen, und fängt an ihm die Augen zu öffnen.
JEDOCH, sagte sie, hier ist Arznei mehr am Platz als Klage. Dann aber richtete sie das Auge voll auf mich und sprach: Bist du es, der du einst mit unserer Milch genährt, mit unserer Speise erzogen, zu mannbarer Geisteskraft gereift warst? Hatten wir dir doch Waffen gegeben, die dich, hättest du sie nicht vorher fortgeworfen, durch ihre nie besiegte Festigkeit beschützt hätten. Erkennst du mich nun? Warum schweigst du? Bist du vor Scham oder vor Staunen verstummt? Lieber wollte ich vor Scham, aber ich sehe, Staunen hat deine Zunge gelähmt. Und wie sie mich nicht bloß schweigend, sondern völlig sprachlos sah, legte sie ihre Hand sanft auf meine Brust: Es ist keine Gefahr, sagte sie, er leidet an schlaffer Abspannung, der gewöhnlichen Krankheit verblendeter Geister. Er hat ein wenig seiner selbst vergessen, er wird sich leicht auf sich besinnen, wenn er zuvor uns erkannt hat. Auf daß er dies könne, wollen wir ein wenig seine Augen abwischen, die trüb sind von der Umwölkung irdischer Dinge. So sprach sie und trocknete mit ihrem gefalteten Gewand meine von Tränen strömenden Augen.
Drittes Metrum.
Der Kranke erfreut sich, daß die Nacht entflieht, und sein Geist wieder heller wird.
Da verließ mich das Dunkel, es wichen die nächtlichen Nebel,
Frühere Kraft rückkehrte den Augen.
Wie wenn vom Südwind getrieben die stürmischen Wolken sich ballen,
Regenverschleiert am Himmelsgewölbe
Sich die Sonne verbirgt, kein Sternbild am Himmel aufsteigt,
Wenn auf die Erde dunkele Nacht sinkt;
Dann aus thrazischer Höhle gesandt sie Boreas aufpeitscht
Und den verschlossenen Tag wieder auftut,
Phöbus zuletzt hervortritt und Pfeile des Lichtes schleudert,
Staunende Augen die Strahlen verwunden.
Dritte Prose.
Die Philosophie erteilt den Rat, sich gegen die Angriffe der Bösen in die Feste der wahren Weisheit zu flüchten, indem sie die wahren, nicht bloß vermeintlichen Philosophen als Bespiel aufstellt.
NICHT anders zerstreute sich mir der Nebel der Traurigkeit, ich sog den Anblick des Himmels ein, gewann meine Besinnung wieder und erkannte das Antlitz meiner Ärztin. Als ich nun die Augen auf sie wandte, meinen Blick auf sie heftete, sah ich meine Nährerin wieder, an deren Herde, ich von Jugend auf erwachsen war, die Philosophie. Und wie, sprach ich, du bist in diese Einsamkeit meines Kerkers gekommen, du, die Meisterin aller Tugend, hast dich von deinem hohen Wohnsitz herabgelassen? Oder bist du mit mir angeklagt, wirst auch du von falschen Anschuldigungen verfolgt?
Sollte ich dich meinen Zögling verlassen, antwortete jene, sollte ich nicht die Bürde, die du um meines verhaßten Namens willen auf dich genommen hast, in gemeinsamer Mühe mit dir teilen? Es war die Pflicht der Philosophie, den Weg des Unschuldigen nicht unbegleitet zu lassen; ich sollte die Anschuldigung meiner selbst scheuen und vor ihr zurückschrecken, als ob es etwas Neues wäre? Meinst du denn, daß erst jetzt, wo die Sitten verderbt sind, die Weisheit von Gefahren bedrängt sei? Haben wir nicht auch bei den Alten schon vor der Zeit unseres Plato oft den großen Kampf mit der Unbesonnenheit der Dummheit gekämpft? Dieser zwar blieb leben; hat aber nicht sein Lehrer Sokrates mit meinem Beistand in ungerechtem Tod den Sieg errungen? Als dann dessen Erbschaft der epikureische und stoische Pöbel und alle anderen jeder sein Teil zu rauben trachteten, als sie mich trotz Widerspruchs und Widerstrebens wie ein Beutestück hin- und herzerrten, zerrissen sie mein Gewand, das ich mit eignen Händen gewebt hatte. Fetzen rissen sie von ihm ab und gingen davon im Glauben, daß ich ihnen ganz gehöre. Und da man noch einige Spuren meiner Tracht an ihnen entdeckte und sie daher für meine Freunde hielt, so hat selbst einige von ihnen, ihrer Unklugheit überführt, der Irrtum der gemeinen Menge ins Verderben geführt.