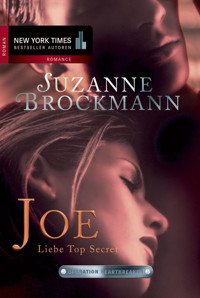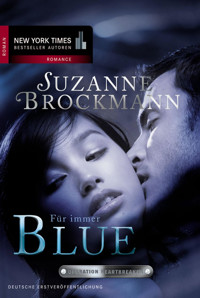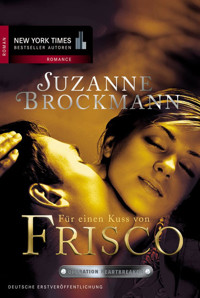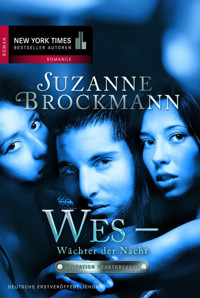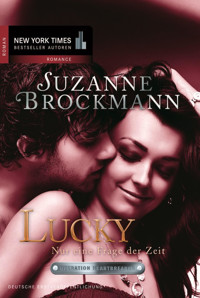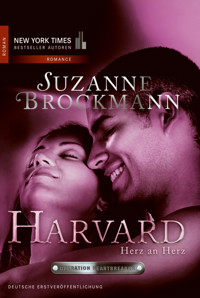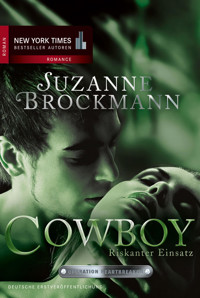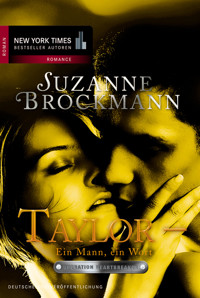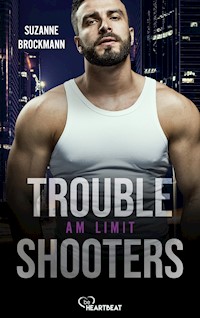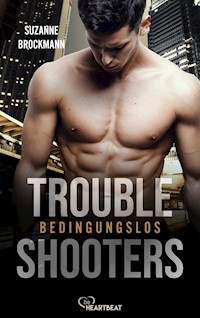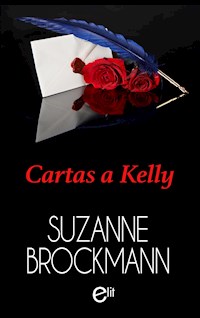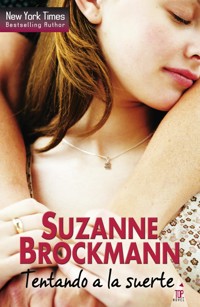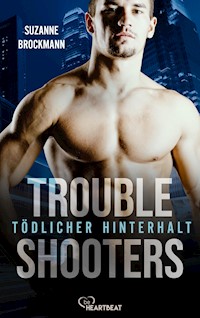
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Troubleshootes - die heißesten Navy SEALs der Welt!
- Sprache: Deutsch
Nur gemeinsam haben sie eine Chance!
Tom Paoletti ist kein normaler Navy Seal. Er ist Teil der Troubleshooters - einer Spezialeinheit. Nach einer schweren Kopfverletzung soll er sich in seiner Heimatstadt in Neuengland erholen. Doch daraus wird nichts, denn am Flughafen sieht Tom einen für tot erklärten Terroristen. Als er seinen Vorgesetzten von der Entdeckung berichtet, schenken sie ihm keinen Glauben, und er beschließt kurzerhand, den Terroristen gemeinsam mit seiner Jugendliebe Dr. Kelly Ashton auf eigene Faust zu schnappen. Doch das erweist sich als gefährlicheres Unterfangen, als Tom je hätte ahnen können ...
Die meisterhafte Mischung aus Abenteuer, Dramatik, Leidenschaft und Spannung ist ein Muss für die zahlreichen Fans von Suzanne Brockmann, dem Superstar des Romantic Suspense!
»Ein meisterhaft geschriebener Roman, äußerst berührend und atemberaubend spannend!« ROMANTIC TIMES
Die Troubleshooter-Reihe - die heißesten Navy SEALs der Welt!
Band 1: Troubleshooters - Tödlicher Hinterhalt
Band 2: Troubleshooters - Bedingungslos
Band 3: Troubleshooters - Am Limit
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Danksagung
Über die Autorin
Alle Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Hat es dir gefallen?
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:
be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Tom Paoletti ist kein normaler Navy Seal. Er ist Teil der Troubleshooters – einer Spezialeinheit. Nach einer schweren Kopfverletzung soll er sich in seiner Heimatstadt in Neuengland erholen. Doch daraus wird nichts, denn am Flughafen sieht Tom einen für tot erklärten Terroristen. Als er seinen Vorgesetzten von der Entdeckung berichtet, schenken sie ihm keinen Glauben, und er beschließt kurzerhand, den Terroristen gemeinsam mit seiner Jugendliebe Dr. Kelly Ashton auf eigene Faust zu schnappen. Doch das erweist sich als gefährlicheres Unterfangen, als Tom je hätte ahnen können …
SUZANNE BROCKMANN
Troubleshooters
TÖDLICHER HINTERHALT
Aus dem amerikanischen Englisch von Christian Bernhard
Für die tapferen Frauen und Männer,
die im Zweiten Weltkrieg für die Freiheit gekämpft haben. Ihnen gilt mein aufrichtigster, bescheidener Dank.
Prolog
Frühjahr
Nachdem sowohl der Seahawk als auch sein Pilot einen Treffer abbekommen hatten, wurde die ohnehin schon schlimme Lage noch übler.
US Navy SEAL Lieutenant Tom Paoletti übernahm die Kontrolle über den Helikopter und zog ihn schlingernd gen Himmel hoch, während Jazz und Lopez alles unternahmen, um zu verhindern, dass der Pilot verblutete.
Die Special-Operations-Truppe mit acht Elitesoldaten war mit dem Auftrag, für die sichere Abreise der Frau eines Diplomaten zu sorgen, in diese Güllegrube von einem Land geschickt worden. Die Mission schien immerhin so wichtig zu sein, dass sie die Anwesenheit von Lieutenant Paoletti erforderte, dem kommandierenden Offizier von SEAL-Team 16. Und tatsächlich kam der Befehl von Admiral Chip Crowley höchstpersönlich.
Dieser hatte Tom knapp erklärt, er hoffe, das Auftauchen des COs sowie seines Executive Officers, Lieutenant Junior Grade Casper »Jazz« Jacquette, werde bewirken, dass sich die faschistischen Arschlöcher weder wie Faschisten noch wie Arschlöcher verhalten würden.
Wenn Tom mit seinem lockeren Lasst-uns-doch-Freunde-sein-Lächeln vor Ort wäre, welches von den vielen Abzeichen an seinem Revers konterkariert wurde, die vermittelten: »Ihr solltet mich ernst nehmen«, und mit seiner gelassenen, autoritären Ausstrahlung aufträte – vielleicht, ganz vielleicht würden diese Widerlinge dann tatsächlich ihr Versprechen einhalten, die Truppe mit Mrs Hampton im Schlepptau abziehen zu lassen.
Und mit dem ein Meter dreiundachtzig großen, fast ebenso breiten, sehr ernsten, sehr stillen, sehr dunklen und sehr, sehr gefährlich aussehenden Jazz an seiner Seite wäre diese Mission womöglich tatsächlich nicht mehr als eine Acht-Mann-Eskorte.
Die Regierung vor Ort hatte immer wieder versichert, dass Mrs Hampton nicht gegen ihren Willen festgehalten werde. Also waren Tom und sein Team mit einem Linienflug ins Land gereist, hatten am Flughafen einen Van gemietet und waren hinaus zu dem Hotel gefahren, in dem die Hamptons gewohnt hatten, bevor Ronald Hampton auf die fatale Idee gekommen war, ohne seine Frau einen Tagesausflug in eines der Nachbarländer zu unternehmen. Innerhalb nur eines Nachmittags und ohne jede Vorwarnung hatte sich die politische Situation in dieser Region so radikal verändert, dass dem guten Ron und seinen Begleitern die Wiedereinreise verwehrt worden war.
Mrs Hampton befand sich tatsächlich in dem besagten Hotel – was Tom innehalten und überlegen ließ, ob es sein konnte, dass sie die Frau wirklich bloß ohne jeden Zwischenfall zum Flughafen zu eskortieren brauchten. Er dachte sogar eine ganze Weile darüber nach, während er mit seiner Truppe in einem angenehm kühlen Garten hinter dem Haus saß, Eistee trank und auf Mrs Hampton wartete, die ihre Sachen packte. Bevor die Dame schließlich selbst erschien, wurden sechs riesige Koffer in die Lobby gebracht.
Mrs Wilhelmina Hampton.
Sie war eine dieser Frauen Mitte fünfzig mit ledriger Haut, die aussahen, als würden sie immerzu ein weißes Tennisdress mit diesem kleinen Höschen darunter anhaben und den dazu passenden Schläger in der einen Hand sowie in der anderen ein Martiniglas und eine Zigarette halten, und schien nicht gerade glücklich darüber zu sein, ihre SEAL-Eskorte zu sehen. Als Tom auch noch vorschlug, sie solle den Großteil ihres Gepäcks nach Hause schicken lassen, da die Gepflogenheit der örtlichen Regierung, Koffer gründlich zu durchsuchen, sie Zeit kosten könne, lehnte sie dies mit jammerndem Tonfall ab, woraufhin der CO sich ernsthaft fragte, warum die Vereinigten Staaten bloß solche Mühe auf sich nahmen, diese Frau außer Landes zu bringen.
Mit einem etwas weniger freundlichen Tonfall merkte er an, dass sich kurzzeitige Verzögerungen in solchen Gegenden der Welt meist zu dauerhaften Aufenthalten entwickelten. Und obwohl Mrs Hampton ihr Gequengel daraufhin nicht vollkommen bleiben ließ, wurde sie dennoch wesentlich leiser und ließ widerwillig drei der Gepäckstücke zurück.
Tom gab sie in die Obhut von Mark Jenkins, einem blutjungen, sommersprossigen Petty Officer Third Class mit der ernsten, engelsgleichen Miene eines Chorjungen. Tatsächlich jedoch war Jenk ein verschlagener Rüpel und der beste Lügner, den Tom in all den Jahren bei den SEALS kennengelernt hatte. Der Petty Officer schenkte Mrs Hampton sein liebenswertestes Lächeln, fragte sie nach ihren Enkeln und führte sie zum Wagen, wo sie auf einem sicheren Sitz in der Mitte Platz nahm, kratzte sich auf der Tom zugewandten Seite seines Gesichts jedoch demonstrativ mit dem Mittelfinger an der Schläfe.
Als sie schließlich vom Parkplatz des Hotels fuhren, hockte O’Leary zur Sicherheit hinten im Wagen. »Eine schwarze Limousine ist direkt hinter uns.«
Sie wurden verfolgt.
Tom wäre auch überrascht gewesen, wenn sie das Hotel ohne Beschatter verlassen hätten.
Jenk und Lopez bestaunten Fotos von Mrs Hamptons ungemein hässlichem Enkelkind, während in der Ferne die erste Sirene ertönte.
Fähnrich Sam Starrett, der am Steuer des Wagens saß, erwiderte den Blick seines Vorgesetzten im Rückspiegel.
»Langsam«, ordnete Tom an. Solange sie nicht sicher sein konnten, ob die Fahrzeuge mit den Sirenen tatsächlich auf sie zukamen, war es unklug, Gas zu geben. Wenn sie die Flucht nach vorn antraten, würde dieses ganze Scharadespiel kippen. Doch momentan konzentrierten sie sich alle noch voll und ganz darauf, so zu tun als ob. Die Regierung würde sie in dieses Flugzeug steigen lassen. Ganz bestimmt.
WildCard, auch bekannt als Petty Officer First Class Kenny Karmody, saß auf dem Beifahrersitz und überwachte den Funk, um ihn so einzustellen, dass ihr Sprachenexperte im Team, Fähnrich John Nilsson, alles mitbekam.
»Vier Wagen und ein Armeetransporter, Lieutenant, mit einem ganzen Zug Besatzung. Sie fahren vom Flughafen aus los, bereit, uns abzufangen – sie haben Befehl, falls nötig Gewalt anzuwenden«, gab Nilsson durch.
WildCard drehte sich um und schaute Tom fröhlich an. Allerdings bereitete ihm auch so gut wie alles Freude. »Plan B, Eure Exzellenz?«
Admiral Crowley hatte betont, dass bei dieser Mission Diplomatie absoluten Vorrang vor einer gewalttätigen Auseinandersetzung habe. Tom wusste, wenn seine Truppe das Feuer eröffnete, würde er hinterher verdammt viel erklären müssen. Doch lieber verbrachte er ein paar unangenehme Stunden damit, vor Crowleys Schreibtisch zu sitzen und dieses Vorgehen zu begründen, als dass sein gesamtes Team sowie die »reizende« Mrs Hampton die nächsten sechs Jahre in irgendeinem Dreckloch von Gefängniszelle hockten und Anlass für eine Briefkampagne von Amnesty International wurden.
Plan B erschien ihm also eine verdammt gute Wahl.
»Los geht’s!« Er hatte den Satz kaum beendet, da gab O’Leary bereits einen sauberen Schuss in einen der Vorderreifen der Limousine ab.
Dann bog Starrett auf zwei Reifen scharf rechts ab, sodass die Hauptstraße und die schlingernde Limousine in Staub gehüllt wurden.
Als sie dabei nur knapp einem Frontalzusammenstoß mit einem Gemüselaster entgingen, begann Mrs Hampton zu schreien. »Was tun Sie da? Was tun Sie da?«
Jenk musste mit seiner jugendlichen Tenorstimme lauter werden, um sie zu übertönen. »Mrs Hampton, Ma’am. Auch wenn man uns versichert hat, dass Sie unbehelligt an Bord einer Linienflugmaschine gehen dürften, haben wir sicherheitshalber Vorkehrungen für eine andere Abreise getroffen. Außerhalb der Stadt steht ein Seahawk-Helikopter bereit. Lieutenant Paoletti hält es im Moment für klüger, wenn wir den Weg dorthin einschlagen.«
»Lieutenant, ich trete das Gaspedal schon voll durch«, rief Starrett. »Aber diese Scheißkarre fährt maximal siebzig.«
Sie rasten zwar in einem alarmierend hohen Tempo durch die engen Nebenstraßen voller Schlaglöcher. Doch falls man sie aktiv verfolgte, würde es sich trotzdem bald als zu langsam erweisen, so viel stand fest.
Was allerdings auch nicht weiter verwunderlich war, immerhin befanden sich acht große Männer, eine nicht gerade leichtgewichtige Dame und dazu noch drei schwere Koffer in dem alten Van.
Es gab folglich nur eine Möglichkeit, die Last zu verringern. Oder besser gesagt drei.
Tom bemerkte Jazz’ Blick. Sein XO wusste genau, woran er gerade dachte – umso besser, denn dann brauchte er es nicht laut auszusprechen. Mrs H. war ohnehin schon aufgebracht genug. Nur leider konnte O’Leary, der im Heck neben den Koffern saß, Toms Gedanken nicht lesen.
»O’Leary, helfen Sie mir, Ballast abzuwerfen«, befahl Jazz dem Scharfschützen mit seiner tiefen Darth-Vader-Stimme.
Mrs H. hatte zwar zu schreien aufgehört, doch man konnte ihr deutlich ansehen, dass ihr der Gedanke, mit dem Helikopter ausgeflogen zu werden, nicht sonderlich behagte. Zum Glück war ihr die nautische Floskel Ballast abwerfen offenbarjedoch nicht geläufig. Somit würde sie wenigstens nicht anfangen zu protestieren, ehe es ohnehin zu spät sein würde.
»In allem, was kleiner ist als eine 737, wird mir übel«, beschwerte sie sich gerade.
Tom beugte sich über die Rückenlehne seines Sitzes, um sie anzusehen, und hoffte, dass sie bei den nun folgenden Worten den Ernst der Lage begreifen würde.
»Wir haben gerade eine Funknachricht mitangehört, in der vier Wagen der Geheimpolizei und ein Transporter mit dreißig Soldaten beordert wurden, uns mit allen Mitteln aufzuhalten«, teilte er ihr mit und starrte sie dabei aus nächster Nähe an, sodass ihr nichts anderes übrig blieb, als ihm in die Augen zu schauen. »Ich vermute, Sie hatten während Ihres Aufenthalts hier keine Gelegenheit dazu, eine Führung durch das Hauptgefängnis zu machen, Ma’am. Stellen Sie sich einfach ein dunkles, kaltes Loch voller Ratten vor, in dem es nach ungewaschenen Körpern stinkt. Wenn das für Sie nach einem Ort klingt, an dem Sie die nächsten fünf Jahre verbringen möchten, dann sagen Sie’s einfach und wir lassen Sie am Straßenrand raus.«
Mrs H. wurde ziemlich still. Sie gab sogar nur ein unterdrücktes Quieken von sich, als sie den Luftzug von der offen stehenden Heckklappe her bemerkte und mitansehen musste, wie gerade der letzte ihrer Koffer über die Straße kullerte. Tom bezweifelte, dass jemals jemand schon einmal so deutliche Worte an sie gerichtet hatte, noch nicht einmal ihr überaus wichtiger Ehemann.
»Bleiben Sie dicht bei Petty Officer Jenkins«, fuhr er fort. »Wenn er oder jemand anderes aus diesem Team Ihnen einen Befehl gibt, sollten Sie ihn ohne Fragen zu stellen und ohne jedes Zögern befolgen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
Sie nickte heftig und presste wütend die Lippen zusammen. »Glasklar, Lieutenant. Aber Sie können sicher sein, dass ich mich in dieser Angelegenheit schriftlich an Ihren Vorgesetzten wenden werde. In den Koffern befand sich teure Designerkleidung, einige Stücke davon sind unersetzbar.«
»Halten Sie den Kopf unten und seien Sie still«, wies Tom sie an. »Wir werden Sie hier rausbringen, damit Sie Ihren Brief schreiben können. Das verspreche ich Ihnen.«
Mrs Hampton konnte sich eine letzte Frage nicht verkneifen. »Was sollte die davon abhalten, Ihren Hubschrauber abzuschießen?«
»Die US Air Force steht zu unserer Unterstützung bereit und wir haben ein Abkommen, das als Sondergenehmigung der NATO gewertet werden kann, falls nötig auch Waffengewalt einzusetzen – und das werden wir per Funk auch auf allen Kanälen durchgeben, sobald wir in der Luft sind. Die wären verrückt, wenn sie trotzdem auf uns schießen würden. Schätzungsweise werden wir in weniger als einer Stunde auf einem Flugplatz in einem den USA freundlich gesinnten Staat landen. Und ich werde persönlich dafür sorgen, dass Sie Briefpapier und einen Stift erhalten, sobald wir angekommen sind.«
»Was ist, wenn etwas schiefgeht?«, fragte Mrs H. säuerlich. »Gibt es auch einen Plan C?«
»Es gibt sogar immer einen Plan K, Ma’am.« Das K stand dabei für kreative, spontane Lösungen – etwas, worin Toms Special-Operations-Team besonders gut war.
Doch bisher lief Plan B wie geschmiert. Nilsson überwachte weiterhin den Funk, Starrett gab Gas und WildCard lotste sie durch die engen Straßen, sodass sie schließlich genau nach Zeitplan am Abholpunkt ankamen, wo sich auch der Seahawk bereits wie geplant näherte. Staub wirbelte auf, als der Pilot den Helikopter landete, damit sie Mrs H. an Bord bringen konnten.
Der Schlamassel begann, als ein voll besetzter Jeep der Feinde auftauchte. Es handelte sich dabei um einen dieser blöden Zufälle, die Tom total nervten. Die Patrouille war genau zur falschen Zeit am falschen Ort. Offenbar hatten die Männer den Hubschrauber gesehen und waren zum Landeplatz gefahren, um zu sehen, was dort vor sich ging. Keine neunzig Sekunden später, und der Helikopter wäre in der Luft gewesen. Nur neunzig Sekunden, und die SEALS hätten sich bereits in raschem Tempo aus der Schussweite der Soldaten bewegt.
Doch stattdessen bog nun die Patrouille mit den Waffen im Anschlag um die Ecke. Lopez, der genau danach Ausschau gehalten hatte, reagierte als Erster und warf eine Granate in Richtung der Soldaten, während Tom und Jazz Mrs Hampton in den Seahawk verfrachteten.
Die Soldaten stoben in alle Richtungen auseinander, doch einem von ihnen gelang es, ziellos ein paar Schüsse abzugeben.
Man konnte es schlichtweg als Pech bezeichnen, dass eine der Kugeln durch die offene Tür des Helis flog und den Piloten an der Schulter traf.
Obwohl es schon ein paar Jahre her war, dass er zuletzt einen solchen Vogel geflogen hatte, gelang es Tom, die Maschine hochzuziehen und sie wegzubringen. Zwar glitten sie nicht gerade dahin, aber es kam dem Ganzen schon relativ nahe.
»Mein Gott, Skipper«, schrie Jenks über das unablässige Gekreische von Mrs H. hinweg. »Wir qualmen.«
Verdammt, tatsächlich. Aus der Maschine quoll eine dichte Rauchwolke wie ein Signalfeuer. Eine Kugel musste in eines der beiden Triebwerke eingeschlagen haben, was man für die gegnerische Seite wohl als Glückstreffer bezeichnen konnte. Verdammte Scheiße!
Sie befanden sich zwar schon ein gutes Stück außerhalb der Stadt und näherten sich der Grenze, würden es jedoch nicht bis hinüber schaffen, nicht mit einem Triebwerkschaden. Und, Gott stehe ihnen bei, auch die Treibstoffanzeige spielte verrückt. Der Tank schien ebenfalls getroffen worden zu sein. Ein qualmendes Triebwerk und ein Leck im Tank waren keine gute Kombination, es sei denn man wollte eine Explosion. Er musste die Kiste runterbringen, und zwar sofort!
Das Gebiet unter ihnen war karg und ausgedörrt, eine Wüste mit unwirtlich aussehenden Felsen und kaum mehr als jede Menge Staub. Es hatte mehr Ähnlichkeit mit dem Mond als mit der saftig grünen Landschaft Neuenglands, in der der CO aufgewachsen war.
»Festhalten!«, schrie Tom, als er den Hubschrauber mit Mühe und Not herunterbrachte. Die Landung fiel dann auch eher holprig aus – zum Teufel, kam einem Absturz ziemlich nahe. Alles, was nicht festgeschnallt war, flog durch die Gegend. »Jazz, bring Mrs H. hier raus! Los!«
Seine Männer hatten sich bereits in Bewegung gesetzt. Jazz und Jenks hakten Mrs Hampton unter, hoben sie aus dem Helikopter und trugen sie über den knochentrockenen Boden, um hinter einer Felszunge Schutz zu suchen, während diese unentwegt strampelte und sich die Lunge aus dem Leib schrie.
Lopez und WildCard kümmerten sich indes um die Bergung des Piloten, derweil sich Nilsson, Starrett und O’Leary bereits so viel Ausrüstung und Wasser aufgeladen hatten, wie sie tragen konnten.
Tom war der Letzte, der aus dem Hubschrauber sprang. Als er zu den anderen rannte, ging ihm durch den Kopf, dass seine kleine Ansprache nicht das Geringste dazu beigetragen hatte, Mrs Hamptons Gezeter zu unterbinden. Dann erst nahm er wahr, was sie da gerade schrie. Ihre Handtasche … Sie hatte ihre verdammte Handtasche liegen lassen.
»Tut mir leid, Ma’am«, hörte er Jazz sagen, »Sie müssen wohl ohne sie auskommen. Das Teil ist eine Zeitbombe, es wird –«
»Meine Herztabletten sind darin!« Mrs Hamptons kratzige Stimme schien von den Felsen widerzuhallen und gegen die sanft ansteigenden Hügel zu prallen.
Herztabletten …
Scheiße!
Plötzlich fühlte es sich an, als würde sich die Welt im Zeitlupentempo drehen. Tom sah, wie Jazz hinter der Felszunge hervortrat und auf ihn zu wieder in Richtung Helikopter gelaufen kam. Aber er selbst war gute dreißig Meter näher dran. Er machte eine halbe Drehung, rutschte jedoch auf dem sandigen Untergrund aus und hatte Mühe, das Tempo beizubehalten, als er nun zur Maschine zurückrannte.
Nach zehn Schritten befand er sich wieder im Inneren des Helis, um das verfluchte Teil zu suchen. Doch wie es einem mit den meisten Frauenhandtaschen erging, wenn man sie schnell finden musste, war auch diese nirgends zu entdecken. Er legte sich auf den Metallfußboden, suchte unter den Sitzen und …
Volltreffer! Die beigefarbene Ledertasche musste bei der Landung nach vorn gerutscht sein. Er schnappte sie sich, war innerhalb eines Wimpernschlags wieder draußen und rannte so schnell er nur konnte.
Er befand sich noch gute zwanzig Meter von den Schutz bietenden Felsen entfernt, als der Seahawk hinter ihm hochging und er durch die Wucht der Explosion durch die Luft geschleudert wurde. Viel zu schnell sah er den Boden auf sich zukommen.
Verdammt, schoss es ihm durch den Kopf, während er Mrs Hamptons Handtasche an sich drückte, um sie mit seinem Körper zu schützen, das würde wehtun.
Und dann hörte er auf zu denken, denn alles um ihn herum wurde schwarz.
1
8. August
Tom zog seine Tasche aus dem Gepäckfach über den Sitzen und schlurfte gemächlich hinter den anderen Reisenden von Bord des Passagierflugzeugs hinaus auf das Rollfeld des Bostoner Logan International Airports.
Sich so langsam zu bewegen tat gut, insbesondere, wenn er – wie jetzt gerade – Schwindelanfälle bekam, welche von seiner Kopfverletzung herrührten, die ihn beinahe für immer außer Gefecht gesetzt hätte.
Hinter dem Terminal konnte man im trüben Morgenlicht die Silhouette der Stadt erkennen. Willkommen im sommerlichen Neuengland!
Und die Luftfeuchtigkeit würde noch weiter steigen, so viel war klar. Tom machte sich auf den Weg zu der kleinen Gemeinde Baldwin’s Bridge, die sich an der Nordküste befand. Er hatte viel zu viel Zeit im Krankenhaus verbracht, weit weg von seiner Kommandoeinheit. Wobei er dank Rear Admiral Larry Tucker im Moment nicht einmal wusste, ob es überhaupt noch eine Einheit gab, zu der er zurückkehren konnte.
Während Tom im Koma lag, hatte es sich der Konteradmiral nämlich zur Aufgabe gemacht, SEAL-Team 16 auf die Einsparungsliste für das kommende Haushaltsjahr zu setzen. Verständlich, dass der CO die Beherrschung verloren hatte, als ihm das Ganze zu Ohren gekommen war. Und obendrein hatte Tucker auch noch die Special-Operations-Einheit von Team 16 – von einigen nur »die Troubleshooters«, von hohen Tieren, die nicht den SEALs angehörten, wie Tucker jedoch »die Troublemakers« genannt – in alle Ecken der Welt verstreut. Dabei handelte es sich um eine Eliteeinheit von Männern, die Tom über Jahre hinweg sorgfältig ausgewählt hatte.
Also war der Lieutenant vor dem Rear Admiral ausgerastet, hatte ihn in Washington D. C. jedoch weder durch das Fenster seines Büros im vierten Stock geworfen noch ihm das selbstzufriedene Grinsen aus dem Gesicht geschlagen, sondern seine Einwände lediglich in einem vielleicht etwas heftigeren Tonfall vorgebracht, als er es für gewöhnlich tat.
Aber genau deshalb war eine weitere Woche seines Lebens dafür draufgegangen, dass er sich von einem Team aus Ärzten und Psychiatern untersuchen lassen musste, das herauszufinden versuchte, ob sein Ausbruch mit seiner kürzlich erlittenen schweren Kopfverletzung zusammenhing.
Auch wenn er natürlich versucht hatte, den Medizinern klarzumachen, dass sein Wutanfall eigentlich bloß eine Nebenwirkung im Umgang mit Tucker war.
Doch sein behandelnder Arzt – Captain Howard Eckert – hatte es auf eine Beförderung abgesehen und tat folglich alles, um beim Rear Admiral gut dazustehen. Toms Erklärungen zeigten also keinerlei Wirkung, und Eckert beurlaubte ihn schließlich für dreißig Tage, damit er sich weiter von seiner Verletzung erholen konnte. Der Arzt und die Seelenklempner warnten ihn zudem davor, bei solchen Verletzungen sei es nicht selten, dass sich vorübergehend leichte Persönlichkeitsveränderungen bemerkbar machten – aggressives Verhalten, Verfolgungswahn und Paranoia. Hinzu kamen natürlich die Schwindelanfälle und Kopfschmerzen. Deshalb solle er möglichst versuchen, ruhig und entspannt zu bleiben. Denn wenn er nach dreißig Tagen zum Marinestützpunkt in Virginia zurückkehrte, müsste er eine ähnliche Reihe von Tests über sich ergehen lassen, deren Ergebnisse schließlich über sein Schicksal entschieden.
Würde man ihn für dienstuntauglich erklären und entlassen oder würde er seine Laufbahn in der US Navy fortsetzen können?
Für ihn kam Variante A nicht infrage, doch er wusste, dass Tucker alles daransetzte, ihn sicher in den Ruhestand zu schicken. Und das wiederum bedeutete, Tom müsste in den nächsten dreißig Tagen alles dafür tun, damit er so ruhig und entspannt – und so mental ausgeglichen – wie möglich wurde.
Was seine geistige Gesundheit anging, so kannte er sich selbst gut genug, um zu wissen, dass es keine gute Idee war, für mehr als ein verlängertes Wochenende nach Hause zu fahren. Und ein Aufenthalt von Dienstag bis zum darauffolgenden Sonntag bedeutete schon ein sehr langes Wochenende.
Eine kurze Stippvisite würde ihm jedoch guttun. Er wollte seinen Großonkel Joe besuchen, zudem seine Schwester Angela sowie seine Nichte Mallory sehen. Mal hatte in diesem Jahr ihren Highschoolabschluss gemacht, und ihre Teenagerzeit stellte sich gerade als ebenso turbulent heraus, wie seine und Angies es gewesen war.
Es hatte den Anschein, als wäre es immer noch keine leichte Sache, als Spross der Paolettis im noblen Baldwin’s Bridge in Massachusetts aufzuwachsen. Verdammt, es gab Polizisten, denen sich noch immer die Nackenhaare sträubten, wenn sich Tom ihnen nur näherte.
Dabei war er inzwischen sechsunddreißig Jahre alt und ein ebenso hochdekorierter wie angesehener kommandierender Offizier bei den US Navy SEALs. Und trotzdem hielten sich nach wie vor hartnäckig all die alten Bezeichnungen für ihn – wie Störenfried, Nichtsnutz oder »das wilde Paoletti-Balg«.
Nein, so sehr er Joes Gesellschaft auch vermisste, ein Wochenende in Baldwin’s Bridge würde definitiv genügen. Aber vielleicht gelang es ihm ja, Joe dazu zu überreden, mit ihm für eine Woche oder auch zwei auf die Bermudas zu fliegen. Was eine feine Sache wäre. Und falls Joe darauf bestehen sollte, würde Tom sogar Charles Ashton mit auf die Reise nehmen.
Mr Ashton war Joes verschrobener bester Freund – oder aber sein Erzfeind, das hing ganz von der Laune der beiden alten Männer ab. Der Kerl konnte es wahrlich mit Ebenezer Scrooge und dem Grinch aufnehmen, also durchaus als reizendes, alkoholgeschwängertes Gesamtpaket bezeichnet werden. Doch Joe kannte ihn schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Hinter seiner Loyalität zu dem alten Grantler steckte eine lange Geschichte, und das respektierte Tom. Mal abgesehen davon konnte ein Mann, der jemanden wie Kelly Ashton gezeugt hatte, so schlecht nicht sein.
Kelly Ashton … Jedes Mal, wenn er nach Baldwin’s Bridge zurückkehrte, musste er an sie denken. Aber natürlich spukte sie ihm auch im Kopf herum, wenn er nicht dort war. Wenn man bedachte, dass er sie vor sechzehn Jahren zuletzt gesehen hatte, drehten sich seine Gedanken genau genommen viel zu oft um sie.
Wie hoch standen wohl die Chancen, dass sie ihren Vater ausgerechnet in dieser Woche besuchen würde, während sich auch Tom in der Stadt aufhielt?
Sie strebten gegen null. Kelly war inzwischen eine viel beschäftigte Ärztin mit einem ausgefüllten Leben, da saß sie bestimmt nicht herum und wartete darauf, dass Tom nach Hause kam.
Und sechzehn Jahre hätten definitiv auch für ihn genug Zeit sein sollen, um es sich abzugewöhnen, über diese Frau nachzudenken. Vor allem wenn man bedachte, dass sie verheiratet gewesen war, hatte sie es für ihren Teil offensichtlich getan.
Inzwischen war sie allerdings wieder geschieden.
Was genau genommen aber rein gar nichts zu bedeuten hatte. Soweit er wusste, war sie bereits wieder unter der Haube. Er musste also aufhören, an sie zu denken. Sie würde nicht da sein.
Tom schlängelte sich durch den vollen Flughafen zum Überstand, von dem aus der Shuttlebus zur U-Bahn – in Boston »the T« genannt – abfuhr. Er ging an der Gepäckförderanlage vorbei, schob sich durch das Gewusel von Menschen, die nun, da sich das Band in Bewegung gesetzt hatte, leicht darauf zu drängten.
Die Menge bestand vornehmlich aus urlaubenden Familien und älteren Reisenden, die auf ihre Koffer und Taschen warteten. Die Geschäftsleute hatten nur Handgepäck dabei und den Terminal längst verlassen.
Ein einzelner Mann in einem dunklen Anzug stach jedoch aus der Masse heraus. Er war in etwa so groß wie Tom und hatte hellbraunes, von grauen Strähnen durchzogenes Haar. Als er sich hinunterbeugte, um seine Tasche vom Gepäckband zu nehmen, und sie sich dann mit einer merkwürdigen Drehbewegung über die Schulter hievte, hielt Tom abrupt inne.
Nie im Leben!
War es denn die Möglichkeit, dass Tom von allen Orten in der Welt ausgerechnet am Logan Airport jenem Mann begegnete, den man als »den Kaufmann« kannte?
Sein Haar sah zu hell aus, allerdings ließ sich so etwas auch ganz leicht ändern.
Außerdem schien an seinem Gesicht irgendetwas verändert zu sein – wenngleich es insgesamt noch die gleichen Konturen besaß. Seine Nase und die Wangenknochen wirkten weicher, weniger prominent, und sein Kinn nicht ganz so markant, wie Tom es in Erinnerung hatte. Konnte dies das Werk eines Schönheitschirurgen sein? War das überhaupt möglich?
Tom ging näher an den Mann heran, um eine bessere Sicht auf ihn zu bekommen.
Seine Augen … Sie hatten eine andere Farbe. Es war ein trüber Ton aus Blau und Braun – jene unübliche Farbmischung, die braunäugige Menschen hinbekamen, indem sie sich blau getönte Kontaktlinsen zulegten. Aber die Farbe spielte keine Rolle. Tom hätte diese Augen überall wiedererkannt. Und dennoch, er hatte nur einen kurzen Blick erhascht.
Gott, war das möglich?
Die Tasche noch immer über der Schulter tragend, bewegte sich der Mann auf den Ausgang zu. Tom folgte ihm langsamer, denn die Menschenmenge erschwerte ihm das Durchkommen.
Im Gehen bewegte sich der Kerl anders als der Kaufmann. Aber zweifelsohne würde ein Mann, nach dem eine internationale Fahndung lief, daran arbeiten, ebenso wie das Gesicht und die Haarfarbe, seinen Gang zu verändern. Es blieb diese eine Drehbewegung … Tom hatte sie mehrfach auf verschiedenen Videoaufzeichnungen gesehen – seltenem Material vom Kaufmann in Aktion. Und seiner Beobachtung nach …
Noch immer sah Tom die Augen des Kaufmanns in seinen Träumen.
Während er dem Mann weiter folgte, stieß dieser die Tür nach draußen auf und lief auf ein Taxi zu, das am Straßenrand wartete.
Tom versuchte, aus dem Terminal zu gelangen, musste jedoch zuerst ein paar Trippelschritte hinlegen, um nicht ein Kleinkind zu treten, das seinen Eltern entwischt war, und dann um zwei ältere Damen herumzutänzeln.
Als er die Tür endlich erreichte, hämmerte es in seinem Kopf. Der Kaufmann indes war bereits in den Wagen eingestiegen und fuhr davon.
Was jetzt?Ihm folgen?
Es standen keine anderen Taxen bereit.
Während ihm die Melodie des Rocksongs »Paranoia« durch den Kopf ging, prägte Tom sich die Taxinummer ein, die in schwarzer Schrift auf dem Kofferraum des abfahrenden Wagens stand – 5768. Er sah auf seine Uhr. Es war fast 8:00 Uhr.
Wenn es sich tatsächlich um den Kaufmann gehandelt hatte, würde es nicht viel bringen, das Taxiunternehmen anzurufen, um zu erfragen, wohin Wagen Nummer 5768 den Fahrgast, der um 8:00 Uhr am Logan Airport eingestiegen war, gebracht hatte.
Der Kaufmann würde niemals vom Flughafen aus direkt zu seinem Ziel fahren, sondern sich in Downtown absetzen lassen, dann ein paar Blocks weit gehen und schließlich in ein weiteres Taxi steigen. Das Ganze würde er mehrfach wiederholen, bis er sich sicher sein konnte, dass niemand hinter ihm her war und sich seine Spur nicht verfolgen ließ.
Am anderen Ende des Überstands rollte der Shuttlebus zur U-Bahn an.
»Paranoia« schien ein bisschen lauter zu werden, bis Tom den Kopf schüttelte, und damit sowohl das Lied verdrängte als auch das Schwindelgefühl loswurde, das sich offenbar immer noch einstellte, wenn er zu lange auf den Beinen war.
Ja, es würde sich verdammt verrückt anhören, wenn er versuchte, das Ganze zu erklären. »Hallo, ich glaube, ich habe gerade den international gesuchten Terroristen, dem ich 1996 vier Monate lang hinterhergejagt bin, am Logan Airport in ein Taxi einsteigen sehen. Jepp, das ist in Boston, Massachusetts, dieser brodelnden Brutstätte internationaler Kriminalität …«
Ja, genau.
Tom stieg in den Shuttlebus.
Er würde den Anruf machen. So verrückt es auch klang, er musste jemanden verständigen. Er würde sich an Admiral Crowley wenden – der Mann hatte Toms merkwürdigem Instinkt schon einmal vertraut. Aber er würde anrufen, wenn ihn die behaglich-heimelige Atmosphäre von Onkel Joes Cottage in Baldwin’s Bridge umgab.
Er ließ seine Tasche zu seinen Füßen fallen und setzte sich auf einen Fensterplatz, lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen. Ruhe und Entspannung.
Es gelang ihm, still sitzen zu bleiben, doch seine Gedanken waren nicht zu stoppen.
Tom hatte keine Ahnung – keine Ahnung –, was er machen sollte, falls es Tucker gelang, ihn aus der Navy zu werfen.
Er lag mit einer Wange auf den kalten Fliesen.
Eigentlich fühlte es sich ziemlich gut an, doch Charles Ashton wollte nicht so wie Elvis sterben – auf dem Badezimmerfußboden mit der Schlafanzughose um die Knöchel.
Wie würdelos war das denn?
»Komm schon, Gott«, murmelte er vor sich hin und versuchte, sich die Hose wieder hochzuziehen, »sei nachsichtig mit einem alten Kerl.«
Er war mit dem Schöpfer per du, seit dem Tag, als Joe Paoletti ihn zu Dr. Grant gefahren und dieser viel zu junge Arzt die Worte, Sie und haben, Endstadium sowie Krebs in ein und demselben Satz verwendet hatte. Charles war damals zu dem Schluss gekommen, dass seine Beziehung zu Gott in naher Zukunft um einiges persönlicher und reger werden würde, also konnte er sich auch gleich mit dem Typen anfreunden.
Tod …
Dabei handelte es sich um kein sehr lustiges oder besonders schönes Wort, mit dem man irgendwelche angenehmen Bilder verband. Deshalb bevorzugte Charles auch die beschönigenden Ausdrücke wie »den Löffel abgeben« oder »hopsgehen« – welche doch ziemlich vergnügliche, nett klingende Umschreibungen darstellten. Und dann gab es da noch seine absolute Lieblingsbezeichnung: »abkacken«.
Nein, stopp! Da war ihm das schlichte Wort sterben doch lieber als diese absolut unschöne Vorstellung.
Nach Schätzung des Arztes blieben Charles noch etwa vier Monate, bevor er dahinfahren würde. Dahinfahren … was für ein dämlicher Ausdruck. Dabei musste er unweigerlich an entweichende Gase denken, so als ob sterben ein letzter riesengroßer Furz wäre.
Natürlich hatte ihn der altkluge Jungspund mit dem Medizinstudium gewarnt, er könne mit seiner Einschätzung auch falschliegen, der Moment der Wahrheit würde möglicherweise viel früher eintreten als erwartet.
Wie zum Beispiel an diesem Morgen.
Dabei hatte Charles keine Angst vor dem Sterben. Nicht mehr zumindest.
Na ja, nein, stopp noch einmal … Er hatte Angst, zu sterben – und zwar genau dort auf dem Badezimmerfußboden. So etwas hing einem ewig nach.
»Erinnern Sie sich noch an Charles Ashton?«, würde jemand fragen. »Ja, klar, Ashton«, käme die Antwort. »Der ist in seinem Badezimmer abgenippelt, und sein fetter, nackter Arsch hing ihm aus der Hose.«
All seine Spenden an gemeinnützige Organisationen und sein wohltätiges Handeln wären mit einem Mal vergessen. Vergessen wäre die Tatsache, dass er dem Krankenhaus von Baldwin’s Bridge Geld für eine Kinderstation gestiftet hatte, zum Andenken an seinen Sohn, der an einem Blinddarmdurchbruch gestorben war, und an einen französischen Jungen, den die Nazis umgebracht hatten – dabei war er dem Kleinen nie begegnet. Vergessen wäre der Krieg, den zu gewinnen er beigetragen hatte. Vergessen wären die Treuhandfonds, die er angelegt hatte, damit jedes Jahr drei vielversprechende Schüler aus Baldwin’s Bridge auf das College ihrer Wahl gehen konnten.
Alles wäre vergessen, bis auf sein fetter nackter Arsch, wenn er mausetot auf dem Badezimmerfußboden liegen bleiben würde.
Tot …
Das war ein so kalt klingendes Wort.
Charles hatte schon bei seinem ersten Arztbesuch mit der Nachricht gerechnet, noch bevor die ganze Palette von Tests gemacht wurde.
»Wenn man so alt ist und der Arzt so jung, dass du ihn anguckst und weißt, dein letztes Mal Sex liegt länger zurück als seine Geburt, dann hat er mit verdammt hoher Wahrscheinlichkeit keine guten Nachrichten für dich«, hatte er Joe mürrisch zugebrummt, als sie nach Hause gefahren waren.
Sein alter Freund hatte nicht viel darauf erwidert, aber er war auch noch nie ein großer Redner gewesen. Der junge Joe Paoletti – sechsundsiebzig Jahre alt, Charles dagegen schon stolze achtzig – hatte ihn bloß lange angesehen, als sie an einer roten Ampel halten mussten.
Und Charles hatte daraufhin wohlweislich die Klappe gehalten. Es war nicht sonderlich rücksichtsvoll gewesen, so etwas zu sagen, schließlich hatte Joe seit 1944 keine sexuelle Beziehung mehr gehabt. Der verrückte Mistkerl. Dabei war er ein Herzensbrecher mit dem Gesicht eines Leinwandhelden gewesen, der für jede Nacht in der Woche eine andere Frau hätte haben können. Doch seit sie beide aus dem Krieg nach Baldwin’s Bridge zurückgekehrt waren, hatte er wie ein Mönch gelebt.
Der Krieg. Der gegen die Nazis. Zur Hölle noch eins, aye, aye.
Joe und er waren sich ausgerechnet in Frankreich begegnet. Kurz nach der Normandie, der Hölle auf Erden. Schon damals hatte Joe nicht viele Worte verloren.
Zwischen ihnen entstand eine Art Freundschaft, wie sie sich nur im Krieg ausprägen kann. Es war wie aus dem Geschichtsbuch. Zwei Männer mit vollkommen unterschiedlichen Backgrounds – einer von ihnen der arme Sohn eines hart arbeitenden italienischen Einwanderers aus New York, der andere der reiche Sprössling einer wohlhabenden, alteingesessenen Bostoner Familie, welche die Sommer entspannt in der kühlen Meeresbrise im Küstenort Baldwin’s Bridge im Norden von Massachusetts verbrachte. Sie hatten zusammen gegen Nazi-Deutschland gekämpft und ihre Beziehung war zu etwas Beständigem geworden, zusammengeschweißt durch Winston Churchills ganz eigenes Rezept für unzerstörbaren Muschelbeton, jene Mischung aus Kalk, Sand, Wasser und zerstoßenen Muschelschalen, aus der an der Ostküste einst Häuser gebaut worden waren: Blut, Schweiß und Tränen.
Tränen.
Joe hatte geweint, als Charles vom Arzt das K-Wort mitgeteilt worden war. Er hatte versucht, es zu verbergen, doch Charles war es nicht entgangen.
Nach fast sechzig Jahren enger Freundschaft wusste man, wenn der andere litt – auch wenn man es abstritt und manchmal so tat, als wäre der andere nur der Gärtner, jemand, den man als Hilfskraft angestellt hatte, oder auch bloß der blöde Penner, der einem nach dem Krieg nach Hause gefolgt war.
»Du hättest ihn zuerst zu dir holen sollen«, schimpfte Charles nun mit Gott. »Ich wäre damit klargekommen.«
Mit allerletzter Kraft zog er sich die Pyjamahose über die Hüften. So lag er nun mit gut bedecktem Hintern auf dem kalten Fliesenboden, keuchte vor Anstrengung und fragte sich, ob der Herr es wohl durchschaute, wenn er log.
Dr. Kelly Ashton lief die Zeit davon.
Sie parkte ihren Kleinwagen in der Auffahrt ihres Vaters neben dessen gefühlt vierhundert Jahre altem, aber noch immer makellosem Buick-Kombi und stellte den Motor ab. Für einen Moment blieb sie im Auto sitzen, den Kopf auf die Unterarme am Lenkrad gelegt.
Was sie da machte, war dämlich. Sie war dämlich. Dass sie versuchte, ihre Kinderarztpraxis in Boston aufrechtzuerhalten, während sie hier draußen, eine Stunde nördlich der Stadt, im Haus ihres Vaters in Baldwin’s Bridge lebte, stellte den Beweis dafür dar. Sie sollte das Harvard-Diplom zurückgeben. Denn ganz offensichtlich hatte man es ihr irrtümlicherweise verliehen. Sie war viel zu dämlich, verdiente es nicht.
Und seit ihr Vater ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben hatte, dass er sie nicht da haben wollte, war die Sache doppelt so dämlich.
Er brauchte ihre Hilfe nicht. Lieber würde er allein sterben.
Kelly öffnete die Fahrertür und schnappte sich die Tüte aus der Apotheke sowie die Tasche mit den Lebensmitteln, die sie auf dem Nachhauseweg im Supermarkt besorgt hatte. Eigentlich wäre es besser gewesen, den Tag über in Baldwin’s Bridge zu bleiben, doch sie war bereits um vier Uhr dreißig aufgestanden, um noch vor dem Berufsverkehr nach Boston zu fahren und Papierkram zu erledigen. Ihr neuer Terminplan ließ ihr kaum noch Zeit zu denken, geschweige denn Büroarbeit zu erledigen, und so war es ihr an diesem Morgen gerade einmal gelungen, eine Schneise in die Aktenberge auf ihrem Schreibtisch zu schlagen.
Davon einmal abgesehen hatte sie die Hoffnung gehabt, die Testergebnisse von Betsy McKenna würden gleich als Erstes am Morgen hereinkommen.
Kelly vermutete, dass die zerbrechlich wirkende Sechsjährige an Leukämie litt. Und falls das stimmte, wollte sie diejenige sein, die es Betsys Eltern mitteilte, mit ihnen über Behandlungsmethoden sprach und sie dem Onkologen vorstellte.
Um neun Uhr hatte Kelly jedoch im Labor angerufen und erfahren, dass die Blutprobe des Mädchens in einem Transporter gewesen war, der bei einem Unfall einen Totalschaden erlitten hatte. Demnach mussten alle Proben erneut entnommen werden und sämtliche Patienten – Betsy eingeschlossen – dafür noch einmal in der Praxis erscheinen. Die Ergebnisse würde man Kelly so schnell wie möglich zukommen lassen. Am nächsten Morgen, das hatte man ihr zumindest versprochen. Vorausgesetzt natürlich, dass das Labor noch an diesem Tag eine neue Probe erhielt.
An diesem Punkt hatte sie die ganze Angelegenheit ihrer fähigen Arzthelferin Pat Geary übergeben, den Papierkram liegen lassen und war wieder nach Baldwin’s Bridge herausgefahren, um in der Nähe ihres Vaters zu sein.
Der wollte allerdings nur von ihr allein gelassen werden.
Vermutlich würde sie den restlichen Tag also damit verbringen, durch die Stadt zu laufen und Botengänge zu erledigen, denn das war die einzige Art und Weise, wie sie ihm zu zeigen vermochte, dass sie ihn liebte: Indem sie sich pflichtbewusst und gehorsam verhielt. Und indem sie ihm aus dem Weg ging.
Mit dem Po stieß sie die Fahrertür zu.
Er war schon immer ein selbstsüchtiger Mistkerl gewesen. Was hatte er sich überhaupt dabei gedacht, in einem so verdammt hohen Alter noch ein Kind zu zeugen? Obwohl, sie kannte ihn nur alt – alt, zynisch und noch dazu abgestumpft und sarkastisch.
Und Kelly konnte sich nicht vorstellen, dass ihre Mutter Tina mehr als nur ein junger Körper und ein hübsches Gesicht für ihn gewesen war. Aber sie wusste, was er ihr bedeutet hatte. Charles Ashton war ein eleganter, attraktiver, scheinbar kultivierter und sehr, sehr wohlhabender Mann. Selbst heute, mit achtzig Jahren, sah er noch bemerkenswert gut aus. Er besaß immer noch dichtes Haar, das nun allerdings nicht mehr goldblond, sondern schlohweiß war. Seine Augen bestachen durch ein tiefes Blau, obwohl sie eigentlich glasig und gerötet hätten sein müssen, wenn man bedachte, wie viele Liter Alkohol er über die Jahre konsumiert hatte.
Nur seine Seele war hässlich und verdorben.
Erst jetzt, da er starb, hatte er aufgehört zu trinken. Aber nicht etwa, weil er nüchtern bleiben wollte, sondern weil es ihm Schwierigkeiten bereitete, überhaupt etwas zu essen oder zu trinken. Der Whisky, der einst sein Allheilmittel dargestellt hatte, war mittlerweile zu stark für seinen vom Krebs geplagten Magen.
Welch Ironie …
Erst die nahende Bedrohung eines Krebstods sorgte dafür, dass er den Klauen des Alkoholismus entkam, der ihn langsam, aber sicher zerstört hatte. Kelly war immer davon ausgegangen, die Entzugserscheinungen würden ihm den Rest geben, doch der alte Mann erwies sich als äußerst zäh und hatte sie überstanden.
Zum ersten Mal, seit sie denken konnte, war ihr Vater nun anhaltend nüchtern und in der Lage, sinnvolle Unterhaltungen zu führen.
Nur wollte er nicht mit ihr reden.
Charles brauchte sie nicht, doch verdammt, sie dafür ihn. Ihm blieben noch drei Monate – wenn überhaupt. Diese Zeit musste sie nutzen, um sich mit ihm zu verständigen, und falls das nicht ging, um wenigstens ihn verstehen zu lernen. Selbst wenn sie es nur schafften, im selben Raum zu sein, ohne dass einer von ihnen einen Anfall bekam, wäre das schon mehr, als sie in jüngster Vergangenheit hinbekommen hatten.
Er mochte dickköpfig sein, ein Wesenszug, den jedoch auch sie besaß. Es würde nicht leicht werden, denn letztlich war sie eine Ashton – die von klein auf gelernt hatte, jede Gefühlsregung höflicherweise lieber für sich zu behalten.
Kelly ging ins Haus und stellte ihre Tüten auf dem Küchentisch ab.
Es war still, doch das hatte nichts zu bedeuten. Dieses Ungetüm, das seit hundertfünfzig Jahren als Sommersitz der Ashtons fungierte, war dermaßen weitläufig, da konnte Charles in seinem Fernsehzimmer sitzen und den Ton ohrenbetäubend laut gestellt haben, ohne dass sie in der Küche etwas davon mitbekam.
Kelly begann, die Lebensmittel mit so viel Gepolter wegzuräumen, wie sie konnte, und hoffte – so wie sie sich als kleines Mädchen danach gesehnt hatte, zumindest wegen ihres reinen Einserzeugnisses von ihrem Vater geliebt zu werden –, Charles würde nur ein Mal hören, dass sie zu Hause war, und zu ihr kommen, um ihr einen Guten Morgen zu wünschen.
Am anderen Ende der Leitung schwieg Admiral Crowley. Und als er schlussendlich seufzte, wusste Tom, dass es nicht leicht werden würde.
»Wer war dieser Kaufmann noch gleich?«, fragte Crowley.
Tom konnte nicht verhindern, dass man ihm die Anspannung anhörte. »Sir, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich nicht von oben herab behandeln würden.«
»Ich behandle Sie nicht von oben herab, Tom, ich versuche lediglich, mein ganz und gar nicht lückenloses Gedächtnis aufzufrischen. Würden Sie also bitte einfach meine Frage beantworten? Und ich sage Ihnen gleich: Tun Sie es in einer Lautstärke, bei der mir nicht die Ohren dröhnen. Denken Sie nicht einmal daran, ebenso respektlos gegen mich auszuteilen, wie Sie es letzte Woche bei Larry Tucker getan haben.«
Tom setzte sich an Joes Küchentisch mit der Resopalplatte. »Sir, möchten Sie mir gerade etwa sagen, Sie unterstützen Tuckers Versuch, Team 16 und die Special-Operations-Einheit abzuschaffen?«
»Ich sage Ihnen nichts dergleichen«, gab Crowley zurück. »Mein Sohn, ich stehe zu zweihundert Prozent hinter Ihren Troubleshooters. Mit Team 16 wird rein gar nichts geschehen. Sie haben mein Wort. Was Larry da versucht hat, war von Grund auf falsch. Aber wie Sie darauf reagiert haben, erscheint mir genauso verkehrt. Und ich muss gestehen, dass ich mir ein wenig Sorgen um Sie mache. Es gibt auch Möglichkeiten, mit Arschlöchern wie Tucker fertigzuwerden, ohne dabei vorschnell zu handeln und sich eine Woche Psychoanalyse einzubrocken. Der Mann, den ich vor anderthalb Jahren als Anführer für Team 16 ausgesucht habe, hätte nicht so reagiert wie Sie.«
Crowley hatte vollkommen recht. Tom dröhnte der Schädel, und er rieb sich mit den Fingern über die Stirn, um den Druck zu mindern. Ihm fiel auf, dass die gegenüberliegende Wand der Küche schmuddelig wirkte, und als er sich weiter umsah, stellte er fest, dass der ganze Raum einen neuen Anstrich nötig hatte. Das sollte er mit seinem freien Wochenende anstellen, statt darüber Bericht zu erstatten, er habe einen für tot gehaltenen Terroristen gesehen, und damit seine Karriere noch mehr zu gefährden.
»Also, warum tun Sie mir jetzt nicht endlich den Gefallen und beantworten meine Frage?«, hakte Crowley in freundlicherem Tonfall nach. »Der Kaufmann. Er hatte doch etwas mit diesem Bombenanschlag auf eine Botschaft zu tun. Wann war das noch gleich, 1997?«
»Sechsundneunzig«, antwortete Tom. »Und ja, Sir, er ist ein unabhängiger Auftragnehmer – ein Söldner. Er war der schlaue Kopf hinter dem Autobombenanschlag in Paris, bei dem die amerikanische Botschaft hochging. Eine Gruppe muslimischer Extremisten hat sich damals dazu bekannt, doch NAVINTEL brachte den Kaufmann damit in Verbindung. Es war definitiv seine Arbeit. Überall auf der Bombe verteilt hat man seine genetischen Fingerabdrücke gefunden.«
»Und Sie waren Teil einer amerikanisch-französischen Truppe, die eingesetzt wurde, als man die Spuren der Terroristen nach … London verfolgt hatte, richtig?«
»Liverpool. Der SAS war auch beteiligt.«
Nachdem der Kaufmann und seine dreckige Bande in einem besonders nasskalten Teil der englischen Stadt, die man ansonsten hauptsächlich als Heimat der Beatles kannte, in einem Lagerhaus aufgespürt worden waren, hatten die Einsatzkräfte damals verdammt viel Zeit mit Politik verschwendet. Tom glaubte sogar, dass sie vielleicht sogar in der Lage gewesen wären, alle fünf Zielpersonen festzunehmen, wenn sie sich mehr auf die Ergreifung der Terroristen konzentriert hätten, anstatt zu überlegen, wer dem Protokoll zufolge die Tür eintreten durfte. Stattdessen mussten sie sich mit vier Terroristen zufriedengeben, die Leichensäcke brauchten, und einem fünften Mann – dem Kaufmann –, der sich noch »auf freiem Fuß« befand, wie es die Bundespolizei so schön treffend ausdrückte.
»Auf den Bändern der Überwachungskameras war zu sehen, wie der Kaufmann von Kugeln getroffen wurde«, berichtete Tom dem Admiral. »Laut Videoanalyse muss er also schwere Verletzungen davongetragen haben. Genauer genommen fiel sogar das Wort tödlich. Obwohl er entkommen konnte, hieß es, die Wahrscheinlichkeit, dass er überlebt habe, sei sehr gering.«
Erneut schwieg Crowley. Tom musterte die Sommerblumen, die in einer Vase auf dem Tisch standen. Soweit er sich zurückerinnern konnte, hatte Joe im Frühling und Sommer immer frische Blumen in seiner Küche gehabt.
Das schien einer der Vorteile zu sein, wenn man als Hausverwalter arbeitete. Möglicherweise sollte er auch so etwas machen, falls Tucker ihn zwang, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Er könnte nach Baldwin’s Bridge zurückkehren und bei Joe in die Lehre gehen, im Zuge dessen etwas über Rosen und Schädlinge und all die anderen Dinge lernen, für die er in seiner Highschoolzeit nie die Geduld besessen hatte. Und irgendwann einmal würde er dann in der Lage sein, die Anstellung als Hausverwalter der Ashtons von seinem Onkel zu übernehmen, und wenn Charles Ashton starb … Wenn Charles Ashton starb. Der alte Mann war störrisch genug, um aus reiner Boshaftigkeit unsterblich zu werden. Also wenn Charles irgendwann einmal sterben sollte, könnte Tom in Vollzeit für dessen Tochter Kelly arbeiten, denn zweifelsohne würde sie sein riesengroßes Anwesen erben – das Haupthaus, das Grundstück und auch das kleine Cottage, in dem Joe seit über fünfzig Jahren lebte.
Es war eine Highschoolfantasie, die ihm nie so ganz aus dem Kopf gegangen war. Tom wollte Gärtner bei der wunderschönen Kelly Ashton werden. Dabei hatte diese Wunschvorstellung ziemlich viel Ähnlichkeit mit einem billigen Porno, und sie begann damit, dass Tom ganz verschwitzt war, weil er die Hecken vor ihrem Haus getrimmt hatte. Kelly Ashton mit ihrem Nettes-Mädchen-von-nebenan-Gesicht, diesen unglaublich blauen Augen und ihrem unverschämt perfekten Körper säße auf der vor Blicken abgeschirmten Veranda. Sie würde ihn einladen, auf ein Glas Limonade ins kühle Haus hereinzukommen und …
»Sie sind erschreckend still«, bemerkte Crowley. »Ich weiß, was Sie gerade denken.«
Oh nein, mit ziemlicher Sicherheit wusste das der Admiral nicht.
»Sie meinen, wenn der Kaufmann wirklich so schwere Verletzungen erlitten hätte, wäre er seiner Verhaftung gar nicht erst entkommen«, fuhr Crowley fort.
Damit lag der Mann noch nicht einmal dicht dran. Aber Tom hatte tatsächlich solche Überlegungen angestellt – damals, im Jahr 1996, und seither in den vergangenen Jahren regelmäßig immer wieder. Zumindest wenn er sich nicht gerade vorgestellt hatte, es mit Kelly Ashton zu treiben.
»Admiral«, entgegnete Tom schließlich und versuchte angestrengt, sich zu konzentrieren, »falls der Mann, den ich gesehen habe, der Kaufmann war, dann hat er sich einigen Schönheitsoperationen unterzogen und seine Haare gefärbt. Aber der Kerl besaß die richtige Größe und Statur. Dann diese Augen … Ich weiß, dass ich es nicht richtig in Worte fassen kann, aber ich habe diesen Mann studiert. Damals, 1996, war mein Hauptaugenmerk auf ihn gerichtet. Ich habe mir jedes Foto in der Akte des Einsatzkommandos eingeprägt und im wahrsten Sinne des Wortes Wochen damit zugebracht, auf Bilder von ihm zu starren, mir Videomaterial anzusehen und zu lernen, wie er zu denken. Vielleicht bin ich verrückt, aber –«
»Genau das ist ja das Problem, Lieutenant«, unterbrach ihn Crowley. »Möglicherweise sind Sie verrückt. Ich habe eine Akte über die psychischen Tests, die kürzlich bei Ihnen gemacht wurden, auf dem Schreibtisch liegen. Darin sind einige der Folgeerscheinungen aufgezählt, die sie durch den Schlag auf den Kopf erlitten haben könnten. Ich muss Sie sicher nicht daran erinnern, dass Verfolgungswahn ziemlich weit oben auf dieser Liste steht.«
Tom fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht. »Nein, das müssen Sie nicht, Sir. Aber ich bin diesem Mann begegnet und musste einfach Bericht darüber erstatten, was ich gesehen habe.«
»Was Sie glauben, gesehen zu haben«, berichtigte ihn Crowley.
Tom war zwar anderer Meinung, aber er würde sich nicht mit einem Admiral anlegen. »Ich hatte einfach gehofft, Sie würden die Sache einmal unauffällig überprüfen – nachsehen, ob der Kaufmann in irgendeinem Bericht von NAVINTEL erwähnt wird, oder von irgendeiner Behörde, verdammt. Ich weiß, dass Sie da Ihre Verbindungen haben, Sir. Ich möchte einfach nur herausfinden, ob sonst noch irgendjemand da draußen den Typen vor Kurzem gesehen hat – und zwar jemand, dem die Ärzte in den letzten Monaten keine Löcher in den Schädel gebohrt haben«, fügte er trocken hinzu.
»Ich werde meine Fühler mal ausstrecken«, versprach Crowley ihm. »Und Sie sollten es in nächster Zeit verdammt noch einmal für sich behalten, falls Sie meinen, noch irgendwelche anderen Terroristen gesehen zu haben. Wenn Larry Tucker von der Sache erfährt, halten Sie Ihre Entlassungspapiere dermaßen schnell in den Händen, dass Sie gar nicht wissen, wie Ihnen geschieht.«
»Ich weiß, Sir«, erwiderte Tom. »Ich danke Ihnen.«
»Erholen Sie sich ein bisschen, Lieutenant«, riet Crowley ihm noch, dann legte er auf.
Tom hängte den Hörer ein und stand energisch vom Stuhl auf, musste jedoch innehalten und sich am Tisch abstützen, bis ihm nicht mehr schwindlig war. Über seinen kleinen Schwächeanfall fluchend machte er sich hiernach auf die Suche nach Joe, um ihm zu mitzuteilen, dass er fürs Wochenende nach Hause gekommen war – und dass seine Küche einen neuen Anstrich nötig hatte.
2
»Kelly …«
Kelly erstarrte und zog den Kopf aus dem Kühlschrank zurück, um zu lauschen.
»Kelly …«
Da war es wieder, kaum hörbar. Die Stimme ihres Vaters klang zerbrechlich und schwach. Jedenfalls zerbrechlicher und schwächer als sonst.
Sie packte das Melonenviertel, das sie in den Händen hielt, in den Kühlschrank, rannte aus der Küche und eilte den langen Flur entlang, der zum Schlafzimmer ihres Vaters führte.
Im Raum war es dunkel, da die zugezogenen Vorhänge das helle Sonnenlicht des frühen Nachmittags nicht durchließen. Während sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnten, tastete sich Kelly zum Bett vor, doch Charles lag nicht darin.
Also ging sie hinüber zum Badezimmer und …
Großer Gott!
Ihr Vater lag mit dem Gesicht nach unten auf dem gefliesten Boden.
Kelly kniete sich neben ihn, um seinen Puls zu fühlen. Seine Haut fühlte sich feucht und kalt an, und bei ihrer Berührung begannen seine Lider zu flattern, als würde er versuchen, die Augen zu öffnen.
»Wurd aber auch Zeit, dass du hier reinkommst«, keuchte er. »Sonst siehst du morgens doch als Erstes nach mir. Aber heut hattest du wohl beschlossen, im Küchenschrank die Dosen mit Spinat neu zu sortieren.«
»Ich habe ein paar Lebensmittel weggepackt«, erklärte sie ihm ruhig, doch das Herz schlug ihr bis zum Hals. Stirb jetzt nicht! Wag es ja nicht, schon zu sterben! Sie schlug absichtlich einen sachlichen Tonfall an, denn sie wusste, dass ihre Aufregung ihn nur ärgern würde. »Was ist passiert?«
»Eigentlich«, begann er, »übe ich nur für mein Vorsprechen für diesen Werbespot. Du weißt schon – Ich bin gestürzt und kann nicht aufstehen.«
Kelly konnte sich nicht länger zusammenreißen. »Um Gottes willen, Daddy, würdest du bitte mal für dreißig Sekunden aufhören, dich wie ein Idiot zu benehmen, und mir sagen, was passiert ist? Bist du ausgerutscht? Hast du Schmerzen in der Brust? Hast du dir den Kopf angeschlagen, als du hingefallen bist? Ist irgendetwas gebrochen? Hattest du einen Schlaganfall?« Falls ja, war zumindest sein Sprachzentrum nicht betroffen, so viel stand fest.
»Wenn du es unbedingt wissen willst«, antwortete Charles fast schon mimosenhaft, »in der einen Minute stand ich noch an der Kommode und hab mich um meinen Kram gekümmert, und in der nächsten lag ich bereits auf dem Boden. Ich glaube nicht, dass ich mir den Kopf angestoßen habe. Und es fühlt sich auch nicht so an, als wäre irgendetwas verletzt – außer meine Würde.«
»Wir müssen dafür sorgen, dass eine Krankenschwester nach dir sieht, während ich unterwegs bin«, sagte Kelly, während sie die Augen ihres Vaters sowie seinen Kopf untersuchte. »Meinst du, du kannst aufstehen, wenn ich dir helfe?«
»Nein«, erwiderte Charles. »Und keine Krankenschwester. Denk noch nicht einmal daran, einen Rettungswagen zu rufen. Wenn sie hier rausfahren, werden sie mich ins Krankenhaus bringen, und ich gehe ihn keine Klinik. Erinnerst du dich noch an Frank Elmer? Der ist wegen leichter Schmerzen in der Brust da gelandet – und am nächsten Tag war er tot.«
»Weil er einen schweren Schlaganfall hatte.«
»Genau das meinte ich. Er hätte sich vielleicht erholt, wenn er nicht ins Krankenhaus gebracht worden wäre. Danke, ich bleibe genau hier, wo ich bin.«
Sein Kopf sah gut aus. Er musste sich im Fallen irgendwie abgefangen haben, Gott sei Dank. Als sie seine Arme und Beine in Augenschein nahm, schob er sich gereizt von ihr weg, wenn auch nicht weit. »Hör auf damit!«
»Ich bin Ärztin«, rief sie ihm in Erinnerung. »Wenn du dich weigerst, ins Krankenhaus zu gehen, wenn so etwas passiert –«
»Was ist denn passiert?«, fragte er bissig. »Keine große Sache. Mir ist schwindlig geworden, ich fühle mich immer noch ein bisschen schwach. Das sollte dich doch nicht weiter überraschen. Ich bin eine Milliarde Jahre alt und habe Krebs. Und irgendetwas sagt mir, dass der Badezimmerfußboden und ich keine Fremden füreinander bleiben werden.«
»Wenn wir eine Krankenschwester hätten –«
»Die würde mich auch nur nerven«, beendete Charles die Diskussion. »Hol Joe«, befahl er ihr. »Wenn ihr mich in die Mitte nehmt, kriegen wir mich zurück ins Bett.«
Kelly stand auf, drehte sich im Weggehen aber noch einmal zu ihm um. War er denn kein bisschen froh darüber, dass sie da war? Die Frage rutschte ihr heraus, noch ehe sie sie sich verkneifen konnte. »Ist es das, was du über mich denkst? Dass ich dich nerve?«
Charles schaute sie nur kurz an, machte den Mund auf, um etwas zu erwidern, hielt dann jedoch inne und schüttelte den Kopf. »Hol einfach Joe, und komm wieder her, in Ordnung?«
Sie zögerte, doch ihr Vater machte die Augen zu und schloss damit die Welt um sich herum – sie inbegriffen – aus. Gott bewahre, dass sie tatsächlich jemals miteinander reden sollten. Sie gab sich alle Mühe, sich nicht anmerken zu lassen, wie verletzt sie war – er wäre nur umso genervter von ihr –, drehte sich wieder um und eilte durch das Schlafzimmer, den Flur entlang, zurück in die Küche.
Dann stieß sie die Küchentür nach draußen auf und ließ das Fliegengitter hinter sich zuknallen. Gott sei Dank stand Joes Wagen noch in der Einfahrt. Sie hastete auf das kleine Cottage am Tor zu. »Joe! Bist du zu Hause?«
Plötzlich bemerkte sie den Schatten eines Mannes an der Ecke des Häuschens und änderte ihren Kurs, um auf ihn zuzugehen, aber … Es handelte sich nicht um Joe.
Es war Tom Paoletti, Joes Großneffe.
Eine große, starke, erwachsene, mannshohe Version von Tom Paoletti mit viel weniger Haupthaar und sehr viel mehr Falten in dem aber immer noch bemerkenswert attraktiven Gesicht. Die Schultern, die sich unter seinem Hemd abzeichneten, waren breiter, ebenso schienen seine Züge kantiger geworden zu sein, doch seine Augen hatten sich überhaupt nicht verändert. Sie waren nach wie vor haselnussbraun und zeugten von viel Humor und einem scharfen Verstand. Zudem lag unterschwellig dieser glühende Blick darin – sie gehörten zu jenem Teenager, den sie einst gekannt hatte.
Als er sie erblickte, blieb er abrupt stehen. Er war eindeutig genauso überrascht, sie zu sehen, wie sie ihn.
»Hoppla«, meinte er. »Kelly Ashton.« Auch seine Stimme hatte sich nicht verändert, war tief, warm und weich. Lediglich ein ganz leichter Akzent verriet, dass er der Arbeiterschicht Neuenglands entstammte.
»Tom«, sagte sie und fühlte, wie sie weiche Knie bekam. Sie erinnerte sich an das schummrige Leuchten des Armaturenbretts in seinem Auto, wie es so ein ungewöhnliches Licht auf sein Gesicht geworfen hatte, als sie … Sie schob den Gedanken beiseite. »Ich muss Joe finden. Mein Vater ist –«
Sie unterbrach sich selbst, denn ihr wurde klar, dass so etwas schon einmal passiert war. Fast die gleiche Situation hatte es schon einmal gegeben. Damals war sie in der neunten Klasse gewesen, und Tom hatte kurz vor dem Abschluss gestanden.
Sie war von der Schule nach Hause gekommen und hatte ihren Vater ohnmächtig in der Küche vorgefunden, volltrunken. So etwas war selten mitten am Tag vorgekommen, aber da hatte er gelegen, kurz bevor ihre Mutter jeden Moment mit einigen Damen aus ihrem Tennisklub nach Hause kommen wollte.
Kelly war losgerannt, um Joe zu suchen, und auf Tom getroffen. Gemeinsam hatten sie Charles schließlich in sein Schlafzimmer getragen und ihn wohlbehalten ins Bett gelegt.
»Ich weiß nicht, wo Joe ist«, entgegnete Tom nun. »Ich habe auch schon nach ihm gesucht. Was gibt es denn für ein Problem? Kann ich dir helfen?«
»Ja. Danke.« Sie führte ihn schnell zurück zum Haupthaus. »Mein Vater ist im Badezimmer gestürzt«, erklärte sie ihm. »Und obwohl er jede Menge Gewicht verloren hat, ist er immer noch zu schwer für mich. Ich habe bereits versucht, ihn dazu zu überreden, dass eine Krankenschwester nach ihm sieht, zumindest während ich auf der Arbeit bin, aber er ist so stur.«
Gott, hör sich das einer an. Sie plapperte einfach drauflos. Zum ersten Mal seit sechzehn Jahren überschnitt sich ihr Aufenthalt zu Hause mit einem von Toms unregelmäßigen Besuchen bei Joe. Mit dem Unterschied, dass sie sich dort nicht bloß für eine kurze Stippvisite aufhielt. Sie war gekommen, um zu bleiben. Bis ihr Vater starb.
Tom folgte ihr in die Küche, ins Haus. »Ist dein Vater krank?«, erkundigte er sich.
Kelly drehte sich zu ihm um und staunte erneut darüber, wie viel größer und breiter er geworden war. »Mein Vater stirbt«, teilte sie ihm leise mit. »Hat Joe dir nichts davon erzählt?«
»Er stirbt?« So überrascht, wie Tom nun wirkte, war es ganz offensichtlich, dass er nichts davon gewusst hatte. »Gott, nein! Ich meine, ich habe eine Weile nicht mit Joe gesprochen, aber … Kelly, das tut mir so leid. Ist es …?«
Sie nickte. »Krebs. In der Lunge, in der Leber, in den Knochen, in seinen Lymphknoten. Zähl was auf, er wird auch da Metastasen haben. Sie können nicht sagen, von wo genau es ausgeht und wohin der Krebs überall gestreut hat, aber das spielt jetzt auch schon keine Rolle mehr. Sie werden bei einem achtzigjährigen Mann keine Experimente mehr machen und auf Verdacht Eingriffe vornehmen. Und eine Chemo kommt nicht infrage, also …«
Sie musste sich räuspern. Es laut auszusprechen rief ihr immer die Heftigkeit des Ganzen ins Gedächtnis. Eines Morgens in sehr naher Zukunft würde sie in einer Welt aufwachen, in der es ihren Vater nicht mehr gab. Sie war noch nicht bereit dafür. Und sie konnte sich kaum vorstellen, dass sie es jemals sein würde.
Auf dem Weg den langen Flur entlang zu Charles’ Zimmer ging Kelly voran. »Tragen wir ihn ins Bett, dann kann ich dafür sorgen, dass er es bequem hat.« Danach hätten sie vielleicht etwas Zeit, sich zu unterhalten, und sie könnte sich neben Tom Paoletti setzen, das Objekt ihrer Teenagerträume – und einiger anderer, sehr erwachsener Fantasien.
Kelly fragte sich, ob er wohl irgendetwas über diesen einen Abend sagen würde. Gut möglich, dass er sich noch nicht einmal mehr daran erinnerte.
»Hallo, Mr Ashton«, grüßte Tom ihren Vater, als er an ihr vorbei ins Badezimmer trat. »Sieht so aus, als könnten Sie eine helfende Hand gebrauchen.«
»Du erinnerst dich noch an Tom Paoletti, oder, Dad?«, fragte Kelly.
Nachdem sich Tom neben ihren Vater gehockt hatte, schaute er zu ihr hoch. »Kann er bewegt werden? Ist nichts gebrochen?«
»Ja, ich glaube, er ist okay. Nichts tut schlimmer weh als gewöhnlich, nicht wahr, Dad?«
»Natürlich erinnere ich mich an Tom Paoletti«, meckerte Charles und ging damit völlig über ihre zweite Frage hinweg. »Bist du immer noch bei der Navy?«
»Ja, Sir«, gab Tom zurück. Schon in der Highschool war er überaus höflich gewesen. Er hatte Charles immer mit Mr Ashton und Sir angesprochen, trotz des offensichtlichen Misstrauens des alten Mannes. »Ich bin immer noch bei den SEALs.«
Damals, als sie fünfzehn gewesen war, hatten Tom und sie Probleme gehabt, Charles aus der Küche und den Flur entlang zu seinem Zimmer zu tragen. Doch in den vergangenen Jahren hatte Charles an Gewicht verloren und Tom deutlich an Muskelmasse zugelegt. Scheinbar mühelos hob er ihren Vater nun hoch und trug ihn ganz ohne ihre Hilfe zu seinem Bett.
»Ich bin der kommandierende Offizier von SEAL-Team 16.« Tom legte den alten Mann sachte hin.
»Das weiß ich«, entgegnete Charles. »Joe redet die ganze Zeit von dir, verstehst du. Er ist verdammt stolz auf dich.«