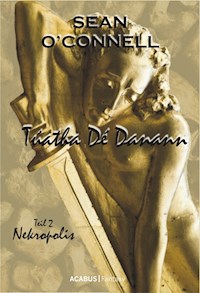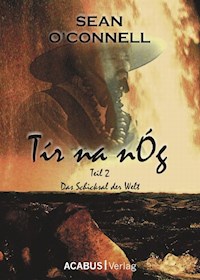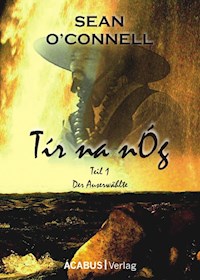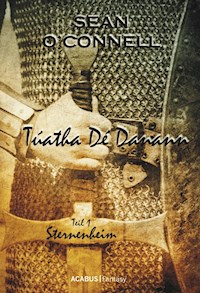
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Cornelis von der Bruderschaft der Archivare sinnt auf Rache. Er folgt Nyail, dem Gesandten des Abgründigen Gottes, der seine Mutter Bernadette getötet hat. Dabei verschlägt es ihn und seine Begleiter in die riesige Metropole Sternenheim, wo er die Bestie Ereschkigal besiegen muss, um den Gral zu erringen. Der magische Kelch ist nicht nur eine von drei verbliebenen Waffen der Túatha Dé Danann, sondern auch das Instrument, mit dem Cornelis die Welt retten muss. Doch er hat nicht die geringste Ahnung, wie diese Aufgabe zu bewältigen ist. Während die Entropie Nord- und Südland nach und nach zerstört und sich gewaltige Karawanen mit Flüchtlingen am Ende der Welt in der Nekropolis zusammenrotten, muss sich Cornelis seinem größten Gegner stellen: dem neu erstandenen, furchteinflössenden Gott Cú Chulainn und seinen in den Schatten verborgenen Horden der Túatha Dé Danann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sean O’Connell
Túatha Dé Danann
Sternenheim
Teil 1
O’Connell, Sean: Túatha Dé Danann. Sternenheim. Teil 1, Hamburg, ACABUS Verlag 2012
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-181-5
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-182-2
Print (Paperback): ISBN 978-3-86282-180-8
Lektorat: Silke Meyer, ACABUS Verlag
Umschlaggestaltung: ds, ACABUS Verlag
Covermotiv: © Masson - Fotolia.com
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© ACABUS Verlag, Hamburg 2012
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Für
Rüdiger Wenk und Pit Burger
Vorspiel
Die Bühne ist bereitet. Rauch steigt auf. Ein von drei prächtigen, weißen Hirschen gezogener Wagen rollt heran. Darauf befinden sich einhundertfünfzig abgetrennte Köpfe, manche von ihnen mit Gold oder Silber überzogen, andere grotesk eingepfercht in kleinen Holzkästchen. Drei betörend schöne Frauen stehen auf dem Wagen und blicken auf die Sitzreihen eines leeren Theaters.
Der Wagen kommt zum Stehen.
Streicher im Orchestergraben weben einen hellen, epischen Klang in unterschiedlichen, aber ineinandergreifenden Tempi, unterstützt von Posaunen und Trompeten.
Die drei Frauen – allesamt gekleidet wie Gralsbotinnen, mit sehr bleich geschminkten Gesichtern, die großen Augen in schwarze Schatten getaucht, mit Mündern rot wie jungfräuliches Blut – tragen Imitate der Waffen der Túatha Dé Danann: den Speer, das Schwert, den Kessel der Wiedergeburt und den Königsstein Lia Fail.
Die Musik steigert sich zu einem wilden Crescendo, dann bricht sie plötzlich ab, das Licht geht an und offenbart die einsame Größe des Saals.
Die drei Frauen steigen vom Wagen. Langsam und vorsichtig, darauf bedacht, die aus Wachs und Plastik geformten Schädel der Ritter nicht zu beschädigen. Sie flüstern miteinander.
Die Erste sagt: „Sein Schicksal entscheidet sich nun.“
„Es war alles vergebens“, klagt die Zweite.
Die Dritte aber, Gwenhwyfer, lächelt. „Nichts ist vergebens, nicht einmal in diesem Moment.“
Angharad, die Erste, die gesprochen hatte, ruft: „Die Welle steigt empor. Sie wird ihn verschlingen!“
Blancheflor wirkt unschlüssig. „Was können wir tun?“
Gwenhwyfer blickt sie an. „Wir werden tun, was wir immer schon getan haben. Wir werden warten.“
Der Wagen wird wieder auf seine ursprüngliche Position gezogen.
Erneut steigt Rauch auf.
1 Maschinenvater
Sternenheim war ein Hermaphrodit, der sich selbst liebte; ein größenwahnsinniger Moloch, nur mit seinen ureigenen, inneren Angelegenheiten beschäftigt – eitel und verkommen nach einer beispiellosen, fünfhundertjährigen Geschichte der Blüte. Zuletzt narzisstisch in Selbstbetrachtung erstarrt und im Kern bereits verfault. Häuser, Fabriken, Terrassen, Viadukte und Straßenzüge – sie alle ruhten in diesem Moment in der mausgrauen Dunkelheit der Nacht. Holten Atem für den neuen Tag.
Harlekin kauerte in der Aussparung eines Stahlträgers der Westbarrenumfahrung und blickte hinunter auf die schlafende Stadt. In dieser schwindelerregenden Höhe waren die Heime der Menschen nur mehr leuchtende Nester, ein verkehrt herum aufgehängtes Sternenzelt.
Verlorenheit, dachte er, ist vielleicht das, was ich empfinden sollte. Menschen würden es tun.
Er starrte in die Schluchten, in denen die nächtlichen Lichter glommen. Sie erschienen ihm fremd.
Du bist nicht verloren, sagte eine Stimme in seinem Kopf. Es war Rachel. Noch nicht, du mechanischer Narr!
Harlekin verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
Was willst du denn? Warum gehst du nicht einfach weg? Verschwindest dahin, woher du gekommen bist.
Weil es keinen Ort gibt, an den ich gehen kann, bin unbehaust, ewig umherziehend, und trotz allem gefangen in deinem mechanischen Körper!
Harlekin blickte auf. Der Himmel schien wie ein Spiegelbild der Stadt: Sterne, so weit das Auge reichte.
Er dachte nach.
Ich fühle mich in meinem Körper nicht unbehaust. Warum kannst du nicht sein wie ich?
Oh, ja! Du bist du, aber ich bin nicht du. Ich bin eine Seele. Vielleicht die erste und einzige Seele. Wer weiß? Cú Chulainn hat sie mir im Augenblick meines Todes geschenkt, aber dummerweise bin ich gefangen in deinem Kopf, so lange, bis deine Schaltkreise und Prozessoren aufhörenzu funktionieren. Bis du rostest und verrottest und eines Tages auf einem der beschissenen, unzähligen Schrottplätze von Sternenheim liegst!
Harlekin kicherte leise und hoffte, dass seine Stimme nicht als Echo von den Stahlträgern widerhallte. Es war gefährlich, laut zu sein; er könnte immerhin von denjenigen entdeckt werden, die er beobachtete.
Und was, amüsierte er sich kurz darauf still an Rachel gerichtet, wenn deine Seele nach meinem Dahinscheiden einfach hier gefangen bleibt, verhaftet in einem nicht verrottbaren Stück Metall meines Körpers, gebunden für endlose Jahrmillionen? Wirst du dann ein Gespenst sein, das auf ewig sein Unwesen treibt, während ich längst aufgehört habe zu existieren?
Die Stimme in seinem Kopf schwieg verdrossen, und Harlekin, der Maschinenjunge, war zufrieden und erleichtert. Er mochte die Stimme nicht, jene Seele, die Jerry Marrks, sein Schöpfer, ihm gegen seinen Willen eingepflanzt hatte. Er hasste sie geradezu. Nach einer Weile des Schweigens war er beinahe überzeugt davon, dass Rachel nun endgültig genug hatte. Vermutlich war sie eingeschnappt und würde bis morgen früh schweigen. Oder zumindest für eine Weile.
Er dachte jetzt an seinen Auftrag, an Ro Thanaya, Kanzlerin von Sternenheim, ihren anmutigen Körper, ihr ebenmäßiges, strahlendes Gesicht, ihren brillanten Geist. Er beschattete sie.
Sie und die Banshees.
Maschinenvater hatte gesagt, die Banshees und Ro Thanaya gehörten zusammen. Obwohl das ein Widerspruch zu sein schien, denn die Banshees waren das Böse, der Feind der Stadt. Es waren Kreaturen der Finsternis, die das Leben aus den Hirnen der Lebenden saugten. Ro Thanaya hingegen war eine Erleuchtung. Das wusste jeder Wähler Sternenheims, der ein Stimmrecht besaß. Sie war das einzige, helle Licht, das diese Stadt aus ihrem langen und unaufhaltsamen Abstieg in die Trostlosigkeit erretten konnte. Ro Thanaya spendete Hoffnung. Hoffnung für die Armen und Unterprivilegierten, für die Mitglieder der mächtigen Gilden, für die Arbeiter, für die Unternehmer, die Denker, den militärischindustriellen Komplex, die Ärzte, die Geistlichen und selbst für die Polizisten; für alle, die auf zwei oder mehr Beinen gingen und so viel Bewusstsein besaßen, dass sie am Wahltag mit einem einfachen Kreuz an der richtigen Stelle ihrer Hoffnung Ausdruck verleihen konnten. Hoffnung auf ein besseres Leben. Ro Thanaya versprach ihnen allen diese Hoffnung: den Menschen, den Nichtmenschen, den Hybriden und allen übrigen Lebensformen, die in Sternenheim eine Heimat gefunden hatten. Sie waren alle bereit, die amtierende Kanzlerin erneut zu wählen, für dieses kleine Stückchen Hoffnung. Die Opposition im Parlament, eine machtlose, kleine Gruppierung, war nicht nur entsetzt darüber, sondern regelrecht erstarrt in ihrer politischen Sprachlosigkeit, unfähig den scheinbar unverdienten Ruhm Thanayas zu begreifen. Stumm und mit vor Zorn geballten Fäusten sahen sie mit an, wie diese überaus schöne und kluge Frau erneut die Herzen der Menschen eroberte. Dabei – da waren sich Ro Thanayas Kritiker einig – gäbe es durchaus Grund für Wechselstimmung: auf den Straßen von Sternenheim herrschte blutiger Terror. Die Bewohner der Millionenmetropole wurden heimgesucht von einem Unheil, das auf den Namen Ereschkigal hörte.
Ereschkigal und die Banshees.
Doch Ro Thanaya versprach die Auslöschung des Bösen. Sie sagte nicht wie und mit welchen Mitteln, doch sie ließ keinen Zweifel daran, dass es geschehen würde. Noch vor der Wahl. Und die Bewohner von Sternenheim glaubten ihr.
Nur Jerry Marrks nicht, Maschinenvater, wie Harlekin ihn nannte. Sein Schöpfer und Mentor.
„Es ist eine Falle“, hatte er dem Maschinenjungen eingebläut. Immer wieder. „Die Kanzlerin und die Kreatur – sie sind ein und dasselbe!“
„Niemand wird uns glauben.“
„Es gibt Beweise … besorge sie mir.“
„Wie wichtig ist das, Maschinenvater? Der Gral … das ist es, was wir wirklich brauchen.“ Harlekin ertappte sich dabei, dass er an die Seele in seinem Kopf dachte und an die Hoffnung, sie durch den Gral wieder loszuwerden. „Den Gral für deine Wunde. Für unsere Zukunft, für die Rettung aller.“
„Der Gral …?“ Marrks seufzte. Er berührte sich an der Seite, spürte die niemals heilende Wunde unter seinen Fingern pulsieren, spürte das ins Nichts tropfende Ramnarough.
„Geh’ und folge Ro Thanaya, hefte dich an ihre Fersen und lass dich nicht aufhalten oder abwimmeln. Egal, was passiert. Es wird nicht lange dauern, dann wirst du in ihrer Nähe die Banshees finden. Und bete darum, dass sie dich nicht finden!“
„Ich bete nicht, Maschinenvater.“
„Sei’s drum. Tu’ einfach, was ich sage. Folge ihr und sende mir eine Botschaft, wenn du die Lagerräume, den geheimen Hafen oder den Tempel von Ereschkigal gefunden hast.“
„Dann lösche ich sie aus, vernichte den Hort des Bösen und besorge uns den Gral.“
„Du darfst nicht zu Schaden kommen. Das, was du in dir trägst, ist das Wichtigste im meinem Leben. Wir dürfen deine Existenz nicht sinnlos aufs Spiel setzen, hörst du? Bleibe auf Abstand und liefere mir Beweise für die Verbindung zwischen der Kanzlerin und den Banshees. Alles andere erledige ich.“
Harlekin schwieg. Nichts, was er in seinem mechanischen Leib trug, war in Maschinenvaters Augen besonders wertvoll, das wusste er, außer jenem nichtmateriellen Gedankenkonglomerat, das sein Schöpfer Seele nannte. Doch es gehörte nicht zu ihm, war nur eine vorübergehende Manifestation in seinem Kopf. Ein Fremdkörper, ein ungebetener Gast. Das Ergebnis jenes Experiments, bei dem Maschinenvater sich die unheilbare Wunde zugezogen hatte. An dieser Seele hing Maschinenvater, nicht an ihm, seiner Roboterschöpfung.
Im Westen hörte Harlekin jetzt das ferne Rauschen des Meeres. Oder waren es nur die dampfbetriebenen Fahrzeuge auf der riesigen Westbarrenumfahrung? Er vermochte es nicht zu sagen. Viele Meter unter ihm erstrahlte plötzlich Licht im Garten der Thanayas. Ein Garten, der von seinen Ausmaßen an einen großen Park erinnerte. Baumhohe Gasfontänenlampen begannen schwach zu glühen, tauchten den fein geschnittenen Rasen in diffuses Gelb.
In das schlafende Anwesen, das er bereits seit Stunden observierte, kam jetzt Leben: Gepanzerte Fahrzeuge rollten zielstrebig auf den von einem mächtigen Portal gekrönten Eingang zu. Die Flügeltüren des Hauses wurden geöffnet und dunkel gekleidete Bedienstete eilten heraus und verluden hölzerne Fässer aus dem Inneren des Hauses in die Fahrzeuge. Kurz darauf wendeten sie und verschwanden genauso schnell, wie sie gekommen waren, in dem ewig dahinfließenden, nächtlichen Verkehrsstrom der Stadt.
Harlekin blickte sich um. Weit und breit schien das Geschehen nicht bemerkt worden zu sein. Das Grundstück der Thanayas war für Sternenheim ungewöhnlich groß und die nächsten Nachbarn weit entfernt.
Ideal für eine geheime Operation, dachte Harlekin. Ideal für Ereschkigal und die Banshees.
Kurz darauf erloschen die Gasfontänenlampen und das Grundstück der Thanayas fiel zurück in nächtlichen Schlummer.
Und jetzt, fragte die Stimme in seinem Kopf. Was machst du jetzt?
Ich werde mir das mal aus der Nähe ansehen, dachte der Maschinenjunge und stellte überrascht fest, dass er mit diesen Worten versuchte, sich selbst Mut zu machen, denn er verspürte urplötzlich eine nie gekannte, lähmende Angst. Ein seltsames Gefühl für eine Maschine, aber Jerry Marrks hatte ganze Arbeit geleistet: Harlekin war perfekt – zumindest als Kopie eines Menschen mit all seinen Fehlern, Schwächen und Ängsten.
Ein Vorgängermodell mit Namen Colombina, an das er sich nicht mehr erinnern wollte – denn sie hatten einander einst etwas mehr bedeutet als zwei sich gegenseitig aushelfende Ersatzteillager –, war nicht mit dem Makel der Angst befleckt gewesen, und dennoch, oder gerade deshalb, hatte sich dieses Modell für unvollendet gehalten. Doch Colombina war fort, zurückgelassen auf dem nördlichen Kontinent im Goldenen Turm der Älteren, weil Maschinenvater dort jemanden brauchte, der ihnen den Rücken freihielt. Und nun musste er ganz allein mit seiner Angst zurechtkommen.
Warum gehst du nicht einfach zurück zu Jerry Marrks? Gesteh’ dir dein Versagen ein, Maschinenjunge!
Lass mich in Ruhe. Da ist etwas im Busch, dessen Ausmaß ich nicht einschätzen kann.
Was immer in diesem Anwesen dort unten gewesen ist, es ist nun jedenfalls fort. Du hast gesehen, wie sie die Fässer verladen haben. Verschwende nicht unsere Zeit.
Spuren, dachte Harlekin, Spuren sind vielleicht noch vorhanden. Der ominöse Tempel, nach dem Maschinenvater sucht. Die Lagerräume. Der geheime Hafen. Wer weiß? Eventuell auch noch andere Dinge. All das mag in diesem Anwesen dort unten verborgen sein. Maschinenvater hat in den letzten Tagen viele Gerüchte gehört. Wenn wir hier etwas finden, das auf eine Verbindung zu den Banshees hindeutet, dann sind wir einen riesigen Schritt weiter. Vergiss nicht, die Wahl ist bereits in drei Wochen. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit.
Und wie willst du da reinkommen? Das Anwesen wird über mehr Sicherheitssysteme und Sensoren verfügen, als du über Schaltkreise und Prozessoren.
Ha, sehr witzig! Und selbst wenn es so ist … Maschinenvater will Ergebnisse sehen. Aber du kannst ja hierbleiben, wenn du keine Lust hast mitzukommen. Dann wage ich mich alleine in die Höhle des Löwen.
Ich glaube nicht, dass du weißt, was Löwen sind, echote es in seinem Kopf, dann schwieg Rachel. Das hatte gesessen. Seltsamerweise hatte er nie verstanden, warum sie überhaupt eine Gefangene in seinem Kopf war. Irgendwie hatte er immer geglaubt, als körperlose Seele könne sie entfliehen, wie es ihr beliebte. Jedenfalls schien das Thema Rachel zuzusetzen. Harlekin wartete einige Sekunden auf eine unfreundliche Entgegnung, doch sie blieb aus.
Die Dunkelheit war allumfassend, und jeder Schritt erhöhte die Gefahr eines Fehltritts. Harlekin bewegte sich äußerst langsam vorwärts. Zu sehen gab es nichts. Selbst auf dem Infrarotband nicht. Seine Füße verursachten auf den Dielen ein leises, aber doch hörbares Geräusch.
Du wirst alle aufwecken, zischte Rachel. Harlekin ignorierte sie. Seine innere Sensorik, die eigentlich nicht für Observationen geeignet war, sagte ihm, dass in dem weitläufigen Anwesen zwar mehrere Personen zu dieser nächtlichen Stunde unterwegs waren, im Augenblick schien aber keine Gefahr zu drohen – sie waren weit weg, in einem anderen Teil des Hauses.
Der Einbruch selbst war einfach gewesen.
Fast zu einfach, wie Harlekin Rachel im Nachhinein recht geben musste. Bereits nach kurzer Suche hatte er ein offenes Fenster im Anbau des Westflügels entdeckt.
Wir sind wie Diebe, hatte Rachel spitzfindig angemerkt, nachdem Harlekin mit nahezu perfekter Lautlosigkeit in das Innere eines unbeleuchteten Zimmers geklettert war. Der Maschinenjunge erwiderte nichts, sondern trat hinaus in ein ebenso finsteres Treppenhaus.
Sein Ziel war das Untergeschoss.
Wenn du in ein Schlafzimmer des Dienstpersonals trittst, und die wohnen nun mal meistens im Untergeschoss, mein Lieber, sind wir verloren! Rachel lachte. Das wäre äußerst dumm von dir, aber es würde mich nicht überraschen. Bei deinem Pech …
Harlekin schwieg weiterhin.
Was er suchte, waren Lagerräume. Lagerräume mit seltsamen Dingen. Vielleicht gehörten auch jene Fässer dazu, die zuvor vom Anwesen weggebracht worden waren. Doch wo konnten sich solch geheime Räume befinden? Er erinnerte sich wieder an die Details von Maschinenvaters Instruktionen. Die Lagerräume befanden sich demnach an einem Ort, an den sich keiner von Thanayas Gästen jemals verirren würde. Nach einer Weile ergebnislosen Suchens verspürte der Maschinenjunge plötzlich einen leichten Luftzug auf der Haut. Die künstlichen Haare auf seinen Unterarmen stellten sich auf.
Hast du das bemerkt, raunte er Rachel in Gedanken zu.
Ja, gab sie zurück. Das könnte eine Lüftungsanlage sein.
Seine Finger ertasteten wenige Augenblicke später ein quadratisches Gitter, durch das kühle Luft strömte. Es war so enttäuschend klein, dass nicht einmal sein Kopf hindurch gepasst hätte. Ehe er einen Seufzer ausstoßen konnte, bemerkte er rechts neben dem Lüftungsschacht Stufen, die in die Tiefe führten. Er folgte ihnen und am Ende stand er vor einer verschlossenen Tür.
Sie zu öffnen könnte riskant sein, appellierte Rachel an seinen Verstand.
Harlekin ignorierte die Stimme in seinem Kopf und drückte vorsichtig die Klinke nach unten. Die Tür glitt auf. Dahinter lag ein langgezogener Gang mit einem roten Teppichboden und blau gemusterten, mit feinen Goldfäden durchwirkten Wandtapeten.
Du wirst uns umbringen, Maschinenjunge!
„Dann bist du endlich erlöst, Seele Rachel. Ist es nicht das, was du immer wolltest?“, stieß er laut hervor und schritt den Gang entlang, ohne auf die einsetzenden Proteste in seinem Kopf zu achten.
Der schallabsorbierende Fußboden, die gleichförmige Deckenbeleuchtung und die zunehmende Stille verstärkten das Gefühl von Unwirklichkeit. Zu beiden Seiten befanden sich Türen. Sie sahen alle gleich aus, und fast schien es, als würde Harlekin sich seit geraumer Zeit nur noch im Kreis bewegen. Kein Hinweis darauf, wohin sie führten: keine Nummern, keine Türschilder, kein Farbcode. Nichts. Gelegentlich streckte er seine Hand nach einem der Griffe aus, fest entschlossen sie zu öffnen, doch es war jedes Mal Rachel, die ihn davor bewahrte.
Sie mussten sich längst außerhalb des Hauses aufhalten, irgendwo unter dem Garten des Anwesens. Die Sensoren des Maschinenjungen funktionierten jedenfalls nicht mehr richtig.
Was machen wir jetzt?
Du Jammerlappen! Was bist du nur für eine Maschine? Selbst die einfachsten Aufträge deines Meisters scheinen dir zu misslingen. Erst besitzt du die Unverschämtheit hier einzudringen und jetzt weißt du nicht mehr weiter. Also gut, ich gebe mich geschlagen. Tu es … mach eine Tür auf … diese Tür da!
Harlekin legte den Kopf schief, rührte sich aber nicht.
Gab Rachel jetzt endgültig klein bei?
Mach schon, maulte sie.
Harlekin tat wie befohlen.
Er öffnete die Tür – und sie betraten einen düsteren, nicht verputzten Keller. Feucht, nach Moder und Schimmel riechend, war er; ein Raum, zum Bersten voll mit durchsichtigen, aber vollkommen verstaubten, mehr als mannshohen Bottichen in bronzefarbenen Einfassungen. Von den dicht an dicht liegenden Deckenleitungen tropfte rostiges Kondenswasser auf den Boden. Was immer der Sinn und Zweck der Behälter war, blieb Harlekin zunächst verborgen.
Ein leises, unangenehmes Summen erfüllte den Raum.
Der Maschinenjunge trat neugierig näher an die Tanks heran. In der grünlichbraunen Flüssigkeit im Inneren bewegte sich etwas. Er konnte undeutlich einen Körper ausmachen. Es war ein Mensch. Harlekin erschrak.
Tote Menschen.
Nein, Narr … sieh genauer hin. Die sind nicht tot. Die Schläuche … sie sind mit den Schläuchen verbunden … und sie leben.
Aus der Wirbelsäule einer der reglosen Gestalten ragten metallene Manschetten, durch die die Schläuche ins Innere des Körpers eindrangen.
Harlekin blickte von einem Bottich zum anderen.
Überall das gleiche Bild: Wie in Zeitlupe drehten sich weiße, aufgedunsene Leiber um ihre vertikale Achse, ihre leeren Augen blickten ins Nichts.
Harlekin starrte auf ihre Münder. Ganz langsam bewegten sich die Lippen, als würden sie versuchen, ihm etwas zu sagen.
„Was ist bloß mit ihnen?“, fragte Harlekin laut, und der Klang seiner eigenen Stimme ließ ihn zusammenzucken.
Das ist das Werk der Banshees, erklärte Rachel. Es sieht so aus, als wäre das hier eine Art Vorratskammer. Hast du jetzt genug gesehen?
„Einen Moment noch …“ Harlekin sah sich unschlüssig um. „Wofür ist das alles gut? Was hat das zu bedeuten?“
Keine Ahnung … am besten gehst du hin und fragst Ro Thanaya persönlich, was es damit auf sich hat; und du kannst sie dann auch gleich fragen, ob sie bereit wäre zuzugeben, dass sie in Wirklichkeit Ereschkigal ist.
„Verstehe …“, beschwichtigte Harlekin kleinlaut. „Du hast recht. Es ist Zeit zu verschwinden.“
Er drehte sich um und erstarrte. In der offenen Tür standen mehrere Männer mit Waffen im Anschlag.
Jerry Marrks hatte kein gutes Gefühl. Sternenheim hatte sich in einen Albtraum verwandelt. All die vertrauten, ineinander verzahnten Geschichten des Gebärens, des Lebens und des Sterbens gingen in den Tagen des scheinbar nie enden wollenden Wahlkampfes völlig unter, wurden negiert, verdrängt, von den Medien ignoriert – verblassten völlig. Die Politik – sie allein beherrschte in diesen Tagen das Geschehen.
Jerry Marrks, der in der dunkelsten Stunde der Nacht auf seinem Balkon stand und die immer noch belebten Straßenzüge Sternenheims überblickte, grübelte, suchte trotz des augenscheinlichen Verlustes menschlicher Themen weiterhin akribisch nach den Geschichten hinter den Geschichten. Nach Hinweisen auf den Gral.
Er gehörte zu den unsterblichen Älteren, Menschen, die vormals auf der Erde gelebt hatten, vor tausend Jahren. Gemeinsam mit Juri-Hiro Ramnarough, Bernadette la Halle und einigen weiteren Auserwählten hatte er diese neue Welt geschaffen. Im Laufe der Jahrhunderte hatte er ein gutes Gespür für ihre Besonderheiten entwickelt, war vertraut mit dem Klang des Lebens und ihrem Pendant, dem schrillen Missklang des Sterbens. Anfangs, so erinnerte sich Marrks, waren es nur ein paar schiefe Töne gewesen, die ihm im Konzert zwischen Geburt und Tod aufgefallen waren, kaum wahrnehmbare Dissonanzen im Alltagsgetöse, kleine Abweichungen in der Partitur der Existenz, die nicht weiter auffielen, vereinzelte, holprige Tempiwechsel, die nicht zum schnellen, städtischen Leben passen wollten – atonale Folgen, scheinbar vernachlässigbare Ausreißer im Gesamtbild: Alles gut und recht, dachte Marrks, das war einmal. Mittlerweile spielte das ganze Orchester falsch. Es war geradezu beängstigend. Niemand außer ihm schien es zu bemerken. Doch wenn man genau hinhörte, wenn man mit wachem Verstand wagte, die Dinge, die verantwortlich für den Missklang zu sein schienen, genauer in Augenschein zu nehmen, dann prangte ein Name wie ein brennendes Fanal über allen Meldungen der letzten Monate:
Ereschkigal – die Bestie.
Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, hieß es in den Kommentaren der Medien. Man müsse nur vorsichtig sein.
Es sei nur eine vage Bedrohung – etwas, das sich ausschließlich an der Peripherie der Stadt zutrug und das kaum eine Meldung wert war.
Die Größe Sternenheims, dachte Jerry Marrks, sie lässt die Menschen diese Dinge glauben. Merkten sie denn gar nichts von der Bedrohung durch die Bestie?
Die Stadt im Meer der Stille war ein Moloch, und alle, die darin lebten, waren berauscht. Ständig. Es war wie Rom zu Beginn der Kaiserzeit, Byzanz während der Blüte Justinians. Andere Zeiten, dieselbe Gleichgültigkeit, dachte Marrks verbittert. Hochmut und Dekadenz hatten die Stadt befallen. Der letzte Tango eines taumelnden Imperiums. Dennoch: Eine schleichende Unruhe nagte an den Menschen in Sternenheim – etwas, dem sie gerne mit derselben, alten Ignoranz früherer Generationen begegnet wären, hätten sie nur deren Format besessen. Aber so war es eine schweißklamme Angst, die sie nachts in der Dunkelheit befiel. Ein kaltes, todbringendes Venom, das sie zittern ließ. Voller Furcht wälzten sie sich in ihren Laken, bemühten sich Schlaf zu finden, was nicht gelang. So blieben sie mit pochenden Herzen wach und starrten in die Dunkelheit.
Selbst die Haus- und Nutztiere in den Ställen standen mit aufgestellten Ohren reglos lauschend, während ihre Nüstern sich furchtsam blähten. Alle blickten hinauf zum bleichen Trabanten, der wie ein böses Omen seit Tagen über Sternenheim hing und die Straßen in fahles, blaues Licht tauchte.
Doch mit dem morgendlichen Aufgang der Sonne verloren die nächtlichen Albträume ihre Schrecken, verblassten, und alles ging erneut seinen gewohnten Gang. Die Kessel der Dampfmaschinen wurden angefeuert, die Bürger eilten zur Arbeit und das elektrische Licht, eine Errungenschaft, derer sich Sternenheim bereits seit Jahrhunderten rühmte, verdrängte die dichten Schatten aus den Köpfen der Bürger. Sie arbeiteten und feierten, genossen ihr sorgloses Leben und vergaßen die Bestie. Bis die Nacht erneut zurückkehrte.
Zu passend, dachte Jerry. Es hätte irgendwem auffallen müssen. Doch Ro Thanaya hatte klug den richtigen Zeitpunkt gewählt. Die politisch aufgeheizte Stimmung war bereits auf dem Siedepunkt.
Ereschkigal und die Wahlen.
Die Menschen waren wie paralysiert.
Es hieß auf allen Kanälen, es sei wichtig, diesmal besonders verantwortlich zu handeln und mit Bedacht und Verstand zu wählen.
Eine Richtungswahl, wie die Experten meinten. Doch die Experten hatten keine Ahnung davon, was vor sich ging. Keiner dachte daran, dass Ro Thanaya schon Kanzlerin war. Sie verfügte bereits über alle Macht und hatte bislang nichts unternommen, die Zustände in der Stadt zu ändern. Aber leider waren das nur krepierende Details im Wust der Informationen. Man schenkte ihnen keine Beachtung. Marrks verspürte eine Gänsehaut, als er in diesem Augenblick in die Tiefe unterhalb seines Balkons blickte. Eine Straße voller Lemminge, dachte er. Er hörte ihr Lachen, ihre Fröhlichkeit. Irgendwo wummerte ein Bass. Leute tanzten und umarmten sich in der Sommernacht, rieben ausgelassen ihre Körper aneinander. Sie wussten nichts von der Zukunft. Sie wussten nicht, dass es bald schon kein Morgen geben würde.
Es klopfte an der Tür.
Um diese Uhrzeit? Ein Schauder befiel ihn. Ich bin viel zu leichtsinnig, dachte er. Viel zu lange schon.
Dann wandte er sich um, verließ den Balkon und durchquerte seine riesige Wohnung. Er öffnete die Tür und starrte überrascht auf ein mechanisches Puzzle mit großen, runden Augen, das lässig in der Tür lehnte. Ein MD. Ein Mechanischer Diener. Eine seiner Schöpfungen.
„Was gibt es? Was machst du hier um diese Zeit?“
„Harlekin schickt mich“, sagte der MD. „Ein Notruf. Die Übertragung beinhaltet Informationen, die er Euch aufgrund der Umstände nicht selbst übermitteln kann.“
Marrks nickte. „Komm rein. Schnell.“
Er bugsierte den dampfzischenden MD ins Wohnzimmer und zog rasch die Vorhänge zu. Man konnte ja nie wissen. Dann schenkte er sich ein Glas Rotwein ein. Er nahm dazu eine der besseren Flaschen und ließ sich gegenüber seiner Schöpfung auf das breite Ledersofa fallen. Er betrachtete das zusammengesetzte Mosaik künstlichen Lebens: Stahl, Aluminium, Kupfer, Golddrähte und Zahnräder. Eine einfache Konstruktion, dachte er nicht ohne Stolz. Eine, die in Sternenheim längst alltäglich war und nicht weiter auffiel.
„Wie lautet der Inhalt der Übertragung?“
„Harlekin hat eine Entdeckung gemacht“, begann der MD und schilderte alles, was der Maschinenjunge in Ro Thanayas Anwesen gesehen hatte.
2 Die Wandernden Kirchen
Als der Tod kam, entsetzlich und finster in Gestalt einer riesigen, weit in den Himmel reichenden Welle, beruhigte sich Cornelis. Selbst das kleine Fischerboot und die kalten, schwarzen Brecher, im Kammbereich immer noch weiß und schaumstrotzend, schienen für einen Moment in ihren Bewegungen innezuhalten. In dem Jungen aus Bandahui erstarb jede Hoffnung. Hier draußen im Mahlstrom, im schwarzen Gedärm eines erbarmungslosen Ozeans, wurde ihm plötzlich klar: Er stand dem biblischen Leviathan gegenüber, einem Naturereignis, dem er nichts entgegenzusetzen hatte, dem er sich nicht entziehen konnte. Es war eine Wand aus schwarzem Wasser, so hoch, dass sie den ganzen Himmel ausfüllte, um ihn, den naiven Jungen vom Land, zu zerschmettern und in die Tiefe zu reißen.
Doch nichts davon geschah.
Ein goldenes Licht erhellte plötzlich das Meer, als wäre ein riesiger Stern zwischen Boot und Welle aufgegangen, und tauchte alles in gleißendes Weiß. Cornelis’ Augen begannen zu tränen und er musste sie mit der Hand bedecken, um überhaupt sehen zu können.
Mit offenem Mund starrte er über die See. Eine menschengroße, goldene Gestalt stürzte aus großer Höhe in die Tiefe und teilte mit ausgebreiteten Armen die Riesenwelle. In einem furchtbaren Getöse fielen die Wellenkämme seitlich in sich zusammen und prallten donnernd und schäumend auf das aufgewühlte Meer. Das Fischerboot begann wild zu schaukeln; Sekundenbruchteile später war das Heck im Freien, strebte himmelwärts, der kleine Außenbordmotor jaulte, rotierte für einen kurzen Moment in der Luft, und Cornelis klammerte sich verzweifelt an den Mast, als das Gefährt mit einem gewaltigen Ruck mit dem Bug voraus in die Tiefe stürzte. Der Aufprall war hart und der gesamte Ozean schien über ihn hereinzubrechen, aber das Boot blieb heil, und kurz darauf konnte der Junge wieder den Himmel sehen, während er wie verrückt nach Luft rang. Das Meer beruhigte sich etwas.
Die Gestalt des Goldenen erschien nun mit einem Mal steuerbords und blickte den Jungen mit seinem augenlosen Gesicht an. Cornelis starrte zurück und war angesichts des lebenden Gottes viel zu perplex, um einen klaren Gedanken zu fassen. Der ehemalige Ältere schien ihm etwas mitteilen zu wollen, eine Botschaft oder eine Warnung, doch anstatt zu sprechen, begann er sich in der Luft zu drehen. Immer schneller rotierte er um seine Achse, erhob sich wie von Geisterhand in den finsteren Sturmhimmel und entschwand nach einer Weile den Blicken des verdutzten Jungen.
Cornelis sank erschöpft zu Boden und presste seine Stirn gegen die Planken. Er schloss die Augen und spürte, wie er am ganzen Leib unkontrolliert zu zittern begann. Alle Kraft hatte ihn verlassen und eine erlösende Bewusstlosigkeit nahm ihn auf. So bemerkte er nicht, wie sich ganz in seiner Nähe ein metallenes Unterseeboot aus den Fluten der See erhob und Kurs in seine Richtung nahm.
Aurelius, der untersetzte Maschinist der Bruderschaft der Archivare, war der Erste, der etwas sah. Er hatte nach längerer Zeit der Untätigkeit das Periskop ausgefahren und justierte nun fieberhaft an den Drehrädchen für die Schärfe, bis er die Wellenkronen klar vor sich sehen konnte.
„Was macht er da?“, keifte der Unternehmer, Herr von Harttland, und Eigentümer des U-Boots, das durch die raue See des Südmeeres schipperte. Er drehte sich hilfesuchend zu den anderen um. „Ich habe ihm nicht erlaubt, irgendetwas zu berühren. He, lass die Finger von den Geräten!“
Aurelius ignorierte ihn. Der mächtigste Mann von Kabelstadt, ein riesiger, kahlköpfiger Koloss mit einem beeindruckenden Leibesumfang, der selbst Aurelius im Vergleich dünn erscheinen ließ, war jetzt nur mehr ein Maulheld, weiter nichts. Ein Gefangener an Bord seines eigenen Schiffes.
Aurelius drehte das Periskop langsam um seine Achse.
„Hmm …“, machte er dabei. „Hm, hmm …“
„Siehst du ihn?“, fragte Michael Altfeld. Die Stimme des Älteren, der den Umgang mit Schwertern, präziser gesagt Katana, beherrschte wie kein Anderer, klang angespannt. Bange Sekunden vergingen, während das Periskop und der dicke Junge sich unmerklich weiterdrehten. Aurelius schüttelte immer wieder den Kopf, sagte aber nichts.
Sie waren auf der Suche nach Cornelis, dem Schüler des getöteten Meister Aki. Der Junge hatte sich, unvorsichtigerweise wie es schien, allein auf die geheimnisvolle Insel Tír na nÓg im Südmeer begeben, um das schwerwiegende Schisma der Bruderschaft der Archivare zu lösen.
Eigentlich hatten seine ehemaligen Begleiter gehofft, ihn noch rechtzeitig in Porta Pueritia, dem einzigen Hafen des Eilands, abpassen zu können, aber dort hatte man ihnen nur mehr die Geschichte eines blonden Jungen aufgetischt, der verzweifelt ein Boot gesucht hatte, um inmitten des schlimmsten Sturms aller Zeiten nach Südland zu schippern. Und ein alter Fischer hatte bei dem Leben seiner einzigen Tochter geschworen, dass genau derselbe Junge sein einziges Boot gestohlen habe, und dass der altersschwache Kutter – zehn zu eins gewettet – niemals den Wahnsinn eines Entropischen Sturms überlebt haben konnte, selbst wenn alle Götter von Nord- und Südland gemeinsam beschützend an der Seite des Knaben gestanden und das Meer beruhigt hätten.
Wenn es sich bei diesem blonden Jungen wirklich um Cornelis handelte, so hatte der Ältere Michael Altfeld wenig später mit bedeutungsschwerer Stimme seinen Begleitern erklärt, dann wäre er wohl just in diesem Augenblick immer noch auf offener See – sollte er überhaupt noch am Leben sein, was einem Wunder gleichkäme, denn bis vor Kurzem war das Südmeer noch ein schreckliches Tollhaus gewesen, das sich nur langsam beruhigte – und sie täten gut daran, sich verdammt noch mal zu eilen.
„Hören Sie, Altfeld, das ist doch scheiße …“ Der Unternehmer wandte sich an den Älteren und seine kalten Augen blitzten vor Wut. „Ein Fischerboot auf hoher See zu finden, ist selbst an guten Tagen schon schwierig, bei diesem Wetter aber völlig unmöglich! Nehmen wir Kurs auf Porta Aqua oder Non’Tur, solange der Diesel noch reicht.“
„Seien Sie endlich still“, gab Altfeld zurück. Er stand, schlank und groß gewachsen wie ein altertümlicher Held, mit seinen beiden Katana in den Händen, zwischen Kommandostuhl und Periskop und drehte sich langsam zu der blonden Frau herum, die sich bislang schweigend im Hintergrund gehalten hatte. Er gab ihr ein Zeichen.
Sie nickte und der Unternehmer krallte sich daraufhin in den Lehnen seines Kommandostuhls fest. „Das können Sie nicht machen, Altfeld. Sagen Sie dieser Schlampe … sie wird es wohl nicht wagen …“
Colombina war neben den Unternehmer getreten und griff nach den riesigen Oberarmen des Mannes. Auf den ersten Blick erschien es unmöglich, ja fast absurd, dass es ihr gelingen würde, dieses riesige Stück Fleisch auch nur einen einzigen Millimeter zu bewegen, doch ihr Griff war wie eine Stahlklammer und der Unternehmer schrie auf, als sie mühelos seinen Arm verdrehte.
Colombina, so schön sie auch anzusehen war, war keine echte Frau.
Gehärteter Stahl ersetzte bei ihr die normale Knochenmatrix, und der Herr von Harttland erinnerte sich jetzt vermutlich schmerzhaft daran, dass unter der organischen Hülle ein hoch entwickelter Roboter des Älteren Jerry Marrks steckte. Langsam drehte Colombina dem Unternehmer den Arm auf den Rücken. Sein Gesicht wurde puterrot und ein unansehnlicher Speichelfaden tropfte von seiner Unterlippe.
„Hee …“ Aurelius fuchtelte wild mit den Armen und hielt so das Maschinenmädchen davon ab, dem Unternehmer etwas wirklich Schlimmes anzutun. „Ich kann etwas sehen! Ich glaube, es ist ein Boot …“
Altfeld drängte das Mitglied der Bruderschaft der Archivare rasch zur Seite und griff selbst nach dem Periskop. Er drehte es nach links und rechts, während seine Augen fieberhaft versuchten, sich an die verminderte Sicht bei sturmgepeitschter See zu gewöhnen. Nach ein paar Sekunden hatte er jedoch das Objekt, das der junge Archivar gesichtet hatte, ebenfalls im Visier.
Er drehte sich herum.
„Auftauchen!“, befahl er.
„Sind Sie verrückt …?“, entfuhr es dem Unternehmer, der trotz der Bedrohung durch das Maschinenmädchen nichts von seiner ungehobelten Art verloren hatte.
„Auftauchen!“
„Ich weigere mich …“
Colombina machte eine kurze Bewegung und der Unternehmer schrie vor Schmerz auf. „Schon gut, schon gut … ich tue, was immer Sie wollen …“
Colombina ließ ihn los und er fiel keuchend in seinen Kommandostuhl zurück. Nach einigen Augenblicken des Jammerns zog er die beweglichen Bildschirmarmaturen zu sich heran und hämmerte darauf herum. Druckluft schoss hörbar in die Wassertanks. Das U-Boot tauchte auf.
„Wenn Sie jetzt auf die Scheißidee kommen sollten, die Luke über unseren Köpfen zu öffnen, dann sind wir geliefert“, rief er an Altfeld gewandt. „Bei diesem Seegang wäre das glatter Selbstmord!“
Der Ältere winkte ab. „Lassen Sie das meine Sorge sein. Tun Sie einfach nur, was ich von Ihnen verlange.“
„Sie erbärmlicher, blöder …“, giftete der Unternehmer und verschränkte die Arme vor der Brust.
Colombina verabreichte ihm emotionslos eine Ohrfeige und zog ihn aus dem Kommandostuhl.
„Übernimm die Armaturen“, befahl Michael Altfeld an das Maschinenmädchen gewandt. „Wir können uns nicht auf ihn verlassen. Kommst du mit der Technik des U-Boots klar?“
Colombina blickte auf die Seitenlehnen des Kommandostuhls. Überall waren winzige Bildschirme mit virtuellen Tasten und Diagrammen zu sehen. Sie nickte. „Technologie aus Kabelstadt. Primitiv.“
Michael Altfeld nickte ihr zu. „Sobald wir die Wasseroberfläche durchbrochen haben, öffne bitte die Einstiegsluke.“
Als Cornelis wieder zu sich kam, fühlte er einen schrecklichen Verlust, als wäre etwas äußerst Wertvolles, das er besessen hatte, von ihm gegangen. Doch er konnte sich nicht mehr daran erinnern, was es war. Er fiel hinaus in die kalte, fröstelnde Wirklichkeit und blinzelte zitternd in das grelle Licht einer Deckenlampe.
Er schrie.
Er verspürte Angst. Schreckliche, nackte Angst.
„Cornelis!“
Irgendjemand schüttelte ihn. Eine vertraute Stimme drang an sein Ohr. Seine Augen waren offen, doch er konnte nichts sehen. Er richtete sich auf, obwohl ihm furchtbar schwindelig war.
„Cornelis!“
Er wollte nichts hören, wollte nur zurück in die rotorganische Wärme seines Traums, aus dem er gerade gefallen war.
Er blinzelte erneut.
Aurelius …? War das etwa Aurelius gewesen, der ihn gerufen hatte?
Sein Herz machte einen Sprung.
Aber ja, es war Aurelius!
Und links und rechts von ihm standen Michael Altfeld und Colombina.
Verwirrt blickte er sich um. Ein seltsamer Raum aus Metall umgab ihn und die seltsame Liege, auf die man ihn gebettet hatte, vibrierte sanft.
Seine Augen huschten hierhin und dahin. Überall befanden sich Anzeigen, Hebel, Schalter und Dampfventile. Bunte Lämpchen blinkten. Alles rings um ihn herum schien so, als befände es sich in Bewegung.
„Wo … wo bin ich hier?“
Michael Altfeld sprach als Erster. Sein schmales Gesicht, die langen, schwarzen Haare, die dunklen Augen und das markante Kinn verliehen ihm etwas Abenteuerliches. Seine Stimme klang dunkel und voll wie die eines Geschichtenerzählers. „Du befindest dich an Bord eines U-Bootes. In Sicherheit. Ruh dich aus, wir bringen dich in friedlichere Gewässer.“
Cornelis nickte. Er war so müde, so erschöpft. Wie sollte er in diesem Zustand mit ihnen sprechen, ihnen alles erklären?
Aber es half nichts. Sie mussten es erfahren. Sofort.
„Bernadette …“, stammelte er schließlich. „Sie haben sie getötet …“
Altfeld blickte verwirrt zu Aurelius und Colombina.
„Nyail …“, fuhr Cornelis fort, während heiße Tränen über seine Wangen liefen. „Der Gesandte des Abgründigen Gottes hat sie getötet … und sie anschließend in den Urdbrunnen geworfen, um den Goldenen hervorzulocken.“
„Was redest du da?“ Altfeld griff nach seinen Schultern, packte sie schmerzhaft. „Cornelis, was genau ist auf Tír na nÓg passiert? Meinst du etwa Bernadette la Halle? Bist du ihr begegnet?“
Cornelis nickte. „Meine Mutter …“
„Deine Mutter …?“, entfuhr es Aurelius. „Die Ältere ist deine Mutter? Was soll das heißen? Ich dachte immer, deine Mutter sei bei deiner Geburt in Bandahui gestorben?“
Cornelis schüttelte den Kopf. „Bernadette … sie ist meine echte Mutter.“ Dann befiel ihn eine tiefe, bleierne Müdigkeit und er stürzte erneut in Dunkelheit.
Die Küste war ganz unvermittelt vor ihnen aufgetaucht, eine feine Linie in Grün- und Brauntönen; ein erdiges Etwas, über dem die heiße Luft flimmerte; ein Etwas, das nur langsam an Form und Höhe gewann und sich schwerfällig aus dem Südmeer erhob, aber dabei dennoch seltsam undefiniert und karstig blieb, mit scharfkantigen Klippen und spitzen Felsnadeln; Land, das darauf zu warten schien, den Menschen den Zutritt zum Landesinneren zu verwehren.
Die ersten Siedlungen, die schließlich in Sicht kamen – primitiv umzäunte Ackerfelder oberhalb der Klippen, rostige Wellblechhütten und kleine, aus grobem Stein zusammengesetzte Häuser, offensichtlich eilig als architektonische Notdurft errichtet –, vermehrten sich im Laufe ihrer Fahrt entlang der Küste zu mittelgroßen Kolchosen und kleinen Städtchen. Schlicht blieben sie bis zuletzt, während das U-Boot des Unternehmers aufgetaucht an ihnen vorbeischipperte, nüchtern funktional mit sich schnell drehenden Windrädern und Sonnenkollektoren auf den flachen Dächern. Allmählich hatten sie sich jedoch entlang des Ufers verdichtet und bald schon waren sie Teil eines größeren Ganzen, wie Cornelis überrascht feststellte. Gepflegte Parks und Cafés unterbrachen die nüchternen Fassadenreihen der Siedlungen. Licht und pastellfarbenes Grün spielten bald eine größere Rolle – unmerklich zunächst, doch bald schon unübersehbar – und jetzt war deutlich zu erkennen, dass sie sich einer großen Stadt näherten. Filigrane Türme erhoben sich vorsichtig in den Himmel, und bunte Reklametafeln, die im Dunst einer niemals schlafenden Hafenstadt aufreizend leuchteten und blinkten, kündeten von Zivilisation. Alles war hier anders als in Nordland, dachte Cornelis. Die Farben, der Baustil, der wilde, aromatische Geruch der kleinwüchsigen Bäume, die die Straßen säumten. Und bald schon würden sie dieses fremde Land betreten.
Zwei Stunden später hatten sie im Hafen von Porta Aqua festgemacht und das U-Boot des Unternehmers verlassen. Den Herrn von Kabelstadt hatten sie mit seinem U-Boot ziehen lassen, auch wenn diese Entscheidung nicht einstimmig gefällt worden war. Doch der Unternehmer war eine schwer kalkulierbare Größe und man war sich einig, dass seine Gegenwart für alle Beteiligten das größere Problem darstellte als seine Abwesenheit. Mochte er zurück nach Nordland gehen und seine Häscher in Harttland mobilisieren, hier auf dem Südkontinent würde er nur wenig ausrichten können und bald schon würden sich die Spuren der kleinen Gruppe ohnehin verlieren.
„Es war dein spezieller Wunsch, hierher zu kommen, Cornelis aus Bandahui“, sagte Michael Altfeld, während sie über den Hafen gingen. Er musterte den Jungen mit ernstem Blick. „Was willst du tun, jetzt wo du diesen neuen Kontinent betreten hast?“
„Ich muss Nyail finden …“, presste Cornelis hervor und schwieg dann. Jedes weitere Wort, so glaubte er, ließe ihn wanken.
Altfeld, der Porta Aqua wie seine Westentasche zu kennen schien und auch den südländischen Dialekt fehlerfrei beherrschte, führte die kleine Gruppe kurz darauf durch die geschäftige Innenstadt, bis sie tief in einem Labyrinth von verwinkelten Gassen innehielten und in die gähnende Dunkelheit einer großen Herberge starrten. Der Ältere orderte Zimmer, Essen und Getränke und bezahlte alles bar mit Münzen, die scheinbar auch auf dem Südkontinent Gültigkeit zu haben schienen.
„Das muss fürs Erste reichen.“ Altfeld schenkte seinen Begleitern ein aufmunterndes Lächeln und warf sich auf ein Bett in einem der Räume, die sie angemietet hatten. „Morgen ziehen wir weiter. Wir bleiben nicht länger als eine Nacht am gleichen Ort. Wer weiß, was der Unternehmer vorhat. Wir können ihm nicht trauen.“
„Warum haben wir ihn dann ziehen lassen?“, fragte Aurelius überrascht. „Ich dachte, das wäre die beste Entscheidung gewesen?“
„Hättest du ihn etwa mitnehmen wollen …?“ Der Ältere warf dem Maschinisten einen undefinierbaren Blick zu. „Die Ereignisse der letzten Tage waren schlimm, zugegeben. Wir sind alle etwas aufgekratzt. Voller Misstrauen und Angst sogar, was nur verständlich ist. Und ja, der Unternehmer ist kein Freund, aber auch kein Gefangener. Lassen wir ihn ziehen, das ist das Beste. Aber bleiben wir dennoch wachsam. Wenn wir uns unauffällig verhalten, wenn wir unauffällig reisen, wird er uns nur schwer finden, sollte er überhaupt noch ein Interesse an uns haben. Wir sollten uns jetzt entspannen und uns auf uns selbst konzentrieren, unsere Kräfte sammeln. Vor allem Cornelis muss sich erholen. Ihm sitzt der Schock über den schrecklichen Verlust von Bernadette und Meister Aki noch tief in den Knochen.“
Die anderen nickten wortlos.
Altfeld fuhr fort: „Der alte Mann, Aki, hat heldenhaft versucht, den Metamorphen, der ihnen gefolgt war, am Ende zu töten, doch die Kreatur hat sich als stärker erwiesen. Und dann haben die Mu ihm zu allem Überfluss auch noch das Gehirn aus dem Schädel entfernt. Cornelis’ Beschreibung des gemeinen Mordes an Bernadette la Halle durch Nyail, dem Diener des Abgründigen Gottes, setzt dem Ganzen die Krone auf. Diese Wunden werden Zeit brauchen, um zu heilen.“ Er seufzte. „Ach ja, und was aus Raggah und Hayo geworden ist, wissen wir auch nicht. Doch lasst den Kopf nicht hängen. Es ist noch nicht vorbei, wir sind nicht geschlagen. Denn wenn es stimmt, was Cornelis uns bereits geschildert hat, dann ist unser Gegenspieler, der Abgründige Gott, immer noch in einem verpuppten Stadium. Nyail wird mit ihm untertauchen müssen, bis er in seiner wahren Gestalt in Erscheinung treten kann.“ Altfeld blickte seine Begleiter der Reihe nach an. „Das ist unsere große Chance. Ist Cú Chulainn erst einmal in seiner vollendeten Form zurückgekehrt, dann wird seine Macht schier grenzenlos sein. Er wird die Túatha Dé Danann aus den Schatten nach Nord- und Südland zurückführen und sie werden uns alle vernichten. Morgen oder übermorgen, wenn wir ausgeruht sind, werden wir herausfinden müssen, wohin das Luftschiff aus Tír na nÓg geflogen ist. Sein Kurs kann über Nor-Ras-Mar, die Weiße Wüste oder über Ost Quitzaurien geführt haben. Die Flugsicherung von Porta Aqua muss Aufzeichnungen darüber haben.“
„Was ist mit Cornelis? Welche Rolle spielt er eigentlich in dieser Geschichte?“, rief Aurelius. „Was, wenn er nicht der Auserwählte ist? Was dann? Was, wenn er uns nicht retten kann?“
Altfeld seufzte. „Ehrlich gesagt, hege keine große Hoffnung auf Rettung, mein lieber Aurelius. Wie wir wissen, steht die Welt vor ihrer Auflösung. Sie verdampft in zunehmender Entropie. Dummerweise gibt es keinen Weg raus aus dieser Singularität, zumindest nicht ohne die Gesetze der Physik zu verletzen. Transformation wäre eine Möglichkeit. Leider kenne ich keinen Weg Ramnaroughenergien in derart großen Mengen zu erzeugen, um alle Bewohner des Landes in gottgleiche Wesen wie Juri-Hiro zu verwandeln. Das allerdings wäre der einzige mir bekannte Weg, die Schöpfungskuhle wieder zu verlassen. Die Welt, in der wir uns hier befinden, ist kein gewöhnlicher Ort und der Schleier, der die Welten trennt, ist undurchdringbar, selbst wenn Juri uns helfen würde, was er nicht tun wird. Es war ja immerhin sein Traum, hier zu sein. Er wird seine Vision nicht aufgeben. Und Bernadette, seine Gefährtin, die uns vielleicht hätte helfen können, ist leider tot.“ Er machte eine Pause. Dann fuhr er mit leiser Stimme fort: „Sie glaubte daran, dass Cornelis uns retten kann. Doch das Wie und Wann blieb sie uns leider schuldig.“
„Sie sagte, ich müsse