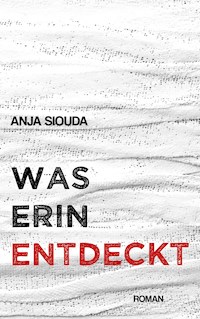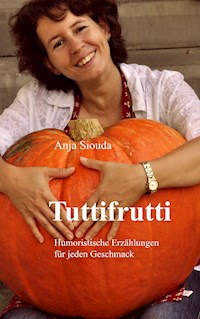
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bis anhin packte und berührte Anja Siouda ihre Leserschaft mit ihren dramatischen interkulturellen Romanen. Geistreich, phantasievoll und mit viel Wortwitz kommen nun ihre 53 humoristischen Erzählungen daher und geben originelle Antworten auf Fragen wie: Wo gibt es Apfelwähenzärtlichkeit? Was sind Schlafzimmerdesserts und Wonneproppen? Wie war das mit dem Scheidungshuhn und mit dem Erklimmen der Schwarzwäldertorte? Wo begegnen uns Friedenstauben und Sündenböcke? Was erzählt ein Zyklop und was denkt der Staubsauger? Wie schmecken Froschaugen? Was steht im Erotik-Ordner? Warum rügt Gott Gabriel? Wo ist das Hühnerparadies? Gibt es Zahnteufelchen und gastfreundliche Zahnärzte? Und wo spielt Gott Dame?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Passionsfrüchte
José
Lustvoll romantisches Familienleben
Freundschaft
Schlafzimmerdesserts
Die Traumrolle
Das erste Mal
Fifty Shades of Blue
Apfelwähenzärtlichkeit
Im Erotik-Ordner
Wo Gott Dame spielt
Im Pool mit Panoramablick
Geistvolles zum Spiritus
Zankäpfel
Grenzübergänge
Die Friedenstauben
Der Einrolltisch
Wacholder-Latwerge
Der Wonneproppen
Das Scheidungshuhn
Der Sündenbock
Ein wahrer Freund und Helfer
Das Rohmaterial
Die PSH-Partei
Maulbeeren
Die Neugier
Habb ar-Rumman: Granatapfelkernchen
Das Erklimmen der Schwarzwäldertorte
Das Zahnteufelchen
Lasagne, Ravioli und Spaghetti
Wasser und Wein
Das Froschauge
Minus Marotte
Von Palatschinken und Kaiserschmarrn
Furchtlos zum Zahnarzt
Paris-Brest
Hirn in Scheibchen
Der Frosch
Knacknüsse
Der Verdacht
Die Grundausstattung
Koffertriodrama
Die Sportskanonen: erster Anlauf
Die Sportskanonen: zweiter Anlauf
Smartphonefrei
Konzentrationsstörung
Der patentverdächtige Staudamm
Frühlingsputz statt Fahrt ins Blaue?
Kichererbsen
Der Zyklop
Im Hühnerparadies
Traumhafter Ausritt
Staubsaugerperspektive
Das Glücksschweinchen
Erdbeerzeit in Berlin
Saloppe Sprache
Links und rechts
Ist hier noch frei?
Passionsfrüchte
José
Nichts und niemand währt ewig, sagte sich Isabella wieder einmal und wischte sich eine Träne weg. Und doch sah der Frühling jedes Jahr so unbekümmert und fröhlich aus, wie wenn er das nicht wüsste. Es war schon Mitte April und in den Blumentöpfen auf ihrem Fenstersims regte sich etwas. Das hatte sie eben gesehen: Ihre zwei letzten teuren Samen, die ihr nach all den Jahren noch blieben – alle anderen hatte sie zu einem umwerfenden Preis verkaufen können –, hatten angefangen zu keimen. Das freute sie einerseits, wie jedes Jahr, aber andererseits wusste sie immer noch nicht, wie sie die Pflänzlinge später auf dem englischen Rasen des Altersheimparks setzen und sie dort pflegen würde. Sie würde nicht nur Hilfe brauchen, sondern bestimmt auch eine Bewilligung. Diese Gedanken verdarben ihr den Frühlingsmorgen, aber es kam auch sonst hie und da vor, in ihrem hohen Alter, dass ihre Laune kippte. Sie war nämlich 99 Jahre alt, im Kopf noch ziemlich klar, aber auf den Beinen ziemlich schwach. Ohne Rollator schaffte sie es nicht einmal mehr, sich in ihrem kleinen Zimmer im Altersheim zu bewegen, und von einem Ausflug in ihren eigenen prächtigen Garten konnte sie nur noch träumen. Ihr Haus war seit ihrem Eintritt samt Umschwung verkauft worden, und mit dem Erlös wurde ihr Aufenthalt im Heim finanziert. Aber immerhin, sie war seit ihrem Eintritt in dieses Haus vor knapp einem Jahr noch nicht auf der anderen Abteilung gelandet, auf der Pflegeabteilung. Sie hatte auch nicht die geringste Lust, ihr Zimmer zu wechseln. Es war ja nicht sicher, dass sie auf der anderen Station, wo die Pflegefälle waren, ihr Zimmer genau gleich gestalten konnte, wie sie es liebte. In der anderen Abteilung gab es nämlich keine Einzelzimmer. Hier aber hatte sie niemand davon abgehalten, sämtliche Wände mit den Artikeln und Fotos von José und ihr zu tapezieren. Die Angestellten des Heims hatten ihr dabei sogar bereitwillig und auch mit einer Spur Bewunderung geholfen. Es gab kaum noch ein freies Fleckchen, ausser um den Fensterrahmen herum, und genau das gefiel ihr. José, flüsterte sie leise, und es schwang Liebe und Stolz in ihrer Stimme mit. José, der Name hatte so gut zu ihm gepasst, es lag eine Art Vollkommenheit in diesen zwei Silben, das fand sie auch heute noch. Sie strich über einen der leicht vergilbten Zeitungsartikel und schloss die Augen. Als er noch klein war, hatte sie ihn jeden Tag umarmt und gestreichelt. Später aber konnte sie es nicht mehr, er war eindeutig zu gross und zu dick geworden. Das aber hatte sie nie gestört an ihm, ganz im Gegenteil. Sie hatte sich enorm darüber gefreut, es war doch ein eindeutiger Beweis gewesen, dass sie besonders gut zu ihm geschaut und ihm immer genau die richtige Nahrung angeboten hatte. Isabella öffnete ihre Augen wieder und ging, gestützt auf ihren Rollator, zur gegenüberliegenden Wand. Dort hingen die beeindruckendsten Bilder von José und ihr: Er wog damals dreihundert Kilo und sie stand daneben, wie eine Mutter neben ihrem Kind, und hatte dabei ihren rechten Arm auf ihn gelegt. Sie lachte auf diesem Bild bis zu den Ohren. Es war ja auch der Tag der Preisverleihung und niemand anderer als sie hatte ihn gewonnen, den ersten Preis für ihren Riesenkürbis.
Lustvoll romantisches Familienleben
Wie schön ist doch dieses einfache Campingleben! Ferien sollten immer so sein: Kein kompliziertes Kochen, nur Sachen vom Grill und frische Salate! Kein Streit, nur Frieden und gute Laune und einen blutroten Sonnenuntergang über dem glitzernden See.
Sie beobachtet ihn in seinen Jeans und seinem enganliegenden schwarzen T-Shirt, das ihm so gut steht, während er mit den Jungs Fussball spielt. Er fängt ihren zärtlichen Blick auf und ruft lächelnd:
«Ich mag es, wenn du mich so anschaust!»
«Und ich mag es, wenn du so ausschaust», ruft sie zurück und bedauert augenblicklich, dass sie ihn abgelenkt hat. Der Schuss des jüngsten Sohnes ist kraftvoll und der Ball trifft des Vaters Nase.
«Verflucht», schreit er, reibt sich das Gesicht mit seinen Händen und sucht nach der Brille, die auf den Boden geschlagen wurde. Als die Nase des Vaters auch noch zu bluten anfängt, beginnt der erschreckte Junge zu weinen.
«Entschuldige, Papa, ich wollte dich nicht …»
«Mach dir keine Sorgen, ich weiss, dass du deinen Vater nicht verletzten wolltest», sagt sie und fährt dem Jungen zärtlich durchs verschwitzte, struppige Haar.
«Was? Du kümmerst dich um den Verursacher des Unfalls und vernachlässigst das unschuldige Opfer?», ruft ihr Mann beinahe mit einem Anflug von Eifersucht in seiner Stimme.
«Aber natürlich kümmere ich mich um dich. Ich werde dir ein Taschentuch holen, Schatz!»
Bei ihrer Rückkehr ist er dabei, die Brille wieder gerade zu biegen.
«Du hast Glück gehabt, dass sie nicht kaputtgegangen ist», versucht sie ihn zu trösten, hält ihm ein Kleenex hin und fährt ihm mit den Fingern durchs Haar.
«Nein, du hast Glück, dass sie nicht kaputt ist, andernfalls hättest du uns morgen nachhause fahren müssen», betont er und wischt sich mit dem Papiertaschentuch das Blut vom Gesicht.
«Ok, ich habe Glück, dass mein lieber Gatte nicht aus Versehen von seinem kleinen Zidane in spe umgebracht worden ist», neckt sie ihn.
«Genau, ich bin wirklich grade dem Tode entronnen, aber du bist dazu verurteilt, für Linderung zu sorgen!», sagt er mit spielerisch drohender Stimme und einem Zwinkern in den Augen, während er versucht, ihre Hüften zu umfangen. Sie aber kreischt mit vorgetäuschter Angst und rennt davon. Er rennt ihr nach, fängt sie ein, und schliesslich rollen beide ins weiche Gras. Sie küsst ihn flüchtig und windet sich aus seinen Armen.
«Vergiss nicht, dass wir nicht allein sind. Die Kinder …»
«Die Kinder, die Kinder, immer die Kinder!», murrt er genervt.
«Weisst du was, spiel den Fussballmatch fleissig weiter und schau zu, dass sie schön müde werden. Ich werde dir jetzt eine Tasse Kaffee machen, okay?»
Sie kehrt zum winzigen gemieteten Campingwagen zurück und beginnt den Kaffee zuzubereiten. Von draussen dringt das Gelächter der Jungen und ihres Ehemannes zu ihr. Er hat einen Stafettenlauf improvisiert für die Kinder und offenbar geraten die Jungs immer mehr ausser Atem. Nach einer Weile betreten die beiden den Campingwagen, verschwitzt, durstig und endlich erschöpft.
«Zeit für die Dusche», verkündet sie und schaut dabei auf ihre Uhr, die dreiundzwanzig Uhr anzeigt. Die Jungs sind zu müde, um zu protestieren, schnappen sich ihre Frottiertücher, Seife und Zahnbürsten und begeben sich zu den Waschräumen.
«Gut gemacht», sagt sie zu ihrem Mann, als sie die zwei Tassen Kaffee unters Vordach bringt und sich auf den Plastikstuhl neben ihm setzt. Da sie sich nicht in der Hochsaison befinden, ist der Campingplatz in ruhige Dunkelheit getaucht. Sie streichelt seinen Nacken liebevoll.
«Ich bin sicher, dass sie völlig fertig sind und sofort einschlafen werden.»
Er antwortet nichts, aber legt seine Hand auf ihren rechten Schenkel und streichelt ihn zart.
Nachdem die Jungs zurückgekommen und in ihrem winzigen Schlafraum verschwunden sind, schliessen sie sorgfältig die dünne Schiebetür, die den Wohnraum vom Schlafzimmer trennt, klappen die gepolsterte Eckbank und den Tisch zu einer geraden Fläche zusammen, legen die restlichen vorgesehenen Polsterkissen darauf und haben endlich ihr Doppelbett. Ein paar Minuten später hören sie ein leises Schnarchen aus dem Raum der Kinder.
Da einer der Vorhänge im Wohnzimmer fehlt, löschen sie das Licht aus, nachdem sie die Eingangstür abgeschlossen haben. Noch immer bekleidet legt er sich auf die Polstermatratze und zieht sie nah an sich. Sie presst sich mit Verlangen an ihn, knabbert an seinem Ohrläppchen und reibt ihr Gesicht an seiner rauen Wange, bis sie sich plötzlich versteift und vor Schmerz den Atem anhält.
«Was ist denn?», fragt er mit heiserer, überraschter Stimme.
«Beweg dich nicht! Beweg dich nicht, mein …», aber sie schafft es nicht, ihren Satz zu Ende zu sprechen und bekommt einen Lachanfall.
«Spinnst du? Hör auf, du wirst gleich die Kinder wecken», sagt er mit unterdrückter Stimme, aber sie kann nicht antworten, da es sie vor Lachen nur so schüttelt, während sie versucht, ihr Gesicht möglichst nahe an seiner Wange zu behalten.
«Mein Ohrring, er hat …», jetzt wiehert sie noch lauter, «er hat sich mit … mit deiner Brille verheddert.»
«Scheissbrille! Wäre sie doch vorhin kaputtgegangen!», schreit er, ohne auf den Schlaf der Kinder Rücksicht zu nehmen, und versucht möglichst vorsichtig, im Dunkeln ihren spiralförmigen Ohrring von seinem Brillengestell zu trennen. Endlich schafft er es, sie zu befreien, aber sie lacht immer noch Tränen.
«Hör doch auf, bitte!», sagt er beinahe verzweifelt, aber es ist zu spät.
«Mami, was ist denn so lustig?», fragt der Zwölfjährige hinter der dünnen Tür.
«Nichts …», antwortet sie und versucht, ihr Lachen zu unterdrücken, aber sie prustet nur noch lauter los.
«Ruhe jetzt und geh zurück ins Bett!», schreit er wütend Richtung Schiebetür. Dann öffnet er die Eingangstür, geht hinaus und zündet sich eine Zigarette an. Sie schafft es schliesslich, sich endlich zu beruhigen und folgt ihm mit schmerzenden Bauchmuskeln, fühlt sich aber beinahe so entspannt, als hätten sie zu Ende gebracht, worauf sie aus waren.
«Es tut mir ja so leid, Schatz», sagt sie und umfängt seinen Rücken, «aber das war eben so unglaublich doof, dass ich es für den Rest meines Lebens nicht vergessen werde.»
«Ich werde diese ach so romantischen Ferien auch nie vergessen», brummt er völlig frustriert.
«Nächstes Jahr gehen wir in ein Hotel, okay?», versucht sie ihn zu trösten.
«Ja, mit zwei getrennten Zimmern mit Wänden wie ein Betonbunker und Schlaftabletten für die Kinder!»
Freundschaft
Sie hiess Dagmar und sie kam mit dem Schiff. Meistens jedenfalls, aber ab und zu kam sie auch mit dem Bus und mit dem Zug zur Schule. Ich war dreizehn Jahre alt damals und ich fand das toll, aber für sie war der Schulweg manchmal lang, vor allem am Abend, wenn sie wieder nachhause fuhr, in ihr kleines, sympathisches Touristendorf am Vierwaldstättersee. Wenn sie dort aus dem Schiff ausstieg, hatte sie noch einen kurzen Weg zu Fuss vor sich, bis sie wieder in einem Schiff zuhause war. Im Hotel Schiff, neben dem auch tatsächlich ein Schiff stand. Rechts von der Auffahrt, die zum Hotel hinaufführte, war es originellerweise direkt in den Hang hineingebaut und sass zwar in der Nähe vom See, aber ganz auf dem Trockenen. Das gemütliche Hotel gehörte ihren Eltern, und Dagmar und ihre Geschwister halfen im Betrieb fleissig mit. Dagmar aber konnte es besonders gut! Ich sah das jeweils, wenn ich hie und da zu Besuch bei ihr war, wobei ich übrigens auch Anjo kennenlernte, ihren Schwyzer Niederlaufhund, der per Zufall fast mein Namensvetter war und aufgrund seiner zu lang geratenen Beine von Jagd- auf Hotelhund umgesattelt hatte. Dagmar half immer viel beim Service und sie machte es stets mit einem liebenswerten Lächeln. Auch an den Stammtisch setzte sie sich, plauderte und scherzte charmant mit den Stammgästen. Sie konnte das super, im Gegensatz zu mir. Mein Humor brauchte jeweils etwas Zeit, um zu reifen, Schlagfertigkeit war nicht meine Stärke, dafür schrieb ich schon damals die besten Schulaufsätze. Zusammen machten wir Vorträge für die Schule, zum Beispiel über James Dean oder über die Honiggewinnung in Lateinamerika. Wir zogen uns dafür oftmals in einen Speisesaal im Hotel zurück, am Nachmittag, wenn er ganz leer war. Dort stand auch ein Klavier und Dagmar spielte hie und da darauf. «Pour Elise» war damals der absolute Hit, vor allem in der Soft-Romantik-Version von Richard Clayderman. Wir konnten das gut, einander von der Vorbereitung des Vortrags ablenken und über Gott und die Welt plaudern, bis es Abend wurde und ausnahmsweise ich den langen Weg auf dem Schiff vor mir hatte statt sie. Manchmal waren es um diese Tageszeit ganz kleine Schiffe und beim hohen Wellengang wurde mir fast übel, zumal ich meistens schon bei der Abfahrt das dicke Sandwich verzehrte, das mir Dagmar jeweils zubereitete, bevor ich gehen musste. Aus Anstand wehrte ich natürlich immer ab, nein, nein, sie solle sich doch nicht bemühen, aber ich liebte sie, diese riesigen Doppeldecker mit einer Schicht von mehreren Zentimetern Aufschnitt und reichlich Butter, die mir Dagmar in der Hotelküche schmierte. Es hatte auch immer alles auf Vorrat, was es dazu brauchte, in so einer professionellen Küche. Dagmar aber blieb trotzdem immer gertenschlank, im Gegensatz zu mir, wahrscheinlich weil sie so fleissig beim Servieren half und nicht so ein Stubenhocker war wie ich. Sie trank auch nicht ständig Milch zu den Mahlzeiten, wie ich es in der Schulkantine für gewöhnlich tat. Sie fand das immer kurios und diese Gewohnheit teilte sie wirklich nicht mit mir, obwohl wir grade beim Essen sehr viel miteinander teilten. Am Mittag assen wir ein einziges Menu zu zweit – es reichte uns und es kam auch billiger, das heisst, wir besserten uns damit indirekt auch ein bisschen unser Taschengeld auf, denn von den Eltern bekamen wir natürlich das Geld für ein ganzes Menü, nicht für ein halbes – auf dem gleichen Tablett und zum Dessert gab’s oft einen Mohrenkopf, damals nannte man ihn noch so, davon gab’s dann einen pro Person. Wir höhlten ihn genüsslich aus: Mit dem dünnen weissen Plastikstäbchen fürs Rühren im Automatenkaffee holten wir die süsse, klebrige Eiweissmasse heraus, vielleicht ein bisschen wie die alten Ägypter den Mumien das Hirn durch die Nase herauszogen, wie wir im Geschichtsunterricht erfahren hatten. Dagmar konnte das, ohne dass die Schokolade in ihren Fingern zerlief. Mir gelang das nie, meine Finger versanken immer in der dünnen Schokoladewand. Etwas anderes genossen wir auch gerne zu zweit – den französischen Frischkäse Cantadou, den wir damals neu entdeckten und den man in der Stadt Luzern noch offen kaufen konnte. Mit einem frischem Brot und einer Schale Cantadou hockten wir uns jeweils an die Reuss oder an den See, brachen das Brot in kleine Stücke und tauchten es in die köstliche Masse. Andere Genüsse aber hielten wir geheim – nicht voreinander – aber vor den anderen. Wir schämten uns ein bisschen dafür und tauschten sie deshalb nur auf der Schultoilette aus, die Groschenromane, die wir eine Zeitlang lasen. In ein gelbes B5-Couvert steckten wir sie und reichten sie uns, nachdem wir unsere Zähne geputzt hatten, unter den Trennwänden der Toiletten durch, wo wir sie lachend in unseren Mappen verschwinden liessen. Für Freundschaften mit Jungs interessierten wir uns damals noch nicht, unsere Mädchenfreundschaft war abenteuerlich und erfüllend genug. So machten wir einmal eine mehrtägige Velotour, zusammen mit ein paar anderen Schulkolleginnen und -kollegen. In die Westschweiz ging’s, von Moutier über Délémont und Saint-Ursanne nach Saignelégier, und ich erinnere mich noch gut daran, wie laut und unheimlich nachts jeweils die Kühe vor unseren Zelten schnauften und wie leise und glitschig uns die fetten Nacktschnecken über die Schlafsäcke krochen. Auch an Saignelégier erinnere ich mich, wo wir einmal ein Problem mit unserem Gaskocher hatten, als wir gerade beim Garen von Teigwaren waren. Das Gas war alle und wir schafften es nicht, eine neue Gaspatrone auf das Gerät zu schrauben. Wir gingen sogar zur Polizei, die uns dabei half, aber nachher waren die Eierteigwaren total zerkocht. Noch heute müssen wir lachen, wenn wir uns gegenseitig an die berühmt-berüchtigten «Eierhörnli» erinnern. Andere gemeinsame Erinnerungen haben wir an Wien. Bei diesem Städtetrip waren wir siebzehn Jahre alt und reisten mit dem «Wiener Walzer» ab Zürich in einer Nacht ganz alleine hin, nachdem wir vorher alles selber organsiert hatten. Ohne Internet. Wir kamen in einer einfachen Schweizer Pension im Stadtzentrum unter, teilten ein Doppelbett und eine ganz kuriose Kastendusche, die auf Füssen im Zimmer stand, wie ein Schrank mit Vorhang. Wie alle anderen Touristen bewunderten wir den eindrücklichen Stephansdom, stiegen auf den höchsten Turm hinauf, genossen die tolle Aussicht auf die Stadt und die Fiaker auf dem Platz darunter, besuchten das wunderschöne Schloss Schönbrunn mit seinem weitläufigen Park, dem Raub der schönen Helena und der schönen Quelle, wo uns eine steinalte Grossmutter das besondere Wasser kosten und den mit Zeitungsberichten von ihr selbst austapezierten Innenraum studieren liess. Auch die Hofburg mit der Hofreitschule und den Donauturm besuchten wir sowie das historische Museum, wo gerade die Ausstellung «Traum und Wirklichkeit» aktuell war. Natürlich begegneten wir auch Richard Strauss, Beethoven, Schubert und Mozart, Letzterem nicht nur aus Stein, sondern auch aus Schokolade und Marzipan. Tatsächlich hatten es uns – oder vielleicht vor allem mir – die leckeren, in Goldpapier eingepackten Mozartkugeln angetan. Überhaupt schmeckte uns das österreichische Essen allgemein, obwohl Knödel aller Art, panierte Brathähnchen und Kümmelbrot schon etwas gewöhnungsbedürftig waren. Enttäuscht waren wir hingegen vom Sacher-Hotel, wo uns die Garderobefrauen unsere Jacken beinahe entrissen und worauf wir dann geduldig lästerten – Dagmar mit ihrer Service-Erfahrung wusste ja immerhin einiges über den liebenswürdigen Umgang mit Gästen –, bis uns der berühmte Wiener Kaffee und die noch berühmtere Sachertorte serviert wurden. Beim Verlassen des Hotels, nachdem wir zwanzig Schilling hatten bezahlen müssen, um unsere Jacken zurückzubekommen, waren wir uns völlig einig, dass weder der Kaffee noch der Kuchen noch die Bedienung ihren Weltruhm verdienten. Richtig lustig hatten wir es hingegen wieder im Prater – wo wir ganz unterschiedlich dimensionierte Räder bestiegen: das Riesenrad mit seiner umwerfenden Aussicht und ein Gefährt mit vier Rädern, worauf wir fröhlich zwischen den Fressbuden und Verkaufsständen herumpedalten. Natürlich schleppte mich Dagmar damals auch in jede Kirche, der wir auf unseren Entdeckungsreisen quer durch die Stadt begegneten, sowie nach Grinzing, wo wir bei Wein, Brot und Käse einen gemütlichen Abend verbrachten. Auch einen Abstecher zu Europas grösstem unterirdischen See, im Bergwerk Seegrotte, machten wir noch, wo wir uns schwer beeindruckt und mit einem etwas mulmigen Gefühl auf den unterirdischen Wassern herumgondeln liessen. Als unsere Ferienwoche schliesslich um war, probierten wir auf der Heimfahrt von Wien nach Zürich bei einem Zwischenhalt in Salzburg zum krönenden Abschluss noch die «Salzburger Nockerln», ein Klassiker, der uns so leicht in Erinnerung blieb wie seine Konsistenz. Nur zwei Jahre später dann, als ich Dagmar mit neunzehn Jahren, noch vor meiner Matura, meine bevorstehende Heirat ankündigte, sagte sie mir verständlicherweise: «Du spinnst!» Aber zur Heirat kam sie dann doch und lächelte auch ganz charmant als Trauzeugin auf dem Standesamt. Seither sind fast neunundzwanzig Jahre vergangen, ich bin immer noch glücklich verheiratet und sie hat es mir vierzehn Jahre nach meiner Heirat auch nachgemacht. Wir telefonieren ab und zu miteinander oder treffen uns hie und da, nicht sehr oft, denn wir leben in verschiedenen Ländern, aber wenn es dazu kommt, verstehen wir uns immer noch genauso gut wie früher.
Schlafzimmerdesserts
Sie haben noch nie von Schlafzimmerdesserts gehört? Nein? Haben Sie noch nie eines zubereitet oder genossen? Ich wette doch, Sie wissen, dass es sich hierbei nicht um einen Bienenstich, ein Wespennest, eine Eiterschnitte, ein Tiramisu, einen Windbeutel, einen kalten Hund, ein Schweinsöhrchen, einen Berliner, ein Diplomat, eine Schuhsohle, einen Prophetenkuchen, ein Nonnenfürzchen, eine Madeleine, eine Charlotte oder ein Japonais handelt. Schon eher um eine Götterspeise, eine Katzenzunge, einen Spitzbuben, einen Schoggikuss oder einen Liebesknochen. Wann schmecken sie Ihnen denn am besten, die Schlafzimmerdesserts? Im Dunkeln? Im Kerzenlicht? Bei sanfter Musik? Mit Softrock? Mit Hardrock? Mit Hip-Hop? Mit Tango? Mit Bolero? Mit Swing? Mit einer vorausgehenden Wellnessmassage? Nach einem warmen Bad? Nach einer gemeinsamen Dusche? Nach einem handfesten Streit? Bei Tag? Bei Nacht? Und welche Hauptzutaten brauchen Sie dazu? Liebe, Harmonie und Libido? Und eine Prise Ungestörtheit? Genau, eine der unerlässlichen Zutaten ist die Ungestörtheit, selbst wenn sie nur fünf Minuten dauert. Das kann reichen, notfalls, aber fünfzehn Minuten sind natürlich besser und mit einer halben Stunde wähnt man sich schon im Nirwana. Wer keinen Nachwuchs hat, kann sich solche Zeitnischen für endlose Tête-à-Têtes natürlich problemlos organisieren. Wie aber schafft man es beispielsweise als Elternpaar mit Kindern, das Dessert ganz alleine zu geniessen, ohne auf den Nachwuchs Rücksicht zu nehmen, obwohl man ja sonst mit dem guten Beispiel vorangehen und alles redlich teilen soll in der Familie? Vor allem wenn die Kinder noch ganz klein sind, ist der Genuss eines Schlafzimmerdesserts wirklich ein Marathon mit langen Durststrecken. Entweder man ist zu müde, muss fünfmal pro Nacht aufstehen, zweimal das Baby füttern und frisch ankleiden, das Kinderbett neu beziehen, ein Schlafliedchen singen oder dann, etwas später, ist man vielleicht ausnahmsweise ausgeruht, freut sich auf das Schäferstündchen zu zweit, wird aber schon beim ersten Bissen durch den Dreikäsehoch gestört, der wegen seinen Albträumen partout auch im sicheren Ehebett schlafen will. Sind die Kinder etwas älter, stehen die Chancen gut, dass man dem Genuss des Desserts einiges näher kommt, einem aber der Appetit abrupt vergeht, weil ein Sechsjähriger plötzlich neben dem Bett steht und fragt, was Mama und Papa denn eigentlich machen. Sind die Kinder endlich, endlich schulreif und lässt sich ein freier Tag unter der Woche einrichten, steht einem richtigen Schlafzimmerdessertbüffet nichts mehr im Wege! Man kann dann so richtig schwelgen und jede Krume auskosten, jedenfalls so lange, bis die Schwiegermutter, die im Untergeschoss wohnt, an die unverschlossene Wohnungstür klopft, sie – da ihr niemand aufmacht – sachte öffnet und voller Freude ruft: «Überraschung, meine Lieben! Ich habe gerade Qalb el-Luz für euch gemacht!» Warum aber soll man sich denn beklagen? In anderen Ländern geht es ganz anders zu und her. Grossfamilien leben auf engstem Raum, Schlafzimmerdesserts müssen in aller Eile auf dem Plumpsklo, auf einem unbequemen Autositz oder in der stinkenden Latrine verschlungen werden, wobei der Genuss bestimmt auf der Strecke bleibt. In Tokyo, wo es notorisch an Raum mangelt und Familien ebenfalls eng miteinander wohnen, gibt es sogar – wie in einer Dokumentarsendung zu sehen war – eine Extra-Einrichtung für dessertgenussfreudige Paare: winzige Räume mit Doppelbett, die man für ein bis zwei Stunden mieten kann, sogar das passende Outfit wird zur Miete oder zum Kauf angeboten. Genau wie bei uns Badekleider und Frottiertücher im Hallenbad. Oder wie das Japonais zum Nachmittagskaffee im Tea-Room.
Die Traumrolle
Sie kann es auch diesmal, bei ihrem dritten Besuch, nicht glauben, aber der Arzt sieht aus wie ihr Lieblingsschauspieler: Colin Firth steht sozusagen in natura vor ihr. Charmante Wangengrübchen inbegriffen. Vielleicht ist er es ja, und er spielt einfach gerade die Rolle in einem kitschigen Arztroman, versucht sie sich zu überzeugen. Vielleicht ist es ja sie selbst, die ihm diese Rolle auf den Leib schreibt. Einen Moment lang ist sie völlig durcheinander. Der weisse Arztkittel steht ihm umwerfend und er ist genauso gross und schlank wie der attraktive Colin. Auch eine Brille trägt er, ganz wie ein Arzt aus dem Bilderbuch oder, besser gesagt, aus dem Groschenroman. Seine sehr leise Stimme, offenbar eine seiner Eigenarten, verwirrt sie allerdings, macht ihn aber nur umso interessanter. Kein Vergleich etwa mit einem zynischen, stockschwingenden Doktor House.
Im Wartezimmer begrüsst er sie extra, streckt ihr seine Hand hin, fragt, wie es geht, obwohl sie doch noch gar nicht an der Reihe ist. Sie schreckt auf von ihrem Stuhl, etwas geniert über so viel unerwartete Zuvorkommenheit. Sie gibt ihm die Hand, drückt sie leicht, lächelt, riecht sein Parfüm und setzt sich wieder. Während er sich an die alte Dame im Rollstuhl vis-à-vis von ihr wendet, studiert sie seine Schuhe, braun, Wildleder, mit einer unaufdringlichen kleinen Goldschnalle auf der Seite. Sie erforscht seine Hosenbeine, dann den locker offen getragenen weissen Kittel. Weiter nach oben traut sie sich nicht und senkt ihren Blick wieder. Seine Schuhe gefallen ihr, das weiche Wildleder wirkt schick und samtig zugleich und sie kann sie mit gesenktem Blick anstarren, solange sie will. Er unterhält sich weiter mit der alten Frau. Mit seiner unheimlich sanften, ruhigen Stimme. Himmel, wie er seine Rolle gut spielt, dieser Colin Firth. Er hat wirklich ein beeindruckendes schauspielerisches Repertoire und sie bereut ihre Wahl nicht. Mit professioneller Behutsamkeit fasst er der alten Dame nun an den dick geschwollenen Knöchel, der in einem grauen Strumpf steckt und auf dem Stuhl vor ihr hochgelagert ist. Sie habe Pech gehabt, erzählt sie, wegen den vielen Baustellen vor der Klinik sei sie auf dem Weg zu ihrer Halbjahreskontrolle bei ihm gerade eben total unglücklich gestürzt. Ein Pfleger habe ihr einen Rollstuhl besorgt und sie hierher gefahren. Der Arzt macht ein betroffenes Gesicht, empfiehlt ihr, sich doch am besten gleich zur Notfallabteilung stossen zu lassen, wo ihr Fuss sofort geröntgt werden könne. Die alte Dame nickt und der Arzt entschuldigt sich kurz bei ihr, die nun ihren Blick vom Wildleder reisst, er werde die Dame schnell auf die Notfallstation bringen. In fünf Minuten sei er wieder zurück. Sie nickt verständnisvoll. Hach, was für ein Freund und Helfer, dieser Colin, nimmt sich sogar persönlich seiner alten Patientin an und stösst sie auf eine Abteilung, wo er gar nicht arbeitet. Zehn Minuten verstreichen und er ist wieder zurück, zusammen mit seinem Parfüm. Er öffnet ihr nun die Tür zu seinem Praxisraum und bittet sie lächelnd hineinzugehen. Sie setzt sich auf einen der eleganten Stühle vor seinem mächtigen, dunklen Schreibtisch, während er sein klingelndes Handy zur Hand nimmt und antwortet. Sie schaut demonstrativ nach links, um ihn beim Telefonieren nicht zu stören. Sein Büro hat eine beeindruckende Glasfront, die den Blick auf die neuste Baustelle gegenüber freigibt. Den verschneiten Jura sieht man auch noch ein bisschen. Sie lässt ihren Blick nun doch sachte zu ihm hinübergleiten. Er telefoniert immer noch, versucht aber das Gespräch abzukürzen, das hört sie mit, ob sie will oder nicht. Hinter ihm steht ein riesiges Gestell voller Bücher mit goldenen Lettern und kostbaren Einbänden. Zuvorderst steht Kidney. Er notiert etwas und es fällt ihr sofort auf, dass er Linkshänder ist. Er umfasst den Kugelschreiber nämlich so seltsam wie Barack Obama. Den Kopf hält er leicht vornübergebeugt, seine Augen sieht sie nicht, aber sie weiss ja schon längst, welche Farbe sie haben: Wildlederbraun. Sein leicht gewelltes, nach hinten gekämmtes Haar ist ebenfalls braun. Sie gefallen ihr, diese Wellen im Haar. Sie wirken dynamisch und voller verhaltenem Temperament. Zwei herzige Kinder hat er offenbar auch, die hatte sie doch gar nicht eingeplant, aber sie sieht sie auf den gerahmten Fotos neben ihm. Sie sind noch klein, aber vielleicht sind die Fotos schon ein paar Jahre alt. Wie wohl seine Frau ausschaut? Wenn er Kinder hat, muss er ja auch eine Frau haben. Sie sucht vergeblich nach einem Foto von ihr. Wie es sich wohl lebt mit einem Arzt? Wie kommt er am Abend nachhause? Völlig geschlaucht? Hat er dann noch Zeit für seine Frau und seine herzigen Sprösslinge? Und seine leise Stimme, wird die nie laut mit seinen Kindern? Endlich beendet er sein Telefongespräch, blickt zu ihr auf und entschuldigt sich schon wieder für die Störung. Nun nimmt er ein Blatt zur Hand, und von Weitem erkennt sie das Logo des Labors darauf. Die Analysen hätten nichts Besonderes mehr ergeben, erklärt er ihr so leise, dass sie ein zweites Mal fragen und sich nun selber auch leicht vorbeugen muss. Sie sei also völlig gesund und brauche sich keine Sorgen zu machen, ergänzt er lächelnd, steht auf und reicht ihr bereits die Hand zum Abschied. Sie drückt sie, lächelt zurück, ohne sich ihre Enttäuschung anmerken zu lassen, und geht zur Tür, die er ihr galant aufhält. Nein, so kann das nicht enden, denkt sie noch. Das ist ihr zu wenig dramatisch, und die ganze Wartezimmerromantik war ja völlig für die Katz. Sie müsste sich etwas Besseres einfallen lassen, aber was denn? Da hört sie es schon wieder klingeln, sein Telefon, langsam geht ihr das auf den Wecker, denn diesmal wird es sogar immer lauter und richtig unangenehm. Nur raus hier, fährt es ihr plötzlich durch den Kopf, und endlich erwacht sie und bringt den nervtötenden Wecker zum Verstummen.
Das erste Mal
Er hat ein nettes Lächeln, denkt sie, geradezu einladend. Selbstvertrauen strahlt er auch aus. Klar, ein Mann in diesem Alter hat gewiss jede Menge Erfahrung. Übrigens ist sie ja genau deshalb zu ihm gekommen, weil eine ihrer Freundinnen ihn ihr empfohlen hatte. Sie hatte lange darüber nachgedacht und sich schliesslich dazu aufgerafft, ihn anzurufen, und nun ist sie hier mit ihm und teilt diese erzwungene, künstliche Intimität mit jemandem, der ihr gefällt, aber den sie nicht kennt.
«Alles in Ordnung?», fragt er sie und blickt ihr in die Augen.
Sie fühlt sich eingeschüchtert, schaut auf ihre Hände hinunter, die nervös am Saum ihres T-Shirts kneten, und antwortet mit unsicherer Stimme.
«Ja, ja, alles bestens. Danke.»
Er ist ein einfühlender Typ, tätschelt ihre eiskalte Hand und stellt fest:
«Es ist also das erste Mal, nicht?»
«Ja, leider», sie schafft es gerade noch zu einer Antwort, obwohl sie beinahe von Gefühlen überwältigt wird, die sie vergeblich zu unterdrücken sucht.