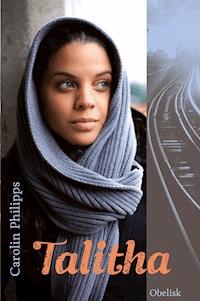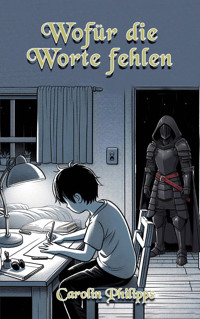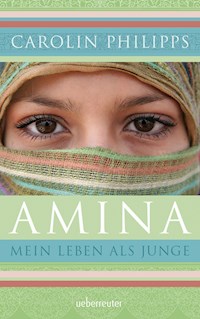Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ueberreuter Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn der Sturm naht, bleibt dir nicht mehr viel Zeit: Doch kannst du deinem Schicksal wirklich entkommen? Mitten im Südpazifik liegt die Inselgruppe Tuvalu. Dort lebt die 15-jährige Tahnee mit ihrer Familie. Sie ernähren sich von den Fischen aus der Lagune und von den Kokosnüssen, die vor dem Haus wachsen. Doch nun ist ihr Leben auf der Insel bedroht. Jedes Jahr von November bis April fegen Taifune über das Meer, die meterhohe Wellen verursachen. Sie zerstören die Häuser und lassen die Erde salzig und unbrauchbar werden. Eines Tages beschließt der Vater, mit der Familie auszuwandern. Tahnee hingegen möchte lieber bleiben … Ein spannender und hochaktueller Roman über ein Zuhause, das vom Untergang bedroht ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Mitten im Südpazifik liegt die Inselgruppe Tuvalu. Dort lebt die 15-jährige Tahnee mit ihrer Familie. Sie ernähren sich von den Fischen aus der Lagune und von den Kokosnüssen, die vor dem Haus wachsen. Doch nun ist ihr Leben auf der Insel bedroht. Jedes Jahr von November bis April fegen Taifune über das Meer, die meterhohe Wellen verursachen. Sie zerstören die Häuser und lassen die Erde salzig und unbrauchbar werden. Eines Tages beschließt der Vater, mit der Familie auszuwandern. Tahnee hingegen möchte lieber bleiben …
Ein spannender Klima-Roman!
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Anhang
1
Er kam am Abend, plötzlich und ohne Vorwarnung. Es gab nichts, was auf einen Sturm oder gar Monsterwellen hingedeutet hatte. Nicht einmal die talaalikis, die Rußseeschwalben, die beim Herannahen eines Zyklons über die Dörfer flogen und alle mit ihrem schrillen Schrei warnten, waren gesehen oder gehört worden. Auch das von der Regierung installierte Frühwarnsystem, das die Bewohner auf dem kleinen Atoll mitten im Südpazifik warnen sollte, war wieder einmal ausgefallen.
Urplötzlich war sie da: die erste der Monsterwellen, die jeden Sturm begleiteten. Aus einer Höhe von acht Metern trafen die Wassermassen auf die Palmen am Strand, die wie trockene Zweige umknickten, und überschwemmten die kleinen Wohnhäuser, die keine zwei Meter über dem Meeresspiegel lagen. Die Menschen schrien, stolperten und rannten durcheinander nach allen Seiten davon. Mütter und Väter umklammerten die Hände ihrer Kinder und zerrten sie mit sich fort. Wer stürzte, wurde vom Wasser überspült.
Welle auf Welle schwappte durch Fenster und Türen in die Häuser und dann weiter bis zur Lagune auf der anderen Seite der an vielen Stellen nur zehn Meter breiten Insel Nanumea. Häuser, Dächer, Bäume, alles flog durch die Luft oder wurde im Wasserstrudel davongerissen.
Tahnee saß eng aneinandergedrängt neben ihren Eltern, ihrer Schwester Nouma und ihren zwei jüngeren Brüdern in der Kirche. Sie waren rechtzeitig vor dem immer stärker werdenden Sturm geflüchtet, nachdem ein umherfliegendes Wellblechdach auf der Terrasse ihres Hauses gelandet war.
Tahnee hörte von draußen das laute Knacken der Bäume, die der Sturm zu Boden warf. Immer wieder wehte der Wind auch die verzweifelten Schreie der Menschen herein, die es nicht mehr geschafft hatten, sich in der Kirche in Sicherheit zu bringen. Ängstlich schaute sich Tahnee um und seufzte dann erleichtert auf, als sie ihren älteren Bruder Petala hinten in der Kirche neben seinen Freunden stehen sah.
Stürme und Monsterwellen gehörten zu Tahnees Leben dazu wie der Regen und die Sonne. Und doch war es jedes Mal aufs Neue schrecklich, weil es jedes Mal Verletzte oder sogar Tote durch umfallende Bäume und zusammenstürzende Häuser gab und Freunde, Nachbarn oder Verwandte mit einer Welle ins Meer gespült wurden und manchmal für immer verschwanden.
Tahnee drückte ihren weinenden kleinen Bruder Tupou an sich. »Du brauchst keine Angst zu haben«, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Hier kann uns nichts passieren. Hier sind wir in Sicherheit.« Hoffentlich, dachte sie. Aber bislang hatte die Kirche, die das einzige Gebäude aus Stein auf dem Atoll war, noch jeden Sturm überstanden.
Die Regentropfen schlugen auf das Dach wie harte Trommelschläge. In der Kirche war es dunkel. Wahrscheinlich hatte das Wasser auch die Solaranlage der Insel überschwemmt. Es würde wieder Tage oder sogar Wochen dauern, bis die Anlage repariert werden konnte und sie wieder Strom und damit Licht hatten.
Die Erwachsenen flüsterten leise, einige Kinder waren erschöpft eingeschlafen, andere weinten.
Die Stimme des Pastors, der vorne auf der Kanzel einige Kerzen angezündet hatte, hallte durch den Raum. »Gott sandte die Flut zur Erde, weil die Menschen seine Gebote nicht befolgt hatten. Alle ertranken. Nur Noah und seine Familie wurden gerettet, weil er rechtschaffen war.« Tahnee lauschte wie alle anderen den tröstenden Worten des Pastors so aufmerksam, als würde er etwas Neues verkünden. Dabei kannten sie alle die Geschichte aus der Bibel über Noah, die große Flut und die Arche auswendig. Es war diese Geschichte, die ihnen den Mut gab, nicht zu verzweifeln: Wer die Gebote Gottes beachtete, musste sich keine Sorgen machen.
»Als Gott sah, was er angerichtet hatte«, fuhr der Pastor fort, »versprach er Noah und durch ihn allen Menschen, dass nie wieder eine Flut alles zerstören würde. Und zum Zeichen dafür schickte er einen Regenbogen. Darum fürchtet euch nicht. Gott wird helfen … Gott wird helfen …«
Die Menschen in den Bänken fielen in seinen Sprechgesang ein: »Gott wird helfen!« Immer schneller, immer lauter wurden sie, bis die Worte den Regen und das Sausen des Windes übertönten, den ganzen Kirchenraum ausfüllten und dann plötzlich abbrachen.
In die Stille hinein begann Tahnees Mutter zu singen, andere Frauen aus ihrem Kirchenchor fielen ein. Schließlich sangen alle, Stunde um Stunde gegen die Angst. Auch Tahnee sang, bis sie heiser war. Tupou schlief friedlich auf ihrem Schoß.
Irgendwann wurde es ruhig in der Kirche. Auch Tahnee war eingeschlafen und wachte erst wieder auf, als ihre Mutter sie an der Schulter schüttelte. »Es ist vorbei!«, sagte sie.
Draußen schien die Sonne, ein leichter Wind wehte winzig kleine Wellen ans Ufer und der Himmel war wolkenfrei, so als hätte es die letzte Nacht nicht gegeben.
Gemeinsam mit den anderen machte Tahnee sich auf den Weg nach Hause durch kniehoch stehende Pfützen, in denen das Meerwasser in schlammigen Blasen aus dem Boden quoll, vorbei an umgestürzten Kokospalmen, die einige der Häuser beim Fallen zerdrückt hatten.
Ihr Haus stand noch, aber das Wellblechdach war davongeflogen, die Regentonne mit dem kostbaren Wasser umgekippt. Der Vorrat an getrockneten Kokosnussschalen an der Feuerstelle vor dem Kochhaus war durchgeweicht, sodass sie mit dem Kochen warten mussten, bis die Sonne die Schalen getrocknet hatte. Im Haus war alles nass und durcheinandergewirbelt worden.
Tahnee seufzte. Die Aufräumarbeiten würden wieder mehrere Tage dauern. Während ihr großer Bruder Petala und der Vater sich auf die Suche nach dem Wellblechdach machten, half Tahnee der Mutter im Haus.
Sie arbeiteten schweigend, jede wusste genau, was zu tun war. Es war nach jedem Sturm dasselbe. Auch ihre Gedanken gingen in die gleiche Richtung: Wie ging es den anderen aus der Familie? Den Großeltern, Onkeln und Tanten, Cousins und Cousinen und ihren Familien, die in den Dörfern auf den drei anderen bewohnbaren Inseln des Atolls lebten. Das Telefonnetz war kaum ausgebaut, kaum einer der sechshundert Einwohner von Nanumea besaß einen Anschluss und so gab es keine Möglichkeit, sie schnell zu erreichen.
»Hoffentlich ist niemand schwer verletzt«, meinte die Mutter leise und seufzte. Das einzige Krankenhaus des gesamten Inselstaates Tuvalu, zu dem Nanumea gehörte, befand sich in in der Hauptstadt auf dem vierhundertsechzig Kilometer entfernten Atoll Funafuti. Eine Flugverbindung gab es nicht und das nächste reguläre Schiff lief Nanumea erst in drei Wochen an. So blieb nur die kleine Krankenstation, die aber Schwerverletzte nicht versorgen konnte.
»Sie hätten Boten geschickt, wenn einer von ihnen verletzt wäre.« Tahnee umarmte ihre Mutter. Sie wusste genau, woran sie dachte. Es waren diese Bilder im Kopf, die nach jedem Sturm wie ein immer wiederkehrender Albtraum zurückkamen: Kurz nach Tahnees Geburt hatte eine Monsterwelle die jüngste Schwester ihrer Mutter gegen einen Baum geschleudert. Das Rettungsschiff konnte wegen des Sturms und des hohen Seegangs nicht aus dem Hafen der Hauptstadt auslaufen, doch es wäre ohnehin zu spät gekommen.
Auf Nanumea, der Hauptinsel des Atolls, auf der Tahnees Dorf lag, hatte es zum Glück diesmal keine Toten gegeben, nur einige leicht Verletzte. Sie hatten es alle überlebt, aber die Angst vor dem nächsten Sturm, der so sicher kommen würde wie Ebbe und Flut, blieb und wurde mit jedem Sturm größer.
2
»Der große Kokosnussbaum ist auf Großmutters Haus gefallen!« Mit dieser Nachricht kam Petala am Tag nach dem Sturm aus Lakena zurück. Der Vater hatte ihn auf die kleine Insel am Rande der Lagune geschickt, um zu sehen, wie es den Eltern von Tahnees Mutter und der Familie ihres Bruders ergangen war.
Die Mutter schrie erschrocken auf.
»Sie lebt«, beruhigte Petala sie, »Onkel Wawe hat vorgeschlagen, dass Großmutter zu ihm zieht, aber sie will einfach nicht.«
»Das verstehe ich nicht!«, sagte Tahnee. »Warum soll sie denn zu Onkel Wawe ziehen? Warum baut ihr das Haus nicht einfach wieder auf? Das habt ihr sonst auch immer gemacht! Was sagt Großvater denn dazu? Soll der auch umziehen? Das wird er bestimmt nicht machen!«
Petala schwieg und schaute erst die Mutter, dann den Vater an. »Großvater ist vor zwei Tagen zum Fischen aufs Meer gefahren …«
Entsetzt starrten ihn alle an.
»Er … er ist nicht zurückgekommen … noch nicht. Ich meine … er ist vielleicht auf einer Insel gestrandet …« Petala versuchte verzweifelt, seiner Nachricht das Schreckliche zu nehmen. »Vielleicht hat er den Sturm kommen sehen und hat sich in Sicherheit gebracht …«
»Hoffen wir das Beste!«, meinte der Vater. »Aber wir alle wissen doch, dass es da draußen weit und breit keine Inseln gibt!«
Tahnee hatte mit weit aufgerissenen Augen und starr vor Entsetzen zugehört. Doch plötzlich schob sie ihren Bruder beiseite und rannte aus dem Haus, die Treppe hinunter mitten in eine Riesenpfütze hinein.
Das Wasser spritzte nach allen Seiten. Um sie herum kreischten ihre beiden jüngeren Brüder mit ihren Freunden vor Freude, hüpften in der Pfütze herum und bespritzten sie. Sie schubste sie aus dem Weg und rannte weiter bis zu einem kleinen Seitenpfad, der zur Lagune führte. Hier am Ufer lag ihr Kanu.
Tahnee stieg ein und paddelte, so schnell sie konnte, in die Mitte der Lagune. Dort setzte sie ihr Segel. Sie musste sich beeilen. Wenn die Sonne unterging, würde es schlagartig dunkel werden. Dann war es zu gefährlich, noch bis zur Großmutter nach Lakena zu segeln. Außerdem hatte die Ebbe schon eingesetzt und bald würden überall in der Lagune kleine Felsen aus Korallen herausragen, die man bei Nacht leicht übersah.
Der Wind war günstig und sie kam gut voran. Trotzdem ging die Sonne unter, bevor sie auch nur die halbe Strecke geschafft hatte. Sie holte aus ihrem Boot eine Lampe, band sie sich um den Kopf und segelte vorsichtig weiter, angestrengt auf das dunkle Wasser blickend.
Wenn der Lichtschein auf einen Schwarm fliegender Fische traf, flogen sie erschrocken hoch. Einige der silbrigen Fische landeten sogar in ihrem Boot.
Tahnee musste an ihren Großvater denken, der ihr das Auslegerkanu mit Segel vor sieben Jahren zu ihrem achten Geburtstag aus einem Brotfruchtbaum geschnitzt und ihr das Segeln beigebracht hatte.
Mädchen bekamen eigentlich kein Boot, sie fuhren auch nicht zum Fischen aufs Meer. Aber dem Großvater war das egal. Er nahm sie sogar manchmal mit zu seinen Nachtfahrten, bei denen er auf die andere Seite des Korallenriffs fuhr, um fliegende Fische zu fangen.
In diesen Nächten musste es stockdunkel sein, auch der Mond durfte nicht scheinen. Auf dem Motorboot befanden sich dann neben Tahnee und ihrem Großvater meist noch zwei weitere Männer aus dem Dorf. Großvater steuerte, während ein anderer am vorderen Ende des Bootes hockte – ausgestattet mit einem großen Netz und einem Helm mit einer starken Lampe. Der dritte saß in der Mitte des Bootes, ebenfalls mit einem Netz in der Hand.
Tahnee kauerte auf dem Boden des Bootes und klammerte sich fest, während das Boot durch das Wasser flog. Die Lampe erschreckte die Fische, sodass sie in Scharen aus dem Wasser flogen, um dem Lichtkegel auszuweichen.
Mit den Netzen wurden die fliegenden Fische eingefangen und auf den Boden des Bootes geworfen. Schon nach kurzer Zeit war Tahnee von zappelnden silbrigen Fischen umgeben. Manchmal landete auch einer mitten in ihrem Gesicht. Die schönsten Momente waren die, wenn Delfine auftauchten, um mitzujagen. Große, graue Schatten, die leise durch das Wasser flogen, dann in die Luft sprangen und dabei laut pusteten.
Großmutter aber sah es nicht gerne, wenn Großvater sie mitnahm. Bei hohen Wellen konnten auch die besten Fischer leicht die Orientierung verlieren, da die Inseln sehr flach waren und nur wenige Meter aus dem Meer herausragten. Oder wenn dichte Wolken die Sonne oder die Sterne versteckten, mit deren Hilfe schon ihre Vorfahren über Tausende Kilometer ihren Weg durch das Meer gefunden hatten.
Tahnee hatte das Lachen ihres Großvaters noch in den Ohren, mit dem er jedes Mal auf die Ängste seiner Frau antwortete. »Was soll schon passieren?«, sagte er. »Es gibt keinen auf der Insel, der das Meer besser kennt.«
»Aber das Meer hat sich verändert«, erwiderte Großmutter dann. »Die Natur ist nicht mehr unser Freund. Wir verstehen sie nicht mehr so wie früher.«
Großvater nickte dann immer. Er wusste, dass sie recht hatte. »Aber was soll ich machen? Wir brauchen den Fisch zum Leben. Ich fahre ja nicht zum Vergnügen hinaus. Und Tahnee fährt zum Lernen mit, damit sie mir später helfen kann. So etwas lernt sie nicht in der Schule.«
Tahnee hatte keine Angst. Sie vertraute ihrem Großvater, der der beste Bootsführer auf dem ganzen Atoll war. Doch nicht nur das: Neben ihrer Großmutter war es der Großvater, zu dem sie die engste Beziehung hatte. Nach dem Tod von Tahnees Tante hatten die Eltern Tahnee, die gerade erst ein Jahr alt war, nach Lakena gebracht, damit sie, wie es Tradition war, ihre Großeltern über den Verlust ihrer eigenen Tochter hinwegtrösten sollte. Sie war bei ihnen aufgewachsen, bis sie wie viele Schüler Nanumeas mit 14 Jahren auf die Internatsschule nach Vaitupu kam, einer 345 Kilometer entfernten Insel, um dort die weiteren Klassen zu besuchen.
Und jetzt war der Großvater irgendwo da draußen auf dem weiten Meer verschwunden. Tränen liefen Tahnee über das Gesicht. Sie wollte so gerne glauben, was Petala gesagt hatte, aber sie wusste auch, dass es nach einem solchen Sturm mit Monsterwellen keine große Hoffnung mehr gab.
Endlich hatte sie Lakena erreicht. Sie zog ihr Boot ein Stück den Strand hinauf, in sicherer Entfernung zum Haus ihres Onkels Wawe, das am Rande des Dorfes lag. Sonst führte ihr erster Weg immer dorthin. Sie wusste, dass sie willkommen wäre und zum Essen eingeladen würde. Aber sie wusste auch, dass er sie dann im Dunkeln nicht mehr zu ihrer Großmutter lassen würde, die eine halbe Stunde Fußweg entfernt am anderen Ende der Insel lebte.
Der einzige Weg dorthin verlief mitten durch das Dorf und dann weiter durch den Dschungel. Überall vor den Häusern flackerten die Holzkohlefeuer, sie hörte die lachenden Stimmen von Menschen, die beim Essen zusammensaßen. Nur einige Hühner und Schweine liefen noch herum.
Eine Straßenbeleuchtung gab es auf Lakena nicht und zum Glück schien auch der Mond nicht, sodass Tahnee unbemerkt durch das Dorf schleichen konnte.
Nachdem sie das letzte Haus passiert hatte, schaltete sie ihre Lampe wieder ein. Vorbei an Brotfrucht-, Pandanusbäumen und Kokosnusspalmen führte der Sandweg ins Innere der Insel. Etwas weiter Richtung Südstrand stand das Haus der Großeltern, das noch ganz im traditionellen Stil auf Pfählen und mit einem Dach aus Pandanusblättern gebaut war. Es war nach allen Seiten offen, sodass der Wind hindurchwehen konnte. Das machte das Leben bei großer Hitze angenehmer als in dem Haus aus Zement und Wellblech, das der Vater vor einigen Jahren für die Familie auf Nanumea gebaut hatte. Am Dach waren kunstvoll geflochtene Matten befestigt, die man herunterlassen konnte, um Schatten zu bekommen und den Regen abzuhalten.
So hatte das Haus zumindest bei ihrem letzten Besuch vor einer Woche noch ausgesehen. Jetzt lag einer der großen Kokosnussbäume, die das Haus umgaben, quer über dem Dach und hatte es unter seinem Gewicht zerdrückt. Die dicken Holzbalken waren zersplittert, als wären sie dünne Zweige, die Plattform, auf der das Haus gebaut war, lag in mehrere Teile zerbrochen darunter.
Tahnee stand für einen Moment regungslos da. Es war alles noch schlimmer als erwartet. Von dem Haus, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte, war nicht viel übrig geblieben. Es würde ein neues Haus gebaut werden, vielleicht sogar größer und schöner als das alte, nur ohne die vielen Erinnerungen, die in jeder Ecke des alten Hauses gewohnt hatten.
3
Die Großmutter stand allein an der Feuerstelle vor der Kochhütte und rührte in einem ihrer großen Töpfe. Als sie Tahnee sah, lächelte sie. »Ich wusste, dass du kommen würdest«, sagte sie und umarmte Tahnee.
Früher hatte es Tahnee manchmal erschreckt, wenn die Großmutter Dinge zu wissen schien, die sie eigentlich gar nicht wissen konnte. Sie besaß die Kraft ihrer Vorfahren, in die Zukunft zu sehen.
Tahnee klammerte sich an ihre Großmutter und fing an zu weinen. Lange standen sie da, fest umschlungen, bis Tahnee sich losmachte. Schließlich war sie hergekommen, um die Großmutter zu trösten. »Morgen kommen sicher auch Vater und Petala, um dein Haus wieder aufzubauen«, sagte sie, während sie sich die Tränen aus dem Gesicht rieb.
Großmutter nickte. »Gut so. Ich hoffe, auch dein Onkel Wawe und die Leute vom Dorf werden kommen, damit es schneller geht. Denn ich werde hierbleiben. Hier ist mein Zuhause, auch wenn Großvater nicht mehr zurückkommt.«
Tahnee schluckte. Dann riss sie sich zusammen und versuchte, sich und ihrer Großmutter Mut zu machen. »Er kennt das Meer und vielleicht befindet er sich längst an Bord eines dieser großen Fischfangboote. Er …«
Die Großmutter schaute sie an. »Wir wissen doch beide, dass sein Boot nur eine winzige Kokosnussschale war, mitten in den Wellen, so hoch wie der Kirchturm in eurem Dorf«, sagte sie leise. »Aber du hast recht, man soll die Hoffnung nie aufgeben.«
Schweigend saßen sie anschließend am Feuer und aßen Großmutters paw paw, ein Bananenbrei, der hier bei ihr am besten schmeckte.
»Lass uns schlafen gehen«, meinte die Großmutter nach dem Essen. »Die Männer werden morgen sehr früh hier sein und wir müssen die Mahlzeiten für sie vorbereiten.«
Sie hatte bereits einige der Schlafmatten aus dem zerstörten Haus in die Kochhütte getragen und so schliefen sie eng aneinander gekuschelt auf dem Boden ein.
Am nächsten Morgen wachte Tahnee vom Gegacker der Hühner auf, die draußen frei herumliefen. Die Großmutter bereitete vor der Kochhütte das Frühstück vor und graue Rauchwolken zogen zu Tahnee herüber. Tahnee sprang auf, schöpfte Wasser aus dem Eimer neben der Regentonne und wusch sich das Gesicht.
Dann nahm sie eine der leeren Kokosnussschalen und kletterte auf den Kokosnussbaum neben dem Haus, so wie sie das seit Jahren jeden Morgen machte, wenn sie hier war. Großvater hatte Stufen eingeschnitzt, sodass Tahnee schnell vorankam bis zur Spitze in zehn Metern Höhe. Dort hing eine ausgehöhlte Kokosnussschale, die den toddy genannten weißen, dickflüssigen Saft aus der eingeritzten Rinde auffing. Großmutter machte daraus Marmelade oder, wenn er gegoren war, Palmwein für die Erwachsenen.
Nach einem schnellen Frühstück, zu dem es neben den Resten vom gestrigen Abendessen Großmutters neuen Lieblingssalat aus Tomaten und Zucchini gab, machten sie sich auf den Weg zum Grundstück der Familie.
Jede Familie auf dem Atoll besaß hier auf Lakena ein Grundstück mit Obstbäumen und pits, riesigen mit kompostierter Erde aufgefüllten Gruben. Sie waren über Generationen ausgeschachtet worden bis zur Süßwasserlinse hinunter, die unterhalb der Insel lag, und waren der kostbarste Besitz einer Familie. In diesen pits wurden Taro und Pulakaknollen angepflanzt, die zu jeder Mahlzeit gehörten.
Als Tahnee und ihre Großmutter die pits erreichten, trafen sie auf Tahnees Urgroßonkel, der mit seinem Sohn Malaki gekommen war, um ebenfalls beim Hausbau zu helfen.
Tahnee zuckte zusammen, als Malaki so plötzlich vor ihr stand. Seit dem Sturm war nicht eine Minute vergangen, in der sie nicht an ihn gedacht hatte. Ging es ihm gut? Hatte er sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können? Und nun stand Malaki da und lächelte sie an. Am liebsten wäre sie zu ihm gelaufen und hätte ihn in den Arm genommen. Malaki, der das wohl ahnte, schüttelte warnend seinen Kopf. Darum nickte sie ihm nur kurz zu und begrüßte dann ihren Urgroßonkel, der aufgeregt auf die Großmutter einredete und sie kaum beachtete.
»Das Wasser in den pits ist salzig geworden. Salzig wie das Meer!«, sagte er.
»Es ist immer ein bisschen salzig. Die Pulakas vertragen das«, meinte Großmutter.