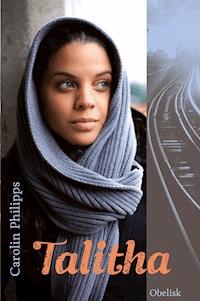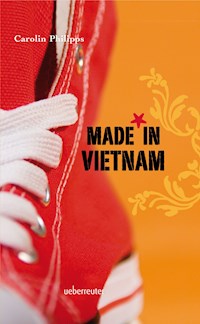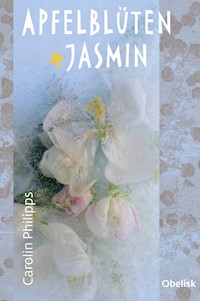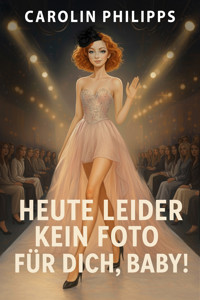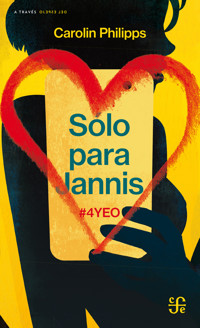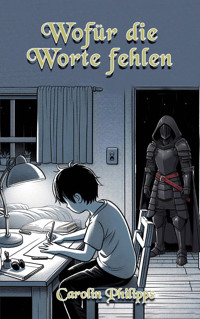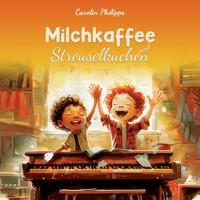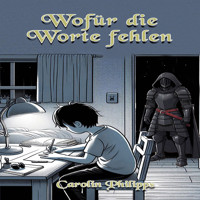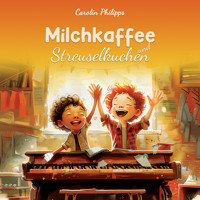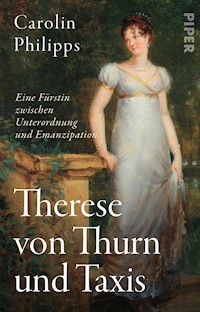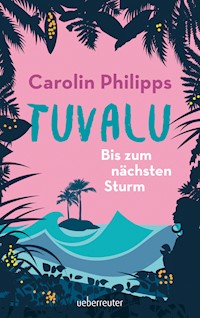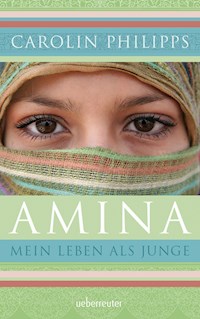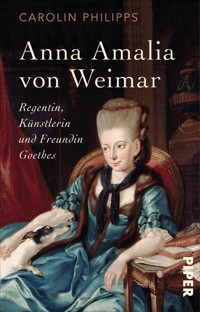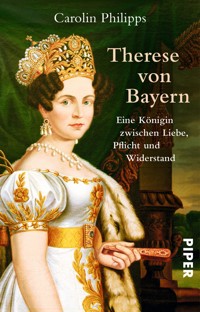
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Fünf Tage lang feierten die Bayern im Jahr 1810 die Hochzeit Therese von Sachsen-Hildburghausens mit Kronprinz Ludwig. Doch das Eheglück währte nur kurz. Der bayerische Thronfolger verehrte Therese in seinen Gedichten zwar als Ideal einer Frau, demütigte sie jedoch durch seine zahlreichen Affären – bis schließlich Ludwigs Affäre mit Lola Montez beide die Krone kostete. Das Volk jedoch stand immer zu seiner Königin, die für jeden Hilfesuchenden ein offenes Ohr hatte. Carolin Philipps Nachforschungen zeigen den Weg einer Frau, die unerfahren und ängstlich an den Münchener Hof kam, an ihren Aufgaben wuchs und schließlich ihre gesellschaftliche Macht aufs Klügste ausspielte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meinen Vater ( 1925–2012 ), der dieses Buch nur noch in seinen Anfängen begleiten konnte
ISBN 978-3-492-97163-8
Februar 2017
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: akg images
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Menschen treten in unser Leben undbegleiten uns eine Weile.Einige bleiben für immer,denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.
Prolog
»Und nun entscheide, theurer Ludwig, überzeugt seyend, daß Dein Ausspruch mir Gesetz.«1
So und ähnlich enden unzählige Briefe Thereses an König Ludwig I. Seit ihrer Hochzeit im Oktober 1810 hing ihr Schicksal von einem Mann ab, den sie zwar liebte und von ihm auf seine Weise ebenfalls geliebt und verehrt wurde, den sie aber auch wegen seiner Wutausbrüche und Misshandlungen fürchtete.
Sanftmut und Liebenswürdigkeit bescheinigten Therese alle, die sie kannten. Tugendhaftigkeit, Pflichtbewusstsein und ein starker Glaube an einen Gott, der auch in der größten Not die Hand über sie hielt, prägten ihren Lebensweg. Dass sie für ihren Mann eine kompetente Beraterin in politischen Fragen war, ist ein hartnäckiges Gerücht, das aber den Tatsachen nicht standhält. Nach der Auswertung von Tausenden von Briefen Thereses an ihren Mann und an ihre Kinder, die im Geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher in München liegen, lässt sich feststellen, dass ihre Einflussnahme sich nur auf den familiären Bereich bezog. Zu mehr war sie durch ihre Vorbildung, ihre Interessen und auch die Beratungsresistenz ihres Mannes nicht in der Lage. Sie war erzogen worden, zu einer vollkommenen Ehefrau und Mutter möglichst vieler männlicher Nachkommen zu werden, und diese Rolle hat sie perfekt ausgefüllt.
Im März 1847 aber kam der Moment, wo sie aus dieser Rolle heraustrat, als ihr Mann nämlich verlangte, dass sie seine Geliebte Lola Montez, von Ludwig zur Gräfin erhoben, bei Hofe empfangen und sie damit gesellschaftsfähig machen sollte. »Ich bin es meiner Frauenehre schuldig – die mir teurer als daß Leben – diejenige welcher Du eine Standeserhöhung verliehen, nie – und unter keinen Bedingungen, von Angesicht zu Angesicht zu sehen«, schrieb sie ihm.2
Die sanftmütige Königin, die sich widerspruchslos den Anordnungen ihres Mannes unterwarf, die seine früheren Affären schicksalsergeben ertragen hatte, setzte sich an die Spitze des passiven Widerstands der ganzen Gesellschaft gegen den König und seine Mätresse. Ein Widerstand, der letztendlich zum Rücktritt König Ludwigs führte und auch Therese den Thron kostete.
An Therese, die ihre Aufgabe als Königin in erster Linie als »Landesmutter« begriff, erinnern heute, neben der Wiese, auf der das jährliche Oktoberfest stattfindet, viele Schulen und soziale Einrichtungen in ganz Bayern, die ihren Namen tragen.
Therese von Bayern hat keine Kriege gewonnen, keine Lorbeeren auf dem diplomatischen Parkett errungen, aber sie hat Spuren in den Herzen der Menschen hinterlassen, die ihr begegneten.
Behütete Kindheit in kriegerischen Zeiten (1792 – 1809)
Geburt im Revolutionsjahr 1792
»Laß Segen und Gedeihen zum Wachstum der neugeborenen Prinzessin zufließen, damit sie ein bleibendes Denkmal Deiner Güte, zur Freude der Durchlauchtigsten Eltern und des ganzen Landes werde.«1
So beteten die Einwohner in den Kirchen der Stadt Hildburghausen in Thüringen am Morgen des 8. Juli 1792. Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen informierte noch am selben Tag die Verwandten in nah und fern: »daß meine zärtlich geliebte Gemahlin am 8. dieser Früh gegen 1 Uhr unter göttlichem Beystand mit einer gesunden und wohlgebildeten Prinzessin entbunden wurde.«2 Die Geburt hatte im nahe gelegenen Jagdschloss zu Seidingstadt, dem Sommersitz der Familie, stattgefunden. Die kleine Prinzessin war das sechste Kind ihrer Eltern im siebten Jahr ihrer Ehe.
Am 13. Juli 1792 wurde sie auf die Namen Therese Charlotte Louise Friederike Amalie getauft. Auch wenn die Schwestern der Herzogin Charlotte nicht als Paten aufgeführt sind, ist es wohl kein Zufall, dass die Namen der kleinen Prinzessin denen der Schwestern der Herzogin3 entsprachen, die zusammen mit ihr als die schönsten Frauen ihrer Zeit galten: Fürstin Therese von Thurn und Taxis, Königin Luise von Preußen, Friederike, die spätere Königin von Hannover. Es war eine Tradition, von Charlotte eingeführt, den Kindern die Namen der Geschwister zu geben, um die enge Verbundenheit mit ihnen zu demonstrieren.
Thereses Mutter Charlotte (1769 – 1818) war die älteste Tochter Karls von Mecklenburg-Strelitz und seiner Frau Friederike (1752 – 1782), einer geborenen Prinzessin von Hessen-Darmstadt. Nach einer Kindheit, geprägt von familiärer Geborgenheit in Hannover, starb ihre Mutter, als Charlotte zwölf war. Ihre Stiefmutter Friederike, eine Schwester der Mutter, kümmerte sich liebevoll um sie. Die bis dahin fünf Geschwister hingen zeit ihres Lebens mit einer besonderen Zärtlichkeit aneinander. Umso größer war der Schock, als im Juni 1785 ein Schreiben von Prinz Joseph aus Hildburghausen eintraf, in dem er für seinen Neffen um die Hand der 15-jährigen Charlotte anhielt.
Es sollte eine der damals üblichen arrangierten Ehen aus dynastischen Gründen werden. Karl von Mecklenburg-Strelitz war ein liebevoller Vater, aber er hatte vier Töchter, die es alle standesgemäß zu verheiraten galt. Hatte Charlotte eine Chance, den Antrag abzulehnen? Wir wissen, dass Karl von Mecklenburg-Strelitz keine seiner Töchter gegen ihren ausgesprochenen Willen verheiratet hätte. Am Ende siegte aber auch bei Charlotte das Pflichtgefühl, den Wünschen des Vaters zu entsprechen, über die Angst vor der Zukunft mit einem ihr fremden Mann in einem fernen Land, 350 Kilometer entfernt von der alten Heimat. Als einzige Vertraute begleitete sie ihre alte Erzieherin, Magdalena von Wolzogen, als neue Oberhofmeisterin. Durch alle ihre Briefe an den Vater und die Geschwister zieht sich zeitlebens die Sehnsucht nach ihrer Ursprungsfamilie.
Thereses Vater Friedrich von Sachsen-Hildburghausen (1763 – 1834) war der einzige Sohn des Herzogs Ernst Friedrich III. Carl von Sachsen-Hildburghausen (1727 – 1780) und dessen dritter Gemahlin Prinzessin Ernestine Auguste Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach (1740 – 1786). Er durchlief die übliche Erziehung eines Erbprinzen, den es auf die spätere Regentschaft vorzubereiten galt. Als sein Vater 1780 starb, erbte Friedrich ein immer noch hoch verschuldetes Fürstentum. Sein Urgroßonkel Joseph (1702 – 1787) übernahm seine Vormundschaft, auf ausdrücklichen Wunsch Friedrichs auch noch nach 1784, dem Jahr seiner Volljährigkeit, bis zu Josephs Tod im Jahr 1787, da sich Friedrich mit der Regierung überfordert fühlte.
Auch für Prinz Friedrich war es natürlich eine arrangierte Heirat, seine Braut kannte er nur von dem Miniaturbild, das ihm zugeschickt worden war. Die Hochzeit fand am 3. September 1785 statt. Das Schloss, in das Charlotte einzog, lag am Rande der Stadt, die seit 1680 Residenz der Fürsten von Sachsen-Hildburghausen war und um 1810 ca. 3500 Einwohner hatte. Die Ausstattung des Schlosses soll sehr prunkvoll gewesen sein. Vor dem Gebäudekomplex erstreckte sich der Schlossgarten mit mehr als fünf Quadratkilometern Grundfläche. Das gesamte Schlossterrain war bis 1826, als der Hof nach Altenburg umzog, für die übrige Bevölkerung gesperrt, die Tore waren durch Wachen gesichert.4
Das Geburtsjahr Thereses 1792 stand ganz im Bann der revolutionären Ereignisse in Frankreich, von denen sich alle großen und kleinen Herrscher im übrigen Europa bedroht fühlten. In Paris hatte sich das Volk im Sommer 1789 gegen seinen König erhoben, ausgelöst durch den Plan Ludwigs XVI., neue Steuern zu erheben. Am 26. August 1789 hatte die neue Nationalversammlung die Erklärung der Menschenrechte nach dem Vorbild der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. Der zentrale Satz im Artikel 1, dass alle Menschen gleich geboren und mit gleichen Rechten ausgestattet seien, bedeutete das Ende der alten Ständeordnung, die auf der sozialen Ungleichheit der Menschen aufgebaut war. Im September 1791 wurde eine neue Verfassung angenommen. Nach dem Willen des Volkes sollte niemals wieder ein einziger Mensch die ganze Macht im Staate haben. Über allen, auch über dem König, der nach wie vor die Regierung als Teil der Exekutive anführen sollte, standen die Gesetze. Brach er sie, konnte er, wie jeder andere auch, zur Rechenschaft gezogen werden.
Ein Schrei des Entsetzens ging durch die europäischen Fürstenhäuser, als diese Nachrichten verbreitet wurden. Vor allem die Behandlung der Königsfamilie löste ungläubige Empörung aus. Thereses Vater sah sich, wie auch sein Schwiegervater und die meisten Fürsten, als väterlicher Beschützer seiner Untertanen. Protest, Auflehnung und gar ein Recht auf Widerstand waren gleichbedeutend mit der Umkehr der natürlichen gottgegebenen Ordnung.
Die Herrscher von Österreich und Preußen versuchten zunächst durch Appelle und Drohungen die Monarchie in Frankreich zu retten. Die Franzosen nahmen diese Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten aber sehr übel und erklärten im April 1792 den übrigen Mächten den Krieg. Am 20. August wurden der französische König Ludwig XVI. und seine Familie im Temple gefangen gesetzt, am 25. September schaffte die Nationalversammlung die Monarchie ab, Frankreich wurde Republik.
Kurze Zeit später marschierten die französischen Truppen in Mainz und Frankfurt ein, um ihre Republik mit dem Schlachtruf »Krieg den Palästen, Friede den Hütten« gegen das monarchische Europa zu verteidigen. Der französische König wurde in einem Scheinprozess, bei dem das Ergebnis schon vorher feststand, zum Tod durch die Guillotine verurteilt, ebenso wie seine Frau Marie Antoinette, die Kinder blieben noch jahrelang im Gefängnis.5
Hildburghausen wurde vom eigentlichen Kriegsgeschehen zunächst nur am Rande gestreift. Die Regierung Herzog Friedrichs wurde zu diesem Zeitpunkt von niemandem infrage gestellt. Von den Schrecken der Zeit dürfte Therese aber später durch die Erzählungen der Mutter und ihrer Tanten und Onkel erfahren haben, denn die Familie ihrer Mutter war persönlich mit Marie Antoinette bekannt und die Geschwister ihrer Mutter waren mit der Großmutter drei Monate nach Thereses Geburt auf der Flucht vor den französischen Truppen aus Darmstadt nach Hildburghausen geflohen, wo sie für einige Monate Asyl erhielten.
In späteren Jahren gab es immer wieder Truppendurchmärsche und Einquartierungen in Hildburghausen, auch musste das Herzogtum als Mitglied des Rheinbundes Napoleon Soldaten stellen, aber im Vergleich zu Charlottes Schwestern, die auf der Flucht vor den französischen Truppen quer durch Europa reisten, verlief das Leben der Herzogsfamilie eher in ruhigen Bahnen. Herzogin Charlotte beschreibt selbst Anfang 1808 ihr Leben in einem Brief an ihren Vater noch so: Zurückgekehrt von einem Ball, den die Herzogin von Sachsen-Meiningen gegeben hat, »sind wir wieder hier, im alten, gewöhnlichen Laufe der Ordnung zurückgekehrt, wo ein Tag dem anderen ziemlich ähnlich, ruhig dahingleitet.«6
Erziehung einer Prinzessin
»… als einfache und bescheidene Blume erblühte sie in der Abgeschiedenheit im Refugium der Familie, in dieser frommen Zufluchtsstätte der häuslichen Tugenden …«1
So beschreibt eine von Thereses Töchtern, vermutlich ihre jüngste Tochter Alexandra, nach dem Tod der Mutter deren Kindheit und fügt hinzu, dass diese keinesfalls im Luxus aufgewachsen sei, wie man vielleicht vermuten könne. Dies hing natürlich vor allem mit den von der kaiserlichen Debitkommission verhängten Sparmaßnahmen zusammen, die die Regierungszeit Herzog Friedrichs überschatteten. Der äußere Prunk, den Thereses Mutter Charlotte bei ihrer Ankunft in Hildburghausen noch vorfand, wurde von Prinz Joseph aus seinem Privatvermögen finanziert und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem jungen Paar für seinen Haushalt nur ein stark begrenzter Etat zustand, was Charlotte zeit ihres Lebens bedauerte.
Immer wieder kam es zu Spannungen mit ihrem Mann, wenn Charlotte dadurch nicht an Unternehmungen ihrer Geschwister oder an einem Familientreffen mit dem Vater in Neu-Strelitz teilnehmen konnte. So schrieb sie am 13. März 1801 an ihren Bruder Georg, dass ihre Schwester Therese Pläne mache für »sich und auch für mich, die fast zu schön sind, um ausgeführt zu werden. Ach, das leidige Geld! Im Grunde ist es mir so wenig, aber in manchen Augenblicken doch viel!«2
Geschichten über den Geldmangel im Herzogshaus kursierten auch in der Bevölkerung. So erzählte man sich, dass die Hofküche manchmal »kein Fleisch erhalten konnte, weil die Lieferanten, bevor die alten Fleischrechnungen nicht bezahlt wären, nur gegen bares Geld abliefern wollten, oder wie ein ander Mal die Seife im Hofwaschhaus fehlte, oder wie ein Hofball, weil die ausgebrannten Kerzen nicht erneuert werden konnten, vor der Zeit geschlossen werden musste, oder wie sich die Dienerschaft aus Mangel an Licht im Dunkeln behelfen musste.«3
Wie viel Therese davon mitbekommen hat, wissen wir nicht genau, denn wirklicher Mangel herrschte im Schloss natürlich nicht. Allein der Hofstaat von Herzogin Charlotte und ihrer drei Töchter umfasste zum Beispiel 1805 zwölf Hofdamen, Kammerfrauen und Garderobemädchen sowie zwei Kammerdiener.4 Aber im Vergleich zu dem Luxus, der sie später als Kronprinzessin von Bayern erwartete, ging es auf dem Schloss zu Hildburghausen nach dem Tod von Prinz Joseph wohl eher bescheiden zu.
Thereses Erziehung stand ganz im Zeichen der Rolle, die sie später als Ehefrau eines Fürsten ausfüllen musste. Intellektuelle Bildung hatte dabei nicht die oberste Priorität. Auch eine Auseinandersetzung mit den aktuellen politischen Zuständen fand nur auf emotionaler Ebene statt, politische Zusammenhänge standen nicht auf dem Lehrplan – das zeigen auch ihre späteren Briefe. Ein Schwerpunkt ihrer Erziehung lag bei der Unterweisung im protestantischen Glauben. Im Mittelpunkt standen dabei weniger Fakten über Luther und die Reformation oder Kirchengeschichte, es ging vielmehr darum, durch das Lesen und Verstehen der Bibeltexte Vertrauen in die Güte Gottes und Ergebenheit in seinen Willen zu gewinnen und Wege für ein eigenes tugendhaftes Leben zu finden.
Thereses Lieblingsbuch war darum auch keinesfalls eine philosophische Abhandlung, sondern ein Religionsbuch mit dem Titel »Gumal und Lina«, das der Dekan der Predigerkirche zu Erfurt 1795 geschrieben hatte, um Kindern durch »eine sinnliche Darstellung die nützlichsten Begriffe und Kenntnisse« von der Religion beizubringen. Die Kernsätze, die sich darin finden, spiegeln sich auch in Thereses Glauben wider, so zum Beispiel, wenn eine der Figuren der Geschichte sagt: »Denn wer unter dem Schutz des Allmächtigen ist, der darf kein Unglück fürchten, der kann auch mitten in Gefahren getrost und frohen Muthes seyn.«5 Für Therese waren die Gebote der Bibel zeitlebens Richtschnur ihres Handelns. Sie hatte, wie auch ihre Mutter, einen sehr persönlichen Zugang zur Religion; ihre gelebte Frömmigkeit war ein wesentlicher Teil ihres Lebens. »Das Gebet und ›heilige Besinnungen‹ waren ihr zu allen Zeiten Zufluchtsort und Trost«, schreibt ihre Tochter dazu.6
Gelebte Frömmigkeit bedeutete für Therese auch Mildtätigkeit gegenüber den Armen. Hier lernte sie durch das Vorbild der Mutter, die jährlich die Hälfte ihres Einkommens für Bedürftige, Pensionen, Erziehungs- und Lehrlingskosten aufgewandt haben soll.7 Neben dem traditionellen Unterricht für Prinzessinnen in deutscher Literatur und französischer Sprache als Hofsprache war ein weiterer Schwerpunkt ihrer Erziehung der musisch-künstlerische Bereich. Herzogin Charlotte, die sich intensiv mit den Lehren des Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827), vor allem mit dessen ganzheitlichem Ansatz, beschäftigte, ließ ihre Söhne ein Handwerk lernen und ihre Töchter, die das Talent der Mutter geerbt hatten, auf musischem Gebiet fördern.
Herzogin Charlotte holte Musiker, Maler und Schriftsteller an den Hof, unter anderem die Dichter Jean Paul und Friedrich Rückert; im Hoftheater gastierten die bekanntesten Schauspieltruppen der Zeit. Auch die Herzogin selbst trat häufig zur Begeisterung ihrer Zuhörer auf der Bühne auf, ebenso Therese, wie ihre im Stadtmuseum ausgestellten Schuhe von der Aufführung des »Rotkäppchen« im Hildburghäuser Theater um 1800 bezeugen.
Familienleben zwischen Freude und Trauer
»Die Seele war gleichsam nur mechanisch beschäftigt«,1
schrieb Herzogin Charlotte am 13. Juli 1800 an ihren Bruder Georg in Neu-Strelitz über die Zeit nach dem Tod ihres fünfjährigen Sohnes Franz. Therese, die zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt war, erlebte mit, wie ihre Mutter nach dem Tod des Bruders schwer krank wurde. Sie erlebte auch die schwere Depression, in die ihre Mutter verfiel, als sie in Folge der Krankheit nicht mehr singen konnte.2
Die Geburt neuer Geschwister und ihr Tod, verbunden mit der Teilnahme an der Beerdigung, der wochenlangen Hoftrauer in schwarzer Kleidung und die Verzweiflung der Mutter gehörten zu Thereses Kindheit dazu. Charlotte gebar insgesamt zwölf Kinder, vier davon überlebten das erste Jahr nicht. Zu den überlebenden sieben Geschwistern hatte Therese ihr Leben lang eine sehr enge Beziehung, die ihr Zentrum im intensiven Familienleben mit der Mutter hatte: Da war ihre älteste Schwester Charlotte (1787 – 1847), die 1805 Paul von Württemberg (1785 – 1852) heiratete, der sich 1816 aber von ihr trennte, ein Ereignis, das auch Therese sehr betroffen hat. Es gab ihre Schwester Luise (1794 – 1825), die den Herzog Wilhelm von Nassau (1792 – 1839) heiratete und mit 31 Jahren starb. Ihr Bruder Joseph (1789 – 1868) trat 1834 die Nachfolge seines Vaters an. Schließlich gehörten die jüngeren Brüder Georg (1796 – 1853), Friedrich (1801 – 1870) und Eduard (1804 – 1852) dazu.
Auch wenn die Ehe ihrer Eltern als nicht sehr glücklich galt, war das Familienleben, in dem Therese aufwuchs, sehr lebendig, wie zum Beispiel Charlottes Bruder Georg bezeugt: »Dein Familienkreis ist der einzige, wo ich wahres häusliches Glück empfinde, und den ich daher wahrhaft meinen Familienkreis nennen kann.«3 Es gab Feste, Sommeraufenthalte im Jagdschloss Seidingstadt und feste Traditionen, die Herzogin Charlotte einführte und die ihre Tochter Therese in ihre eigene Familie übernahm.
Zur Familie im weiteren Sinn gehörten für Therese auch ihr Großvater Karl von Mecklenburg-Strelitz und die Geschwister ihrer Mutter. Das Schloss zu Hildburghausen war für die ganze Familie immer wieder ein beliebter Treffpunkt, so zum großen Familienfest im Jahr 1805. Am häufigsten aber kam Charlottes Bruder Georg von Mecklenburg-Strelitz, der oft für Wochen in Hildburghausen weilte und den Therese sehr verehrte, wie ihre Briefe aus der Zeit zeigen.4
Konfirmation – Ende der Kindheit
»Entflohen sind der Kindheit Blumenzeiten, der Lauf der Weihe-Stunde ist erfüllt!«
So beginnt das Gedicht, das Herzogin Charlotte zur Konfirmation ihrer Tochter Therese am 11. April 1808 selbst verfasst haben soll.1
Wir wissen nicht, was Therese gedacht hat, als es ihr verlesen wurde, prophezeite es doch für eine 16-Jährige zumindest aus heutiger Sicht eine eher düstere Sicht auf die Zukunft. Auf jeden Fall wird deutlich, was die Mutter, analog ihrer eigenen Geschichte, von ihrer Tochter erwartete. »Dort harret dein der Riesen-Kampf der Pflichten«, ist eine der zentralen Botschaften des Gedichtes. Das Wort »Pflicht« zieht sich auch später wie ein roter Faden durch Thereses Briefe und ist ein wichtiger Schlüssel zur Beurteilung ihres Lebens.
»Es heilt ein Gott des sanft Ergebnen Wunde.« Auch das war eine Botschaft der Mutter, die Therese mit in ihr Leben nahm. Was auch immer ihr widerfuhr, sie hat es mit Vertrauen in die Vorsehung und die Güte eines väterlichen Gottes angenommen.
Dass der »Kindheit Blumenzeiten« nun beendet waren, bekam im Jahr 1809 noch eine ganz andere Bedeutung für Therese. Bereits seit Jahren hatten sich ihre Eltern auseinandergelebt. Aktueller Anlass für die Krise im Jahr 1809 war die Forderung Herzog Friedrichs, seine Frau solle nach einem sechsmonatigen Aufenthalt bei ihrem Vater in Neu-Strelitz unverzüglich nach Hause zurückkommen, obwohl sie krank war und auch die Ärzte in Neu-Strelitz dringend zu einer Kur geraten hatten, die der Herzog aber nicht finanzieren wollte. Die Scheidungsgerüchte kursierten bereits in Berlin, wo sie, vor allem wegen der Verwandtschaft zu Königin Luise, in allen Salons heiß diskutiert wurden.2 Aus dem Exil in Königsberg schalteten sich daher sogar Königin Luise und Charlottes Bruder Georg, der dort zu Besuch war, ein. Luise wollte, dass der Vater persönlich nach Hildburghausen reisen solle, da der Herzog sich seiner Autorität nicht entziehen könne.3 Da der Vater aus gesundheitlichen Gründen nicht fahren konnte, wurde Georg als Vermittler eingesetzt. Der Bruder schaffte es tatsächlich, den Frieden zwischen dem Herzog und seiner Frau wiederherzustellen, wofür ihm Charlotte sehr dankbar war.
Die Ehekrise im Herzogshaus war also zumindest an der Oberfläche gebannt, als Therese selbst zur begehrten Heiratskandidatin wurde.
Romantische Brautzeit und Traumhochzeit (1809 – 1810)
Therese von Sachsen-Hildburghausen – begehrte Heiratskandidatin
»Die Kronprinzessin ist keine Schönheit, klein von Gestalt; aber doch dabei sehr hübsch, einnehmend und liebenswürdig«,
schrieb der Dichter Graf August von Platen, der am Münchner Hof als Schüler der Pagerie weilte, über Therese im Jahr 1810. »An unserem Hofe [München] [Anm. d. Verf.] war sie immer die schönste Dame. Sie ist ohne Ziererei und Koketterie, voll Natürlichkeit, leutselig, gutmütig. Ihr Lächeln und alle ihre Gebärden sind unwiderstehlich.«1 Auch andere Quellen heben vor allem ihre Sanftmut und Natürlichkeit hervor. Während ihre drei Jahre ältere Schwester Charlotte bereits seit vier Jahren verheiratet und schon dreifache Mutter war, lebte Therese Ende 1809 noch im väterlichen Schloss in Hildburghausen, wohl wissend, dass mit 17 Jahren auch ihre Verheiratung nur noch eine Frage der Zeit war.
Als mögliche Heiratskandidaten präsentierten sich gleich mehrere, ganz unterschiedliche Männer: Im Jahr 1809 ging ein Gerücht durch die Fürstenhäuser Europas, dass Napoleon sich von seiner Frau Josephine scheiden lassen wolle, weil sie keine Kinder mehr bekommen konnte, seine Dynastie aber unbedingt einen Nachfolger brauchte. Daher hätte er eine Kandidatinnenliste der heiratsfähigen Töchter der Fürsten des Rheinbundes aufstellen lassen, auf der auch der Name Therese von Sachsen-Hildburghausen stünde. Sie kam zwar nur aus einem kleinen Herzogtum, das aber glänzende Verbindungen in die übrigen Fürstenhäuser hatte, unter anderem war sie die Nichte der preußischen Königin Luise und eine Großnichte der englischen Königin Sophie Charlotte. Für die Familie aber war die Vorstellung, Napoleon als neues Familienmitglied begrüßen zu müssen, undenkbar.2 Herzogin Charlotte hätte es am liebsten gesehen, wenn Therese ihren Onkel Georg geheiratet hätte, der seit Jahren auf vergeblicher Brautsuche war. Durch seine häufigen Besuche in Hildburghausen kannten sich beide sehr gut, und so war wohl bei ihnen im Laufe des Jahres 1808 ein Gefühl entstanden, das zumindest Georg als Liebe bezeichnete. In Briefen an seine Schwester Therese von Thurn und Taxis deutete er schon 1808 an, dass er sich in Hildburghausen verliebt hatte, ohne seiner neugierigen Schwester zunächst Details zu verraten.3 Eine Ehe zwischen Verwandten zweiten Grades war in Adelskreisen nicht ungewöhnlich, auch wenn sie das Krankheitsrisiko für die Nachkommen erhöhte.
Ob Therese in ihren Onkel verliebt war, wissen wir nicht genau. Er war ihr sehr vertraut, stand für alles, was sie auch an der Mutter liebte, und ihre Briefe zeigen durchaus vorsichtige Ansätze eines Flirts mit dem Onkel, so in einem Brief vom 30. Juli 1808 nach einem längeren Besuch Georgs in Hildburghausen: »Schade, daß Sie nicht länger dablieben; vielleicht würde Ihnen in der Folge nicht allein die Gegend wohl gefallen haben, sondern auch so manche Menschen, deren Schüchternheit gewiß mehrere ihrer Vorzüge verbergen.«4 Was im Einzelnen zwischen beiden passiert ist, können wir nur vermuten, aber Georg und auch Herzogin Charlotte und ihre Schwestern gingen von einer Heirat aus.
Am 21. Dezember 1809 aber erschien im Schloss der 23-jährige bayerische Kronprinz Ludwig von Bayern (1786 – 1868) auf der Suche nach einer Braut. Er fürchtete, genau wie seine Schwester Auguste, die Napoleons Stiefsohn Eugène heiraten musste, Teil der dynastischen Heiratspolitik Napoleons zu werden – eine Aussicht, die ihm zutiefst zuwider war. »Ich bin bald 24 Jahre alt, ich muß unbedingt heiraten«, schrieb er in sein Tagebuch. »Ist das einmal geschehen, können solche Anschläge auf meine Freiheit von Paris her nicht mehr gemacht werden.«5 Sein Vater hatte ihm vorgeschlagen, Therese oder Luise von Sachsen-Hildburghausen zu ehelichen, eine seiner Großnichten. Jede von ihnen sei »lieb, freundlich und gütig und könnte eine ausgezeichnete Frau abgeben«. Zwar bringe sie kein Geld mit in die Ehe, aber Hildburghausen sei so klein und politisch so unwichtig, dass auch Napoleon keine Bedenken haben würde.6 Bei Konzerten und beim Walzertanz kam man sich näher und am Ende entschied er sich für Therese. Ludwig schien, zumindest nach seinen Tagebucheinträgen zu urteilen, sehr verliebt.
Therese erwiderte diese Gefühle, obwohl Ludwigs Äußeres keinesfalls dem Bild eines Märchenprinzen entsprach. Sein Aussehen wird von den meisten Zeitgenossen als »wenig einnehmend« bezeichnet. Er war von mittlerer Größe, hatte eine vorspringende Nase und Blatternnarben im Gesicht. Er war stark schwerhörig, ein Erbteil der Mutter, und stotterte, was die Zeitgenossen als »schwere Zunge« bezeichneten. Daher waren Unterhaltungen mit ihm eher mühsam und auch Konzert- und Theaterbesuche schwierig. Die Folge der Schwerhörigkeit waren ein überlautes Sprechen, abrupte Bewegungen und wildes Gestikulieren. Er sprach kurz und abgehackt, oft keine ganzen Sätze und seine Äußerungen wurden von den Zeitgenossen als oftmals heftig und taktlos empfunden.7
Am 24. Januar 1810, als Ludwig von Hildburghausen nach München zurückkehrte, ließ er ein Gedicht bei Therese zurück, das sehr deutlich zeigt, unter welchem Dilemma die Beziehung von Anfang an stand: Ludwig, hochgebildet in Theorie und Praxis durch seine Reisen, direkt beteiligt an den großen Ereignissen der Zeit einschließlich der Teilnahme an Schlachten, traf auf ein 17-jähriges junges Mädchen, das abgesehen von Besuchen innerhalb der Familie keine Erfahrung mit der Welt außerhalb des heimatlichen Schlosses hatte und in einer sehr behütenden Familienatmosphäre aufwuchs. Dies war Ludwig durchaus bewusst, doch Therese sollte die eigentliche Bedeutung seiner Verse erst im Laufe der nächsten Jahre erkennen.
An Therese
In dem Herzen tragest Du den Himmel
Du empfindst des Lebens reinstes Glück,
Ferne dem gehaltlosen Gewimmel,
Seligkeit Dir jeder Augenblick.
Heiter wie das Heute dir, so morgen,
Reiht sich Tag an Tage, Jahr an Jahr;
Glückliche! Du kennst noch nicht die Sorgen,
Für des Herzens Reinheit eitler Gefahr.
Froh, zufrieden, mit dem, was gegeben,
Lebst Du Deinem heiligen Gefühl,
Und Dich peiniget keine ängstlich Narben,
Stilles Häuslichglück Dein frommes Ziel.
Soll ich Deinem Frieden Dich entreißen,
Stürzen in die sturmbewegte Welt?!
Alles Alte sinkt aus seinen Gleisen,
Und das Gute, Schöne es zerfällt.
Fremd Dir von dem Leben die Beschwerden,
Deine Welt der Deinen traute Zahl.
Ach! daß anders einstens dies muß werden!
Jedem wird auf Erden einstmal Qual.
Mehren können nicht die goldnen Tage
Unbefangner schöner Leichtigkeit.
Fruchtlos nur hallt ihnen nach die Klage,
Denn der Mensch muß in des Lebens Streit.
Alles keimt, wächst und wird blühen,
Doch gereifet muß die Blüt’ zergehn,
Sie zu halten wäre leer Bemühen,
Die Natur, sie baut kein Stillestehn.
Ach! des Mädchens harmlos kleine Stunden
Werden Dir auch bald verschwindend fliehn,
Und von meinem Lebensbild umwunden,
Um Dein Aug’ die Welt sich anders ziehn.
Dir noch unbekannte tiefe Schmerzen,
Freude auch, Dein neuer Stand verleiht;
Doch es kommt das Glück nur aus dem Herzen;
Deines zu vermehren meine Seligkeit.8
Im ersten Brief, den Therese ihm schrieb, drückte sie sich noch vorsichtig, wie es sich gehörte, aber durchaus mit Gefühl aus: »Dem alten Freund, dem hier zum erstenmal Vermissten, sendet mit inniger Freude, die eine Freundin. – O könnte sie dem edlen Herzen, doch Alles geben, was es je vermissen könnte. Wie glücklich wäre sie.«9
Lange musste sie auf eine Antwort warten, weil Ludwig zunächst das Einverständnis seiner Eltern, die zu der Zeit in Paris zu Verhandlungen mit Napoleon waren, für seine Entscheidung abwarten musste. Dann endlich, Ende Januar, kam der ersehnte elterliche Brief und Ludwig konnte sich überschwänglich für Thereses Brief bedanken, in dem er »immer mehr mein Herz beseligende Gefühle« entdeckte. »Liebte ich Sie nicht schon, durch Ihren Brief hätte ich Sie lieben müssen. Eine solche Therese giebt es nicht mehr auf Erden. O seliger Gedanke der Hoffnung mit Ihnen einst vereint zu werden für das Leben; möchte ihm Wirklichkeit zukommen. Dieses ist meine Sehnsucht.« Er schreibt weiter von »glühender Sehnsucht« und »Verehrung«, spricht von ihr als »erhabener Fürstin« und »Geliebter«.10
Ludwig, Kronprinz von Bayern (1786 – 1868)
Nicht bey dem Glücke kann der Mensch verweilen,Denn er muß immer sehnen, immer hoffen,Die Welten liegen seinen Wünschen offen,Rastloses Treiben spürt er, fortzueilen.
So lautet der Beginn eines Sonetts, in dem Ludwig sein Seelenleben offenbart. Auch wenn seine Gedichte schon von den Zeitgenossen nicht als hohe Kunst betrachtet wurden und Ludwig selbst bewusst war, dass sie nur gedruckt wurden, weil er König war, gibt es doch kaum einen König, der durch seine Gedichte einen so intimen Einblick in sein Gefühlsleben gewährte. Ludwig fuhr fort:
Aus milden Thales Fluren zu den steilen
Berghöhen strebt sein Trachten; zu den schroffen
Felsklippen; wenn sein Wünschen eingetroffen,
Möcht’ er das Vorige sich neu ertheilen.1
Die tiefe lebenslange innere Zerrissenheit Ludwigs, ein Sehnen ohne Erfüllung, die Suche nach der blauen Blume eines Novalis wird hier deutlich. Seine Gefühlswelt glich einer Achterbahn, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt und dazwischen immer wieder jähzornige Ausbrüche. Sein Biograf Heinz Gollwitzer bezeichnet ihn als »überempfindlichen Egozentriker«, als »äußerst unausgeglichenen Menschen«.2 Gollwitzer, der als einer der letzten Historiker seine Tagebücher einsehen durfte, fand dort häufig Eintragungen wie: »Da brauste ich auf« oder »Da fuhr ich hoch« oder »In Zorn brach ich aus, was mich bald reuete«.3 Auf die Biografie Ludwigs wird im Folgenden aber nur in den Punkten ausführlicher eingegangen, die für seine Beziehung zu Therese von Bedeutung sind.
Ludwigs Vater, Maximilian Joseph von Pfalz-Zweibrücken (1756 – 1825), war vor der Französischen Revolution als Oberst im Heer des französischen Königs Ludwigs XVI. in Straßburg stationiert. Am 30. September 1785 heiratete er Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt (1765 – 1796), eine Tante von Thereses Mutter, der Herzogin Charlotte von Hildburghausen. Zumindest am Anfang muss die Ehe sehr glücklich gewesen sein. Ludwig wurde am 25. August 1786 in Straßburg geboren. »Von dem Augenblick, da er das Licht der Welt gesehen hat, haben mich die Schmerzen verlassen und Freude und Wonne sind an ihre Stelle getreten. Von jeher war ich die glücklichste Tochter und jetzt bin ich die glücklichste der Mütter und Weiber«, schrieb seine Mutter nach der Geburt.4 Taufpate wurde unter anderen der französische König Ludwig XVI. Ludwig und sein Vater hatten für Frankreich große Bedeutung, da sowohl der Kurfürst in München, Karl Theodor, als auch der Herzog von Zweibrücken kinderlos waren und es nicht ausgeschlossen war, dass Maximilian Joseph der zukünftige Kurfürst von Bayern werden konnte.
Ludwig war drei Jahre alt, als 1789 die Französische Revolution und ihre Folgen sein Leben auf den Kopf stellten. Die Familie musste Straßburg verlassen, die Franzosen besetzten das linke Rheinufer – der Beginn einer mehrjährigen Flucht vor den Heeren der Franzosen, die Ludwig für sein Leben prägten. Am 1. April 1795 starb der Bruder Maximilians, Herzog Karl August von Zweibrücken, an einem Schlaganfall, auch er auf der Flucht. Ludwigs Vater wurde neuer Herzog eines Landes, das von den Franzosen immer noch besetzt war.5 Ludwigs Mutter war durch die Flucht sehr geschwächt, zudem im siebten Monat schwanger. Sie überlebte zwar die Geburt, aber erholte sich nicht mehr. Am 30. März 1796 starb sie mit 31 Jahren. Ludwig war neuneinhalb Jahre alt und nicht nur durch die Kriegserlebnisse, sondern vor allem durch den Tod der über alles geliebten Mutter traumatisiert. Der Hass auf die Franzosen, die er dafür verantwortlich machte, begleitete ihn sein Leben lang. Wie tief seine Trauer noch 30 Jahre später war, zeigen seine Gedichte, die er nahezu alle fünf Jahre zur Erinnerung an seine Mutter schrieb, zum Beispiel 1826:
An meine verewigte Mutter
Es hat die Erde heut vor dreißig Jahren
Der Frauen schönste, herrlichste verloren,
Die liebevolle, welche mich geboren;
Beschieden dreißig Jahre nur ihr waren.
Im Zeitlichen das Ewige erkoren,
Ist ihre Seele früh’ zu ihm gefahren,
Sie wurde sehnend von den sel’gen Schaaren,
Empfangen an des Himmels heil’gen Thoren.
Zurück in die Heimath nur gekehret
Ist sie, hat selbe immer hier entbehret;
Dort lebt sie, wie auf Erden verkläret.
O! Mutter! Zu dem Höchsten dorten bitte,
Daß solche leite Deines Sohnes Schritte,
Auch er gelange in der Sel’gen Mitte.6
Ludwig und vor allem seine Beziehung zu Therese kann man nicht verstehen, wenn man seine Beziehung zu seiner Mutter und das Trauma ihres Verlustes unbeachtet lässt.
Bereits ein Jahr später heiratete sein Vater Karoline von Baden (1776 – 1841), mit der er weitere acht Kinder bekam. Ludwigs Beziehung zur neuen Frau an der Seite seines Vaters blieb stets distanziert. Nur in ihrer Abneigung gegen die Franzosen waren sich beide nahe. Das Jahr 1797 brachte einen weiteren Verlust für ihn. Während seine Familie weiterhin auf der Flucht war, siegten die Franzosen gegen die Österreicher und bekamen im Frieden von Campo Formio, Ludwigs Heimat, das linke Rheinufer einschließlich Zweibrücken und Teile der Kurpfalz zugesprochen. Auch dies wurde zur lebenslangen Erschütterung für den inzwischen 11-jährigen Ludwig. Zeit seines Lebens versuchte er, letztendlich vergebens, seine Heimat und die damit verbundenen glücklichen Jahre mit seiner Mutter zurückzugewinnen.
Vernunft und Leidenschaft
»Wir waren in gar vielem das Gegenteil voneinander, er voller Vorliebe für die Franzoßen, für die Tricolore, für die Republik, für Napoleon, ihnen entschiedener Freund, ich entschiedener Feind, ja ein glühender Feind der Franzosen«,7
schrieb Ludwig über die Beziehung zu seinem Vater. Am 16. Februar 1799 wurde Maximilian Joseph von Pfalz-Zweibrücken nach dem Tod Karl Theodors nicht nur neuer Kurfürst Bayerns, sondern sein Sohn Ludwig als neuer Kurprinz auch Ziel dynastischer Heiratspolitik. Um den neuen Kurfürsten und Bayern für die Allianz Österreich, Russland, England zu gewinnen, schloss der russische Zar Paul I. ein geheimes Heiratsabkommen mit Maximilian Joseph: Der 13-jährige Ludwig sollte seine Tochter, die Großherzogin Katharina, heiraten, sobald er 18 war.8 Dafür musste Bayern gegen Frankreich mit in den Krieg ziehen.
Nach der Niederlage der Österreicher in Hohenlinden kam es zum Vertrag von Lunéville, in dem den Franzosen das linke Rheinufer endgültig überlassen wurde, was der neue Kurfürst den Österreichern sehr übel nahm. Forciert von Außenminister Graf Maximilian von Montgelas (1759 – 1838), der besser Französisch als Deutsch sprach, und zum Entsetzen des Kurprinzen schloss Bayern 1801 mit Frankreich einen Freundschaftsvertrag, in dem Frankreich als neue Schutzmacht Garantien gegen österreichische Übergriffe übernahm und Bayern Entschädigungen für den Verlust des linksrheinischen Gebietes erhielt, was einer Anerkennung der revolutionären Regierung durch Bayern gleichkam. Es kam zu ersten Konflikten zwischen Ludwig und seinem Vater. Träger der neuen Politik mit seiner Anlehnung an Frankreich und einer Kirchenpolitik, die in der Auflösung aller katholischen Klöster gipfelte, wurde immer mehr Graf Maximilian von Montgelas, der seinen größten Kritiker im Kurprinzen hatte. Gefördert wurde diese Kritik durch Ludwigs Erzieher: Joseph Anton Sambuga (1752 – 1815), ehemals Hofprediger zu Mannheim, der noch von der Mutter Ludwigs ausgesucht worden war. Zwei Grundsätze verfolgte Sambuga mit seiner Erziehung beim Kurprinzen, wie er selbst schreibt: »die Liebe zu seinen Baiern, und die Liebe zur Religion seiner Väter«, der katholischen.9
Im Herbst 1803 besuchte Ludwig nach einem halben Jahr in Landshut die Universität in Göttingen, wo er neben Vorlesungen in Geschichte und Staatslehre auch solche in Altertumskunde hörte. Als er Ende 1804 nach München zurückkam, befürchtete Montgelas, Ludwig würde seine Frankreichpolitik behindern, und so wurde er gleich wieder auf Reisen geschickt.10 Seine erste Italienreise führte ihn nach Venedig, Rom und Neapel. Sie war der Beginn einer Leidenschaft für das Land, die antike Kunst und die Künstler, die ihn sein Leben lang begleitete und die Museen und Gemäldesammlungen Münchens mit antiken Kostbarkeiten füllte.
Und hier verliebte er sich auch zum ersten Mal mit 18 Jahren, als er 1805 in Gaeta die Tochter des amerikanischen Gesandten in Paris, Mary Livingston, traf. Sie steht am Anfang einer langen Liste von Frauen, die die Leidenschaft des Kronprinzen entflammt haben sollen.
Gollwitzer bescheinigte Ludwig ein »aktives erotisches Temperament«, eine Leidenschaftlichkeit oft bis »zur Persönlichkeitsgefährdung«, die ihm »Schmerz bereiten konnte«. Ludwig selbst rechtfertigte sich immer damit, dass er »sein poetisches Gemüt durch Anregungen erotischer Art in ›Schwung‹« halten müsse. Ludwig von Bayern, der Mann, den Therese heiraten würde, war ein Mann von innerer Zerrissenheit, ein Getriebener auf der Suche nach Frieden: einmal durch den Kampf gegen seine Erzfeinde, die Franzosen, und für den Rückgewinn seiner Heimat, der Pfalz, und zum anderen im Kampf gegen die »vulkanische Dimension seiner Liebesleidenschaft«.11 Ludwig dichtete dazu:
Ohne Liebe wäre nicht die Erde,
Ohne Liebe selbst der Himmel nicht;
Liebe, welche sehnend ich begehrte,
Du allein bist meines Lebens Licht …12
Kronprinz Ludwig, Napoleon und Tirol
»[I]ch bitte Sie, nur nicht mit den Franzosen zu gehen, unsere Waffen nicht mit den ihrigen zu vereinen und nicht mit den Ungerechtigkeiten dieser Nation gemeinsame Sache zu machen, die alles Recht mit Füßen tritt«,13
schrieb Ludwig im Sommer 1805 an seinen Vater, um in letzter Minute zu verhindern, dass der Geheimvertrag von Bogenhausen mit Frankreich unterzeichnet würde. Kurfürst Maximilian wäre am liebsten neutral geblieben, aber das hätten weder die Österreicher noch die Franzosen geduldet. So setzte sich am Ende Montgelas durch, der in einem Bündnis mit dem starken Napoleon die Interessen Bayerns am besten gesichert sah. Im Vertrag, der am 28. September unterzeichnet wurde, garantierte Frankreich als neue Schutzmacht die im Reichsdeputationshauptschluss 1803 festgelegten Grenzen Bayerns und stellte neuen Gebietszuwachs in Aussicht. Dafür unterstützten sich beide Staaten fortan gegenseitig bei feindlichen Angriffen, so zum Beispiel bei der Schlacht von Austerlitz 1805.
Um das Bündnis weiter zu festigen, griff Napoleon auf eine bewährte Methode zurück: Heirat. Sein Stiefsohn Eugène de Beauharnais sollte die 17-jährige Schwester Ludwigs, Auguste, heiraten, obwohl sie bereits mit dem Erbprinzen von Baden verlobt war. Die Hochzeit fand am 14. Januar 1806 statt, die Verbindung soll recht glücklich gewesen sein.14
Eine erste Belohnung bekam das bayerische Herrscherhaus bereits am 1. Januar 1806, indem es zum Königreich ausgerufen wurde. Aus dem Kurprinzen Ludwig wurde der Kronprinz, zukünftiger bayerischer König. 1806 kam es zur Auflösung des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation und zur Gründung des Rheinbundes mit Napoleon als Schutzherrn. Im Zuge der Neuordnung wurde auch ein Vertrag zwischen Russland und Frankreich abgeschlossen, was Ludwigs Hoffnung auf eine Hochzeit mit der Großfürstin Katharina wieder wachsen ließ. Er schrieb an seinen Vater, dass man den russischen Hof wissen lassen solle, dass er sie im Sommer 1808 heiraten wolle.15
Die seit 1792 andauernden kriegerischen Auseinandersetzungen – die Therese in Hildburghausen allenfalls, wenn überhaupt, durch die durchmarschierenden Truppen mitbekam – führten 1807 zum ersten Kampfeinsatz Ludwigs, als man ihm nominell das Kommando der zweiten bayerischen Division, die Napoleon im Kampf gegen Russland unterstützte, übertrug. König Joseph Maximilian I. hatte ihn dorthin beordert, um Napoleons Misstrauen gegenüber der bayerischen Bündnistreue zu besänftigen. Immerhin war im März 1807 ein Gedicht Ludwigs erschienen, in dem er zum Widerstand gegen Napoleon aufgerufen hatte.
Das Jahr 1809 war in mehrfacher Hinsicht für Ludwigs weiteres Leben bedeutsam: Großfürstin Katharina Pawlowna heiratete am 3. August 1809 nicht ihn, sondern den Herzog Georg von Oldenburg, und König Joseph Maximilian I. ernannte seinen Sohn Ludwig zum Generalgouverneur des Inn- und Salzachkreises, ein Gebiet, das 1805 von den Österreichern an die Bayern abgetreten werden musste. Die bayerische Verwaltung war hier auf eine Bevölkerung gestoßen, deren Leben überdurchschnittlich stark von den katholischen Traditionen geprägt war. Schon im 18. Jahrhundert war es zu Protestantenverfolgungen gekommen, die größte im Jahr 1731/32, an denen die mit der Volksmissionierung beauftragten Jesuiten aus Bayern maßgeblich beteiligt waren. Ziel war es, den Protestantismus auszurotten. Die im Sinne der Aufklärung vom Toleranzgedanken getragenen Reformen König Maximilians trafen daher auf den masssiven Widerstand der Tiroler, der sich 1809 zu einem Aufstand entwickelte. Natürlich spielten dabei auch andere Faktoren eine Rolle: die durch den langen Krieg zusammengebrochene Tiroler Wirtschaft, Steuererhöhungen, Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, Abschaffung der traditionellen Selbstverwaltung der Tiroler. Diese revolutionäre Stimmung war von Wien aus geschürt und finanziell und personell unterstützt worden. Als die Österreicher am 9. April 1809 den Franzosen den Krieg erklärten, kam es parallel dazu zum Aufstand der Tiroler gegen die bayerische Herrschaft. Ludwig engagierte sich persönlich stark für die freiheitsliebenden Tiroler und bat immer wieder um Schonung. Trotzdem musste er weiter am Feldzug gegen sie teilnehmen, schließlich war sein Vater ein Verbündeter Napoleons. Der fünfte Koalitionskrieg endete mit einem Sieg Napoleons und seines Verbündeten Bayern gegen Österreich. Die Tiroler unter ihrem Anführer Andreas Hofer kämpften noch Monate weiter, am endgültigen Sieg gegen sie war auch Ludwig direkt beteiligt, als er am 2. November mit seinen Truppen in Innsbruck einzog. Andreas Hofer wurde am 20. Februar 1810 erschossen.
Die bayerische Regierung nahm keine einzige ihrer religions- und kirchenpolitischen Verordnungen nach 1809 zurück. Doch erkannte man in München, dass man behutsamer vorgehen und unnötige Verletzungen der religiösen Gefühle der Bevölkerung vermeiden musste. Das war wohl auch ein Grund, warum man Kronprinz Ludwig dort als Gouverneur einsetzte. Es war allgemein bekannt, dass er immer wieder versucht hatte, die Situation der Tiroler zu verbessern.
Brautzeit zwischen Liebesschwüren und ersten Missverständnissen
Ein Versprechen
»Ich finde die Idee des bayrischen Kronprinzen, Therese zu bitten, ihre Religion zu ändern, höchst lächerlich«,
schrieb Königin Luise von Preußen Mitte Januar 1810 an ihren Vater. »Ich habe Charlotte geantwortet, daß man in einer derart ernsten Angelegenheit das nicht anraten könne, aber andererseits habe ich ihr zu verstehen gegeben, daß allein Therese wissen könne, ob sie das Glaubensbekenntnis und die Gelübde, die sie zu Füßen des Altares Gottes abgelegt habe, mit Überlegung und voller Glauben gesprochen habe, oder ob sie in einem der entscheidenden Augenblicke ihres Lebens unüberlegt, verwirrt oder leichtfertig gewesen sei.«1 Während nun zwischen Therese und Ludwig Anfang 1810 die ersten Liebesbriefe hin- und hergingen, schlugen in Hildburghausen, Berlin und Neu-Strelitz die Wellen hoch. Abgesehen von Georgs enttäuschten Hoffnungen ging es vor allem um die Frage der Religion. Der Kronprinz hatte ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass Therese zum katholischen Glauben übertreten sollte, was das Herzogspaar, vor allem Herzogin Charlotte, ablehnte.
Niemand ahnte zu dem Zeitpunkt, dass Ludwig Therese bereits ein Versprechen abgerungen hatte, von dem er seine Werbung um sie abhängig machte: Er musste zu Recht davon ausgehen, dass sein Vater, der bereits seiner protestantischen Frau Karoline von Baden eine eigene Kapelle und einen eigenen Geistlichen zugestanden hatte, dieses auch bei Therese machen würde. Er hatte aber auch den Tiroler Aufstand erlebt und war besorgt, dass ein Gouverneur mit einer protestantischen Ehefrau, die ihre eigene protestantische Kapelle nebst Geistlichen mitbrachte, von Anfang an zu Problemen, ja vielleicht sogar zu einem neuen Aufstand führen könnte.
Ludwig suchte nach einem Kompromiss und nahm Therese Anfang Januar 1810 ein Versprechen ab, das sie ihm in ihrem Brief vom 5. Januar 1810 schriftlich bestätigen musste: »Fordert es nemlich die Rücksicht auf Ihre Unterthanen, so will ich mir einer Kapelle, ja selbst eines Geistlichen versagen, so lange Ihr Wunsch es nothwendig finden wird, und Ihren Gottesdienstlichen Versammlungen beiwohnen, so viel meine Pflicht und ihre Kirche einer Evangelischen erlauben.«2 Einen Übertritt zum katholischen Glauben lehnte sie aber ab. Was auch immer Ludwig ihr im Januar 1810 über Tirol, die Jesuiten und die Situation der Protestanten erzählt hatte, um sie zu diesem Verzicht zu bringen, es bewirkte eine lebenslange Furcht vor den Jesuiten und ihrer Macht. Noch als Königin sagte sie zu ihrer Oberhofmeisterin, wenn die Jesuiten im Land wieder zugelassen würden, wäre es besser gewesen, sie wäre nie nach Bayern gekommen.3
Thereses Vater, der Herzog von Sachsen-Hildburghausen, war glücklich über die herausragende Partie, die seine Tochter machen würde. Schon am 24. Januar, als das Einverständnis des bayerischen Königs noch gar nicht eingetroffen war, schrieb er ihm begeistert: »Ein herrliches Los ist meiner Tochter gefallen. Sie mag, sie wird es verdienen durch treue Liebe, durch treue Erfüllung ihrer Pflichten. Gott segne diesen Bund, den Liebe schloß.«4
Herzogin Charlotte sah das allerdings ganz anders. »Die Überraschung machte sie krank und leidend«, schrieb Königin Luise an ihren Vater. Auch Therese von Thurn und Taxis war wenig begeistert, vor allem, weil ihr Bruder Georg darunter leiden musste.5
Die Verlobung von Therese und Ludwig fand am 12. Februar 1810 in Hildburghausen statt. Am Tag danach kehrte Ludwig nach München zurück und schrieb an seine Braut: »Ich fühle mich wie in einer anderen Welt, sehne mich zurück nach dem herzlichen Kreise, wieder zu Dir, Geliebte meiner Seele.«6
Erst am 9. März 1810 traute sich Therese ihrem Onkel Georg zu schreiben. In diesem kurzen Brief fällt auf, wie oft sie die Beziehung Onkel – Nichte betont, so als hätte es für sie darüber hinausgehende Gefühle gar nicht gegeben. »Theuerster Oncle! Nur wenige Worte vermag ich zu schreiben, und doch Vieles und Wichtiges für mich habe ich Ihnen zu sagen.« Obwohl er ja Bescheid wisse, möchte sie ihm doch persönlich »von der neuen frohen Aussicht meiner Zukunft« berichten. »Sie kennen den Mann, dessen edles Herz mich gewiß einst glücklich machen wird; o daß es auch mir gelingen möchte, zu seinem Glück zu leben. Schenken Sie mir auch ferner, theurer Oncle, Ihre Freundschaft und Ihre Theilnahme, welche mich immer so sehr beglückte! Und Ihre freundschaftlichen Rathschläge, deren ich bedürfen und die ich immer mit Freude und Dankbarkeit befolgen werde … Mit inniger Verehrung, theuerster Oncle, Ihre gehorsame nièce Thérèse.«7 Georg heiratete 1817 Prinzessin Marie von Hessen-Kassel (1796 – 1880). Seiner Nichte Therese blieb er zeit ihres Lebens ein treuer Freund und Ratgeber, wie die vielen Briefen zwischen den beiden belegen.
Liebesschwüre
»Zwei andere Leben deucht es mich München, Hildburghausen, fremdartig, nur in meinem Herzen hier und dort und überall, wo ich bin, dich liebend finde ich ihre Vereinigung.«8
Ihr Leben in zwei Welten, das Ludwig Anfang März 1810 so klar beschreibt, galt nicht nur für die Vergangenheit, es würde auch in der Zukunft so bleiben. Therese wird seine Worte nicht verstanden haben, denn sie kannte nur die eine Welt, ihre Welt. Sie las aus Ludwigs Schreiben und seinen Gedichten lediglich die Sehnsucht einer romantischen Liebe heraus.
Das Zusammensein zu zweit fand im weißen Kabinett im Hildburghausener Schloss statt, dort waren auch Umarmungen und Küsse erlaubt, es war der Ort, an dem Therese Ludwigs Briefe las und in Erinnerungen schwelgte, wenn er abgereist war. »Es ist zum Heiligthum geworden; auch durch Deine lieben Verse, – oft und mit welchen Empfindungen wurden sie gelesen!«9 Und noch etwas hinterließ Ludwig, als er im Februar abreiste: Einen Code für geheime Botschaften in den Briefen. Das war einmal sinnvoll, wenn man an die Unsicherheit des Postweges in den kriegerischen Zeiten dachte, und zum anderen, weil nicht ausgeschlossen war, dass Thereses Eltern seine Briefe an Therese lesen würden.10
In den folgenden Monaten gingen zahllose Briefe hin und her, die zunächst Sehnsucht und Liebesschwüre zum Inhalt hatten. »Froh seh’ ich meiner Zukunft entgegen, glücklich in Deiner Liebe«, schrieb Ludwig. »Ich küße Dich, holde Braut, in Gedanken ist es nicht so süß wie auf Deine zarten Lippen.«11 Therese antwortete ihm, wie es ihre Erziehung gebot, das vertraute »Du« noch vermeidend: »Geliebter Freund! Könnten Worte die Freude schildern, mit der ich Ihre mir so theuren Zeilen empfing. – Wo durfte ich sie lesen, als im lieben kleinen Kabinette? – In diesen schönen Augenblicken hörte ich Sie selber zu mir sprechen.« Sie unterschrieb mit »Ihre glückliche Therese«.12
Man kann sich vorstellen, was in einem 17-jährigen Mädchen vorgeht, das zum ersten Mal verliebt ist und den folgenden Brief erhält: »Ueberall denk’ ich dein, dein denk ich immer, das brauche ich Dir nicht zu sagen, Du bist davon überzeugt, und ich bin es von meiner Therese. Mein, mein, du bist es schon, vielgeliebte Braut, dieses Mein gibt dem Herzen Seligkeit. Der erste Tag des Hierseins war noch nicht vorüber und mich dünkte schon die Trennung von dir so lange.« Er würde in München gelobt für sein gesundes Aussehen, schrieb Ludwig weiter, und das habe er nur ihr zu verdanken: »Die Zufriedenheit dich für meine Braut zu haben, danken alle meine Züge uns, und glücklich für mich, daß meine Seele in der Zukunft weilt.« Das Interesse an der zukünftigen Kronprinzessin sei in München sehr groß, schrieb er ihr, jeder wolle wissen, wie sie aussehe, wie groß sie sei, welche Haarfarbe sie habe.13
Einerseits schmeichelte ihr die neue, ungewohnte Aufmerksamkeit, andererseits machte sie ihr Angst, weil sie nicht wusste, ob sie die großen Erwartungen, die man offenbar an sie stellte, auch erfüllen konnte. »Nur ein Gedanke beruhigt mich, es ist der, daß mich ein theurer Freund, durch seine freundschaftlichen Rathschläge leiten wird.«14
Ludwig, der auch in Liebesdingen mehr Erfahrung hatte, versuchte sie durch ein Gedicht zum vertrauten »Du« zu überreden.
Daß du mit trautem, zutraulichem Du
Mich nennst, dieß will zu meinem Glücke nur noch fehlen,
Es flößt dem Herzen süße Wonne zu,
Ist gleichgestimmter Menschen geistiges Vermählen …15
Wie unerfahren und unsicher Therese war, zeigt ihr Antwortbrief: »Ich erinnere mich Ihres Wunsches und meines Versprechens, ihn zu zu erfüllen – doch mein Gesicht brennt und meine Finger sind kalt, ehe das Versprechen erfüllt ist. Und stahl sich, schon ein Sie in diese Zeilen, so will ich sogar Dich, meinen geliebten Freund, deshalb um Verzeihung bitten. O wie viel ist mit diesem kleinen Wörtchen ausgesprochen! Wie viel weniger sagt doch ein Mann dem Mädchen damit, als dieses jenem. Das fühlst Du selbst. Nur das höchste Vertrauen kann es aussprechen – möge die Liebe es deuten! Ach ich würde noch viel über das inhaltsschwere Wörtchen sagen, hätte ich es nicht Dir gesagt.«16
Aber auch einen ersten Vorgeschmack auf Ludwigs schwankende Stimmungen bekam Therese bereits in den ersten Monaten, als er sich beschwerte, dass sie ihm nicht oft genug schreibe. »Du warst unzufrieden, und – durch mich, die Dich nie, nie betrüben möchte. Doch zu hart hast Du mich bestraft, da Du das Vergnügen in Zweifel ziehst, welches mir die Unterhaltung mit Dir gewährt. Ja, das war zu hart.« Ihm zu schreiben sei doch das Einzige, was ihr bliebe, wo sie getrennt seien, »und wie sollte eine schriftliche Unterhaltung mit Dir mir nicht teuer seyn? – Das kannst Du selbst nicht glauben.« Sie habe so viele andere Pflichtbriefe zu schreiben, daher fehle ihr die Zeit. »Um Verzeihung bitte ich gerne, wenn ich gefehlt habe, aber auch Du mußt Abbitte über Deine bösen Worte thun, theurer Freund.« Sie unterschrieb nur mit »Therese«, ein Zeichen, dass sie nicht nur sehr verletzt, sondern auch erbost war.17 Es ist bezeichnend, dass sie zwar bereit war, sich zu entschuldigen, aber auch einforderte, dass er dasselbe tun müsse. Zu Beginn ihrer Beziehung war sie noch wesentlich mutiger als später, als sie seinen unberechenbaren Jähzorn kennen und hautnah spüren lernte und alles vermied, was ihn zusätzlich reizen konnte.
Von Brief zu Brief verlor sie auch die Hemmungen, von ihrer Liebe zu ihm zu sprechen: »Du sagtest mir einst, die ataliänische [italienische] Sprache sey die Sprache der Liebe. – Warum ich das nicht früher geahnt habe? Habe ich doch früher schon schreiben müssen: io amo, tu ami, egli ama ppp –, doch was verstand ich von der ganzen Conjugation, ehe Du mein Lehrer wurdest?« Ihr war diese Sprache immer wichtig, aber so richtig erst, wo »ich jetzt schreiben konnte: ti amo il mio Ludovico. – Schöner Name, süßklingend mir in jeder Sprache.«18
Parallel zu dieser privaten Korrespondenz zwischen dem Brautpaar waren die offiziellen Verhandlungen angelaufen. Therese bekam ein Paket mit den Bildern des bayerischen Königspaares zugesandt,19 ihr zukünftiger Hofstaat musste zusammengestellt werden, wobei Ludwig dabei stärker einbezogen wurde als Therese, die aber von ihm zumindest über den Stand der Planungen informiert wurde. Vor allem die Stelle der Oberhofmeisterin war bedeutsam, da sie täglich mit Therese zu tun haben würde. Ludwig teilte ihr am 8. Mai 1810 mit, dass seine Wunschkandidatin, die Gräfin Oberndorf, leider verhindert sei. Therese teilte seine Betrübnis darüber, ohne die Dame zu kennen. »So werde ich immer, wie jede Freude, so auch jeden Schmerz mit Dir theilen, geliebter Freund. Auch Leiden mit Dir Geliebter zu theilen ist süß.« Sie freute sich über die neue Wahl einer Frau von Redwitz, ebenfalls ohne sie zu kennen. Auch hier wird ein Muster für ihr späteres Verhalten erkennbar. Ihre Gefühle hat sie auch in Zukunft immer hintenangestellt. »Freuen würde ich mich aber auch schon um Deinetwillen, wenn sie die Stelle nimmt, da Du es wünschst.«20
Am 23. Juni erfolgte die offizielle Werbung um Thereses Hand durch den Abgesandten des bayerischen Hofes, Freiherr Karl Ludwig von Keßling, nachdem man die Paragrafen des Heiratsvertrages ausgehandelt hatte. Therese erhielt als Brautgeschenk ein mit Brillanten besetztes Porträt des Bräutigams.21
Ein Problem war die Aussteuer, die das verschuldete Herzogtum hart traf. Die konkrete Planung und Umsetzung der Aussteuer übernahm Herzogin Charlotte zusammen mit ihrer Schwester, der Königin Luise von Preußen, die seit Wochen krank gewesen war und den Zeitplan nicht hatte einhalten können. Luise beklagte sich in einem Brief an ihre Oberhofmeisterin Voß: »Nie hat mich eine Aussteuer mehr in Verlegenheit gebracht … Da ich keine Zauberin bin, kann ich nicht mehr als das Mögliche tun; … Anbei ein Brief für meine Schwester [Charlotte], ich bitte Sie, ihr den sofort durch Stafette zuzustellen. Ich habe versprochen, ihr alles, sobald es fertig wäre, durch einen Kurierwagen zu schicken … Der beiliegende Kasten in Wachsleinen soll mit der Stafette gehen, die Sie unverzüglich abschicken werden. Da es Diamanten sind, um die Charlotte mich flehentlich bittet, versichern Sie sie, ich bitte Sie darum und lassen sich einen Schein darüber geben … Ich glaube, Kleeblätter in Buketts gebunden, so daß es ein Tuff machte wie ungefähr eine Hortensienblüte so rund, wäre sehr hübsch. Ich will die Probe davon Montag morgen um 11 Uhr in Berlin sehen, … Tag und Nacht soll daran gearbeitet werden, damit es bis Mittwoch fertig ist.«22
Den Sommer verbrachte Therese, wie gewöhnlich, mit ihrer Familie auf Schloss Seidingstadt, Ludwig kurte in Brückenau. Sehnsüchtig wartete sie auch hier auf seine Briefe, die in der Regel einmal pro Woche eintrafen. »Doch unsere Geister, unsere Herzen, kann und darf keine Entfernung trennen, so bin ich Dir immer nahe. – Bei jedem Geschäfte schwebt Dein Bild mir vor, und leichter und schneller vollende ich es.«23
Sie berichtete ihm von den kleinen Vergnügungen mit ihren Geschwistern, die an einer Lotterie teilgenommen hatten, von ihren Spaziergängen, doch die »liebste Promenade ist mir doch immer die, mit dem Geiste zu dem Geliebten zu eilen. – Sitzend und stehend und gehend, und wachend und schlafend mache ich diese.« Ludwigs Wunsch entsprechend hatte sie sich Anfang Juli »die Kuhpocken einimpfen lassen«. Sie hoffte, nun sicher vor dieser Krankheit zu sein.24 Ihre Briefe schloss sie mit: »Lebe wohl, Geliebter, so wohl als die innigste Lieb es Dir wünscht.«25
Auch Ludwig beschrieb ihr seine Tage, die er, wenn er in Nymphenburg war, meistens in seinem Gartenhaus verbrachte, allein, umgeben von den »großen Männern vergangener Jahrhunderte«, die er studierte. »Studium ist bei mir Leidenschaft.«26
Therese genoss die neue Stellung als zukünftige Kronprinzessin. Immer wieder kamen Menschen, um sich ihr vorzustellen, ihr zu schmeicheln, was sie wohl noch nicht durchschaute. So zum Beispiel ein Herr von Schlottenburg aus Bamberg, der zu ihr von der Liebe der Bamberger zum Kronprinzen sprach, deren Herzen Ludwig durch sein »liebevolles Betragen ganz gewonnen« habe. »Gefühle der Liebe gegen Dich, du theurer, geliebter Freund, kennt niemand besser als Deine Therese, und fühlte ganz das Glück, die Deine zu seyn.«27 Auch die ersten Bittgesuche erreichten sie, als Brief oder persönlicher Besuch, wie der einer Tirolerin, die Ludwig, obwohl sie ihn nicht kannte, verehrte. Es ging um eine Handelserlaubnis für Nürnberg. Therese schilderte voller Eifer in aller Ausführlichkeit das Anliegen der Frau, der sie versprochen hatte, die Bitte weiterzugeben.28