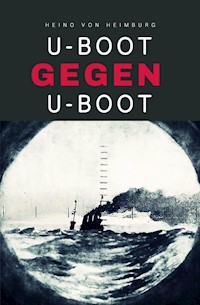
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Kampf, U-Boot gegen U-Boot, gegen Minensperren und Anti-U-Boot-Netze. Der Oberleutnant zur See Heino von Heimburg führte erfolgreich das Kommando über SM UB 14, dessen Geschichte in diesem Buch erzählt wird. Obwohl sein kleines U-Boot als "Occarina" (Instrument; Kugel- oder Gefäßflöte) belächelt wurde, sollte es sich bald ebenbürtig mit den großen Unterseebooten, bei der Verteidigung der Dardanellen erweisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
U-Boot gegen U-Boot
von
Heino von Heimburg
Oberleutnant zur See
______
Erstmals erschienen bei:
August Scherl G.m.b.H., Berlin, 1917
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2017 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-057-1
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Ausfahrt
Das Stelldichein
„Royal Edward“ und „Southland“
Entwischt
In die Dardanellen
Wie du mir, so ich dir. . .
U-Boot gegen U-Boot
Im Schwarzen Meer
Torpediert
Wieder im Mittelmeer
Auf Transporterjagd
Vorwort
„Occarina“ nannte man mein Boot mit etwas spöttischem Lächeln. Der Name passte allerdings nicht schlecht. Klein war es und schwarz, und die plumpe gedrungene Form ähnelte tatsächlich diesem Musikinstrument. Allen Zweiflern und Spöttern zum Trotz aber hat sich die „Occarina“ tadellos gemacht. Ihre Kampfkraft war nur beschränkt, im Seegang war es an Bord ungemütlicher als in der kleinsten Fischerjolle. Nur langsam kam man mit ihr vorwärts. Dessen ungeachtet aber hat das liebe Boot schöne Erfolge gehabt und seinen großen Brüdern recht scharfe Konkurrenz gemacht. Wir sollten helfen, die Dardanellen zu verteidigen. Wir haben es getan. Die Linienschiffe des Feindes hatte kurz vor uns „U 21“ glänzend verjagt, uns blieben die Truppentransporte.
Als wir die Fahrt zum Halbmond antraten, durften wir schon auf schöne Erfolge, die ich leider heute nicht veröffentlichen darf, zurückblicken. Das Boot war kampferprobt und mit ihm meine prächtige Besatzung. Längst lächelte niemand mehr über uns. Erfolgreich war die Fahrt zu den Meerengen, und erfolgreich fährt das Boot auch heute noch unter einem neuen Kommandanten. Manche U-Bootsfahrt ist schon beschrieben worden, stets aber waren es große Boote, die unserem gegenüber aussahen wie ein Linienschiff gegen ein Torpedoboot. Ich habe mich entschlossen, dieses Tagebuch zu veröffentlichen, damit auch einmal der kleinen Boote und ihrer Besatzungen gedacht wird.
„Occarinas“ heißen sie noch heute, niemand aber lächelt, wenn er von ihnen spricht. Sie haben gezeigt, dass ihr Ton in das Konzert passt, das die deutschen Kampfmittel heute unseren Gegnern ausspielen.
Heino von Heimburg,
Oberleutnant zur See.
Ausfahrt
„Pauline geht tanzen, hab’n Sie so was schon erlebt“, gnarrt und quäkt es zum neunten Mal zu uns auf den Turm hinauf, dass die ganze Stimmung bei der gräulichen Dudelei flöten geht. Mit einem wütenden Schwunge saust die Zigarette über Bord, taucht zischend in die Adria und erlischt.
„Nu macht doch endlich mal ’ne neue Platte auf“, rufe ich in das Luk hinunter.
Eine Weile herrscht unten Stille, dann ein leises Wispern. Schließlich lässt sich das Organ meiner Perle, des Kochs Herzig, eines Prachtkerls von der Waterkant, der anscheinend den Dolmetsch für die Gefühle der ganzen Mannschaft abgibt, vernehmen.
„Tja, Herr Oberleutnant.“ ich sehe förmlich, wie er sich verlegen in seiner roten Perücke traut. „wir haben doch nur man die eine. Die andern sind uns alle in die Bilge gefallen.“
„Na, dann lasst die Pauline weiter tanzen!“
Seit drei Tagen fahren wir durch die Adria. Bei einem Wetter, wie wir es im Norden kaum kennen. Tiefblau spannt sich der Himmel über der See; wie ein Spiegel flimmert und flirrt sie Unter den Strahlen der Sonne. Meilenweit öffnet sich der Blick bis dahin, wo an der Kimm in bläulichem Dunst Himmel und Wasser in eins verschwimmen.
Noch stundenlang lässt sich die Bahn verfolgen, die wir ziehen. Die Herren Italiener scheinen vor dem „mare nostro“ einen Mordsrespekt zu haben. Keine Mastspitze, nicht einmal das braune Segel eines Chioggioten, der zum Fischfang hinausfährt, vermögen wir auszumachen. obwohl wir uns auf unsere Doppelgläser doch verlassen können.
Hart unter der Küste gehen wir weiter. An weißleuchtenden Kalkfelsen donnert die Brandung empor, Häuschen mit vorspringenden Loggien und grell bemalten Fensterläden lugen unter Lorbeer, Orangen und Feigenbäumen hervor. Wie ein Paradies ist das hier. Nicht einmal die Stimme der Schlange fehlt mit ihrem Locken und Schmeicheln:
„Pauline geht tanzen, haaaa“ . . . Nanu, was ist denn auf einmal Paulinchen passiert? Mit einem kreischenden, schnarrenden Wehlaut bricht sie mitten im Tanzen ab, und im gleichen Augenblick macht das Boot unter einem schweren Brecher, der von Steuerbord herankommt, einen wütenden Satz nach Backbord hinüber. Wir sind aus dem Schutze der Inseln heraus, und U. . beginnt in rührendster Weise Paulinchen Konkurrenz zu machen, in einem Schritt aber, bei dem ein menschliches Wesen nur schwer mitkommen könnte.
Mit einem großen Satze legt es sich jetzt nach Steuerbord über. Statt sich aber dann, wie es einem rechtschaffenen Boote zukommt, nach der entgegengesetzten Seite zu begeben. versucht es plötzlich, sich mit der Geschicklichkeit eines Zirkuskünstlers auf den Kopf zu stellen, sackt, als ihm das nicht ganz zu glücken scheint, nach achtern, als wollte es zum Himmel hinauffliegen, tanzt, schlingert und pendelt, als wäre es toll geworden.
„Wünsch, bringen Sie mir schnell mein Ölzeug!“ rufe ich in die Zentrale hinunter, obwohl das, wenn ich mir die Sache bedenke, nicht viel Zweck hat. Kein Faden am Leibe ist mehr trocken; eine See nach der andern leckt zu uns auf den Turm hinauf, wahrscheinlich um zu versuchen, ob nicht doch noch eine trockene Stelle zu finden wäre.
„Jawoll, Herr Oberleutnant“, gibt der Matrose unten zurück und erscheint nach einer Minute mit dem Gewünschten auf dem Turm. Mit dem einen Arm hakt er sich krampfhaft an der Reling fest, mit dem andern ist er mir behilflich und . . . unterdes würgt und schluckt er wie ein alter Reiher, der soeben einen Riesenfisch übergenommen hat.
„Tja, mein Sohn, das ist nun mal so auf ’nem U-Boot . . .“ Noch habe ich nicht ausgesprochen, da verschwindet er mit einem Wehlaut und einem wahren Hechtsprung auch schon unter Deck, wo er sicher „mitfühlende Herzen“ findet. Selbst dem befahrensten Seemann geht es auf dem U-Boot nicht anders. Nur allmählich erst gewöhnt er sich an die tollen Bewegungen.
Bald sind wir wieder im Schutz der Inseln und Kanäle sicher vor den Brechern und der Dünung und pendeln in einer See, die in ihrer Ruhe und Bewegungslosigkeit an eine Milchsuppe erinnert, fröhlich und wohlgemut unseres Weges. Eigentlich hatte ich ja die Absicht, bei Einbruch der Nacht irgendwo an Land zu gehen und mein Boot anzubinden. Es fuhr sich aber so herrlich, dass ich beschloss, gleich durchzuhalten. Morgens, gegen sieben Uhr, mussten wir nach meiner Berechnung ungefähr auf der Höhe von Cattaro sein. Ich war in die Knie gegangen, um zu schlafen, als ich — draußen mochte es gerade hell werden — von einem fernen Rollen geweckt wurde. Ein Gewitter? Das konnte in dem Schlauche, den die Adria bildet, böse werden. Mit einem Satze war ich in der Zentrale und auf der Hühnerleiter, die nach dem Turm führt. Nichts! Das schönste Wetter, das man sich nur wünschen konnte; kein Wölkchen weit und breit, so scharf ich auch nach allen Seiten äugte.
Da, als ich eben kopfschüttelnd nach unten verschwinden wollte, kam es wieder auf, jenes ferne Murren und Grollen, als ob in der Ferne ein schweres Wetter heraufzöge. Genau voraus. Jetzt kletterte ich ganz hinauf, wo mich mein Wachtoffizier sofort mit der Meldung in Empfang nahm, dass auch er seit zehn Minuten bereits jenes Donnern vernähme. Von Minute zu Minute steigerte sich, je näher wir herankamen, das Geräusch, wurde stärker und deutlicher. War es ursprünglich noch ein ununterbrochenes Rollen gewesen, das zu uns drang, so konnten wir jetzt bald einige heftige Schläge, Salven ausmachen. Geschützfeuer!
Im gleichen Augenblick hoben sich die Nebelschwaden, die die Sichtigkeit beeinträchtigten, die Sonne drang durch und gab den Blick frei. Steuerbord voraus zogen die zerrissenen Karstberge Dalmatiens und die starre Kuppe, dort musste der Lowtschen sein.
Unten am Wasser lagen die grau-grünen Schiffe der Österreicher. Ununterbrochen blitzte das Mündungsfeuer der Geschütze auf, weiße und braune Pulverschwaden wallten hinauf bis zur Höhe der Masten, von denen bunte Signalflaggen flatternd wehten. Deutlich konnte man durch das Glas die Vorgänge erkennen, die sich auf den zerrissenen Steinhängen des Bergmassivs abspielten. Drüben schien eine montenegrinische Batterie zu stehen. Ununterbrochen funkte sie nach den Schiffen hinunter. Viel zu weit allerdings, wie die Aufschläge zeigten. Aha, jetzt ging es ihr ans Leder. Zwei turmhohe, braunschwarze Wolken erhoben sich gerade dort, wo kurz vorher das Mündungsfeuer aufgeblitzt war, zwei kurze, schmetternde Schläge folgten. Die Wirkung musste bösartig gewesen sein. Drüben rührte und regte sich nichts mehr.
Das Geschützfeuer war verstummt, dafür knallte jetzt wie Peitschenschlag das Gewehrfeuer, in das bald das trockene Knacken der Maschinengewehre einsetzte.
Nur kurze Zeit blieb ich in Cattaro. Der Proviant wurde ergänzt, das Boot nachgesehen, dann ging es bei Anbruch der Dunkelheit hinaus. Bis hierher war es die reinste Spazierfahrt gewesen, jetzt begann der Ernst des Lebens. Zwar war uns die Zukunft etwas schleierhaft, doch sagte ich mir schließlich, dass Gott noch nie einen deutschen Seemann verlassen hat. So gingen wir also tatendurstig und mit einem Mordsmut los.
Vormittags waren wir in der Otrantostraße und fuhren stillvergnügt unseres Weges, als plötzlich voraus Rauchwolken auftauchten. Bald konnten wir das Fahrzeug auch als einen italienischen Kreuzer ausmachen, der mit hoher Fahrt nach Westen ging. Wenigstens ersparte er uns dadurch, dass er nicht näher an uns herankam, das Tauchen. Noch waren wir nicht aus der Straße heraus, als neue Rauchwolken in Sicht kamen. Bald konnten wir die Masken erkennen, wenig später nur entpuppte sich das Fahrzeug als ein italienischer Kreuzer eines älteren Typs, der schnurgerade aus uns loskam.
„Alarm! Schnelltauchen!“
Mit ausgefahrenem Sehrohr ging es weiter. Immer höher und deutlicher wuchs der Schiffskörper aus dem Wasser empor, immer näher kam er heran. Jetzt kreuzte er in kaum tausend Meter Entfernung unseren Kurs, lief noch eine Weile weiter, drehte und ging auf seinem Stropp zurück. Der bewachte wohl die Straße.
„Dunnerslag“ brummte der Mann am Ruder neben mir, „wenn das man bloß ein Franzmann oder ein Ingelschman wesen wär! Man bloß so’n Appelsinenfritze!'
Bequemer hätten wir es allerdings schwerlich haben können. Gerade vor dem Rohr nuckelte uns der Bursche herum. Kein Mann wäre in der leeren Straße gerettet worden! Schließlich entschied er sich aber doch dafür, aus Sicht zu dampfen, so dass wir auftauchen und unseren Weg unbehelligt fortsetzen konnten.1
Das Wetter war ganz famos; ich hatte daher Aussicht, bald in das Ägäische Meer zu kommen. Vergnügt saßen wir wieder auf unserem Turme, schmauchten eine Zigarette nach der andern und ließen die Beine ins Luk hinunterbaumeln. Die Leute von der Freiwache lagen lang auf Deck, wie sie Gott geschaffen hatte, sielten und sonnten sich und ließen sich vom Grammophon „Paulinchen“ vorspielen. In der Dämmerung wurde Korfu passiert.
Nach Mitternacht fing es allmählich an aufzubrisen. Gegen Morgen versteifte sich der Wind mehr und mehr, und als der Tag anbrach, war mit ihm der schönste Sturm da. Eine Stunde lang versuchte ich oben zu bleiben, trotz der wahnwitzigen Bewegungen, die das Boot machte. Schon kurz vor Sonnenaufgang war ich in ziemlich unsanfter Weise geweckt worden. Ich lag friedlich in meiner Koje, als U . . . plötzlich, ohne jegliche Vorbereitung nach Steuerbord überholte, mich aus meinem Bett hinausbeförderte, über den Tisch warf und in der gegenüberliegenden Koje landen ließ. Im nächsten Augenblick prasselte eine See von oben in die Zentrale herunter, klirrte und krachte Geschirr. Da half kein Festzurren mehr. Wie eine Padde musste man sich auf den Bauch legen und versuchen, möglichst auf dem Fleck zu bleiben. Mit vollen Backen blies der Nordwest von achtern. Das war besonders unangenehm, weil von achtern die See erheblich mehr auf die Schraube wirkt. Bald tauchte das Heck tief ein, dann wieder hob es sich so hoch, dass die Schraube in der Luft schwindelerregend umhersauste. Einen Vorteil bedeutete es ja allerdings für unsere Reise, dass jede Welle uns schob und weiterbeförderte. Der Motor aber wurde so sehr angestrengt, dass er bald wie ein asthmatischer Mops keuchte und schnaufte. Als sich dann die ersten Versager einstellten, tauchten wir und gingen auf zwanzig Meter. Droben musste es noch mächtig wehen, denn selbst in dieser Tiefe machte sich der Seegang noch ganz erheblich fühlbar. Ruckweise pendelte das Boot bald nach Backbord, bald nach Steuerbord über. Dazu kam noch der Geruch nach Öl und den Motoren, der gerade kein besonderes Labsal für überempfindliche Geruchsnerven darstellt.
Nach einer Stunde gingen wir nach oben. Das Bild hatte sich nur wenig verändert. Turmhoch kam die See heran. Jedes Mal sah es aus, als ob ein gläserner Berg auf uns herabfallen und uns unter seiner Last zerschmettern würde. Schob sich eine besonders hohe See heran, dann mussten wir allerdings schleunigst das Luk zuwerfen, damit sie nicht voll hineinschlug. Ein Vergnügen bedeutete dieser Tag ja nun nicht. Oben auf dem Turm gab es trotz Ölzeug keinen trockenen Faden mehr, und unten sah es nicht viel besser aus. Es triefte alles, an Trocknen aber war gar nicht zu denken.





























